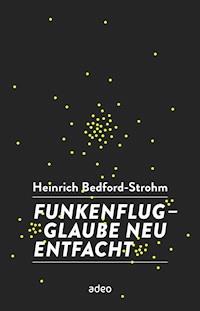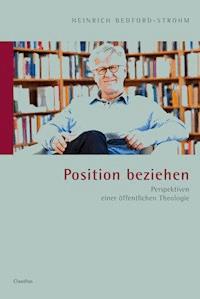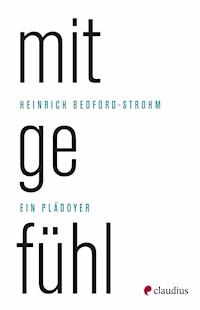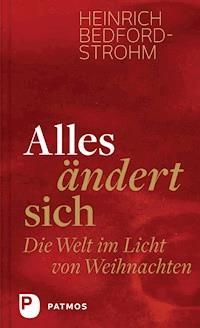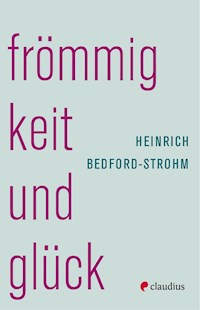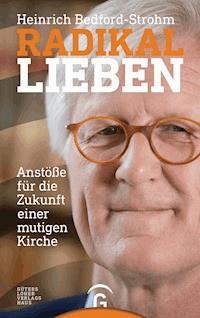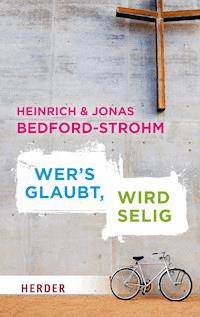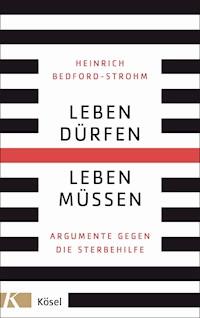
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Wer sich dagegen ausspricht, das Leben eines todkranken, leidenden Menschen zu beenden, hat einen schweren Stand. Die Zustimmung zur aktiven Sterbehilfe und zur Beihilfe zur Selbsttötung ist hoch. Politiker plädieren dafür und es werden Anträge für eine Freigabe erarbeitet. In dieser Situation sind ethisch starke Argumente gegen solche Handlungen, die zum Tode eines Menschen führen, gefragt. Der Sozialethiker, EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, erläutert die Ablehnung der aktiven Sterbehilfe aus christlicher Sicht auch unter Berücksichtigung allen menschlichen Leids am Lebensende. Er bietet damit eine klare Orientierung in dieser schwierigen Frage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Ähnliche
Über den Autor
Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm, geboren 1960, ist seit November 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und seit 2011 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er ist verheiratet mit der Psychotherapeutin Deborah Bedford und Vater dreier Söhne.
»aus guten Gründen gehört das aktive Töten zu den großen Tabus unserer Gesellschaft.«
Über das Buch
Dass wir sterben müssen, wissen wir. Dass wir am Ende aber womöglich schwerkrank leben müssen, stellen immer mehr Menschen in Frage. Die gesellschaftliche Zustimmung zur aktiven Sterbehilfe oder zum assistierten Suizid scheint groß, auch Politiker plädieren für eine ärztliche Unterstützung der Selbsttötung als Behandlungsoption und erarbeiten entsprechende Gesetzesanträge. Ist der Tod auf Rezept zum Greifen nahe?
Der EKD-Ratsvorsitzende und Sozialethiker Heinrich Bedford-Strohm erinnert in diesem Moment mit Nachdruck an unsere christliche Verantwortlichkeit, die gegen die Sterbehilfe spricht und für eine menschenwürdige Begleitung am Lebensende. Seine fünf ethischen Leitlinien geben eine klare Orientierung in dieser schwierigen Situation.
Heinrich Bedford-Strohm
Leben dürfen –Leben müssen
Argumente gegen die Sterbehilfe
KÖSEL
Copyright © 2015 Kösel-Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlag: Weiss Werkstatt München
ISBN 978-3-641-10239-5
Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter
www.koesel.de
Meinem Vater Albert Strohm zum 85. Geburtstag
Inhalt
Vorwort
Wir alle werden sterben
›Selbstmord‹ oder ›Freitod‹?
Die Medizin macht es möglich
Grau ist alle Theorie
Was zur Debatte steht
Palliativmedizin oder Behandlung am Lebensende
Passive Sterbehilfe oder Sterbenlassen
Indirekte Sterbehilfe als eine Form von Behandlung am Lebensende
Assistierter Suizid oder Beihilfe zur Selbsttötung
Aktive Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen
Was das Gesetz zum Thema sagt
Die Rechtslage in Deutschland
Die Rechtslage in den Niederlanden und in Belgien
Was ethisch auf dem Spiel steht
Utilitaristischer Ansatz
Ansatz individueller Autonomie
Ansatz bedingter Autonomie
Ansatz unbedingten Lebensschutzes
Ansatz verantwortlichen Lebensschutzes
Orientierungsmaßstäbe der jüdisch-christlichen Tradition
Positionen in der evangelischen Ethik
Was die Kirchen sagen
Die römisch-katholische Kirche
Die griechisch-orthodoxe Kirche
Die evangelische Kirche
Umgang mit dem Sterben – fünf ethische Leitlinien
Dankbarkeit für das Leben
Endlichkeitsbewusstsein
Selbstbestimmung und Verantwortung
Kontextsensibilität
Sozialkulturelle Verantwortung
Konsequenzen für die politische Debatte
Leben dürfen – leben müssen
Verwendete Literatur
Anmerkungen
Vorwort
Mitten in eine aktuelle Debatte hinein ein Buch zu schreiben, hat Chancen und Risiken. Aktuelle Debatten – das ist das Risiko – können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines solchen Buches wichtige neue Einsichten gebracht haben, die zu dem Zeitpunkt, als das Manuskript abgeschlossen wurde, noch nicht gewonnen waren. Dieses Risiko nehme ich gerne in Kauf. Denn dass neue Einsichten gewonnen werden, spricht ja für die Qualität einer Debatte.
Mit einem Buch über ethische Gesichtspunkte im Umgang mit dem Sterben, das in eine aktuelle Debatte hineinspricht, ist zugleich eine große Chance verbunden. Denn die grundsätzlichen Orientierungen, die es einbringen will, verbinden sich hier mit Entscheidungsfragen, die für jeden Menschen persönlich existenzielle Bedeutung bekommen können. Gleichzeitig sind sie mit wichtigen und öffentlich breit beachteten politischen Weichenstellungen verbunden. Die Relevanz und Notwendigkeit der Reflexion ethischer Grundsatzfragen, die zum Kern des Aufgabenprofils von Kirche und Theologie gehören, wird anhand solcher konkreter Problemstellungen besonders deutlich.
Dieses Buch bezieht Position. Das wird am Untertitel deutlich. Dass hier Argumente gegen die Sterbehilfe gegeben werden sollen, steht nicht im Widerspruch zu einer differenzierten und lernoffenen Herangehensweise, die zuallererst die in der öffentlichen Diskussion gebräuchlichen Begriffe präzisiert. Wir brauchen beides zusammen: differenzierte Darstellungen und engagierte Positionierungen. Dass gerade aus dem Raum der Kirchen engagierte Debattenbeiträge kommen, wird niemanden überraschen. Denn der Umgang mit den existenziellen Fragen des Lebens und des Sterbens gehört unbestrittenermaßen zu den ›Kernkompetenzen‹ der Kirchen.
Wenn die Kirchen sich öffentlich zu organisierter Sterbehilfe, zu ärztlich assistiertem Suizid oder zu Tötung auf Verlangen äußern, dann tun sie das nicht als ›Wächter‹, die von oben auf den politischen und ethischen Diskurs oder gar auf betroffene Patienten, Angehörige oder Ärzte, die in zweifellos oftmals schweren Konflikten stehen, schauen. Sondern sie verstehen sich als Teil einer demokratischen Zivilgesellschaft, in die sie ihre Überzeugungen einbringen. Dies auch ganz konkret und praktisch: in der tagtäglichen Arbeit von Seelsorge, Diakonie und Ehrenamt. So besuchen über 66 000 evangelische Ehrenamtliche in Deutschland Kranke oder begleiten Menschen in besonderen Lebenssituationen. Und etwa ein Drittel der 200 stationären Hospize in Deutschland sind Einrichtungen der Diakonie.
Ob die Kirchen sich mit entsprechendem Gewicht einbringen, hängt natürlich maßgeblich von der Überzeugungskraft, von der sachlichen Tiefe und von der ethischen Orientierungskraft ihrer Beiträge ab. Das Orientierungswissen der christlichen Tradition hat unsere Gesellschaft substanziell geprägt. Es spricht viel dafür, dass es an Aktualität nichts verloren hat. Ich hoffe, dass dieses Buch ein wenig davon deutlich macht
Dass in einem Vorwort auch ein Dank steht, ist mehr als ein Ritual. Es ist Ausweis der Tatsache, dass solch ein Buch nie entstehen könnte, wenn nicht viele Menschen seine Entstehung begleiteten. Zuallererst danke ich meiner Frau Deborah Bedford-Strohm dafür, dass sie das Schreiben dieses Buches in jeder seiner Phasen unterstützt hat und mir trotz der begrenzten gemeinsamen Zeit den Freiraum dazu gegeben hat. Auch meinen drei Söhnen gilt dieser Dank. Ich danke den vielen Menschen, mit denen ich in der Zeit des Gemeindepfarramts und an der Universität über dieses Thema im Gespräch gewesen bin, ich nenne besonders den Chefarzt der Coburger Geriatrie Prof. Dr. Johannes Kraft. Er repräsentiert für mich die medizinische und menschliche Exzellenz, die ein würdiges Sterben möglich macht. Ich danke meinen Bamberger Studierenden, mit denen ich das Thema vielfältig diskutieren konnte. Ich danke meinen jetzigen Mitarbeitenden im Bischofsbüro, die sich immer gerne auf die Diskussion über eine Idee oder eine Formulierung eingelassen haben. Für vielfältigen freundschaftlichen Austausch und manche – auch kontroverse – Diskussion danke ich den Fachkollegen in der evangelischen Ethik, wenigstens nennen möchte ich Peter Dabrock, Wolfgang Huber, Stefanie Schardien, Ulrich Körtner und Reiner Anselm. Mein herzlicher Dank gilt auch Michael Brinkmann, der das Manuskript gründlich gelesen und mir wertvolle Hinweise gegeben hat. Schließlich danke ich Michaela Breit vom Kösel-Verlag, die dieses Buch als Lektorin begleitet hat, die aber vor allem die Idee dazu hatte und nicht lockergelassen hat, bis aus der Idee ein konkreter Plan geworden ist.
Ich widme dieses Buch meinem Vater Albert Strohm, dem ich zusammen mit meiner Mutter so vieles verdanke, zum 85. Geburtstag. Wir haben als Familie diesen Geburtstag und, damit verbunden, die Diamantene Hochzeit meiner Eltern vor wenigen Wochen nur feiern können, weil die Möglichkeiten der modernen Dialyse-Medizin sein Leben bis zum heutigen Tage erhalten haben. Für dieses Geschenk bin ich unendlich dankbar.
München, im November 2014
Wir alle werden sterben
Sterben ist ein Thema, das uns alle berührt. Dieses Thema lässt niemanden kalt. Wir alle werden eines Tages sterben. Und wir gehen ganz unterschiedlich damit um. Die einen versuchen das Thema zu meiden, wo immer es geht. Die anderen beschäftigen sich schon jetzt intensiv damit, um vorbereitet zu sein, wenn es so weit ist. Die meisten von uns bewegen sich irgendwo zwischen diesen beiden Polen. Mit dem Sterben setzen wir uns auseinander, weil wir in unserer aktuellen Lebenssituation um die Wichtigkeit dieses Themas wissen. Vielleicht aber auch, weil wir direkt damit konfrontiert sind.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!