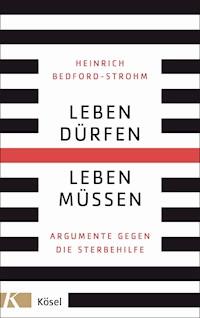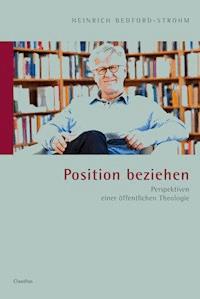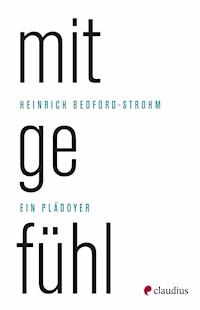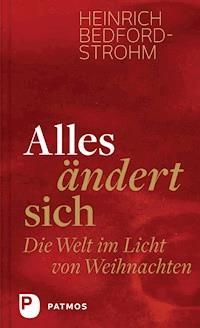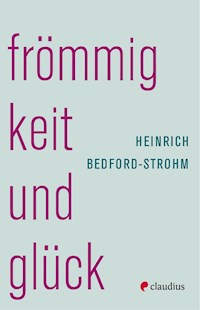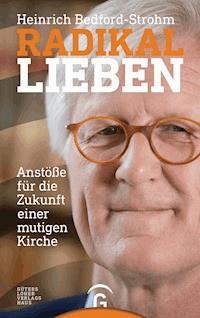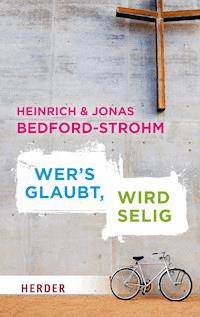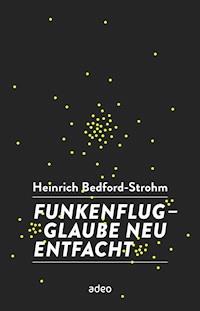
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: adeo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Bischof Bedford-Strohm ist als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche der oberste Repräsentant von 23 Millionen Protestanten in Deutschland. Er kennt die Analysen, dass die Kirche auf dem Rückweg ist, dass sie Jahr für Jahr Mitglieder verliert. Aber die Zahl allein ist für ihn nicht entscheidend. Entscheidend sind die Entschiedenen - Menschen, die ihren Glauben bewusst leben und diejenigen, die sich neu dafür begeistern lassen: für einen Glauben, der nach Freiheit schmeckt, nach Liebe, nach Geborgenheit. Wer so lebt, kann sich wirklich frei fühlen. Heinrich Bedford-Strohm schreibt über seinen Traum von einer neuen Kirche: christlichen Glauben, der wie ein Funke überspringt. Der in Bewegung bringt, Mut macht, sich für andere zu engagieren. Um Hoffnung zu verbreiten in einer Welt, die von Armut, Zerstörung, Terror und Krieg bedroht ist. Offene Augen zu haben für alle, die Hilfe brauchen - Arme, Kranke, Verfolgte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MEINER FRAU DEBORAH IN GROSSER DANKBARKEIT
INHALT
Funken am Nachthimmel
1 Ganz nah
2 Den Nächsten lieben
3 Gerechter handeln
4 Frieden stiften
5 Schöpfung bewahren
6 Lass dich begeistern
7 Gemeinsam Kirche sein
Feuer
Vita
FUNKEN AM NACHTHIMMEL. Ein Feuer hat etwas Anziehendes. Wer in der Dunkelheit von weitem ein Feuer brennen sieht, verspürt einen unweigerlichen Drang, näher zu kommen. Wo ein Feuer brennt, sind Menschen. Wo sie um ein Feuer herumsitzen, spüren sie Gemeinschaft und können sich wärmen, wenn es kalt ist. Ein Feuer ist in ständiger Bewegung, Funken fliegen.
Die Erfahrung, um ein Feuer herumzusitzen, habe ich zu vielen Gelegenheiten gemacht. Das Osterfeuer aber ist und bleibt jedes Mal etwas Besonderes. Die Dunkelheit und die Kälte der Nacht sind spürbar und das Leiden Jesu Christi und das Leiden der Welt im Herzen präsent.
Die Jugendlichen haben einen großen Holzstoß aufgerichtet: Das Warten auf den neuen Tag beginnt. Gespannte Stille, bis einer das Feuer entzündet. Schnell wird es warm und hell. Die Osterkerze wird entzündet. Wir beginnen zu singen und ziehen mit der brennenden Osterkerze in die Kirche ein. Christ ist erstanden! Wir feiern die Auferstehung Jesu.
Wie war es wohl damals, als Jesus zu seinen Jüngern sprach? Standen sie auch um ein nächtliches Feuer, auf einem Hügel in Galiläa, als er davon redete, wie man sich Gottes Reich vorstellen könnte? Ahnten die zwölf, was auf sie zukam? Dass es nach Jerusalem ging, war allen klar, auch, dass jetzt etwas Großes bevorstand. Jesus hatte ihnen erzählt, dass seine Zeit bald gekommen sei. Doch was hieß das?
Bestimmt hatten einige von ihnen – so stelle ich es mir vor – Angst vor dem Unbekannten. Andere zweifelten vielleicht: War Jesus wirklich der verheißene Messias, der, von dem die Bibel sprach? Würde mit ihm wirklich etwas Neues beginnen? Hätten sie und ihre Familien dann endlich genug zu essen, könnten sie in Frieden und Freiheit leben? So lange sehnten sie sich schon danach. Oder würde man ihnen und ihrem Anführer einmal mehr feindlich entgegentreten, weil sie es wagten, die vorherrschende Ordnung anzuzweifeln?
Immer wenn sie mit ihm zusammen waren, wich die Angst. Die Zweifel traten in den Hintergrund. Er konnte so wunderbar zu den Menschen predigen. Sie hörten ihm zu, mehr noch, sie hingen förmlich an seinen Lippen. Zu Hunderten hatten sie am Ufer des Sees Genezareth auf ihn gewartet. So viele waren zusammengekommen, dass Jesus schließlich einen Fischer bat, in dessen Boot steigen zu dürfen und hinauszurudern, um von dort aus zur Menschenmenge zu sprechen. Und keiner dieser vielen, vielen Menschen ging, wie er gekommen war, wenn er Jesus begegnet war.
Wie ein Lauffeuer breitete sich die Kunde von jenem Rabbi in Galiläa aus. Sanftmütig war er, so erzählte man sich, geduldig und freundlich. Und er entdeckte am Wegesrand gerade diejenigen, die sonst keiner ansehen wollte: die Entrechteten, die ohne Ansehen – die Zöllner und Geldeintreiber, die Ehebrecherin und den Leprakranken. Er hatte Augen und offene Ohren für die Blinden, die Armen, die Traurigen und die Verratenen. Überhaupt für alle Menschen ohne Hoffnung. Und für jeden hatte er ein gutes Wort.
Wenn Jesus weiterzog, blieb Hoffnung in den Augen der Menschen zurück, die ihm begegnet waren, ein Funke Zuversicht, eine neue Perspektive.
Noch heute kann ich etwas von dieser Aufbruchsstimmung spüren, wenn ich auf die Bibel höre. Und ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie Christinnen und Christen sich immer wieder neu auf den Weg machen. Wenn der Funke im wahrsten Sinne des Wortes überspringt. Wie beim Osterfeuer.
Wie wäre es, wenn wir dem Osterfeuer mehr Raum gäben? Wenn wir den Funken überspringen ließen und dieser Funken neue Begeisterung für unseren Glauben schaffen würde? Wenn eine Kirche entstehen würde, die vor Begeisterung brennt und Wärme ausstrahlt? Die in Bewegung ist wie die lodernden Flammen des Osterfeuers? Könnte dieser Traum Wirklichkeit werden?
GOTT IST DA.Am Anfang und am Ende und zu aller Zeit. In den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten. Auch dann, wenn wir nichts von ihm spüren können. Manchmal merken wir erst viel später, dass Gott uns die ganze Zeit begleitet hat. Das war schon immer so. Anderen vor uns ist es genauso gegangen.
Ich denke an die biblische Geschichte von den Emmausjüngern. Tief verstört sind sie unterwegs. Alles, was ihr Leben ausgemacht hat, ist zusammengebrochen. Jesus, ihr großer Lehrer, ist gekreuzigt und begraben worden. Wie es weitergehen soll, das wissen sie nicht. Plötzlich gesellt sich ein Dritter zu ihnen. Es ist Jesus selbst. Aber die beiden Jünger erkennen ihn nicht. Lange sind sie gemeinsam unterwegs. Schließlich finden sie – es ist Abend geworden – einen Platz zum Übernachten und bitten den Fremden, bei ihnen zu bleiben. Und als er das Brot bricht, erkennen sie ihn.
Wie oft mag Gott mit uns unterwegs sein – und wir erkennen ihn nicht?
Wie zeigt er sich uns? Gott lässt sich nicht herbeizitieren. Gott ist nicht verfügbar. Gott bleibt am Ende ein Geheimnis. Es gibt keine fest vorgezeichneten Wege zu Gott. Aber Wegweiser, die gibt es schon. Davon erzählt die Bibel.
Mir ist es wichtig, jeden Tag mit einem Bibelvers zu beginnen. Deshalb lese ich morgens die sogenannte „Herrnhuter Losung“. Die Losungen heißen so, weil sie wirklich Jahre vorher aus einem großen Topf mit Tausenden von Bibelzitaten für jeden Tag des Jahres ausgelost werden. Immer wieder staune ich darüber, wie sehr diese Bibelverse manchmal genau in die Situation hineinsprechen, so als ob sie genau für mich und genau für diese Situation ausgesucht worden seien. Die biblischen Texte sind einfach zeitlos aussagekräftig.
Manchmal unterbreche ich meinen Alltag und halte inne zum Gebet, unterwegs auf Reisen, am Schreibtisch im Büro oder auch nach einem Gespräch. Es gibt nicht die eine richtige Art zu beten, so wie es nicht die eine richtige Art des Gottesdienstbesuchs gibt oder des richtigen Gebrauchs der Bibel. Wenn ich selbst keine Worte finde, dann bete ich das „Vaterunser“ – das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat.
Immer wieder spreche ich mit Menschen, die wissen wollen, wie man glauben lernen kann. Vielleicht ist die wichtigste Antwort, dass es eben genau keinen Standardweg gibt. Von eigenen Erfahrungen zu erzählen, kann vielleicht helfen, aber es kann nie den eigenen persönlichen Weg zum Glauben vorzeichnen oder gar ersetzen. Und es gibt Grenzen dessen, was man über den eigenen Glauben erzählen kann. Es gibt so etwas wie eine religiöse Scham. Der Glaube ist auch etwas Persönliches. Manches im eigenen Glauben kann auch dadurch entwertet werden, dass man es nach außen preisgibt.
Aber ein wenig kann ich schon von der Entwicklung meines eigenen Glaubens erzählen. Ich bin – das hat natürlich eine zentrale Rolle gespielt – in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Wir waren von klein auf im Gottesdienst, bekamen die biblischen Geschichten erzählt. Am Tisch wurde gebetet, das Gebet am Abend vor dem Einschlafen gab Geborgenheit. Später als Jugendlicher half ich im Kindergottesdienst. Ich kann mich noch an einen sonntäglichen Interessenkonflikt zwischen „Urmel aus dem Eis“ im Fernsehen und dem Gottesdienstbesuch erinnern. Wie oft er zugunsten von Urmel ausfiel, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass meine Eltern uns nicht in den Gottesdienst zwangen. Sie haben mir damit Raum gegeben, meine Gottesbeziehung aus Freiheit zu entwickeln. Bei mir gab es kein datierbares Bekehrungserlebnis, mein Weg zum Glauben war eher ein Prozess.
Während meines gerade begonnenen Jurastudiums merkte ich: Viel zu oft, wenn es thematisch richtig spannend wurde, wenn die Grundsatzfragen gestellt wurden, bekam ich keine für mich überzeugenden Antworten. Das Recht entsteht im Gesetzgebungsverfahren. Das muss man dann auslegen und umsetzen. Aber ob Recht auch gerecht ist, warum man das Recht so formuliert und nicht anders, ob es vielleicht auch Gesetze geben könnte, die zu befolgen moralisch falsch wäre, das war kein zentrales Thema. Wir haben zwar in freiwilligen Arbeitsgemeinschaften und an den Abenden gemeinsam darüber diskutiert, aber im Studienplan spielte es nur eine Nebenrolle.
In dieser Zeit fing ich an, vermehrt in der Bibel zu lesen. Die Texte haben mich fasziniert, auch wenn ich viele schon aus meiner Kindheit kannte, aber so aktiv in der Bibel zu lesen war für mich neu. Ich war fasziniert von der Bergpredigt oder den Jesaja-Verheißungen. Das sind so unglaublich tolle Worte, da spürt man richtig, wie es heil wird im Herzen.
Ich bin wieder häufiger in den Gottesdienst gegangen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Selbst wenn ich einmal mit einer Predigt nur begrenzt etwas anfangen konnte, habe ich mir immer vorgenommen, dass ich mir in diesem Gottesdienst etwas sagen lasse. Und so war es dann auch.
Für mich hat die Bibel den entscheidenden Unterschied gemacht. Ich habe die ungeheure Tragfähigkeit und Tiefe des Psalms 23 immer mehr gespürt. Ich habe darin die Nähe Gottes zu spüren gelernt. Gott ist für uns wie ein guter Hirte und geht mit uns auf unserem Lebensweg. Er weidet uns wirklich auf einer grünen Aue und führt uns zum frischen Wasser. Er wandert mit uns im finsteren Tal, so dass wir kein Unglück fürchten müssen. Das habe ich erfahren – wie viele andere.
Das war mein Weg. Andere werden andere Wege zum Glauben an Gott finden. Es gibt keinen allgemeingültigen, keinen vorgeschriebenen Weg. Und jeder Weg bleibt ein Wagnis.
SEHEN LERNEN
Es gibt im Johannesevangelium eine Geschichte, die mich immer wieder begeistert: „Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloah – das heißt übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder.“
„Er kam sehend wieder.“ Ich freue mich immer wieder darüber, dass sich mit diesem Satz eine Tür öffnet. Es ist eine Tür aus der dunklen Kammer in den weiten, hellen Raum, aus dem Gefängnis in die Freiheit, aus der Verzweiflung in die Hoffnung.
Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.“ Die Heilung des Blinden soll uns eine Sehhilfe sein für das, was Gott jeden Tag an uns tut. Es ist ein Perspektivwechsel, von dem da die Rede ist.
Wirwollen Gründe haben, wieso es sich lohnt. Wir wollen immer wissen: Warum ist es so gekommen? Und Jesus sagt einfach nur: Schau auf das, was geschieht, und nimm es wahr!
Mir ist diese Geschichte so wichtig, weil sie zeigt, wie ein Mensch durch die Beziehung zu Jesus sehen lernen kann. Und dieses Sehen-Lernen ist weit mehr als ein augenoptischer Vorgang. Es ist ein Sehen-Lernen der Seele. Jemand lernt die Menschen um sich herum zu sehen. Er lernt sie wahrzunehmen. Er lernt sie anzunehmen und versteht, dass die anderen sind wie er selbst. Die anderen lieben zu lernen wie mich selbst – diese Erfahrung kann jeder machen.
So vieles in unseren Beziehungen läuft schief, weil wir einander nicht sehen. In unseren Partnerschaften ist es oft das Blindsein füreinander, wodurch sich Zwietracht einnistet. Da steht jemand morgens auf und kommt in gedrückter Stimmung zum Frühstück. Ein falsches Wort und es kommt zum Konflikt. In Situationen wie diesen, die wohl jeder kennt, hilft es, wenn wir verstehen, was den anderen bedrückt! Vielleicht war es ein unbedachtes, verletzendes Wort des anderen am Vorabend. Ein Wort, das hängengeblieben und eben nicht im Schlaf verflogen ist. Vielleicht ist es einfach eine Unausgeglichenheit, für die es noch nicht mal einen Grund zu geben braucht.
Wenn das Herz offen und die Bereitschaft da ist, den anderen wirklich als Ganzes zu sehen, dann braucht es manchmal nicht einmal viele Worte.
Es ist für mich immer eine besondere Zeit, wenn ich nach dem Gottesdienst am Kirchenausgang den Kirchgängern die Hand gebe. Obwohl da ja nie viel Zeit mit jedem Einzelnen ist, entstehen manchmal ganz kurze, aber intensive wechselseitige Begegnungen. Wenn ein Kummer herausbricht, verspreche ich, dass ich für diesen Menschen bete. Und das tue ich dann auch, weil mir das Gesicht im Kopf bleibt und diese Begegnung. Andere sehen zu lernen, macht unser eigenes Leben reicher.
Ich lerne Gottes Wirken in meinem Leben zu sehen und werde dankbar für den ganzen Reichtum, den Gott in mein Leben gibt und den ich so oft für selbstverständlich nehme.
FREIHEIT, DIE ICH MEINE
Was sich so mancher, der schlechte Erfahrungen mit dem Christentum gemacht hat, der es vielleicht als autoritär oder lebensfeindlich wahrgenommen hat, gar nicht vorstellen kann: Leben mit Gott bedeutet ein Leben in Freiheit. In Kapitel 5 des Galaterbriefs sagt Paulus: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! Denn (…) in Christus Jesus gilt der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.“
Wer einmal eingesperrt war, kann das nicht so leicht vergessen. Wer sich nicht frei bewegen kann, der weiß die Freiheit zu schätzen. Wir Deutsche erinnern uns an die freudetrunkenen Wochen im November 1989, als die Mauer gefallen war und die Menschen aus der DDR in ihren Trabis endlich frei die Welt erkunden konnten. „Freiheit ist das Einzige, was zählt“, sang Marius Müller-Westernhagen damals vor und mit Tausenden Zuschauern.
Und dennoch verblasst das tiefe Gefühl der Freiheit, wenn man sich nur lange genug an die Freiheit gewöhnt hat. Man schafft sich wieder Abhängigkeiten und Strukturen, die einen festhalten und letztlich unfrei machen. Das meint Paulus damit, wenn er die Menschen in Galatien aufruft: „So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!“
Freiheit spielte bei Paulus eine entscheidende Rolle. Er selbst wurde oft verfolgt, gefangen genommen und eingesperrt. Er war von außen gesehen alles andere als frei. Und dennoch kann er aus tiefer Überzeugung von seiner persönlichen Freiheit sprechen. Eine Freiheit, die von Zwängen löst, die von inneren einengenden Banden befreit.
Die Stricke und Fesseln, die uns heute gefangen halten, sind vielleicht andere als die zur Zeit des Paulus. Aber es gibt solche Fesseln heute genauso wie damals. Wir laufen heute so vielen Ansprüchen hinterher. Wir wollen schön sein, schlank sein, reich sein, immer gut drauf sein, erfolgreich sein – ja und auch ökologisch konsequent sein und moralisch korrekt sein gehört dazu. Auch richtige, wichtige Ansprüche bleiben Ansprüche. Das alles macht uns unfrei.
Es gibt so viele Menschen, die daran zerbrechen, dass sie sich einer äußeren Messlatte unterwerfen. Stimmen die Körpermaße nicht, geht der Selbstwert in den Keller. Wenn die Erfolge nicht eintreten, die man sich erhofft hat, bricht der Sinn weg.
Wer sich selbst als Macher seines eigenen Lebens fühlt, kann leicht vergessen, wie sehr er sein Leben anderen verdankt. Als „Selfmademan“ wird jemand gefeiert, der den Erfolg in seinem Leben vermeintlich ganz sich selbst verdankt. In Wirklichkeit ist das Unsinn. Wer einigermaßen ehrlich mit seiner eigenen Biographie umgeht, weiß das ganz genau.
Wir machen uns eben nicht selbst! Wir sind von unserer Mutter geboren – und viele Menschen haben uns im Leben begleitet und gefördert. Unser Erfolg kommt nicht nur aus uns selbst. Schon gar nicht haben wir unser Glück in der Hand. Was wir sind und was wir haben, kommt neben dem, was wir selbst dazu getan haben, aus der Hilfe und Unterstützung vieler anderer. Wir sind nicht „self made“, wir sind „God made“!
Das zu erkennen, ist ein Stück Freiheit, wie Paulus sie meint. Das zu erkennen befreit vom ständigen Drehen um sich selbst. Es befreit sowohl vom sorgenvollen als auch vom selbstherrlichen Fokussieren auf die eigene Person. Zu dieser Freiheit hat uns Christus befreit.
Wer die Erfahrung machen darf, dass der eigene Selbstwert nicht auf die eigenen Leistungen und die Anerkennung der anderen gegründet ist, sondern ganz auf Christus, der spürt tatsächlich eine neue innere Freiheit. Eine Freiheit dazu, für Positionen einzustehen, die nicht unbedingt bewundert werden oder in der Gesellschaft angesehen sind, die sich aber aus der Wahrheit speisen. Eine Freiheit, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch den anderen.
Das war die entscheidende Einsicht, die Martin Luther gewonnen hat, als er sich mit den Briefen des Paulus beschäftigte, und die zur Quelle seines reformatorischen Aufbruchs wurde: Der Mensch kann sich die Gnade und Liebe Gottes nicht erarbeiten und schon gar nicht erkaufen. Durch alles menschliche Streben und Bemühen kann es nicht gelingen, das Gesetz und die Gebote Gottes zu erfüllen. Alle Anstrengung ist letztlich zum Scheitern verurteilt. Freiheit und Erlösung sind unverdient und können uns nur geschenkt werden – durch Jesus Christus.
Der Mensch – so hat Luther es bei Paulus lesen können – ist „gerecht allein aus Gnade und nicht aus den Werken“. Dieses Geschenk der Liebe Gottes befreit. Weil es uns festen Halt im Leben gibt. Es ist – sagt Paulus – die sichere Basis, von der aus man getrost auf Herausforderungen zugehen kann, ohne ständig die Angst haben zu müssen, zu versagen, schlecht dazustehen oder einfach den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen.
Das zu erkennen, das zu wissen und es zu leben ist die stärkste Basis, die man im Leben haben kann. Und es ist eine Freiheit, die einem von außen niemand nehmen kann. Ein Geschenk, das trägt, das hält und das bleibt – Gott sei Dank.
SCHLUSS MIT VERGELTUNG
Diese Freiheit ist genau deswegen so tragfähig, weil sie die dunklen Seiten unserer Existenz nicht ignoriert. Denn wir leben ja nicht so, wie Gott es uns zugedacht hat. Wir wenden uns immer wieder von Gott und unseren Mitmenschen ab. Das ist es, was das alte Wort „Sünde“ meint. Manchmal versuchen wir, es zu banalisieren, indem wir von „Diätsünden“ oder „Parksünden“ sprechen. In Wirklichkeit geht es um eine tiefe Störung gegenüber Gott und unseren Mitmenschen. Dass wir andere verletzen oder in ihrer Not ignorieren, dass wir anderen Hilfe schuldig bleiben, obwohl es vielleicht um Leben oder Tod geht, ist eine Tatsache, die wir gerne verdrängen.
Ist das am Ende alles egal? Die Antwort, die Paulus auf diese Frage gibt, ist genauso überraschend wie einzigartig. Immer wieder sagt er in seinen Briefen, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, so dass wir frei von unseren Sünden werden und allein aus Gnade leben dürfen. Das sind alte und vielleicht für manchen fremde Worte.
Man kann sie nur verstehen, wenn man versteht, dass uns in Christus Gott selbst begegnet. Gott ist ein gerechter Gott. Also kann er es nicht hinnehmen, wenn Menschen anderen Leid antun, wenn Menschen Unrecht tun, wenn Menschen das Liebesgebot mit Füßen treten.
Man stelle sich vor, wie sich die Opfer solchen Unrechts fühlen würden, wenn Gott das alles einfach auf sich beruhen ließe. Es muss so etwas wie Sühne geben. Alles andere wäre ungerecht.
Von diesem Punkt an ist uns im Christentum eine faszinierende Perspektive geschenkt. Wir sagen nicht nur: Gott ist ein gerechter Gott. Wir sagen auch: Gott ist ein liebender Gott. Ein unendlich liebender Gott. Und dieser Gott sagt nun zu einem jeden von uns: Dein Unrecht, all das, was du an Verletzungen hinterlässt, vielleicht sogar ohne es zu merken, muss tatsächlich gesühnt werden. Aber ich nehme die Sühne, die eigentlich du leisten müsstest, auf mich selbst. Weil du mein Geschöpf bist und weil ich dich liebe. Ich will nicht dein Verderben, und wenn du dich noch so weit entfernt hast von mir. Ich will dich nicht loslassen. Ich will, dass du lebst.
Diese alte und so oft missverstandene Lehre vom „Sühnopfertod Jesu Christi“ ist also am Ende Ausdruck einer großen Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Diese Liebe Gottes ist nicht etwas, was erst im Neuen Testament sichtbar wird. Sie durchzieht das, was schon im Alten Testament über die Beziehung Gottes zu den Menschen gesagt wird. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die für mich wie keine andere zeigt, wie in Gott selbst die Liebe siegt und fortan den Ton angibt.