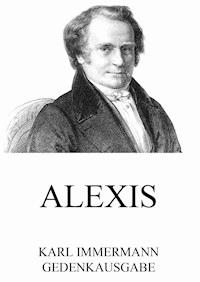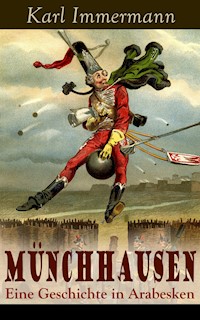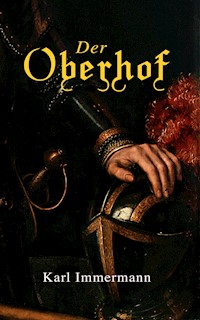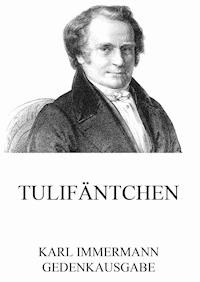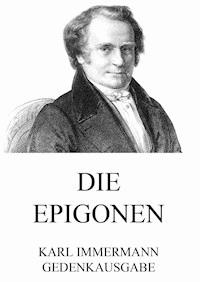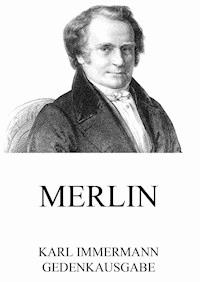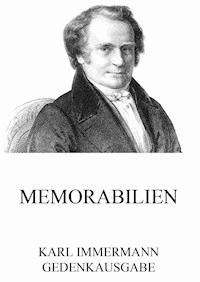2,39 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Studien enthält das Buch, von welchem hier der erste Theil erscheint, Studien in einer Doctrin, in der Niemand über den Schüler hinauskommt. Diese Doctrin ist das Leben. Wie das Leben mich an einzelnen Puncten berührte; besonders wie Kunst und Wissenschaft sich mir in das Leben verschlangen, wollte ich erzählen.
Die Gegenwart will Stoffes aller Art habhaft werden; gleich dem Araber sitzt sie bei Sternenschein unter'm Zelte und begehrt Erzählung auf Erzählung. Möchte denn in der Tausend und einen Nacht der „Bezüge, Zustände und Erinnerungen“ auch meinem Geschichts- und Sittenmährchen hier und da Jemand zuhorchen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Memorabilien
Autobiographisches
1836–1840
Karl Immermann
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383836988
Erster Theil.
[Vorwort.]
Avisbrief
Knabenerinnerungen
Zwischenbemerkung
Die Familie
Pädagogische Anekdoten
Der Oheim
Lehre und Literatur
Fichte
Jahn
Der Despotismus
Die Jugend
Zweiter Theil.
[Bruchstücke dramaturgischer Erinnerungen.]
Grabbe
Erzählung, Charakteristik, Briefe.
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Tagebuch. September 1836 – Februar 1837.
September.
Oktober.
November.
December.
Januar 1837.
Das Fest der Freiwilligen zu Köln am Rhein, den 3. Februar 1838
I.
II.
III.
IV.
Nachwort.
Epilog zu Goethe's Todtenfeier
Albrecht Dürer's Traum.
Erste Scene.
Zweite Scene.
Kurfürst Johann Wilhelm im Theater.
Erster Auftritt.
Zweiter Auftritt.
Dritter Auftritt.
Vierter Auftritt.
Fünfter Auftritt.
Ost und West.
Strophe bei dem Tode des Königs.
Fränkische Reise.
Düsseldorfer Anfänge.
Maskengespräche, 1840.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erster Theil.
Die Jugend vor fünfundzwanzig Jahren.
[Vorwort.]
Studien enthält das Buch, von welchem hier der erste Theil erscheint, Studien in einer Doctrin, in der Niemand über den Schüler hinauskommt. Diese Doctrin ist das Leben. Wie das Leben mich an einzelnen Puncten berührte; besonders wie Kunst und Wissenschaft sich mir in das Leben verschlangen, wollte ich erzählen.
Die Gegenwart will Stoffes aller Art habhaft werden; gleich dem Araber sitzt sie bei Sternenschein unter'm Zelte und begehrt Erzählung auf Erzählung. Möchte denn in der Tausend und einen Nacht der „Bezüge, Zustände und Erinnerungen“ auch meinem Geschichts- und Sittenmährchen hier und da Jemand zuhorchen!
Ich stelle zuerst das Genrebild einer früheren stürmischen Generation aus, welche nur noch in sehr gemilderten Ueberbleibseln vorhanden ist. Anreihen werden sich „Düsseldorfer Anfänge“; „Dramaturgische Erinnerungen“ und vielleicht einige Reisegeschichten.
Ich weiß nicht, was ich von dem Interesse dieser Mitteilungen voraussagen soll. Eins aber kann ich versichern: Daß mich dabei der Trieb nach Wahrheit geleitet hat und stets leiten wird. Der Mangel an Wahrhaftigkeit ist der böse Schaden eines großen Theils des heutigen Schriftenthums. An Talent fehlt es durchaus nicht, an Wahrhaftigkeit Vielen. Und dadurch ist der Stand weit tiefer gesunken, als durch den Umstand, daß kein deutscher Fürst jetzt die Schriftsteller beschützt, kein Mächtiger sie fördert. Alle Protection neigt sich ihrem Ende zu, und Jegliches, was da ist oder sich vorbereitet, wird sich auf das Volk verlassen müssen, natürlich auf das Volk im besten und höchsten Sinne. Dieses Volk will keine Schmeicheleien, es will keine Sophisten- und Sycophantenkünste; es achtet nur die Schriftsteller, welche ihm Zeugen der Wahrheit sind; ernste, einfache, unbestochene Zeugen. —
Avisbrief
Die Jugend vor fünfundzwanzig Jahren! – Was heißt das? das soll die Jugend heißen und bedeuten, welche am vierzehnten Oktober 1806 mindestens zehn Jahre und höchstens sechszehn Jahre alt war, welche also am dritten Februar 1813 die siebzehnjährigen bis zu den dreiundzwanzigjährigen Menschen des Volks ausmachte. Man sieht aus der Nennung jener Tage, daß hier die Jugend von Norddeutschland gemeint ist. Denn am ersten wurde Norddeutschland umgeworfen und, soweit es den Fremden möglich war, in seinem Dasein zerstört, am zweiten aber begann der Wiederaufbau durch die Gesamtkraft der Nation in die Sichtbarkeit zu treten. Ich will unternehmen zu schildern, wie und auf welche Weise die norddeutsche Jugend von den beiden Tagen, von dem, was zwischen ihnen lag, und von dem, was dem letzten unmittelbar folgte, berührt worden ist, welche Gestalt des Geistes und des Herzens ihr dadurch zukam, und in welchen Folgen sich diese Gestalt abdrucken mußte. Die Altersgrenzen habe ich darum so gefaßt, weil sie mir die natürlichen Scheiden zu sein scheinen, von welchen ab und bis zu welchen hin der Mensch seine bestimmenden Eindrücke empfängt. Denn mit dem zehnten Jahre etwa pflegt das Bewußtsein zu erwachen, und in den ersten Zwanzigen hat es sich am Vaterhause, an der Schule, an der Universität und an den frühesten Berufsanfängen dergestalt entwickelt, daß die geistige Physiognomie zwar nachmals noch manchen Ausdruck empfangen kann, eigentlich sich zu verändern aber nicht mehr imstande ist. Die Züge stehen fest und nur die Objekte wechseln noch, über welche sie später lächeln, zürnen, oder ein stilles Nachdenken zeigen.
Was die jüngeren Kinder durch jene beiden Tage und durch das, was ihnen anhing, erfuhren, gab ihnen also wenigstens nicht den vollen Kernschuß der Eindrücke; und ein Gleiches läßt sich von den älteren Leuten der Periode behaupten. Bei den einen wie bei den anderen traf ihr Strahl entweder auf einen zur Empfängnis noch nicht vorbereiteten Punkt, oder er fand schon einen Widerstand in Ausbildung und Charakter vor, welcher die unbedingte Einwirkung des ganzen Zeitraums mannigfach spaltete und brach.
Daß aber der vierzehnte Oktober und der dritte Februar zusammengehören, wird der Geschichte wohl unverboten bleiben zu sagen, wenn auch einige die Erinnerung an den ersten Tag unbequem finden. Diese verraten dadurch, daß sie von dem letzten ebenfalls nichts wissen oder nichts mehr wissen wollen. Denn eine glorreiche Erhebung fand nur statt, weil eine schmähliche Niederlage vorangegangen war. Die also von der Niederlage zu hören tauben Ohres sind, legen Zeugnis ab, daß ihnen die Erhebung vorübergegangen ist wie etwa ein Sturm, vor dem sich der für seine Gesundheit besorgte Mann unter einem Wetterdache birgt. Am konsequentesten unter diesen verfahren denn auch diejenigen, welche die Jahre 1813, 1814, 1815 geradezu für schädliche Wetterereignisse ausgeben.
Für solche werden die nachfolgenden Blätter nicht beschrieben. Da wir nur durch jene Jahre als Deutsche vorhanden sind, so zeigen sie, daß sie an diesem Zustande nicht teilhaben wollen, sondern entweder überhaupt nur als sogenannte Weltbürger daseien, oder sich bei andern Völkern naturalisiert haben wollen. Von diesen nenne ich, nicht in gehässiger Absicht, sondern beispielsweise: Franzosen, Engländer, Russen; denn alle drei Völker sind wirkliche Volksindividualitäten. Ob die Wahlvölker nun solchen Übergängern das Naturalisationspatent auszufertigen geneigt sein möchten, ist eine Frage, auf welche nur die Ironie die verneinende Antwort in Zweifel stellen würde. Sonach wären die Gemeinten lediglich an das Weltbürgertum verwiesen, über welches die öffentliche Überzeugung sich dahin geeinigt hat, es für eine Negation, d.h. für ein reines Nichts zu erklären.
Meine Darstellung wendet sich also an Deutsche und denen will sie etwas erzählen oder in das Gedächtnis zurückrufen. Unter den Deutschen sind nicht etwa verschollene oder neu zu erweckende Altdeutsche verstanden, welche vielmehr auch schon der Geschichte und nicht mehr der Gegenwart, noch viel weniger aber der Zukunft angehören. Es hieße das recht eigentlich den Toten predigen wollen. Vielmehr verstehe ich unter Deutschen diejenigen, die von den Schauern der Weltgeschichte zwischen den sechs Strömen erschüttert, diese Schauer fromm nachfühlen und das Gebot der Weltgeschichte auszuführen sich bestreben, ohne dazu Abzeichen an Kappe und Kleid, oder Stichworte in Rede und Schrift nötig zu haben.
Daß für diese eine Darstellung, wie ich sie vorhabe, von Interesse sein werde, sollte ich meinen, wofern sie mir nämlich gelingt, wie ich wünsche. Denn der Gegenstand ist von der Art, daß er in Deutschland früher nie vorgekommen war und allem Vermuten nach kaum wieder vorkommen kann. Eine Napoleonische Überziehung war unerhört und kann sich nicht wiederholen, sollte auch in späteren Zeiten ein neuer Eroberer auf eine neue Schwäche treffen, weil dann doch Held und Überwundene in andern Farben spielen werden. Nun brachte jene Tyrannis auch eine nie gesehene Wirkung hervor. Unsere Jugend ging vor der Eroberung ihren mäßigen Lebens- und Bildungsschritt. Die Weltereignisse traten nicht an sie hinan; die Stille des Hauses umgab ihre ersten Entfaltungen, zugeschnitten war der Unterricht und dieser überlieferte sie nach gelindem Schäumen und Brausen in den akademischen Jahren einem geordneten Berufe, in dem sie nun das wurden, was sie vorher verachtet hatten, nämlich Philister. Zwischen der Gewalt des öffentlichen Lebens und ihr war bis dahin eine unübersteigliche Kluft befestigt gewesen. – Gegenwärtig lebt zwar die Jugend seit dem Erwachen ihrer Aufmerksamkeit mehr in den Weltbegebenheiten, weil diese alle Vorstellungen und Verhältnisse zu durchdringen angefangen haben, allein sie empfängt dieselben doch nur in einer Rückspiegelung und gestaltet sie sich in einer oft sehr vorschnellen Reflexion, so daß zwischen ihr und dem Öffentlich-Wirklichen abermals ein breiter Strom fließen bleibt, nämlich der Strom ruhiger Friedenstage. – Ganz im Gegenteil zu beiden Zuständen sah die Jugend, welche beschrieben werden soll, ihrer ersten Blüte die furchtbarsten Erschütterungen in materiellster Aufdringlichkeit annahen und wenige Jahre später hörte sie sich berufen zu dem Eingreifen in das öffentliche Leben, über welches hinaus es kein tieferes gibt, nämlich die Waffen zu nehmen, um Thron und Vaterland retten zu helfen. Die Jugend vor der Eroberung war daher politisch null, die gegenwärtige Jugend ist im glücklichsten Falle (wenn nämlich keine phantastischen Verirrungen sie hinreißen) politisch-kontemplativ; die Jugend vor fünfundzwanzig Jahren war politisch leidend und handelnd. Gewiß ein Phänomen, welches, nur einmal so vorgekommen und von den weitestgreifenden Folgen gewesen, ernste Betrachtung verdient. Und was zu letzterer noch mehr auffordert, ist: die Jugend litt damals als Jugend, handelte als Jugend. Jugendstimmungen wurden angerührt und jugendliche Motive in Bewegung gesetzt.
Aber, wird man sagen, dergleichen Betrachtungen sind schon zum Übermaß angestellt; bis zum Ekel ist von jener Zeit und von dem Anteile der Jugend an ihr geredet und geschrieben worden. Ich gestehe zu, daß der Gegenstand kein Modegegenstand mehr ist und manchem als sehr altfränkisch erscheinen mag. Aber die Mode bringt in solchen Dingen wenig mehr hervor, als die Debatte der Parteien. Und so verhielt es sich auch hier. Wir haben zwar viel gehört und gelesen einesteils: von frischer, freier, frommer, fröhlicher Jugend, vom Eichenwalde deutscher Jugend, von der Jugend Tugend und Zucht, von den Gebeinen der Jünglinge, die auf den Feldern von Groß-Görschen modern; andernteils: von überspannten jungen Menschen, von Demagogen und Hochverrätern – ich erinnere mich aber keiner Darstellung, welche, wenigstens mit einiger Mühe und Sorgfalt, hinabgestiegen wäre in die Ökonomie des jugendlichen Geistes und Gemüts jener Zeit, und nachgewiesen hätte, was darin durch die Hand des Elendes und der Befreiung entwickelt oder zerrüttet, zurechtgerückt oder verschoben worden ist. Entweder helles Licht oder finsterer Schatten! Ein Gemälde, worin beides harmonisch vermittelt wäre, worin die Farben an ihrem Orte ständen, kenne ich nicht. Und doch geschah an jener merkwürdigen Schicht der bürgerlichen Gemeinschaft, welche so viele der jetzigen Vierziger geliefert hat, also einen bedeutenden Beitrag zu dem eigentlichen Ernste und Grunde und Boden der Gesellschaft, das eine wie das andere: Aufbau und Zerstörung.
Auch ich vermesse mich nicht, eine vollständige Geschichte jener geistigen Erschütterung in offenen Seelen geben zu können. Dazu habe ich zuwenig selbst erfahren, und vieles weiß ich nur von Hörensagen oder durch Kombination. Aber einige Materialien bin ich zu liefern imstande, und warum sollte ich mit denen zurückhalten? Früh entwickelte sich bei mir ein aufmerkender Sinn und eine Neugier, welcher das unscheinbarste Detail der Dinge nie zu geringfügig war. Diese Kraft der Beobachtung, welche man Kälte genannt hat, ergriff einige sonderbare und gewaltige Ereignisse, welche meinem jungen Auge nahe traten, durchdrang sie und folgerte aus ihnen sich Nahes und Verwandtes zusammen, bis mir ein Bild entstand, was meinem Triebe nach Wahrheit genügte. Oft gab ich etwas wieder auf, aber nie für immer das, was meine Seele einmal wahrhaft berührt hatte, sondern nach Zwischenräumen des Vergessens sprang es von neuem hervor, meistenteils in gewandelter Umgebung, unter dem Strahle eines anderen Lichtes. Wahrhaft glücklich habe ich mich immer nur gefühlt in der Betrachtung, zu der ich mit dem Vorahnen eines ewigen und göttlichen Zusammenhangs kam, weshalb ich sie auch um so schärfer und scheinbar chemischer anstellen durfte. Ich wußte ja, daß diese Scheidekünste mir das Wirkliche nur klarmachen, nicht aber es auflösen würden.
Einer solchen betrachtenden Stimmung ist das Explodieren täglicher Vorsätze und Entschließungen, wie es zum Teil das charakteristische Zeichen jener Zeit war, weniger gemäß; ich habe nicht mitgeturnt und nach dem Freiheitskriege keine überschwenglichen Reden gehalten, aber ich fühlte als Knabe die Not der Alten und lernte von dem Kriege wenigstens so viel kennen, um den Geist des Krieges im ganzen erraten zu dürfen. Man muß vielleicht nicht zu tief in den Dingen gesteckt haben, um die Dinge nachmals sanft und gerecht beurteilen zu können.
Ist es aber nicht vielleicht noch zu früh zu irgendeiner Geschichtsschreibung? Hat sich der Gewinn schon abgeklärt? Steht es schon fest, in welche Bahn Deutschland durch den Enthusiasmus der Kriegsjahre gekommen ist? – Ich will angeben, was mich zu der Hoffnung bewegte, daß wenigstens der Anfang gemacht werden könne, in einem anderen, als im Parteisinne über jene Periode zu reden. Wir feierten im vorigen Jahre das Fest der Erinnerung an den Aufruf; ich war bei dem Kölnischen und habe diesen Tag, als man es so von mir haben wollte, beschrieben. Überall in den einigermaßen bedeutenden Städten Norddeutschlands fanden, wie das Datum für jedes Land gekommen war, Feste statt. Hätte das Volk sich noch in den Moment, der gefeiert wurde, mit seinen Empfindungen verwickelt betrachtet, so wären die Städte die Festgeberinnen gewesen. Nicht die Freiwilligen unter sich wären in den geschmückten Sälen zusammengekommen, sondern das Volk hätte den Freiwilligen die Feste gegeben.
Allein dem war nicht so. Nur an äußerst wenigen Orten fand eine Verbreitung und Erweiterung des Festes durch das Gemeingefühl der übrigen Menschen statt. Hamburg ist hier beispielsweise zu nennen und unter den kleineren Städten später Dortmund und Westfalen. Regel blieb jene Absonderung der Feier, die sie zu einer Art von größerem Familienfeste machte, welches das Volk als durchaus wohlwollender aber untätiger Zuschauer umstand. Irgendwo soll selbst das jüngere Geschlecht, aufgefordert zur Teilnahme, diese abgelehnt haben.
Da die Sachen sich so verhielten, so leuchtete ein, daß dem Volke das, wovon es sich handelte, ein Abgetanes geworden war, und daß es mit keinem Affekte mehr an demselben, als an einem fortzeugenden, teilnahm. Gerade in einem solchen Momente aber soll die Betrachtung eines Ereignisses anheben. Die Gesamtheit lebt in den Folgen fort, ohne sich um die Ursache in Liebe oder Haß zu bekümmern; wenigstens insofern man beiden Empfindungen eine gewisse Energie beimessen will. Nun legt aber jedes Faktum der modernen Geschichte zwei Stadien zurück, das mythische und das historische, worauf es in das dritte, in das der Geschichtsforschung eintritt. Das mythische wird durchmessen, wenn das Ereignis selbst erst noch zur vollen Evidenz gebracht werden soll. Da arbeiten alle Kräfte, die liebevollen wie die feindseligen; an Götter, Helden und Teufel knüpfen die Menschen ihre Vorstellungen, und selbst das Wunder wird nicht verschmäht, wenn es geeignet scheint, hinzureißen oder zu schrecken. Ist das Ereignis geboren und fangen die neuen Lebensformationen, die von ihm entsprangen, an, Bildung und Gestalt zu bekommen, dann wendet sich alle Kraft der Menschen auf diese und vernachlässigt, treu dem Gesetze, daß alle gesunde Tätigkeit sich nur in einer Richtung entladet, den Ursprung. Nun aber, und solange jene Lebensformationen noch unvermischt aus der Quelle ihre Nahrung empfangen, ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Geschichte ihr Werk beginnen darf über den Ursprung, nämlich auszusagen, wie dieser Ursprung war und was zu demselben gehörte. Noch ist die Erinnerung frisch, der Löwe, der durch die Welt ging, ist zwar dem Auge verschwunden, aber in jedem Körnlein des gelockerten Bodens, welcher seine Spur empfing, in jedem gebeugten oder zerknickten Gräslein ist doch der Abdruck noch scharf und vollkommen; die Erfolge reden noch ein unverworrenes Zeugnis. Aber nicht lange, so verschlingt sich das Leben wieder tausendfältig, andere Löwen laufen über die alten Spuren, und man weiß nun nicht mehr, welches die neue Fährte ist und welches die alte, die Erfolge metamorphosieren sich, oder was schlimmer, sie verstümmeln einander gegenseitig. Da ist es mit der eigentlichen Geschichte vorbei und das Stadium der Geschichtsforschung ward betreten. In diesem werden die sogenannten verschiedenen Standpunkte genommen, von deren einem z.B. Philipp der Zweite als ein blutdürstiger Tyrann, Elisabeth als eine neidische Kokette, von deren anderem dieselben als gerechte Regenten erscheinen; oder es trifft sich auch wohl, daß die ganze historische Arbeit nur Kritik, Urkunden und Zeugensichtung wird. – Möchte, um bei einem vaterländischen Gegenstande einen vaterländischen Wunsch im Vorübergehen auszusprechen, bald ein eigentliches Werk über Friedrich den Zweiten erscheinen, nämlich ein historisches Kunstwerk, zu welchem sonst vielleicht schon bald die rechte Zeit entschwunden sein dürfte.
Das Ereignis, welches 1813 für uns in die Wirklichkeit treten wollte, war, daß die Deutschen, und zwar zuerst die Norddeutschen, eine Nötigung ausführten, ein Volk zu sein, nachdem sie lange nur ein Konglomerat von Haushaltern, Gelehrten, Dienenden oder Befehlenden gewesen waren. Sie empfanden diese Nötigung nicht in einem Anfalle von Verzweiflungskrämpfen, ähnlich denen der Numantiner oder der Karthager nach dem Zweiten Punischen Kriege. Sondern sie warteten eine über alle Maßen furchtbare Kalamität ab, welche einen nur etwas mittelmäßigeren Feind kaum noch zu besiegen übriggelassen haben würde und selbst einen so großen dergestalt gelähmt hatte, daß der ganze unglückliche Ausgang des Kampfes kaum denkbar war. Von dieser Seite hat man die Begebenheiten sogar herabzusetzen gesucht und mir scheinen sie doch deshalb eben erst recht menschlich und echt in unserem Sinne zu sein.
Denn an die Taten der Völker ist ein anderer Maßstab der Größe zu legen, als an die Handlungen einzelner. Es mag erhaben sein von dem einzelnen, sich mit einem Schiffe in die Luft zu sprengen, des Volkes erste Pflicht aber ist, wenn es zum Leben wieder erwacht, an sein Leben zu glauben, deshalb also überzeugt zu sein, daß keine Unterdrückung es austilgen könne, es für sein höchstes, ja für sein einziges Gut zu halten und in diesem Sinne es und sich zu bewahren. Ein Volk, welches diese Pflicht erkennt, wagt sich nicht in den sogenannten Kampf auf Tod und Leben, sondern weiß, bis der rechte Augenblick kommt, zu dulden. Nur zerrüttete Nationen spielen um ihr Dasein. Die Folgen belehren. Spanien hat an fanatischem Heldenmute Deutschland übertroffen, schwerlich möchte etwas aus unserer Kriegsgeschichte der Verteidigung von Saragossa an die Seite zu setzen sein, und dennoch hat das Land während eines Vierteljahrhunderts nach erlangtem sogenanntem Frieden nicht zur sozialen Gestaltung durchdringen können. – Den Polen wird man wohl den Ruhm der Tapferkeit nicht bestreiten können, und dennoch sind sie Weit weniger dem Schwerte der Russen, als vielmehr dem Umstande erlegen, daß die alten Sünden des Reichstages von neuem wiederauftauchten, daß das Volk bei jedem Unfall an gar nichts anderes zu denken wußte, als an Verrat, und daß sie in neun Monaten zehn Diktatoren, Präsidenten, Oberfeldherren hatten. Wäre es den Polen verliehen gewesen, den Sinn ihres Nationalliedes sich tragisch-leidend ganz innerlich auszudeuten, so würden sie wenigstens ganz anders stehen, als wie sie jetzt zu stehen gekommen sind. Jedes Volk hat seinen Charakter und nach dem lebt es und stirbt es, deshalb sollen keinem schulmeisterliche Ratschläge insbesondere nach einem großen Unglück gegeben werden, nur ist auch der deutsche Sinn nicht herabzusetzen darum, weil er sich in anderer Weise als der anderer Völker zu dem wichtigsten Entschlusse ermannte.
Als dies geschehen war, fühlten die Deutschen sich in keiner Einheit durch einen großen Herrscher oder einen Feldherrn, gleich dem des Feindes. Sie empfanden, daß ein Zweck des Kampfes die Erhaltung oder Herstellung des germanischen Königtums sei, jedoch als Spitze und Gipfel des Volksdaseins, und sie wußten, daß sie zuletzt doch nur auf sich als Volk beruhten. Das Volk also regierte in jener Zeit, wie Niebuhr richtig in einem seiner Briefe gesagt hat, die Hingebung des einzelnen an das Ganze war grenzenlos, die Tat, welche alle folgenden einleitete, geschah ohne Befehl und auf eigne Verantwortung, ein stilles Gefühl großer gemeinsamer Verschuldung heiligte den Kampf, hielt hier Grausamkeiten gegen die überwundene Partei im eigenen Busen des Vaterlandes zurück (denn einzelnes, was dagegen vorfiel, kommt nicht in Betrachtung), brachte dort den Sinn hervor, daß es weniger darauf ankomme, immer zu siegen, sondern mehr darauf, immer zu sein, wo der Feind war, um sich mit ihm zu messen. So schienen selbst verlorene Schlachten Ehren, und so konnte, einig mit diesem Sinne und von ihm getragen, derjenige erstehen, welcher der eigentliche Held jener Tage geworden ist. Der Gewährsmann, den ich nannte, sagt in einem Briefe vom 16. Juni 1813: »Es ist lange nicht genug zu sagen, daß unsere Armee mit beispiellosem Heldenmut gefochten hat, sondern um für sie die tiefe Achtung zu empfinden, welche sie verdient, muß man wissen, daß sie nicht allein unbedingt unter die Gewalt fremder Feldherrn, die ihren früheren Ruhm nicht behauptet haben, gegeben war, und also das Opfer ihrer Fehler und Ungeschicklichkeiten ward, sondern daß es ihr selbst an oberer, erfahrener und geschickter Leitung in ihrem eignen Umfange fehlte. Selbst weiter hinunter fehlte es den besten Offizieren bald an Erfahrung bald an kaltem Blute; sie haben ihr Leben verschwendet. Aber mit allem dem hat der verhältnismäßig kleine Haufen unserer Armee, immer nur teilweise von unseren Verbündeten unterstützt (doch ist gerecht zu sagen, daß wo russische Divisionen herankamen, sie immer äußerst gut geschlagen haben, nur nicht mit Begeisterung) gegen eine für uns ganz ungeheure Übermacht, weil jeder gefochten hat, als ob alles auf ihn ankäme, Dinge getan, die man für unmöglich halten möchte. – Bataillons, denen fast alle Offiziere erschossen oder verwundet waren, haben mit größter Ordnung fortgefochten. Dabei ist die Geduld, die stille Resignation, die Früchte ihrer Taten ohne Ursache vergehen zu sehen, die Sittlichkeit, die Ordnung der Armee – kein einziges Exempel von Exzessen wird erwähnt; kein Soldat hat auf dem Rückzuge marodiert – so erhebend, daß man vor dieser Armee Ehrfurcht haben muß.«
Dieser gerechte und mäßige Krieg, welcher dadurch groß war, daß er keiner eigentlichen Größe eines einzelnen bedurfte, sondern viele sonst geringe Menschen trieb, an ihrer Stelle groß zu handeln, hat nun folgende Gestalt der Dinge hervorgebracht. Zuvörderst läßt sich die Trennung, welche allerdings noch zwischen den deutschen Volksstämmen in manchen Dingen besteht, mit dem früheren Haß, Hader, Spott und Schimpf nicht vergleichen. Das Gefühl der germanischen Einheit ist ohne Zweifel größer geworden. Es würde z.B., wie ich glaube, keine Freude in Norddeutschland ausbrechen, wenn man dort vernähme, der Feind stehe in München oder in Wien, und so umgekehrt. Die häuslichen Beziehungen, welche die Deutschen über ihre lange Nichtigkeit hinüberlullten, sind in einer großen Umbildung begriffen; vielfach ist ausgesprochen worden, daß auf der Familie der Staat beruhe und man fängt an zu merken, daß dieses Wort auch in die Tat schon einigermaßen überging. Ganz beschäftigt sich fast keiner mehr bloß mit sich und seinem Vergnügen, sondern etwas ein jeder mit dem öffentlichen und Allgemeinen. In der herrschenden Leidenschaft, Monumente zu setzen, selbst bis zu Hermann dem Cherusker hinauf, den Bauer und Bürger doch nur durch die Vermittlung der Gelehrten kennen, flammt der Drang des Volkes, mit seiner Geschichte wieder anzuknüpfen. In der nicht minderen Begier, Assoziationen aller Art zu knüpfen, ist der Lebenstrieb neuer gesellschaftlicher Bildungen tätig. Diese Assoziationen beschränken sich nicht auf das einzelne Land, sondern greifen vielfältig über die Grenzen hinüber, werden also ebenfalls zu einem Bindemittel. Die Gelehrten haben aufgehört, oder hören auf, eine vom Leben zurückgezogene Priesterkaste zu sein. Ganz antiquiert ist die Meinung, es könne jemand im Besitze von Zeichen und Wundern sein über Dinge, die allen not tun. Das Königtum wollen alle, die Republik nicht einer. Die Fremden wünscht niemand in das Land herein, selbst die Hambacher haben sich gegen die Unterstellung eines solchen Wunsches verwahrt. Man will aber die Majestät binnen der Schranken, binnen welcher sie, wie man glaubt, allein Majestät bleibt, und über welche hinaus (so glaubt man) sie eine Art erhabener Klopffechterei wird. Gewaltsam ist einigen Regenten ein veränderter öffentlicher Zustand abgedrungen worden, an anderen Orten hat der bestehende zu heftigen Reibungen zwischen Fürst und Volk geführt; das Schlimmste aber, was aus solchen Dingen entsprang, war etwa ein Aufruhr, der von einer Revolution auch keine Farbe trug. Das neueste Ereignis dieser Art bewegt sich bis jetzt ganz auf dem Boden des Rechts und Geistes. Politische Sympathien haben unter den Deutschen begonnen, zwar noch schwach aber doch regsam. Sie richten sich fast nie auf eine Schilderhebung, für die oder die Partei, sondern wie Recht ist, meistenteils auf einen einzelnen Akt, über den man sich freut oder entrüstet. Was endlich den Wehrstand betrifft, so ist dieser populärer geworden, am populärsten im größten norddeutschen Kriegsstaate. Die Eifersucht auf diesen, auf Preußen, und der Haß gegen dasselbe – einige Zeitlang der fressende Krebs deutscher Verhältnisse, da jener Staat nun einmal durch die Geschicke bestimmt ist, nächster Schirmvogt der einen Hälfte unseres Vaterlandes zu sein – war eingeschlummert und hatte sich in Nord- und Mitteldeutschland zu Achtung und Wohlwollen umgewandelt, wie meine Erfahrung mich selbst auf einer Reise lehrte, die ich vor drei Jahren durch jene Gegenden machte. Neueste Ereignisse haben hierin etwas geändert, über sie urteile ich nicht, folgend meinem Grundsatze, von nichts zu reden, als was mir abgeschlossen zu sein scheint, und nicht wissend, ob sie und ihre Folgen zu den Zwischenfälligkeiten oder zu den Katastrophen gehören.
An den materiellen Tendenzen nimmt Deutschland, soweit es vermag, beeiferten Anteil. Von ihnen ist am schwersten zu sprechen. Gewiß wird kein tieferes Gemüt für die Eisenbahnen als solche und den Dampf, wenn er weiter nichts ist, und für die Maschinen, wenn sie nur klappern, den Säckel eines Gewerbsmannes zu füllen, sich erglühet fühlen. Gewiß ist ferner, daß durch jene Tendenzen in vielen Menschen eine gewisse Versandung entstand und eine Trocknis der Seelenkräfte. Gewiß ist aber auf der anderen Seite auch, daß sie hervorgehen nicht aus einer Täuschung, sondern aus einer Wirklichkeit, daß sie außer dem Geleite phantastischer Einbildung im strengsten Gefolge der Wissenschaft einherschreiten, und daß nicht einzelne Projektenmacher zu ihnen anführen, sondern daß die größere Hälfte der Gesamtheit in ihnen mehr oder minder lebt und webt. Sonach sind alle Kennzeichen vorhanden, daß eine der großen und notwendigen Evolutionen des menschlichen Geistes im Werke sei. An der Natur wird dieses Werk unternommen. Dem Altertume war sie ein Göttliches, dem Mittelalter ein Magisches, und der neueren Zeit scheint sie ein Menschliches werden zu sollen. Deshalb gebar sie dem Altertume die Schönheit, dem Mittelalter die Furcht Gottes und den christlichen Spiritualismus, und der neueren Zeit wird sie gewiß auch ein lebensfähiges, gliedmäßiges Kind gebären. Dessen Geschlecht und Gabe zu bestimmen, mögen Traumdeuter und Astrologen sich abmühen, und diese können um so dreister reden, da die Furcht vermutlich noch lange im Schoße der Mutter bleibt und die Wahrsager daher bei eigenen Lebzeiten schwerlich Lügen gestraft werden. Ich für meine Person weiß davon ebensowenig zu sagen, als ich, wenn ich Gutenberg seine hölzernen Tafeln hätte schneiden sehen, imstande gewesen wäre, vorherzuverkündigen, daß die Presse dereinst den Thron der Bourbonen umstürzen würde, nachdem er durch ein historisches Wunder wiederaufgerichtet worden war. Gut aber ist es, daß auch Deutschland sich in die Strömung, da sie nun einmal in die Zeit sich ergießen sollte, mit seinen Kräften warf.
Dieser ist der Zustand der Dinge. Wie man ihn nennen will, gilt gleich; ich glaube aber nicht, daß man die Züge übertrieben oder in das fälschlich Schöne verzogen schelten kann. Mit Willen habe ich nur die gröbsten Linien entworfen, gleichsam mit Frakturschrift geschrieben, um eben nur das Unzweifelhafte auszusprechen, welches aufhört, sobald die feineren Nuancen beginnen.
Neben jenen Lichtern dunkeln freilich auch tiefe Schatten. Der trübste ist, daß Deutschland noch immer des rechten, vollen Selbstvertrauens entbehrt. – Dreißig Millionen Menschen fürchten! – Das allgemeine Selbstvertrauen fehlt aber, oder ist noch nicht so stark, wie es sein könnte, weil der einzelne sich nicht genugsam zu vertrauen weiß. Noch immer, wenn auch schwächer als früher regt sich die alte Wut, zu dienen, sich wegzuwerfen und ein abgeleitetes Dasein zu leben, statt eines eigenen. Der Deutsche hat aber recht eigentlich die Bestimmung, sich in seinem innersten Kerne zu begreifen, verstehen zu lernen, wozu ihn Gott und die Natur haben wollten und nur in dieser Gestalt anzuknüpfen mit einem fremden Willen. Das ist nach meiner Meinung der wahre Begriff germanischer Freiheit, welche nicht mit wütenden Rotten durch die Straßen läuft, sich selbst ausrufend, sondern der Gewalt eine unsichtbare und stumme Schranke entgegensetzt. Diese germanische Freiheit ist nur in England bis jetzt zum Vorschein gekommen und auch da unvollständig, gebrochen, anfangs durch die normannische Eroberung, später durch den erwachten Merkantilismus. Es fehlt aber viel, daß sie bei uns im vollen und ganzen bestände. Würde sie einmal mehr durchdringen, so würde dann der wahrhaft germanische Staat erwachsen sein, der vollkommenste der neueren Zeit, weil wenigstens die Mehrzahl seiner Bürger ihm angehören würde nicht durch die niederen Triebe der Natur, sondern durch das Beste im Menschen, durch das, was man seine geistige Person nennen kann.
Daß der Zustand, wie er in seinen allgemeinsten Merkmalen angegeben worden ist, aus der Niederlage von 1806 und der Erhebung von 1813 entsprang, wird man nun leicht einsehen. Denn seine guten Seiten beziehen sich sämtlich auf das in den Zeiten der Not wiedererwachte Volksbewußtsein; die Verarmung und das materielle Unwohlsein während der Unterdrückung hatte die Sehnsucht nach einem reichlicheren Wesen geschärft, und dieses wird zunächst durch die materiellen Tendenzen angestrebt, so daß daher auch sie, wenigstens in der Gewalt, mit welcher sie herrschen, als Folgen der Vergangenheit erkannt werden dürfen. Der Schatten aber ist ebenfalls aus dem Schatten geboren, welcher über dem Freiheitskampfe lastete. Dieser war das historische Unglück, daß nicht Deutsche allein die Rettungsschlachten schlugen, sondern daß der Kampf eine gemischte Natur hatte.
Noch also ist die Spur des Löwen sichtbar; wenigstens wie die Sonne, wenn Wolken am Himmel sind, würde vielleicht Sancho Pansa hinzusetzen. – Aber wie bald kann sich das ändern, wie bald können neue Ereignisse unserem ganzen Sein durchaus neue Zutaten geben! Wer seine eigenen Augen nicht verschließen will, muß einsehen, daß das Schicksal Frankreichs auf zwei Augen steht und daß der junge Herzog von Orleans, wenn Ludwig Philipp nicht mehr ist, eine unlösbare Aufgabe hat. Man sagte noch vor kurzem, daß die Schüsse auf den König eben bewiesen, welche Festigkeit der Julithron gewonnen habe. Jetzt errichten vierhundert junge tollkühne Menschen Barrikaden in der Hauptstadt, das Volk sieht zu, die Nationalgarden kommen zögernd und in schwacher Zahl, die Aufrührer sterben, ohne zu beichten, und noch in den Zügen der Toten prägt sich Trotz und Verachtung aus. Was wird man nun sagen? Welchen neuen Vorwand der Beschwichtigung wird man nun ersinnen? – Ist es denn überhaupt nach der Natur der menschlichen Dinge denkbar, daß das Volk, welches doch dort unleugbar einen König gemacht hat, in zwei Menschenaltern vergessen werde, es habe sich den König eigentlich nach seinem Bilde machen wollen?
Ich werde in meine Schilderungen viel Individuelles verweben, werde mich sogar nicht scheuen, mit Knabenerinnerungen zu beginnen. – »Memoiren also!« – Nicht so ganz. Mein Leben erscheint mir nicht wichtig genug, um es mit allen seinen Einzelheiten auf den Markt zu bringen, auch habe ich noch nicht lange genug gelebt, um mir den rechten Überblick zutrauen zu dürfen. Ich werde vielmehr nur erzählen, wo die Geschichte ihren Durchzug durch mich hielt. Da aber werde ich auch Kleines und anscheinend Geringfügiges nicht verschmähen, denn die großen Ereignisse entspringen zwar nicht selten in einem großen Haupte oder Herzen, ihren Leib aber bekommen sie immer nur aus den Elementen und deren Infinitesimalteilchen.
Daß der Rhapsode sich auf diese Weise zum Mittelpunkt seiner Erzählung mache, scheint mir erlaubt zu sein. Es wäre schon nicht übel, wenn der Darsteller einzelner historischer Tatsachen angäbe, durch welche persönlichen Motive er sich mit seinem Stoffe wahlverwandt gefühlt habe. Dadurch würde die Geschichtsschreibung offener den Charakter geistiger Konfessionen bekommen, und keine ist etwas anderes. Nur müßte dies freilich mit mehr Wahrheit und Freimut geschehen, als es Sallust getan hat. Eine objektive Darstellung im strengen Sinne des Worts gibt es gar nicht. Die Sache ist vielmehr die. Es gibt objektive und subjektive Zeiten d.h. solche, in welchen eine große Menge Menschen in gewissen Lebensveranstaltungen oder Überzeugungen übereinstimmen, und solche, worin das Gegenteil stattfindet, worin nur das Individuum für sich da ist. Goethe hat auf diesen Unterschied in den Gesprächen mit Eckermann scharfsinnig hingewiesen, und nur darin geirrt, daß er sich selbst für eine objektive Natur hielt, während er doch nur die auf die Spitze getriebene Subjektivität des achtzehnten Jahrhunderts in sich zur höchsten Blüte zu bringen wußte, und alle Stoffe, die wie z.B. »Egmont«, in ihrer Großheit und Subjektivität nicht zusagten, umbrechen mußte, um sie behandeln zu können. Merkwürdig sind in dieser Beziehung die Geständnisse über seine Beschäftigungen während der großen Entscheidungen des Vaterlandes, aus welchen man ihm mit Unrecht einen Vorwurf erhoben hat. – Gegenwärtig leben wir in einem Übergange von der subjektiven zur objektiven Periode; die Zeit, von welcher geredet werden soll, gehört noch ganz der ersten Richtung an.
Bei einem allgemeinen Sitten- und Charakterbilde, wie ich es zu geben versuchen werde, ist es nun sogar notwendig, von der Person des Zeichners auszugehen, wenn es die rechte Wahrheit erhalten soll. Der Held, der Kriegeszug, die Friedensunterhandlung ist durch Abhörung von Zeugen oder Einsicht der Urkunden noch allenfalls herzustellen. Dagegen lernt man die Sitte, Stimmung und Strömung einer Zeit nur dadurch kennen, daß man mit ihr lebt, und auf die Weise lernt man sie kennen, wie man mit ihr zu leben wußte. Sie ist wie die Harmonie von Blättergesäusel, Blumennicken, Lüfteziehen, Nachtigallenschlag und Getön fernarbeitender Menschen an einem Frühlingstage; oder von Meereswogen, Möwenschrei und Vorüberfahren einsamgespannter Segel am Strande, etwas Unendliches, Zerrinnendes, ewig sich Wandelndes, welches nur in den Organen des Beschauers Abschluß und Umrahmung erhält. Hier ist also die subjektive Darstellung die beste, weil sie die ehrlichste ist.
Knabenerinnerungen
Ich bin in einer Familie erwachsen, welcher von väterlicher Seite her zwei große Gestalten der Vergangenheit in höchstem Glanze vorgeführt wurden. Wie andere Kinder mit Märchen gespeiset werden, so wurde mein frühestes Denken und Fühlen durch das Gedächtnis an sie ernährt – vielleicht war es eine zu strenge Nahrung für das unreife Alter.
Die erste jener beiden Gestalten war Gustav Adolf, König von Schweden. Eine glaubwürdige Familientradition, die mein Vater in seinem Hausbuche aufgezeichnet hatte, besagte, daß Peter Immermann, Sergeant in der Armee des großen Schwedenkönigs, der erste des Namens in Deutschland gewesen sei. Er hatte bei Lützen mitgefochten »für teutsche Gewissensfreiheit« wie im Hausbuche steht, was da vor mir liegt, war in Deutschland geblieben, hatte eine durch den Dreißigjährigen Krieg wüst gewordene Bauerstelle im Dorfe Etgersleben unweit Magdeburg in Besitz genommen, eine Bäuerin, namens Ilse geheiratet, und war so der Stammvater der Familie geworden, welche sich dann durch Landleute, Handwerker, Schullehrer und Prediger verbreitete, bis sie in meinem Vater zu einem nach dem Maßstabe früherer bescheidener Zeiten hochgeschätzten Ansehen gelangte. Er war Königlicher Rat und stand bei der magdeburgischen Krieges- und Domänenkammer.
Es ist nicht wahr, daß nur der Adel sich etwas auf seine Ahnen einbilde. Bürgerfamilien sind ebenso stolz, wenn sie unter ihren Vorfahren jemand wissen, der den Stammbaum verherrlicht, sei es auch nur dadurch, daß sein Name mit irgendeiner großen oder gerühmten Begebenheit in Zusammenhang steht. Eine sehr natürliche und lobenswerte Neigung im Menschen; der Keim des Staats und alles politischen Lebens. Jener alte Schwede, von dem sonst nichts weiter bekannt war, erhielt sich in der Familienerinnerung als eine respektable Figur, mein Vater erzählte mit Behagen, daß er einstmals jüngere Vettern mit nach Etgersleben hinausgenommen, ihnen das Stammgut der Familie gezeigt und sie veranlaßt habe, den Hut vor dieser Solstätte abzunehmen. Über die problematische Natur des Erwerbstitels wurde hinweggesehen, keine Kritik nagte an der Rechtfertigkeit des Besitzes. Das Gütchen war übrigens längst in andere Hände übergegangen, und ich habe es nie zu Gesicht bekommen.
Indessen bedurfte denn doch der schwedische Sergeant eines Heros, von dessen Strahlen er erst sein rechtes Licht zu empfangen hatte. Und dieser konnte kein anderer sein als Gustav Adolf. Mein Vater nannte ihn nie anders als den Erretter Deutschlands, viel wurde von ihm erzählt, der Dreißigjährige Krieg ging für uns eigentlich nur bis zur Schlacht von Lützen; über allen Zweifel erhaben war es, daß den König eine meuchelmörderische Kugel getroffen hatte, was denn unseren Haß gegen die Ligisten, der ohnehin schon nicht gering war, nur schärfen konnte. Wie die Leiche des Helden nach Weißenfels geschafft worden, wie die Königin sie dort mit Tränen benetzt habe, das und mehr dergleichen stand so vor mir, als wäre ich dabeigewesen. Die Oxenstiernas hörte ich erst weit später nennen und sie konnten mir nach einem solchen Vorgänger wenig Interesse abgewinnen.
Die andächtige Verehrung des großen Schwedenkönigs fand in meiner Vaterstadt außerdem einen fruchtbaren Boden, in dem sie nachhaltig treiben konnte. Eine Stadt verschmerzt ihre Zerstörung in anderthalb hundert Jahren nicht. Tilly und der Teufel galten in Magdeburg ungefähr gleich viel; Katholische und Kaiserliche kamen dicht hinterher. Rathmanns Geschichte von Magdeburg ist das erste Buch gewesen, welches ich gelesen habe. Kam ich nun da an die Stelle, wo es heißt, daß die Belagerer am 9. Mai 1631 zum Schein ihre Stücke aus den Schanzen, ihre Truppen von Krakau und Rothensee abziehen, daß die Belagerten sicher werden, glauben, die Schweden rückten zum Entsatz herbei, und die vom Wachen und Postenstehen ermüdeten Glieder dem Schlummer hingeben, so ergriff mich die heftigste Beklemmung, ich hätte ihnen aus Leibeskräften zurufen mögen: Wacht auf! den Bösewichten ist nicht zu trauen! Es half aber nichts. Wenige Seiten weiter waren die Kroaten, die Wallonen und Lombarden zur Hohenpforte und zum Schrotdorfer Tor eingedrungen, mordeten und brannten. Dietrich von Falkenberg, der schwedische Kommandant, eilt fruchtlos dahin und dorthin, bis ihn eine Falkonettkugel niederstreckt. Nun beginnt der Greuel der Verwüstung, durch den sich die jugendliche Einbildungskraft hindurchwürgen mußte! – Tilly bekam es freilich darauf bei Leipzig, und im Dome sah ich noch seine angeblichen Stiefel hangen, mit Ketten umwunden, aber was konnte das helfen, da Magdeburg bis auf den Dom, einige Kirchen und eine Reihe dürftiger Häuserchen am Fischerufer in der Asche lag! wie ich jederzeit für mich, wenn ich diese grause Lektüre beendigt hatte, ergriffen und pathetisch sagte.
Blickte sich nun der Knabe in der Stadt um, so sah er den gewaltigen Dom mit seinen beiden majestätisch emporstrebenden Türmen und im übrigen lauter Häuser, die wie geschnörkelte Kommoden dagegen aussahen. Es war aber zu uns noch nichts gedrungen von gotischer, vorgotischer und späterer Baukunst aus den Zeiten des verderbten Geschmacks, wovon jetzt jedes Kind zu reden weiß. Wir dachten uns also bei jenem Kontraste auch weiter nichts, als daß die Kommodenhäuser nach dem Sturme aufgebaut seien, und daß der Dom in seiner Pracht und Festigkeit selbst den verruchten Stürmen widerstanden habe. An dem fiel uns besonders auf, daß der Knopf des einen Turmes fehlte, während der andere doch noch ganz stattlich mit seiner steinernen Blume da droben unter den scharfen, hohen Himmelslüften blühte. Wir mußten nun auch über den fehlenden Knopf, der uns so in Verwirrung setzte, wie Kanten einst der Defekt am Rocke des gegenübersitzenden Studenten, vernehmen, ebenfalls er sei von den Kaiserlichen in der Belagerung herabgeschossen worden.
Darauf bezog sich denn unser ganzes Interesse an magdeburgischen Geschichten. Denn ich wußte zwar wohl, daß Kaiser Otto der Große die Stadt gegründet habe, ich fand zwar einst in einem alten staubigen Wandschranke hinter dem Sofa in meines Vaters Stube, als dieses Möbel einer Reparatur wegen abgerückt wurde, zwischen Müll und Moder eine Reihe weggestellter Folianten und Quartanten in Schweinsleder, unter den Quartanten einen, der ganz gelbbraun aussah und der »löblichen uralten Stadt Magdeburg Privilegia« enthielt, und in diesem gelbbraunen Quartanten den deutsch übersetzten Gründungs- und Freiheitsbrief Ottos vom siebenten Tage des Brachmondes Jahres 940, worin der Kaiser »den werten Sachsen, die ihm fürgeleget, wie sie sich in Gottes Frieden zusammenhalten und eine Stadt bevesten wollen«, erlaubt »zu bauen und zu bevesten, und einen Markt zu hegen nach alter Weise, als Marktrecht von alters gestanden hat, auch ewigen Frieden zu haben in der Stadt welche sie Magdeburgk genannt haben«; ich sah des Kaisers steinerne Bildsäule zu Pferde, Krone auf dem Haupte, Zepter in der Hand, Mantel um die Schultern unter ihrem Schirmdächlein auf dem Alten Markte stehen, hörte, daß von der Bildsäule aus alle Landstraßen gemessen würden, die in der Stadt zusammenstießen und wußte, daß die Fischhändlerinnen, die dort mit ihren großen Bütten und Mulden in reichlicher Zahl ausstanden, dem Kaiser als ihrem Patrone noch alljährlich am Sonnabend vor Pfingsten grüne Maien als Zoll der Verehrung an das Postament steckten und ihm ein Frühstück servierten, auch sah ich ihn mit seiner Editha in weißem Marmor hinter erzgetriebenem Geländer im Chore des Domes liegen, wenn wir uns, während der Gottesdienst zu Ende ging und die Gemeinde die Kirche verlassen wollte, dort einschlichen. Aber Privilegienbrief, Bildsäule und Grabmal blieben doch nur Papier, Erz und Stein, der weggeschossene Turmknopf, die Kommodenhäuser und Rathmanns Bericht von den Greueln der Zerstörung gehörten allein zu der Geschichte, die sich um den schwedischen Stammvater und seinen König drehte.
Die zweite große Gestalt, von der ich reden hörte, war Friedrich der Zweite. Mein Vater hatte im Jahre 1750 das Licht der Welt erblickt, sich erst als Fünfundvierzigjähriger verheiratet und so kam es, daß ich von jemand abstammen konnte, der mir aus eigenem Gedächtnisse erzählte, daß die französischen Husaren vor der Schlacht bei Roßbach in das Magdeburgische gestreift und bei dem Anblick der großen Salinenwerke um Salze gerufen hätten: »C'est dommage!« nämlich, daß so schöne Anlagen nun auch bald zerstört und dem Boden gleichgemacht werden müßten. Wenn der Vater das erzählte, so spielte ein satirisches Lächeln um seine fein und scharf geschnittenen Lippen. Da er aber von Natur höchst ernsthaft war, so unterblieb jeder weitere Spott und er fügte nur hinzu, jenes gutmütige Bedauern der französischen Husaren habe sich etwa Ende Oktober zugetragen, die Schlacht bei Roßbach sei aber am fünften November vorgefallen und durch Seydlitz in einer halben Stunde entschieden gewesen. Roßbach und die Franzosen und Seydlitz gehörten hiernach in der Vorstellung der Kinder untrennbar zusammen. Bei der Gelegenheit war auch von der Reichsarmee die Rede, auf welche jedoch nur die bekannte spöttische Bezeichnung verwendet wurde. Jedoch nicht von meinem Vater, der zwar wohl in Familienbeziehungen ungeachtet seines martialischen Ernstes heiter zu scherzen wußte, nie aber sich Späße über allgemeine und wichtige Dinge gestattete, sondern diese immer in einfachster Strenge abhandelte. Nur von Angehörigen, Mitzuhörern der Krieges- und Siegeserzählung, vernahmen wir das nun längst verschollene Witzwort.
Die kräftigsten männlichen Jahre hatte mein Vater im Dienste des preußischen Königshelden verlebt, nämlich als Auditeur bei dem General Saldern. Viele der großen jährlichen Manöver und Revuen unweit Körbelitz hatte er mitgemacht auf seinem »Braunen«, wie er ein besonders geliebtes Pferd nannte, dem auch, nachdem es untauglich geworden, von ihm aus Dankbarkeit auf die Tage des Lebens der Gnadenhafer und das Pensionsheu bei einem Verwandten auf dem Lande gestiftet worden war. Mein Vater hatte es nicht über das Herz bringen können, das treue Roß, welches die mutigen Tage des Reiters in so manchem fröhlichen Ritte gesehen, totstechen oder bei einem Kärrner zu Tode schinden zu lassen. Dieser Braune gehörte ebenfalls zu den mythischen Figuren meiner Kindheit. Es war fabelhaft, wie lange er noch bei dem Landwirte gelebt haben sollte. Steif, blind und zahnlos war er geworden, weshalb die Sage ging, er habe zuletzt mit Mehlsuppe gefüttert werden müssen, weil das arme, greise Maul Rauh- und Hartfutter nicht mehr bewältigen können. Mein Vater gehörte aber zu den wenigen Menschen, die von dem, was sie einmal ausgesprochen haben, nicht wieder abgehen, und da der Vetter und Landwirt ein äußerst gutmütiger und sanfter Mann war (weshalb ihn auch der Vater wahrscheinlich zum Siechenpfleger des alten Braunen ernannt hatte), so verdient die Nachricht Glauben, daß das Pferd endlich wirklich eines natürlichen Todes verblichen sei. Freilich schlich neben dieser Nachricht im Hause die heimliche Sage um, man habe den Vater dennoch getäuscht, dem Vetter sei zuletzt der Faden der Geduld gerissen, das ganz stumpf gewordene Tier aber durch einen Genickschuß abgetan worden.
Erinnerte sich der Vater an die Revuen bei Körbelitz, so pflegte er zu sagen: »Wenn Friedrich die Front heraufgeritten gekommen, so sei es in lautloser Stille einem jeden gewesen, als komme der liebe Gott.« Ich konnte daher als Knabe zwischen dem großen Könige und dem lieben Gott auch eigentlich keinen Unterschied machen. Dabei war mein Vater nicht blind für die Fehler des gefeierten Herrschers und Herrn. Mit großer Erregung sprach er davon, wie Saldern, sein verehrter Chef, durch die Ungnade des Königs die verbittertsten letzten Lebenstage gehabt habe. Es war dies einer der Fälle gewesen, in welchen Friedrich seiner übeln Laune auf jemand durch herbes Spötteln oder kaltes Übersehen Luft zu machen geliebt hat. Glänzend hob sich dagegen hervor, was mein Vater selbst von der Achtung des Königs für eine unerschrockene Meinung erfahren hatte. Ein armer Soldat war, von einem unmenschlichen Vorgesetzten über alles Ertragen hinaus gereizt, unter dem Gewehr gegen diesen tätlich ausgefallen; der Tod schien ihm sonach gewiß zu sein. Mein Vater aber wußte es, mittelst einer Beweisführung, die freilich künstlich genug gewesen sein mag, dahin zu bringen, daß der Missetäter in dem Moment des Verbrechens allenfalls für wahnsinnig hatte gelten können, wußte in dem Kriegsgericht mit seiner Beredsamkeit zu siegen. Das Kriegsgericht sprach den Delinquenten frei. Als mein Vater Saldern das Urteil überbrachte, sah dieser ihn mit großen Augen an, fragte ihn, ob er den Kopf verloren habe, eine solche Erkenntnis könne er nicht auf sich nehmen, über die Sache müsse er an den König schreiben. Der Gescholtene zeigte durch seine stumme militärische Haltung, daß er das erleiden wolle, worauf Saldern ihn heftig anließ und ihm augenblickliche Kassation, Festung und was sonst noch, verkündigte. Mein Vater versetzte, daß er in Eid und Pflicht stehe und seine Schuldigkeit getan zu haben glaube. Saldern schickte das Urteil wirklich an Friedrich ein, mit mancher Beschönigung für den Referenten, den er wie einen in den Militärrechten noch unerfahrenen Menschen dargestellt hatte, selbst aber wenig von dieser Verwendung hoffend. Die Sache war in der Tat keine Kleinigkeit, denn über Disziplin verstand Friedrich bekanntlich wenig Scherz. Aber alles nahm eine günstige, selbst eine epigrammatisch-witzige Wendung. Der König, das Ganze durchsehend, und der guten Absicht das Mittel vergebend, bestätigte wider Erwarten das Urteil und hatte dem Remissorial eine seiner wunderbaren Randverfügungen beigesetzt, ungefähr der Fassung: »Vor diesesmal möge es passieren, Saldern solle aber darauf acht haben, daß nicht mehr Kerls unter dem Gewehr solcherweise überschnappten.« – Der Offizier und Mißhändler wurde in eine Art von Strafbataillon versetzt und die Angelegenheit brachte meinem Vater Ehre und Beglückwünschung, am meisten von Saldern selbst, der ihn liebhatte. – Dieser Tat war er sich mit Freuden bewußt und durfte es auch sein, denn die Menschlichkeit mußte in jenen eisernen Zeiten Schleichwege gehen, wenn sie zum Ziel gelangen wollte. Ein Nebenzug in dem Ereignisse war folgender: Man hatte meinem Vater, als er seine Absicht, den Menschen zu retten, ausgesprochen, vorgestellt, der König werde ihn ja ohne Zweifel begnadigen. Darauf erwiderte mein Vater: die Gnade sei ungewiß, das Recht aber gewiß. Der Mensch brauche keine Gnade, sondern solle Recht bekommen. – Er ließ sich nicht träumen, daß seine Titular-Theorie von der Monomanie beinahe fünfzig Jahre später unter den Richtern und Ärzten wirklich spuken gehen werde.
Ich habe den König Friedrich den Zweiten genannt. Ich muß aber hinzufügen, daß ich ihn nie so in meines Vaters Hause nennen hörte. Die anderen sprachen vom alten Fritz, meinem Vater aber hieß er der König schlechtweg. »Als der König zur Bayerischen Kampagne abreiste – als der König zum ersten Male das Podagra hatte – als der König dann und dann in Magdeburg war« – in solcher Art wurde geredet. Viel las mein Vater in Friedrichs Schriften, von welchen er die Ausgabe von 1788 bei Voß und Decker besaß, über deren schlechte Redaktion damals noch keine Klage geführt wurde. Wenn ich ihm nun einen Band derselben bringen sollte, so sagte er nur: »Hole mir den und den Band von des Königs Schriften.« – Ich schlage soeben den ersten Teil auf und darin finde ich unter neuerem Datum vermerkt, daß einige Bände »von des Königs Schriften« an einen Verwandten ausgeliehen worden seien. Wir lebten unter Friedrich Wilhelm dem Dritten, dem Vater aber war bei tiefster Anhänglichkeit an den regierenden Herrn Friedrich der Zweite der König ohne weiteren Beisatz geblieben. Sprach er von der Gegenwart, so sagte er: Unser jetziger König.
Unermeßlich war die Wirkung solcher Eindrücke auf das erste Erkennen. Durch den Vater, der selbst wie ein Wesen höherer Art und Ordnung vor den Kindern dastand, wurde der Gedanke an Persönlichkeiten vermittelt, zu welchen alles, was man sonst sah und hörte, nicht mehr zupaßte. Denn auch die Ungerechtigkeiten und Tücken des großen Königs, von welchen, wie ich beispielsweise angab, zuweilen die Rede war, minderten an dem Bilde seiner Gewaltigkeit nichts; weil mein Vater jedesmal hinzusetzte: »Wenn er sich dergleichen vorgenommen hatte, so konnte kein Mensch auf Erden dawider an.« – Und so wurde ein Heroenkultus gestiftet, der auch eine Art von Religion ist, nur muß er nicht aus dem Begriff entspringen, wenn er diesen Namen verdienen soll, sondern aus den frühesten und dunkelsten Gefühlen. Der Atem der Friederizianischen Aufklärung umwehte uns von allen Seiten und des Offenbarungsglaubens kam uns gar wenig zu, aber es fragt sich, ob, wie die Sachen wenigstens jetzt zu stehen gekommen sind, das religiöse Gefühl in Kindern nicht am gründlichsten durch eine solche Hingebung an große Menschen vorzubereiten wäre?
Fahle, unheimliche Schatten strichen je zuweilen durch die uns aufgetane Lichtwelt, deren Schimmer nur noch heller hervorstellend. Wir hörten vom »Hochseligen« oder sogenannten »dicken Könige« reden, vernahmen, daß man ihm habe Geister erscheinen lassen, daß seine letzten Tage nur durch künstlich bereitete Lebensluft zu fristen gewesen seien; der Name Bischoffswerder wurde genannt und von Goldmacherei gesprochen. In der Nähe von Emden wurde nie verabsäumt, uns ein einsam und wüst liegendes Häuslein zu zeigen, in welchem die betrügliche, aber damals zu Ansehen gekommene Kunst getrieben sein sollte. Das hatte nun alles keinen rechten Zusammenhang, welcher sich auch bei der eigentümlichen Natur jener Geschichten vor Kindern nicht wohl herstellen ließ, aber es erweckte doch den Gedanken, daß mit dem Tode »des Königs« die Welt eine äußerst schiefe Richtung erhalten haben müsse. Als Söhne der Aufklärung verachteten wir alle Geisterseherei und Goldmacherei von Grund des Herzens und konnten in unserer Geringschätzung nicht begreifen, wie man dergleichen habe glauben und dulden können. Ich grübelte und grübelte über die dunkeln Geschichten, die wie Gespenster mir in der Seele lagen.
Im Jahre 1805 im Sommer bemerkte man plötzlich eine große Regsamkeit in der Stadt. Mehrere der alten Kommodenhäuser am Neuen Markte wurden abgeputzt, das Pflaster, was von da zum Fürstenwalle hinabführte, wurde ausgebessert, das Gouvernementsgebäude, dessen oberer Stock durch eine hölzerne Überbrücke mit dem Fürstenwalle zusammenhing, instand gesetzt, der Fürstenwall, von wo man die Aussicht auf einen bedeutenden Abschnitt der Elbe und ihrer Ufer hatte, mannigfaltig durch die strengen Linien der gegenüberliegenden Zitadelle und die Baumanlagen des Roten Horns, empfing an schicklichen Stellen einen Überzug von grünem Rasen, in den blühende Stauden und insbesondere blaue und rote Hortensien in unendlicher Anzahl eingesenkt wurden, endlich errichteten Werkleute und Tapezierer auf einem Vorsprunge des Walls ein russisches Zelt mit buntem Dache. Der Sinn dieser Anstalten wurde bald klar, es hieß, der König und die Königin würden Magdeburg besuchen. Damals erinnere ich mich zum erstenmal von jener Fürstin reden gehört zu haben. Ich war von frühster Kindheit an sehr neugierig und horchte überall zu, wo ich Erwachsene redend zusammenstehen sah, wie ich denn überhaupt eher ein Verhältnis zu älteren Leuten gehabt habe, als zu meinesgleichen. Die Wirkung der annahenden Königin auf die Männerwelt war nun wirklich so, daß man jeden für einen Champion der schönen Majestät hätte halten dürfen. In der bürgerlichen Sphäre wurde damals weit weniger gereist als jetzt, viele hatten daher die Monarchin noch nicht gesehen und alle waren voll Erwartung des Wunders, oder Entzückens über die Wiederkehr hoher Freude voll. Man sprach nur von der Königin, sie wurde, wo auf sie die Rede kam, »die admirable Frau« genannt. –
Nicht lange währte es, so legte eines Morgens mein Vater mit ernstem Antlitz seine gestickte Uniform an, in der ich ihn noch nie gesehen hatte und in welcher er mir, Degen an der Seite, dreieckigen Hut auf dem Haupte, wunderbar und fremd vorkam. Ich drückte mich, nachdem ich den Glanz dieses Anblicks oben auf des Vaters Zimmer eingesogen, unten in eine Ecke des Hausflurs, um den Genuß noch einmal zu haben. Er schritt an mir vorüber, ohne mich wahrzunehmen, nachdenklich vor sich hinsehend, und ich war ganz erschüttert und betäubt, denn ich hatte keine Ahnung davon gehabt, daß ein solcher Prachtrock in der Welt, geschweige daß er im Hause sei.
Gleich nachher donnerten die Kanonen, läuteten die Glocken, sprengten die roten Kammerhusaren – eine Art von Verwaltungsmiliz, die ein in diesem Friedensdienste unmäßig korpulent gewordener Rittmeister kommandierte – durch die Straße, lärmte und schrie das Volk, und lief im wildesten Rennen nach dem Brücktore. Es war uns Kindern streng verboten worden, uns in das Getümmel zu wagen, aber wie wäre da Haltens gewesen! – Das Haus war von seinen Bewohnern geleert und nur der Hut einer alten Wärterin anvertraut. Der vorbeizukommen hielt nicht schwer. Rasch hatte ich die Türe hinter mir und war mit den letzten Nachzüglern auch im vollen Rennen nach dem Brücktore. Aber in der Nähe desselben kamen uns glänzende Equipagen entgegengefahren, nachflutete der Volksstrom dem Fürstenwalle zu, von diesen Wogen wurde auch ich gefaßt, nun schwamm ich mit der Flut und wurde von ihr ruckweise auf die Stirn des Walls befördert.
Dort stand Kopf an Kopf und es schien fast unmöglich bis zum Gouvernementsgebäude vorzudringen, in welchem die Majestäten abgestiegen waren. Aber was wäre einem von Neugier brennenden Knaben in solchem Falle unausführbar? Gehend und kriechend, schiebend und geschoben, stoßend und gestoßen schrotete ich mich die schwarze Menschenmasse hindurch und gelangte endlich glücklich wenn auch etwas gequetscht an einen Ort, wo ich nun unter den Vordersten gerade der großen Salontüre gegenüberstand, in welcher die Herrscher erscheinen mußten, wenn sie sich, wie jedermann erwartete, dem Volke zeigen wollten.
Da stand ich denn also an der glücklichsten Stelle. Aber bald überfiel mich ein entsetzliches Bangen. Im Kampf und Ringen stürmt der Mensch sich bewußtlos auf die schmale Zinne eines Turms hinauf, aber wenn er die Zinne erobert hat und nun da droben steht, kann ihm schwindlig werden. Mir fiel plötzlich zentnerschwer aufs Herz, daß ich denn doch wider das ganz ausdrückliche Verbot meines Vaters da vorhanden sei, welches mir so viel gelten mußte, als ein Befehl Friedrichs seinen Offizieren gegolten hatte. Meinem Geiste trat eine furchtbare Phantasie nahe; ich dachte, der Vater könnte da statt des Königs oder der Königin in der Salontüre sich zeigen, sein Auge den Ungehorsamen entdecken. Zurückzuweichen war völlig unmöglich, die Menge hinter mir bildete eine undurchdringbare Mauer. Ich mußte also stehen bleiben, den Fügungen des Geschicks verfallen, und mich noch vor den beiden roten Kammerhusaren in acht nehmen, welche die Brücke nach dem Salon gegen den Andrang zu schützen hatten. Diese machten nicht viel Umstände mit dem Volke, und es ging hier zu wie allerorten bei solchen Gelegenheiten. Nicht die Drängenden erlitten unsanfte Behandlung, sondern die Gedrängten, die unschuldigen Vordersten.
Aber bald löste ein reizendes Schauspiel alle Angst auf und jedes herbe Wesen. Die Königin trat in die Salontüre. Ich erinnere mich ihres Anzuges noch ganz deutlich; sie trug einen stahlgrün seidenen Überrock, und war übrigens ohne Schmuck, einfach gekleidet. Das Volk begrüßte sie jubelnd, Mützen und Hüte schwenkend. Sie verneigte sich mit holdseliger Freundlichkeit nach allen Seiten und nun wurde ich Zeuge eines Auftritts, der wohl verdient erzählt zu werden. Auf silbernem Plateau wurde ihr eine Tasse dargeboten, sie nahm sie und frühstückte. Ein Herr mit mehreren Sternen auf der Brust näherte sich ihr aus der Tiefe des Salons und schien des Augenblicks zu warten, wo er ihr nach beendetem Frühstück die Tasse abnehmen dürfte. Plötzlich aber sah die Königin empor, dann mit unglaublicher Freundlichkeit nach dem Volke. Ihr Blick fiel auf ein Kind, mit welchem die Wärterin sich auch unter den Vordersten befand. Die Schönheit des Kindes mochte ihr gefallen, und das lange, goldgelbe Lockenhaar des Kleinen. Sie winkte erst mit dem Finger, da aber niemand die liebenswürdige Natürlichkeit dieser Gebärde begriff, so sagte sie jemand, der hinter ihr stand, etwas, worauf der Diensttuende über die Brücke gegangen kam und der Wärtin befahl, ihm mit dem Kinde zur Königin zu folgen. Die arme Person wurde blutrot, gehorchte zitternden Schrittes, und sah sich dabei unterweilen nach der Menge um, als wollte sie sagen: Ich maße mir diese Ehre nicht an. Inzwischen wollte der Herr mit den Sternen der Königin die Tasse abnehmen; sie lehnte es aber ab, neigte sich dem Kinde, welches unbefangen umherlächelte, entgegen, faßte seine Händchen, streichelte ihm die Wangen und gab ihm dann aus ihrer Tasse in dem Teelöffel zu kosten. Sie fragte die Wärterin nach dem Alter des Kindes, nach seinen Eltern und was dergleichen mehr war. Alles dieses geschah in der Entfernung weniger Schritte von dem Platze, wo ich stand, so daß ich diese Einzelheiten genau merken konnte. Man begreift, welchen Eindruck der Vorgang im Volke machen mußte, bei dem eine Königin sich so lieblich mütterlich gegen ein fremdes Kind bezeigte. Es wurde nicht gerufen oder sonst eine laute Freude an den Tag gelegt, aber rings um mich her hörte ich murmeln, daß das doch noch eine Königin sei, wie sie sein müsse.
Dieser Tag hatte für mich eine Belehrung unerwarteter Art in seinem Schoße. Ich wußte vom alten Fritze, konnte alle Schlachten des Siebenjährigen Krieges nach der Schnur her erzählen, es war mir bekannt, daß die Kaiserlichen Magdeburg zerstört hatten, und die Königin von Preußen hatte ich soeben gesehen. Aber wie das alles mit der Gegenwart zusammenhing, darüber fehlte mir jede Vorstellung und in betreff der aktuellen Regierung ging es mir, wie Götzens Karl, als er nach dem Herrn von Berlichingen befragt wird. Aus Rathmanns Geschichte waren mir die alten magdeburgischen Erzbischöfe als besonders kenntliche Figuren entgegengetreten und ich glaubte daher an deren Fortbestand so treuherzig, wie Campes Kinder daran glauben, daß ihr Freund Robinson noch am Leben sei. Der Tag aber, von dem ich rede, sollte mich enttäuschen.
Glücklich und unbemerkt war ich nach Hause zurückgelangt, und saß meinem Vater bei Tische gegenüber. Er hatte sofort nach der Rückkehr von der Cour die Gala abgelegt, war jedoch schweigsam und ernst und überhaupt herrschte eine gewisse feierliche Schwüle im Familienkreise. Mir wurde dabei im Bewußtsein des verbotenen Genusses, den ich gehabt, nicht ganz wohl, ich hielt es unter diesen Umständen für doppelt geraten, der Unterhaltung mich nach Kräften anzunehmen, damit sie nicht etwa in verfängliche Nachforschungen abspränge, und so fuhr ich plötzlich, als eine lange Stille im Gespräch entstanden war, mit der Frage heraus: wer jetzt Erzbischof von Magdeburg sei?
Hierauf sah mich mein Vater mit einem Blick an, den ich nie habe vergessen können. Er hatte hellblaue Augen, die eines blitzenden Ausdrucks fähig waren. Diese blitzenden blauen Augen auf mich werfend und auf mir ruhen lassend, sagte er ganz ruhig und gehalten, aber so, daß mir der Ton durch Mark und Bein ging: »Das Erzstift ist lange aufgehoben und zum Herzogtum Magdeburg gemacht. Der König von Preußen ist Herzog von Magdeburg.« –
»Und du hast heute gegen meinen Befehl die Königin gesehen«, dachte ich, würde nachfolgen, glühend in meiner Sündenschuld. Indessen verblieb es bei jener Auseinandersetzung, die mir eine ganz neue Welt eröffnete, mich aber fast so traurig machte, wie Robinsons junge Freunde wurden, als sie vernahmen, ihr insularischer Einsiedler sei längst im Himmel. Ich hatte mich immer darauf gefreut, einmal einem lebendigen Erzbischofe in dem Ornate, den ich an ihren Stein- und Metallbildern im Dome sah, zu begegnen und mich lange im stillen verwundert, warum sich statt dessen nur Domprediger zeigten. Jetzt wußte ich freilich, woran ich war; der Herzog von Magdeburg wollte mir aber wenig behagen. – In einer so fabelhaften Welt leben Kinder, wenn ihnen die Geschichte und die Wirklichkeit auch noch so handgreiflich aufgerückt wird.
Die erste große Weltbegebenheit, welche meinem Sinne einging, war der Krieg der Österreicher im Jahre 1805. Die Dinge, welche ich davon vernahm, sind charakteristisch, um die damalige jetzt unglaublich aussehende Stimmung in Norddeutschland zu bezeichnen. Ich hörte nämlich eines Tages unter mehreren Bekannten des Hauses von dem nahen Ausbruche jenes Krieges reden, und es war nicht anders, als wenn es ein Unglück wäre, sollten die Österreicher siegen. An welche Schlußfolgerung diese Sorge geknüpft wurde, ist mir entfallen. Sie erschien um so verwunderlicher, als daneben her der Abscheu gegen den französischen Vergewaltiger ging. Ein alter Doktor, der Hausarzt, hatte sich besonders unter jenen Redenden hervorgetan, jedoch die Zweifelmütigen mit der Aussicht auf die gewisse Niederlage der Österreicher beruhigend. Dieser war es auch, der meinem Vater in seine Gartenstube die erste Nachricht von dem greulichen Unglücke bei Ulm brachte. »Was habe ich gesagt, Vetter!« rief er schon von draußen zwischen den Blumenbeeten meinen Vater an; »die Halters haben tüchtige Schmiere gekriegt.« – Ich saß mit meiner Rechentafel beschäftigt in einen schwierigen Bruch vertieft und dachte, als ich nun Macks Kapitulation mit anzuhören bekam, im stillen: da habt ihr es für den Sturm von Magdeburg. – Wie erdichtet klingt es, es ist aber wahr, daß die demnächst erfolgte Auflösung des Reichs und die Niederlegung der Kaiserkrone bei uns nur Freude erregte. Es wurde darüber gewitzelt, gespöttelt und ein munteres lebhaftes Frauenzimmer, deren Zunge bei keiner Gelegenheit zu feiern pflegte, habe ich ausrufen hören: »Nun hat sich das Franzel selbst auf Pension gesetzt!« –