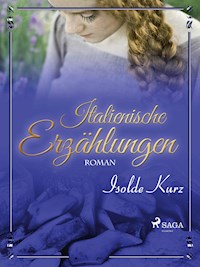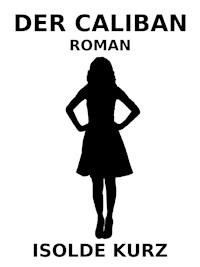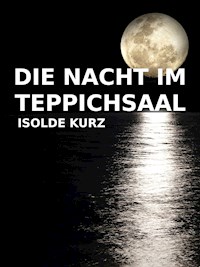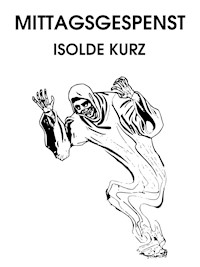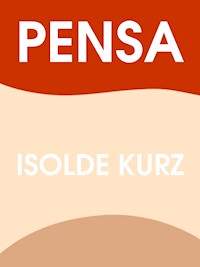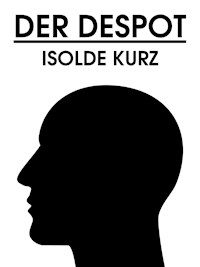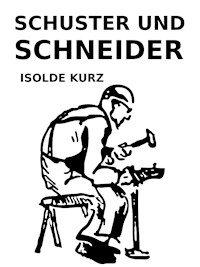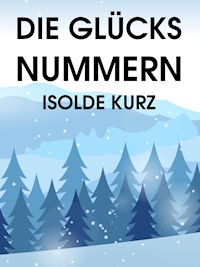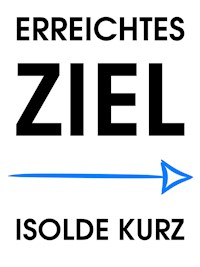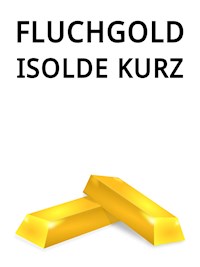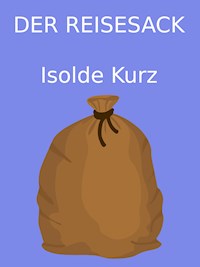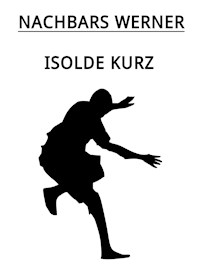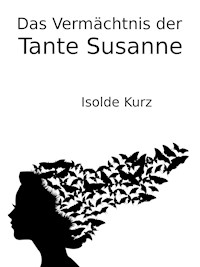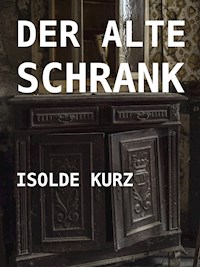Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Werthers Grab ist eine Erzählung von Isolde Kurz. Auszug: Die Eisenbahn durchschneidet das Dorf am oberen Ende, wo sich die große Klary'sche Ziegelfabrik mit ihren ausgedehnten Schuppen und dem rauchenden Ringofen befindet. Doch der Schnellzug kümmert sich nicht um die mit Backsteinen hochaufgethürmten Lowren, die auf dem Seitengeleise angeschoben sind, und läßt mir kaum die Zeit, einen Blick auf das nüchterne Stationsgebäude mit seinen Signalapparaten zu werfen. Dann lehne ich mich zurück, und im Weiterfahren erscheint vor meinen inneren Augen ein völlig anderes Bild. - Wo der Bahnhof steht, da sehe ich im Geist eine langgestreckte Parkmauer mit hochwipfligen Baumreihen, zwischen denen tief unten in der Nähe des Flusses die Rückseite eines großen Wohnhauses mit hohen Schornsteinen und steinerner Terrasse eben noch zu erkennen ist. Weiterhin tauchen hinter der Mauer grüne Lauben, weiße Götterfiguren und lange Taxusgänge auf, die nach einem kleinen, von Maulbeerbäumen beschatteten Häuschen im Schweizer Stil mit grünen Läden, hölzernen Altanen und ebensolcher Außentreppe führen. Ringsum ist Alles grün; an Stelle der rauchenden Schlote, der Ziegelschuppen und der nassen Lehmgruben sehe ich nur Obstgärten und Felder mit wehenden Halmen bis hinauf zu den waldgekrönten Höhen des Lerchenbergs und abwärts bis zur Lindach, in deren krystallklarem Wasser sich die Erlen und Weiden des Ufers spiegeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werthers Grab
Werthers Grab - Kapitel 1Werthers Grab - Kapitel 2AnmerkungenImpressumWerthers Grab - Kapitel 1
Mitten in dem anmuthigen Lindachthal, am linken Ufer der Lindach, liegt das freundliche Pfarrdorf Ilgenau mit seinem kleinen, weißgestrichenen Kirchlein und der uralten Linde daneben.
Die Eisenbahn durchschneidet das Dorf am oberen Ende, wo sich die große Klary'sche Ziegelfabrik mit ihren ausgedehnten Schuppen und dem rauchenden Ringofen befindet. Doch der Schnellzug kümmert sich nicht um die mit Backsteinen hochaufgethürmten Lowren, die auf dem Seitengeleise angeschoben sind, und läßt mir kaum die Zeit, einen Blick auf das nüchterne Stationsgebäude mit seinen Signalapparaten zu werfen. Dann lehne ich mich zurück, und im Weiterfahren erscheint vor meinen inneren Augen ein völlig anderes Bild. – Wo der Bahnhof steht, da sehe ich im Geist eine langgestreckte Parkmauer mit hochwipfligen Baumreihen, zwischen denen tief unten in der Nähe des Flusses die Rückseite eines großen Wohnhauses mit hohen Schornsteinen und steinerner Terrasse eben noch zu erkennen ist. Weiterhin tauchen hinter der Mauer grüne Lauben, weiße Götterfiguren und lange Taxusgänge auf, die nach einem kleinen, von Maulbeerbäumen beschatteten Häuschen im Schweizer Stil mit grünen Läden, hölzernen Altanen und ebensolcher Außentreppe führen. Ringsum ist Alles grün; an Stelle der rauchenden Schlote, der Ziegelschuppen und der nassen Lehmgruben sehe ich nur Obstgärten und Felder mit wehenden Halmen bis hinauf zu den waldgekrönten Höhen des Lerchenbergs und abwärts bis zur Lindach, in deren krystallklarem Wasser sich die Erlen und Weiden des Ufers spiegeln.
Es ist das Ilgenau, das noch keine Eisenbahn hatte, das Ilgenau meiner Kindheit.
In jener schönen Zeit, wo es noch gar keine Zeit gab, und wo man folglich mit den Tagen anfangen konnte, was man wollte, war ich häufig zu Besuch in Ilgenau. Meine frühesten und schönsten Erinnerungen knüpfen sich an diesen Namen. War's Zufall, oder täuscht mich die Erinnerung? – Ich meine dort nie ein schlechtes Wetter erlebt zu haben, wie es mir auch vorkommt, als hätten die Kirschen dort zeitiger geblüht und süßer geschmeckt als jemals wieder anderwärts.
Ein Freund der Eltern, den wir Kinder »Onkel« nannten, hatte damals das Haus mit den hohen Schornsteinen inne, und er kam oft in seinem zweispännigen Jagdwägelchen nach der Stadt gefahren, um sich eins oder das andere von uns als Gast nach Ilgenau zu holen.
Er war ein gewaltiger Nimrod, der Onkel Entreß, und zeigte sich in der Oeffentlichkeit nie anders als von Hunden umbellt, meist zu Pferd oder zu Wagen, seltener zu Fuß und dann fast immer in Jägertracht. Pferde, Hunde und Kinder liebte er mit Leidenschaft, wie überhaupt Alles, was Lärm ins Haus brachte. Nachdem er kurze Zeit beim Militär gewesen, wo er sich mit seinen Vorgesetzten nicht vertragen konnte, hatte er sich auf den väterlichen Besitz in Ilgenau zurückgezogen, den er mit mäßigem Erfolg selber bewirthschaftete. Er war Adliger, aber liberal, und um seinen Liberalismus zu bethätigen, sowie auch seinen aristokratischen Verwandten zum Tort hatte er ein bürgerliches Fräulein – noch dazu mit kleiner Mitgift – heimgeführt. Doch er, der sonst gegen Groß und Klein voll Freundlichkeit war, behandelte die anmuthige, hingebende Frau unwirsch und ungerecht. Ohne allen Anlaß gab er ihr barsche Worte und konnte sich sogar so weit vergessen, daß er sie vor Gästen und Dienstboten herabsetzte.
Tante Thekla hatte ein sanftes Gesicht mit blauen Augen und schwarzen, gescheitelten Haaren, und ihr stilles, überaus liebreiches Wesen hat sich mir unauslöschlich eingeprägt. Sie wußte, daß ihr Gatte eine Andere geliebt hatte, eine stolze Amazone, die zwei Sommer lang in den Wäldern von Ilgenau mit ihm geritten und gejagt hatte, und die er nie vergessen konnte, obgleich er von ihr verschmäht worden war. Thekla sprach von dieser Anderen, die sie nur vom Hörensagen kannte, in den Ausdrucken der höchsten Verehrung, und gern hätte sie sich ganz nach ihr gemodelt, um ihrem gestrengen Eheherrn zu gefallen; aber wie sie sich auch anstellte, sie machte es ihm niemals recht, denn sie war zu weich geartet für den heftigen Mann.
So konnte er ihr zum Beispiel nie verzeihen, daß es ihm in den Flitterwochen nicht gelungen war, sie reiten zu lehren. Sie hatte sich zwar gehorsam von ihm in den Sattel heben lassen, hatte auch bebend die Zügel in die Hand genommen, aber sobald das Pferd sich nur ein wenig in Trab setzte, war sie aus lauter Angst regelmäßig wieder herunter geglitten, was den Onkel Entreß aufs Tiefste verdroß. Auch zitterte sie immer am ganzen Körper, wenn er einen seiner großen Hunde züchtigte; denn es war einmal vorgekommen, daß der furchtbare Harraß, der Schrecken des ganzen Dorfes, sich bei einer solchen Gelegenheit auf den eigenen Herrn gestürzt und ihm eine tiefe Bißwunde beigebracht hatte. Seither wurde sie jedesmal bleich, wenn das Thier nicht auf der Stelle gehorchte, und Onkel Entreß griff nun aus Aerger in ihrer Gegenwart doppelt gern zur Peitsche, so daß das arme Frauchen aus den Aengsten gar nicht herauskam.
Onkel Entreß hauste mit seinen Hunden und Flinten im Parterre, wo Alles wild durcheinander lag. Thekla dagegen besaß eine ganze Reihe eigener, schön eingerichteter Zimmer im oberen Stock, die aber alle zu trauern schienen wie die Seele ihrer Bewohnerin. Darunter war eines, das ganz voll stand von Kästen und Schränken, und alle diese Kästen und Schränke waren mit Kleidern angefüllt, deren sie unzählige besaß.
Einmal, als sie mir ein besonderes Vergnügen machen wollte, führte sie mich in dieses Zimmer und zeigte mir sämmtliche dort aufgespeicherte Kleider. Sie waren sehr prächtig – oder schienen mir wenigstens so –, mit vielen Bandschleifen und blitzenden Knöpfen verziert, und ein jedes hatte seine eigene Geschichte. Das hellblaue mit den schwarzen Sammetbändern hatte die Blicke ihres Mannes angezogen, als er sie zum ersten Mal sah; das leichte aus rosa Seidenstoff erinnerte sie an jenen Ballabend, wo sie sich kennen lernten; das weiße hatte sie zur Trauung getragen, das graue auf der Hochzeitsreise und so weiter. – Die Kleider waren für sie lebende Wesen, ihre Vertrauten. Sie saß oft vor dem offenen Schrank und führte stumme Gespräche mit ihnen. Auch gab sie keines jemals her, so gern sie sonst schenkte, und ihr Mann verschrie sie deshalb als einen Geizdrachen, was ihr, obgleich sie dazu lächelte, heimlich sehr wehe that, denn er verkannte damit ihr innerstes, ganz auf Liebe zu ihm gestelltes Wesen. Wer sie um ein altes Kleid anging, dem schenkte sie das Zeug zu einem neuen, und die abgetragenen hängte sie in einen besonderen Schrank, wo sie das Asylrecht auf ihre alten Tage genossen. Die geflammte Busenschleife, die sie von einem dieser Kleider mit schwerem Herzen absteckte, um sie mir zu schenken – dieselbe war, beiläufig gesagt, so groß, daß sie meine halbe damalige Person bedeckt hätte –, mußte ich ihr am anderen Morgen zurückgeben, versteht sich, gegen angemessene Entschädigung: es scheint, daß diese Schleife etwas wußte, das all' den andern Kleidungsstücken entfallen war.
Nachdem sie jenes Tags den Inhalt sämmtlicher Schränke vor mir ausgebreitet hatte, zog sie mich zu sich heran, legte beide Arme um meinen Hals und weinte. Und ich verstand aus Instinct, daß sie weinte, weil sie nicht geliebt und einsam war, und weil sie an leeren Hüllen und an den Kindern fremder Leute ihr hungerndes Herz sättigen mußte.
Während sie noch weinte, kam sporenklirrend der Onkel herein. Sie erschrak und trocknete rasch die Thränen. Aber die Schränke zu schließen, war es zu spät.
»Immer Fetzen und Fahnen!« sagte der ungeduldige Mann stampfend und ging schnell wieder hinaus.
So war das Entreß'sche Ehepaar, bei dem alle Kinder aus befreundeten Häusern ihre zweite Heimath hatten. Wir konnten dort thun und treiben, was wir wollten, und hatten das Recht, in Haus und Hof das Unterste zu oberst zu kehren. Tante Thekla war nicht älter als unsereins: sie kroch mit uns unter die Tische und versteckte sich, wenn es sein mußte, im Hühnerstall. Der Onkel dagegen, der ihr den Vorrang in unserer Liebe nicht lassen wollte, gab uns Anleitung in der Landwirthschaft, das heißt, er ließ uns auf dem hochbeladenen Heuwagen fahren, setzte uns auf die pflügenden Ochsen oder ließ uns durch die Garbenluke wohl zwanzig Schuh tief in die mit Heu und Korn gefüllte Scheune hinabspringen, wo man in den Garben versank und sich unter Jubel und Gelächter, die Haare und Kleider voll Heu, wieder herauswand.
Nebenan in dem Schweizerhäuschen wohnten die drei alten Fräulein von Plessen, nach denen das Haus seiner Kleinheit halber im Scherz die Plessenburg genannt wurde. Zu meiner Zeit waren es nur noch zwei; die Dritte, Franziska, lebte in der Erinnerung der Anderen noch mit als die »Schwester Franz«, und ich hörte sie so oft nennen, daß ich mir einbilden könnte, sie auch gekannt zu haben, wenn die Daten dem nicht widersprächen.
Fräulein Luise von Plessen, die Aelteste von den Dreien, war Thekla's nächste Freundin, eine damals schon hochbetagte Dame, deren Geburt noch ins achtzehnte Jahrhundert fiel. Sie ging immer weiß gekleidet, in einem weiten, garnirten Oberkleid, das sich vorn über einem reich mit Volants verzierten Unterkleid öffnete; auf dem Kopfe trug sie einen großen Florentiner Strohhut mit weißem Band und schwarzseidene, filetgestrickte Halbhandschuhe an den schöngepflegten Händen. Obgleich das Alter der Schäferspiele weit hinter ihr lag, war sie doch mit ihrem Schäferhut nicht lächerlich: eine sanfte Würde, eine Jugend der Seele stimmte zu diesem Anzug. Ihre Haare waren noch völlig schwarz, und sie hatte weder Runzeln noch Furchen, nur daß die Haut ein wenig lose geworden war, aber ihre zarte Färbung war ihr geblieben, wie ein welkes Rosenblatt noch immer ein Rosenblatt ist.