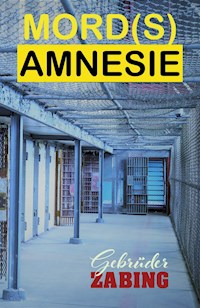Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sandré audio & books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dunkle Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein unerkannter Serienmörder treibt in Trier und Umgebung sein Unwesen. Wird er entdeckt? Eine junge Frau wird von ihrem Zuhälter getötet. Wird er gefasst? Ein Finanzbeamter überwacht seine Kollegen sogar am stillen Örtchen*. Warum? Ein Bauingenieur hat ein geheimes Doppelleben**. Was sagt seine Freundin dazu? Herrgott höchstselbst springt von seinem Thron auf. Was treibt ihn um? Ein schwuler Polizist ermittelt. Wird er von seinem Ex-Freund abgelenkt? Ein Medizinstudent verliert seine Schwester. Kann er sie doch noch retten? Zu allem Überfluss lernen Sie Deutschlands beliebtesten Rechtsmediziner kennen: Dr. Freisinger. Warnung: Bitte lesen Sie dieses Buch nicht, wenn Sie humorbefreit sind. Auch nicht, wenn Sie immer politisch korrektes Verhalten verlangen. Wenn Sie nicht volljährig sind, gleich weiterschenken. - Oder die paar Jahre warten. Wenn Sie nicht lesen können, nutzen Sie einfach die Hörbuchversion, oder fragen Sie einen Bekannten, ob er Ihnen weiterhilft. Noch eine Warnung: Alle dargestellten Techniken, Phantasien, Äußerungen sind nicht zum Nachahmen empfohlen. Die Autoren übernehmen keine Haftung für eventuelle Folgeschäden, die beim Lesen des vorliegenden Buches entstehen werden (Psychische Traumata eingeschlossen). Und noch eine Warnung: Das Buch und sein Inhalt sind nicht zum Verzehr geeignet. Bitte außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Es ist auch nicht als Pausenbrot für die Kleinen geeignet, denn in den Händen mancher Lehrer könnte dieses Buch zu Verstörungen führen. *Im Buch selbst heißt "das stille Örtchen" folgerichtiger Scheißhaus! Oder wie leise ist eigentlich ein Klo? **Zu den Doppelsternen ist uns nix eingefallen. Wir malen Ihnen aber eine Linie hin, auf der Sie nach dem Lesen des Buches eine Notiz machen können: ________________________________________________________________ (Nicht fürs E-Book geeignet. Die Schmiere geht nie wieder runter.)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch 1.1
Gebrüder
Samuel & Arjen Zabing
1. Druckauflage November 2021
©by Gebrüder Samuel & Arjen Zabing
Erschienen bei:
Sandré audio & books
S. Zabel & A. Wersching GBR
Nackterstraße2a
67310 Hettenleidelheim
www.sandre-verlag.de
Coverbild: pixabay
Satz: Samuel & Arjen Zabing
Realisierung E-Books: Sascha Zabel
Covergestaltung: Samuel & Arjen Zabing
ISBN: 978-3-96686-009-3
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages oder der Autoren erlaubt. Alle im Buch beschriebenen Handlungen sind frei erfunden, unterliegen der Kunstfreiheit und stellen keinen Bezug zu lebenden Personen dar. Die Schriftform entspricht der einfachen Lesbarkeit, weswegen auf genderneutrale Schreibvarianten verzichtet wurde.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1.1.1.1
Kapitel 1.1.2.1
Kapitel 1.1.3.1
Kapitel 1.1.1.2
Kapitel 1.1.2.2
Kapitel 1.1.3.2
Kapitel 1.1.1.3
Kapitel 1.1.2.3
Kapitel 1.1.3.3
Kapitel 1.1.1.4
Kapitel 1.1.2.4
Kapitel 1.1.3.4
Kapitel 1.1.1.5
Kapitel 1.1.2.5
Kapitel 1.1.3.5
Kapitel 1.1.1.6
Kapitel 1.1.2.6
Kapitel 1.1.3.6
Kapitel 1.1.1.7
Kapitel 1.1.2.7
Kapitel 1.1.3.7
EPILOG
Leseprobe
Prolog
Zu erklären, was inmitten der Nacht an jenem Küchentresen geschah, mag den einen oder anderen vielleicht ein wenig schocken. Aber Umstände, die einem das Haar im Nacken vor Abscheu gefrieren lassen, müssen erwähnt, vor allem beim Wort genannt sein, frei von Verharmlosung oder Scham.
Er beugte sich über den Topf, als wollte er die Temperatur des Sudes mit seiner Nase testen. Genussvoll sog er den angenehmen Duft der Gewürze des frisch zubereiteten Fonds ein. Es fing wie immer in der Nase an …den Duft wahrnehmen. Dann sammelte sich das Hochgefühl in seiner Stirn und zog langsam, aber bestimmend hinunter bis hin zu seinen Lenden. Wie immer bekam er fast schon eine Erektion. Kurz hob er den Kopf, um die kalte Luft seiner Küche einzusaugen und den Klängen seiner HiFi-Anlage zu lauschen: Bach, der seiner Meinung nach fulminanteste zeitgenössische Künstler. Wieder den Kopf senkend, verschwammen das Jetzt und Hier zu einem wahren Freudenfeuer seiner Lenden und Ohren. Er begann, ekstatisch und vor allem unmelodisch, seinen Oberkörper hin und her zu wiegen. Dieses psychopatische Gebaren passte zu Bachs Concerto No. 1 in D-Moll. Er wurde von entrückter Wonne ergriffen.
Den Kochlöffel haltend, als sei er seine Geliebte, berührte er mit diesem sanft seine erigierte, nackte Lust. Der stechende Schmerz des vom Kochen heißen Löffels sorgte an seiner Eichel für jenes Hochgefühl, welches ihn immer zur Ejakulation brachte. Heute jedoch konnte er sich diesem Hochgefühl nicht wie gewohnt hingeben. Er schaffte es einfach nicht, sich fallen zu lassen, etwas ganz Entscheidendes fehlte.
Er sah sich fast verloren in seiner Küche um und ging im Kopf pedantisch alles durch. Auf dem Küchentresen lag der Oberschenkel des Radfahrers. Abgetrennt und ausgebeint – vorbereitet, in dem duftenden Fond gekocht zu werden. Die Musik stimmte … Bach, mittlerweile Partita in E-Major … sehr passend. Er hatte sich mit dem Kochlöffel berührt, fühlte die Vorfreude, hatte getanzt. Es fehlte etwas. Frust und Wut stiegen in ihm auf. Das löste diese bodenlose, tiefschürfende Enttäuschung aus, die ihn immer wieder beherrschte und zu Taten hintrieb, die sich seiner Kontrolle entzogen.
Jetzt fiel es ihm ein, erlöste ihn jäh. Er hatte vergessen, sein Lieblingsmesser, jenes in der oberen Schublade mit dem Lederhalfter und der fünfunddreißig Zentimeter langen Klinge, zu schärfen. Er durchmaß mit mächtigen Schritten die Küche, schnappte sich das Rotweinglas vom Tresen, trank einen langen ausgiebigen Schluck und zog die Lade auf. Da lag es. Lächelte ihn förmlich an, als wolle es sagen: „Schleif mich, berühr mich!“ Diesem inneren Zwang folgend griff er bedächtig das Messer und zog es aus dem Halfter. Diesen strich er lüstern und behutsam über seinen Bauch, bis hinab zu seinem harten Schwanz. Er rieb das mittlerweile vom Alter und dem ständigen Gebrauch ausgehärtete Leder an seinem Pimmel einige Male hin und her. Dann, als er sich den Halfter über den erigierten, nun vollends ausgehärteten Penis stülpte, stöhnte er auf. Wie ferngesteuert machte er sich nun an die sorgsame Schleifarbeit. Mittels eines Schleifklotzes, den er eigens in Japan fertigen ließ, gab er dem Messer den nötigen Schliff.
In Trance zu Bachs Musik und mit verklärtem Blick begann er sorgsam, das Bein des Radfahrers mit seinem Lieblingsmesser zu filetieren. Bei voller Größe wäre das Fleisch zu schwer und auch zu mächtig, um in dem Kochtopf Platz zu finden. Als er die geschnittenen Beinscheiben bedächtig in den Fond gleiten ließ, kamen Erinnerungen hoch. Erinnerungen daran, wie er sein heutiges Opfer entdeckte. Daran, wie er ihn auserkoren hatte. Es war am vergangenen Freitag gewesen. Also vor vier Tagen. Er hasste Menschen, die sich nicht an die Spielregeln des Zusammenlebens hielten. Er musste sie einfach vernichten. Und er wusste sie zu finden. Alle!
Kapitel 1.1.1.1
Hinter mir befindet sich meine Lieblingsfraktion. Eine große, massive Regalwand mit vielen Büchern. Nur leider sind diese Bücher nicht meine, sie gehören dem Café-Betreiber. Das hält mich aber nicht davon ab, mir die Buchrücken anzuschauen. Ist immer so bei mir. Bücher lösen den Drang aus, sie zu bewundern, am liebsten in alter Form. Gedruckt eben.
Die unschöne Entfremdung des Buches durch eine App oder E-Book ist mir ein Gräuel. Ich brauche einfach die Papierseiten. Vor allem verlangt es mich nach dem Geruch von Druckerschwärze auf Papier. Ein gebundenes Buch hat eben mehr Stil und mehr Charakter als jede erdenkliche Aushilfsvariante.
Wie ich meinen Hals nach hinten verdrehe, um zu schauen, welche Bücher in den robusten Regalen aufgereiht sind, muss für viele Betrachter seltsam aussehen. Egal, denke ich. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Mir ist es ja auch einerlei, daran teilzuhaben, wie ein älterer Mann mit Einsteinfrisur am Nebentisch ganz offensichtlich Autos zählt. Klar drängt sich die Frage auf, warum jemand in einem Kaffeehaus sitzt, um derlei sinnfreie Dinge zu tun. Aber ich lasse ihm seinen Spaß. Als er bei Nummer 175 angekommen ist – immerhin zählt er so laut, dass es wirklich jeder mitbekommt –, steht er auf und verschwindet Richtung WC.
Kurz darauf erschallt laut tönend die Spülung. Millisekunden später schwingt die Tür auf und er läuft – nein, hechtet – auf mich zu. Diese kurze Zeitspanne, stelle ich angeekelt fest, konnte nicht ausreichen, um die Hände zu waschen. Manche Menschen sind echt abscheulich.
Als er an meinem Tisch ankommt, fragt er mich, als sei es ganz normal:
„Wie viele Autos waren es denn?“
Da ich mir nicht sicher bin, was er hören will, und ich mich nicht verantwortlich für vorüberfahrende Autos fühle, antworte ich knapp:
„Vier“, natürlich, ohne mir die geringsten Gedanken darüber zu machen, ob meine aus der Luft gegriffene Zahl nun der Wahrheit entspricht oder eben nicht.
„Dann war ich aber nicht lange weg.“ Er läuft, ohne weitere Worte zu verlieren, an seinen Tisch.
Dein Toilettengang war nicht mal lange genug, um wenigstens die Grundregeln der Hygiene einzuhalten, denke ich mir. Eventuell wird jetzt klar, warum ich niemals die Türklinke einer öffentlichen Toilette anfassen würde. Wer greift schon gerne in die Pisse anderer?
Ich muss mich fast zwingen, die Bücher hinter meinem Rücken außer Acht zu lassen und beschließe, endlich meine Arbeit fortzusetzen. Ich bin Bauingenieur und arbeite seit Jahren gleichzeitig an mehreren Projekten.
Als ich die Baupläne und Lagepläne mit der jetzigen Situation vergleiche, stelle ich fest: Unser Zeitplan wurde übertroffen. Die Leute arbeiteten überaus zügig und haben hervorragende Arbeit geleistet. Meine Anwesenheit hier in Kirchheimbolanden ist also nicht weiter nötig. Mein Chef wird den Mitarbeitern und mir für die schnelle Umsetzung dieser Schienenbrücke wohl eine angenehme Bonuszahlung geben können.
Abgesehen von der Brücke hier in Kirchheimbolanden sind weitere Projekte in Stuttgart, Hamburg, Bremen, Ludwigshafen und Osnabrück zu betreuen. An den verschiedenen Einsatzorten ist mindestens einmal wöchentlich meine Anwesenheit erforderlich. Daraus folgt die ernüchternde Zwangsläufigkeit, dass ich sehr wenig zu Hause bin. Mein Zuhause als Wohnort zu bezeichnen, ist genau aus diesem Grund eigentlich der falsche Terminus. Treffender wäre Übergangs-Schlafstätte.
Diese befindet sich in Trier, also nur 45 Autominuten von hier entfernt. Heute ist es wieder so weit, ich werde wieder in Trier übernachten können. Morgen bin ich zunächst in Ludwigshafen eingeplant. Von der Fahrstrecke her kann ich mir also einen Besuch zu Hause erlauben.
Ich winke der Bedienung zu, die mich nicht ignoriert; sie kommt sofort an meinen Tisch. Mit einem echten Lächeln bedankt sie sich bei mir für mein sehr großzügiges Trinkgeld und wünscht mir einen angenehmen Abend.
Am Auto angekommen, stelle ich mir erst mal eine Playliste meiner Lieblingssongs zusammen, die meine Fahrt kurzweiliger gestalten soll. Als der Motor des Firmenwagens zum Leben erwacht, erschrecke ich.
Mitnichten vor dem Motor oder dem Wagen; es ist die extreme Lautstärke des ersten Bassriffs aus den Boxen, der sich wie ein Axtschlag auf meinem Trommelfell anfühlt. Okay, wach wäre ich nun und mein Adrenalin wegen des Schreckmoments ordentlich in Wallung. Bedeutet, die angenehme Fahrt ist anfänglich vor allem ein Aufpeitschen der Hormone. Egal.
Während der ersten Kilometer beruhigt sich mein Adrenalinspiegel und ich fange an die Musik zu genießen. Allerdings währt dieser Genuss viel zu kurz. Er endet mit Blaulicht hinter mir.
War das eben schon da? Nein, mit Sicherheit nicht! Der Polizeiwagen überholt mich. Zu allem Überfluss leuchtet durch das Heckfenster eine nette Einladung auf. POLIZEI, bitte folgen. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als der Aufforderung Folge zu leisten.
Nachdem ich meinen Wagen hinter dem Polizeiauto zum Stehen gebracht habe, steigt auch schon der erste Beamte aus. Also verlasse ich ebenso mein Auto und schließe bei geöffnetem Fenster die Fahrertür. Er mustert mich sehr herabwürdigend, als sei ich ein entflohener Häftling und er habe mich nun endlich erwischt. Jeder kennt diesen Typ: Er wurde nicht Polizist, um die Bevölkerung vor Verbrechern zu schützen. Er ist jener abwegige Gesetzeshüter, der seine überlegene Machtposition mittels Marke definiert und stützt. Ich mache mich schon auf ein verbales Machtgeplänkel gefasst, während er stolzierend an meinem Auto ankommt. Er baut sich vor mir auf, als sei er der Sprössling irgendeines Comic-Helden. Fordernd hebt er seine dunklen, viel zu buschig geratenen Augenbrauen. Es wirkt fast so, als wolle dieses Buschwerk mit seinem schwarzen Haar einen Platzkrieg austragen. Das Haar selbst fällt schmierig, ungewaschen und strähnig in ein pickelübersätes Gesicht, welches mittig eine knollige Alkoholiker-Nase zum dominanten Attribut hat. Einer von der ungepflegten Sorte, stelle ich fest. Er verkrampft den Mund, als müsse er sich beherrschen. Dann schreit er:
„Führerschein und Fahrzeugschein!“
Er wartete einige schleppende Sekunden, die für ihn wahrscheinlich länger wirken, als sie es für mich sind. Weil von mir keine Reaktion kommt, mutet es an, als stünde er kurz vor einer Explosion. Unvermittelt brüllt er, nur lauter und wesentlich irremachender als zuvor:
„Sind Sie taub, Mann? Führerschein und Fahrzeugschein!“
Da ich meine Sache auch beherrsche und mich nicht von einem dahergelaufenen Polizisten einschüchtern lasse, warte ich gedulderprobt eine Weile ab. Nicht ein einziger Muskel regt sich in meinem Gesicht. Abwartend betrachte ich ihn. Nicht fordernd oder provokant, sondern mit neutralem Gesichtsausdruck. Genau das ist es, was diese Typen immer mehr in Rage bringt. Ich untergrabe seine Machtposition, welche er aufgrund seines Berufsstandes überzeugt ist innezuhaben.
Extrem gelassen sehe ich dabei zu, wie er immer angestrengter versucht, seine Wut zu bannen. Ich frage mich, wann er endgültig Opfer seiner Emotionen wird und ob mit ihm sprichwörtlich der Gaul durchgeht. Nebenbei bemerkt, jedem Gaul würde ich mehr Verstand zugestehen als diesem Doppelhorst-Polizisten.
„Sofort!“, brüllt er. Spucke schießt aus seinem Mund in meine Richtung. Zum Glück trifft er mich damit nicht.
Ich hingegen bewundere meine Beherrschung. Ich reagiere nicht im Geringsten, sondern beobachte diesen ungepflegten, viel zu ungehobelten Intelligenz-Geisterfahrer. Als komplett untauglich für eine Arbeit in der Öffentlichkeit weist er sich auch aus, weil sein Mundgeruch extrem derb ist. Ich bemühe mich krampfhaft den Würgedrang zu unterdrücken, habe aber das Bild vor mir, was den Polizisten alles treffen würde, wenn ich meine Körperfunktionen nicht unter Kontrolle hätte.
Ich bin froh darüber, in solchen Momenten meine Gedanken geheim und für die Welt außerhalb unerreichbar zu halten. Andernfalls würde dieser Polizist wahrscheinlich seine Beherrschung verlieren und mich niederstrecken wollen. Ich gewinne fast schon den Eindruck, er möchte Maß nehmen und zuschlagen. Er wird jäh von seinem Kollegen unterbrochen, der endlich auch die Sicherheit seines Polizeiautos verlassen hat, um endlich die Situation zu entschärfen.
„Guten Tag, mein Name ist Kurz, Polizeidirektion Mainz“, beginnt er in freundlichem Tonfall, seine Dienstabsicht kundzutun. „Würden Sie uns bitte Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere zeigen?“ Dieser Zweite mimt also den Guten im Spiel „guter Bulle, böser Bulle“. Ich schaue nun freundlich zu Nummer zwei und lächle ihn sogar an, als ich in sehr freundlichem Ton frage:
„Welchen Grund haben Sie denn, mich anzuhalten und nach meinen Papieren zu verlangen?“
Das ist der Moment, in dem jedem Polizisten völlig klar werden muss, dass er mit mir kein einfaches Spiel haben wird.
„Wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle und möchten nun, wie mein Kollege Ihnen schon mitteilte, Ihre Fahrzeugpapiere und Ihren Führerschein überprüfen.“ Nummer zwei besaß einen sehr formellen, mittlerweile aber etwas bestimmenderen Tonfall.
Vermutlich dachte er, er würde so besser an sein Ziel herankommen. Zumindest strengte er sich mehr an. Er verhielt sich angenehmer als sein total verblödeter Kollege, der offensichtlich mitverantwortlich für das beschissene Ansehen eines gesamten Berufsstandes ist.
„Würden Sie beide, sich mir gegenüber bitte auch ausweisen und mir Ihre jeweiligen Dienstnummern geben?“ Gleiches Recht für alle, dachte ich mir. Abgesehen davon ist es mein zugesprochenes Bürgerrecht, mir die Dienstausweise zeigen zu lassen und zu überprüfen.
Ich werde bei nächster Gelegenheit Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Nummer eins einreichen – diese Absicht behalte ich jedoch für mich. Was ich allerdings sagen musste, weil es mir auf der Zunge brannte, folgte auf dem Fuße. „Fernerhin möchte ich nicht versäumen, Sie auf Folgendes hinzuweisen. Zu meiner Sicherheit habe ich ein Kamerasystem, welches das Geschehen rund um mein Auto aufnimmt. Also auch unsere Unterhaltung.“ Eine rednerische Kunstpause ließ das Gesagte bei den Beiden sacken. Ich konnte sehen, wie bei Nummer eins die Gesichtsfarbe entwich und ihm gleichzeitig der Kiefer ein wenig runter klappte. Er begriff scheinbar den Zusammenhang seiner schroffen Art und meiner Kamera. „Sie wissen“, erklärte ich, „dieses Bild- und Tonmaterial ist nun gerichtsverwertbar!“
Ich überließ es den Polizisten, den nächsten Schritt zu tun. Es dauerte relativ lange. Dieses Mal war es an Nummer eins, sich zu äußern. Allerdings wirkte er wegen der Aufnahme und der resultierenden Gefahr durch die Kamera wie ausgetauscht.
„Wir widersprechen hiermit der Aufnahme unserer Personen durch Sie und bitten Sie, Ihren Weg fortzusetzen.“
„Sehen Sie“, piesackte ich ihn, „es geht doch auch freundlich.“ Dann nickte ich den Beiden höflich zu und verabschiedete mich mit den Worten: „Einen schönen Tag!“ Meine Aufnahme würde ich allerdings nicht löschen. Wer weiß, ob ich die brauche.
Okay, ich arbeite und lebe in diesem Land. Aber deswegen muss ich nicht jede Schikane über mich ergehen lassen, weil ein Nichtskönner-Polizist meint, seine Mitbürger drangsalieren zu können. Ich reagiere auf staatliche Übergriffe stets gleich: Wie Du mir, so ich Dir!
Ist ein Beamter freundlich, bin ich das auch; ist ein Beamter oder Staatsdiener unfreundlich, handle ich genauso. In meiner Vorstellung geht das sehr weit. Angenommen, mich beklaut ein Beamter, finde ich Wege, es ihm gleich zu tun. Getreu dem Motto „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.
Womöglich denken Sie dabei an Strafzettel, Blitzer oder ähnliche Bagatellen. Die meine ich aber keineswegs. Mir ist klar, der Straßenverkehr braucht gewisse Regulierungen, um ein wertvolles, aber vor allem gefahrloses Miteinander zu gewährleisten. Wenn ich gegen sinnvolle Regulierungen verstoße, habe ich eben die Konsequenzen zu tragen. Allerdings nur insoweit, als diese Regulierungen nicht in mein Lebensbedürfnis oder meine Freiheit eingreifen.
Als Beispiel sei die Gurtpflicht erwähnt. Es kann und muss jedem egal sein, ob ich mich selbst der Gefahr aussetze, ohne Gurt am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Nötigung, angeschnallt zu sein, lasse ich nicht zu. Ich verbiete ja auch keinem, sich mit einem Fallschirm in dreitausend Meter Höhe aus einem Flugzeug zu stürzen.
Ich erwarte von meinen Mitmenschen, dass es ihnen am Arsch vorbei geht, ob ich angeschnallt bin oder nicht. Aber weit gefehlt! Sogar die oberdummen Staatsdiener, die eigentlich für das Volk da sein sollten, wollen mich zwingen, einer sinnfreien Gurtpflicht nachzukommen. – Scheißbande!
Eigentlich bräuchte ich wegen der Aufregung mit den beiden Polizisten eine Entspannung. Kurz überlege ich, zu meinem Zweitwohnsitz zu fahren. Ich muss aber an Kim, meine Freundin denken. Sie hat bestimmt schon Essen für heute Abend gerichtet und wartet auf mich. Wir haben uns vierzehn Tage nicht gesehen.
Schweren Herzens entscheide ich mich daher gegen die Fahrt zu meinem Lieblingsort, den ich aus verschiedenen Gründen geheim halte. Zum einen habe ich des Öfteren das Bedürfnis, ungestört zu sein, zum anderen ist mein Verlangen für einige eventuell verstörend. Deshalb muss ich meine Welten voneinander trennen. Es geht nicht nur darum, meiner Freundin Kim diesen Zweitwohnsitz vorzuenthalten. Hauptsächlich geht es um die neugierige Bande der Staatsdiener, die es zu täuschen gilt. In der mir eigenen Akribie habe ich Wege gefunden, die es unmöglich machen, mich als Person mit diesem Zufluchtsort in Verbindung zu bringen. Anstelle meines wirklichen Namens, Bernhart Hord, benutzte ich für den Kauf meines Hauses, ebenso für alle nötigen Anmeldungen, einen gefälschten Pass. Obgleich … das Wort „gefälscht“ ist eigentlich nur teilweise richtig. Besser beschreibe ich den tatsächlichen Hergang.
Vor vier Jahren, kurz bevor ich mit Kim zusammenkam, machte ich in Tschechien Urlaub. Dort habe ich mir von einem Tschechen den Pass ... na, sagen wir mal, „geborgt“. Mit diesem Papier weise ich mich immer dann aus, wenn ich in meinem Zweitwohnsitz bin oder dafür einkaufen muss. Der Typ, dem dieses Ausweisdokument gehörte, sieht mir so ähnlich wie ein Zwilling dem anderen. Auch eine Kreditkarte nebst dazugehörigem Bankkonto habe ich mit diesem Pass anfertigen lassen.
Ich achte jedoch darauf, keine Schulden zu machen. Es könnte passieren, dass durch eine derartige Unbedachtheit meine Alibi-Identität auffliegt. Angenehm ist vor allem, dass ich ursprünglich wirklich aus der Tschechei komme. Bedeutet, ich habe keinerlei sprachliche Barriere vor mir, wenn ich unter dem Synonym Vlad Ionescu herumspaziere. Wie ein langgeübter Automatismus stellt sich immer ein gestochen scharfer tschechischer Akzent ein. Niemand würde je vermuten, dass ich ein Deutscher sein könnte, der sich einer gestohlenen Identität bedient.
An dieser Stelle auch ein großes DANKE an unsere Politiker in Brüssel, die mir indirekt behilflich sind, diese in Deutschland nutzen zu können. Ohne die EU und die Mitgliedschaft Tschechiens in dieser großartigen Neuland-Diktatur-Erfindung könnte ich mit dieser fremden Identität hier nicht frei herumlaufen und vor allem meine Neigungen nicht gefahrlos ausleben.
Vor dem Mauerfall war käufliche Liebe fast überall in der heutigen EU verboten. Dank vieler Politiker, die ihr Volk immer mehr ausbeuten wollen, mussten genügend ablenkende Potenziale frei verfügbar sein. Fast wie im alten Rom beschäftigen uns die Vollzeitgauner – Entschuldigung, ich meinte die Vollzeitpolitiker – durch Spiele, nur dass diese heute nicht mehr von Gladiatoren ausgetragen werden, sondern von Nutten und Medien. Seit Cäsars Zeiten hat sich die Welt echt verbessert! Wir sind heutzutage so ... human!
Je weiter mein Auto Richtung Trier rollt, umso mehr freue ich mich darauf, meine Freundin zu sehen. Klar werde ich erst wieder stundenlang ihr dämliches Gesülze von einer stressigen Uni-Woche ertragen müssen – das geht aber vorbei. Wie immer. Meist essen wir zusammen und lassen den Abend mit einem Spaziergang in der Abenddämmerung an der Mosel ausklingen.
Kim mag diese normalo-romantische Beziehungsvariante eben einfach ... bis auf eine Kleinigkeit: Wir haben in unserer Beziehung nämlich fast keinen Sex. Den mag Madame nämlich nicht!
Sex gibt es bei uns nur im Dreimonatstakt. Das meine ich wirklich so. Wir sind echte Quartalsbumser. Aber bitte nicht mehr! Weil ich Besseres will, liebe ich mein Doppelleben. Das hat durchaus seine positiven Seiten. In der Namenlosigkeit kann ich mich voll und ganz meinen Bedürfnissen der anderen Art hingeben, ohne dabei auf die Gefühle derer zu achten, die meine speziellen Vorlieben nicht teilen.
Mittlerweile sitzen wir, wie von mir vermutet, satt und nach einem gemeinsamen Spaziergang geerdet auf der Terrasse herum. Ich freue mich über das kühle Craft-Bier in meiner Hand und beobachte, wie die Kälteperlen von meinem beschlagenen Glas herunterrinnen. Neben mir hat sich Kim auf ihrer Liege ausgebreitet und liest irgendein Buch auf dem Tablet.
Ich sehne mich in die Zeit zurück, als neue Bücher nach Druckerschwärze rochen und nicht die Gesichtsfarbe meiner Angebeteten veränderten. Kims Gesicht, das sonst so ebenmäßig, voll jugendlicher Schönheit strahlt, wirkt fast entstellt. Okay, es strahlt auch, aber nicht vor Schönheit, sondern eher bläulich, krank durch die Beleuchtung des Tablets. Meine Augen wandern ihren schlanken Körper entlang, bleiben an den harten Nippeln hängen, die sich durch das helle Top abzeichnen. Wandern weiter zu der Stelle, wo sich ihr Schamhügel und die Schamlippen sichtbar, fast greifbar, sanft von innen gegen die engen Shorts pressen. Kim ist in ihr E-Book vertieft und bemerkt nicht, wie ich ihren hervorragenden Körper bestaune. Vor meinem inneren Auge sehe ich, wie Kims Kitzler sanft gegen die Naht der Shorts drückt. Natürlich ist mir klar, dass Kim diesen sanften Druck auf ihren Kitzler nicht wahrnimmt, denn der Hypothalamus blendet so etwas aus. Allerdings ist das meinem inneren Druck egal. Ich habe das Bild des nackten Kitzlers förmlich vor mir und muss mich wirklich stark zusammenreißen, um nicht über sie herzufallen. Und mein Pimmel gibt mir da sehr eindeutige Instruktionen. Er fordert mich drängend heraus. „Nimm sie dir, Tiger!“, scheint er zu sagen. „Du weißt doch, wie toll ihre feuchte Muschi sich um mich schmiegen kann.“ Und er poltert weiter! „Lass mich hier nicht hängen! Du kennst meine Bestimmung!“ ... und so weiter.
Ich versuche die Ausformulierungen meines Schwanzes zu ignorieren. Deswegen fixiere ich meinen Blick auf die gepflegte Grünanlage vor unserer Terrasse. Mein Nachbar, dieser Volldepp, ist wieder dabei, seinen Sonntagsbraten vom letzten Wochenende zu entsorgen. Jedes Mal, wenn ich sehe, was er da macht, könnte ich dieser Evolutions-Bremse eine reinhauen. Warum? Ich denke, einer Erklärung bedarf das nicht. Wie kann man nur seine Speiseabfälle in der Biomülltonne entsorgen?! Es gibt entsprechende Verordnungen, die genau solche Dinge regulieren: In eine Biomülltonne dürfen keine gekochten Küchenabfälle entsorgt werden! Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, den entsprechenden Wortlaut per Internetrecherche herauszusuchen. Dort steht es schwarz auf weiß: Gekochte Essensabfälle gehören nicht in die Biomülltonne. Aber meinem Nachbarn, dem Hirnkastraten, ist das ja scheißegal. Oder, was auch sein könnte, er rafft es einfach nicht. Ich werde ihm einen Denkzettel verpassen müssen.
Welche Möglichkeiten stünden mir da zur Verfügung? Ich könnte ihm natürlich eine reinhauen ... gehört sich aber nicht, fällt also flach! Ich könnte ihm einen Brief schreiben ... ist aber kein Denkzettel im eigentlichen Sinn, und ich gehe davon aus, der Brief wäre ihm egal. Nein, ich hab‘s! Ich werde heute Nacht, wenn meine Nachbarn selig schlafen, an die Biomülltonne gehen und seinen scheiß Braten wieder herausholen. Dann schreibe ich ihm eine kleine Botschaft dazu und schmeiße beides zusammen in seinen Briefkasten. Ich brauche nur einen guten Text.
Am nächsten Morgen habe ich meiner Kreativität freien Lauf gelassen, um dem Herrn eine Botschaft zukommen zu lassen. Hoffentlich lernt er daraus, denn Ordnung bleibt Ordnung. Basta!
Heute fahre ich nach Ludwigshafen. Eine Stadt mit sehr wenigen schönen, dafür aber vielen widerwärtigen Flecken. Kaum Jemandem, außer den Leuten, die da leben, würde es auffallen, wenn diese Stadt einfach von der Landkarte verschwände. So verhält es sich aber mit fast allem. Ist es weg, wird es vergessen, und selbst das Vergessen wird irgendwann vergessen sein. Allerdings darf ich Ludwigshafen wegen meiner Arbeit zunächst nicht vergessen. Ich gondele zu der halbfertigen Autobahnbrücke, um dort den Baufortschritt zu überprüfen. Der Polier präsentiert mir diesen recht schnell. Gegen Mittag kann ich wieder aufbrechen, um mir eine weitere Baustelle in Kaiserslautern anzusehen. Gääähn ... Wieder eine Autobahnbrücke. Ich freue mich schon vor Feierabend darauf, meinen Nachbarn zu sehen und sein womöglich schlechtes Gewissen zu erkennen ... sofern er überhaupt eines hat.
Während der Fahrt in Richtung Heimat, male ich mir aus, was ich heute mit Kim erleben könnte. Ich sollte keine Erwartungen haben, das war klar. Den Gedanken an Sex in Zusammenhang mit meiner Freundin Kim habe ich mir schon vor drei Jahren schmerzlich abgewöhnt. Immerhin – da kann ich schon froh drüber sein – darf ich ja vier Mal im Jahr mit ihr Sex haben. Danach plagt mich jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Sie gibt mir immer, wirklich immer, das Gefühl, Sex wäre für sie eine Pflichterfüllung. Ohne jegliches Zutun lässt sie sich von mir besteigen. Kims Verhalten ist für mich Anlass, nicht mehr als diese vier Begattungsversuche pro Jahr zu starten. Wer will schon das erbärmliche Gefühl haben, ein perverser Lüstling zu sein? Sie liegt im Grunde regloser da als eine aufblasbare Gummipuppe, der man die Luft abgelassen hat.
Ein Hoch auf die Schaffung meiner Zweitexistenz! Hier lasse ich mich fallen. Hier bin ich Mann, lasse mich begehren, aber nicht lieben, suche mir bezahlte Gespielinnen, mit denen ich auslebe, was mir in meiner Beziehung zu Kim fehlt. Abgesehen davon möchte ich Kim mit meinen Vorlieben und Fantasien nicht belasten. Madame hat ja schon mit Normalo-Sex ihre Probleme! Ich hingegen stehe darauf, von Frauen gequält und misshandelt zu werden. Nicht diese weichgespülte SM-Schiene. Mir geht es um wirklich erlebten Schmerz. Dafür habe ich in meinem Zweitwohnsitz einen, wie ich ihn gerne nenne, „Spieleraum“ eingerichtet. Dinge wie eine Streckbank für die Zufügung von Streckschmerz sind zwar aus dem SM-Bereich bekannt, meine Schmerzlust ist aber erst befriedigt, wenn die Bänder und Muskelsehnen zu reißen beginnen. Daneben halte ich Baseballschläger und Holzkeulen für das Hervorrufen von Blutergüssen an meinem Körper bereit. Am intensivsten empfinde ich, sobald beides gleichzeitig Verwendung findet ..., wenn ich also auf der Streckbank liege und bei voll überdehntem Strecken meiner Gliedmaßen die Wucht des Baseballschlägers auf dem Bauch, oder besser, den Schienbeinen spüren darf. Das höchste Wohlempfinden verspürte ich damals, als eine meiner Gespielinnen, deren Name mir mittlerweile entfallen ist, mit voller Wildheit meine Kniescheibe zertrümmerte. Ich lag meinerseits auf der Streckbank, und mir waren schon einige Sehnen wegen des Überstreckens gerissen. Der einzige Nachteil war, dass der Trümmerbruch Wochen benötigte, um zu verheilen. Die süße Zeit des langgezogenen Schmerzes allerdings ist mir bis heute in ergötzlicher Erinnerung.
Mein Wesen besteht aus zwei widersprüchlichen Seiten. Die eine liebt den Schmerz und fordert diesen wie ein Mantra ein, während meine andere Seite liebevoll, gebend und fürsorglich ist. Meine liebevolle Seite würde es nie zulassen, Kim zu schaden oder ihr gar solchen Schmerz zuzufügen, wie ich ihn selbst brauche und vom Leben einfordere. Niemals! Der Gedanke an meinen Spieleraum, meine Puppensammlung und meine Lederwerkstatt, in der ich feinste Haut zu Leder verarbeite, beschwingt meine Vorfreude. Mit einer so innigen Freude, wie sie andere vielleicht bei einem Orgasmus erleben. Wer weiß das schon? Ich kenne den Orgasmus nicht. Ich weiß zwar, wie es sich anfühlt, wenn man abspritzt, aber dass dieses Gefühl irgendwie befriedigen würde, kann ich nicht bestätigen. Frauen bumste ich schon zu Hauf, aber einen Orgasmus bekam ich dabei nie.
Als ich noch ein Jugendlicher war und mit dreizehn begann, mir in jeder freien Minute einen runterzuholen, brachte keine dieser zahllosen Aktionen einen Orgasmus. Wie jeder Dreizehnjährige wedelte ich mir mindestens fünf Mal täglich – erfolglos – die Palme. Weder beim Onanieren im Schulklo oder in der Aula hinter dem Vorhang bekam ich einen Orgasmus. Auch nicht, als ich im Zeltlager alleine in den Wald gegangen war, um, mit einem Pornoheft bewaffnet, zu wichsen. Selbst zu Hause mit Papas geheimer Pornosammlung, von der Mutti bis heute nichts weiß, blieb mir der Orgasmus versagt. Auch Mamas Dildo im Schuhschrank hinter den Stiefeln half mir nicht weiter. Als ich meiner besten Freundin aus dem katholischen Kinderheim davon erzählte, zog sie mir noch im Schulbus den Schwanz aus der Hose, um mir einen zu blasen. Aber auch hier keine Erfüllung meiner Sehnsucht. Obwohl ich zugeben muss, dass sie es echt draufhatte, meinen Pimmel zu verwöhnen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe wirklich viel abgespritzt, und sie hatte den Anstand, kräftig zu Schlucken. Immerhin war es der erste Blowjob meines Lebens, aber eben ohne Orgasmus.
In der Folge machte sie es zu ihrer persönlichen Aufgabe, mir auf jegliche Art und Weise zu meinem ersten Orgasmus zu verhelfen. Sie besorgte mir mehrere Mädels, die mit ihr in dem katholischen Kinderheim wohnten. Nacheinander gingen die jungen Katholikinnen mir an die Wäsche. Mit einigen hatte ich überwältigenden Sex. Vor allem mit jenen, die mir in Alter und Entwicklung voraus waren. Auch diese Einzelversuche brachten nichts.
Wegen der Erfolglosigkeit des Pärchensex rief meine beste Freundin zum Gruppensex mit mir und den dauergeilen Katholikinnen auf. Ich spritzte zwar extrem und viel ab, aber außer dem Gefühl der ersten Orgie meines Lebens geschah nichts.
Mit meiner besten Freundin pflegte ich viele weitere Jahre ein sexuelles Verhältnis. Offensichtlich konnte sie es nicht auf sich sitzen lassen, mich nicht befriedigt zu haben. Doch auch in diesen Jahren gelang es ihr nicht. Meine Jugend verflog so unbefriedigend wie das Leben, das ich als junger Mann führte - bis heute. Als ich, noch vor Kim, eine Dame kennenlernte, die beim Sex aus Versehen ihre Faust ins Gesicht schlug, fühlte sich das neu, erfrischend und gut – nein - geradezu fantastisch an.
Jener Schlag war wie eine Eröffnung in eine neue Dimension meiner Empfindungen. Ich begann in der Folgezeit, mit Schmerz zu spielen, brachte ihn immer mehr in mein Liebesleben ein. Weil aber meine Schmerzsucht dafür sorgte, Frauen von mir abzudrängen, denn kaum forderte ich diesen ein, unterlies ich es wieder, den Wunsch zu äußern. So ersann ich die Möglichkeit, den Dienst bezahlter Frauen zu nutzen.
Endlich fand ich, was mein Körper verlangte. Allerdings beschämte mich mein Wunsch doch sehr. Ich konnte meine Vorlieben fortan nicht in meinem Umfeld ausleben. Mir blieb nur die Flucht in ein Doppelleben. Apropos Doppelleben: Zwar fahre ich im Moment nach Hause zu Kim, lege aber im Geiste fest, spätestens morgen – und wenn ich mir dafür Urlaub nehmen müsste – zu meinem Zweitwohnsitz zu fahren. Warum eigentlich warten? Ich muss Dampf ablassen. Los geht’s!
Kapitel 1.1.2.1
Es gibt überall diese missratenen Arschlöcher mit viel zu mächtigen Tätowierungen auf schwabbliger Haut und einem Benehmen, als hätte sich eine Hyäne mit einem Maultier gepaart. In diesem Fall war das Maultier für die übermäßige Behaarung an Schultern, Bauch und Rücken wie auch für die Sturheit zuständig. Der Einfluss der Hyäne wurde auf mentaler Ebene in Jaden-Horst manifest. Er war ein glatzköpfiger Raufbold, soff sich jeden Abend zu, ging in seine Bude und verdrosch dort zur Begrüßung fast allabendlich seine Freundin Jacqueline. Er verschonte sie wirklich nur an Abenden, die ihm ein anderweitiges Opfer auf dem Heimweg bescherten. Er hätte sich nie mit gleichstarken gemessen, dazu fehlte dem Fettberg schlichtweg der Mut. Weil jedoch fast jeder Entgegenkommende von der Größe her unterlegen war, fackelte er nicht lange. Er schlug einfach jedem Kleineren oder Schmächtigeren seine bratpfannenartige Hand in die Fresse. Hätte einer den Grund für sein Handeln erfragt, wäre Jaden-Horsts Antwort gemäß seinem minimalistischen Verstand nur vier Worte lang: „Weil ich es kann!“ Diese eng begrenzte Auswahl an Worten entsprach, neben anderen Worthülsen, seinem Standardprogramm auf Fragen jeder Art. Es kümmerte ihn nicht, ob Antworten, die er gab, zu den Fragen passten, die ihm gestellt wurden. Wenn Jaden-Horst ein Opfer auserkoren hatte, genügte ihm die Begründung, jenes Opfer benutze SEINE Straßenseite. Alsdann schlug er zu. Ohne den Leidtragenden eines weiteren Blickes zu würdigen, lief er fröhlich und vor allem unbescheiden seines Weges. Verbal ließ er an Anstand und Umgangsformen einen sensationellen Spielraum nach oben. Er bezeichnete jeden anderen einfach als Wichser, wohingegen jede Frau, selbst seine eigene Mutter, immer mit Drecksfotze tituliert wurde. Wenn er sich jemals mit Jacqueline unterhalten würde, um Grüße von der Mutter auszurichten, hätte er dies in etwa so verpackt: „Meine Drecksfotze von Mutter will, dass ich der Dreckschlampe, die in meiner Wohnung haust, Grüße ausrichte! Hab‘ ich ja jetzt!“ Nur wusste Jaden-Horsts Mutter weder von Jacqueline noch von der Dummheit des eigenen Sohnes. Mit seiner Drecksfotze von Mutter wollte er sich nicht rumplagen müssen. Jaden-Horst wusste nicht einmal, ob der Brutkasten, der ihn zu Welt gebracht hatte, am Leben war. Selbst wenn die alte Gammelfotze am Leben wäre – da stand er drüber. Seit er ihr damals die Leviten gelesen hatte, war die Alte für ihn gestorben. Er hatte keine Verwendung für eine Mutter. Schließlich hatte sein Vater die alte Fotze auch nicht gebraucht.
Als Jaden-Horst heute Abend nach Hause wollte, setzte er sich in den Kopf, Jacqueline ausnahmsweise mal keine zu donnern. Er wollte Sex! Und wer ficken will, muss freundlich sein! So war das, ganz einfach.
Okay, er fickte sie auch, wenn er ihr vorher eine verpasst hatte. Nur war das immer so eine Sauerei mit dem Blut, das Jacqueline aus dem Mund quoll. Abgesehen davon heulte die wegen dem bisschen Schmerz immer so blöd rum. Irgendwie störte es auch die Stimmung. Und heute wollte er schön ficken.
Er verließ die Kneipe und setzte in aggressiv angetrunkener Weise, fast schon beschwerlich, einen Fuß vor den anderen, die Augen stur auf den Weg vor ihm gerichtet. Schließlich hielt er ja Ausschau und suchte ein geeignetes Opfer. Wie erwartet, ließ dieses nicht lange auf sich warten.
Ein Mann mittleren Alters lief auf SEINER Bürgersteigseite und kam direkt auf ihn zu. Kurz checkte Jaden-Horst Statur und Größe des Blondschopfes ab. Er war wesentlich kleiner und um ein Vielfaches schmächtiger, ein wahrlich geeignetes Opfer. Jaden-Horst überlegte, wo genau er dem Typ die Faust reinschlagen wollte. Oder viel besser: Der Wichser sah so schmächtig aus, Jaden-Horst würde ihn einfach mit der flachen Hand umhauen! Nur wenige Meter trennten Jaden-Horst von seinem Ziel. Er richtete sich zu voller Größe auf und ging wankend weiter, bis sein Opfer in greifbarer Nähe war. Blitzschnell holte er aus und schlug mit der flachen Hand zu.
Allerdings war sein Opfer schneller und hob beide Arme angewinkelt vors Gesicht. Also traf die Fleischhand nicht, wie von Jaden-Horst geplant, ins erhoffte Ziel. Unerwartet wurde sein Opfer zum Gegner. Und dieser holte mit beiden Händen aus, aber nicht um zuzuschlagen. Er schlang beide Arme um des Riesen Kopf. Mit einem Ruck zog er sich an ihm hinauf und hieb mit den Knien so oft in Jaden-Horsts Gesicht, bis dieser entkräftet zusammenklappte. Er schrie wild wie ein kleines Baby in voller Verzweiflung nach seiner Mama. Erstmals seit Jahren bezeichnete er seine Mutter nicht als Dreckfotze, sondern rief aus vollen Leibeskräften: „Mami, Hilfe! Maaaamiii, bitte hilf mir!“ Dabei wand er sich auf dem Boden wie ein Karpfen, den man aus dem Wasser gezogen und auf den Rasen geschmissen hatte. Während dieser erbärmlichen Schreiattacke machte sich der schmächtige Gegner in aller Seelenruhe daran, seinen Weg fortzusetzen, ohne dem kindlichen Geheule oder den Hilfeschreien des Rivalen auch nur die geringste Beachtung zu schenken.
Die Leute auf der anderen Straßenseite amüsierten sich über sein jämmerliches Geheule. Einzelne Stimmen, besonders männliche, hörte man heraus. „Endlich mal jemand, der dem Typ gibt, was er verdient!“, oder sarkastisch: „Da heult er!“
Jaden-Horsts Gejammer war zu intensiv, vor allem aber zu laut, um überhört zu werden. Selbst seine Freundin Jacqueline Ottwald hörte sein Winseln und Flennen bis in die Wohnung. Sie eilte auf den Balkon, um ausfindig zu machen, wer da so hilfebedürftig schrie. Als sie den Leidenden erblickte, konnte sie nicht anders. Heimlich und nur in den eigenen Gedanken entwich ihr ein Freudenseufzer, der wie ein Befreiungsruf war. Sie hoffte für heute auf Verschonung vor der allabendlichen Abreibung durch Jaden-Horst im Vollrausch und nicht, wie so oft erzwungen, auch noch die Beine für diesen Widerling spreizen zu müssen. Die junge Frau nahm ihren Schlüssel vom Sideboard neben der Wohnungstür und eilte auf die Straße. Er brauchte doch jemanden, der ihm in dieser Situation beistand, ihm half. Eine normale Freundin würde genauso handeln. Nur war Jacqueline streng genommen keine normale Freundin. Sie war Jaden-Horsts Besitz. Er nahm sie sich, wann immer ihm danach war. Er bedrohte ihr Leben und verkaufte sexuelle Dienste an ihr. Er behandelte sie wie eine ungewollte Ware. Schlimmer, er schlug sie und vergewaltigte sie regelmäßig. Je schlimmer ihr Leid war, umso mehr schien es ihn zu freuen. Jacqueline war zu eingeschüchtert, um aufzubegehren, zu verängstigt für eine Flucht. Also spielte sie sein perverses Spiel mit. Letztlich musste sie ja auch Geld ranschaffen. Sie ließ es unter Zwang zu, dass jeden Tag mehrere Männer ihre sexuelle Lust an und vor allem in ihr befriedigten. Wenn sie nicht gehorchte, und sie hatte es ausprobiert, wurde sie geschlagen. Wobei die Schläge nicht das Schlimmste waren. Nein, bei weitem nicht. Er bestellte dann mehrere Männer, die es ihr nacheinander und ohne Unterlass besorgten. Dieser perversen Mehrfachvergewaltigung konnte Jaqueline nur entkommen, wenn sie immer brav tat, was er wollte.
Auf halbem Weg zu Jaden-Horst hielt Jacqueline inne. Ihr kam der Gedanke, ein wenig Zeit verstreichen zu lassen. Soll er doch in seinem Leid ein wenig gefangen sein! Als sein Geheul leiser wurde, setzte sie sich mit konsequent langsamen Schritten wieder in Bewegung.
Augenblicklich, als Jaden-Horst Jacqueline in der Haustür erblickte, wurde ihm jäh klar, was er da gerade tat. Er unterbrach abrupt seinen weinerlichen Singsang, beschämt darüber, wie eine seiner Nutten ihn hier sah. Wie sollte er jemals wieder den Grundrespekt herstellen, den alle Weiber vor einem richtigen Kerl wie ihm haben mussten? Er würde ihr bei nächster Gelegenheit diesen Grundrespekt wieder einprügeln. So viel stand fest. Dieses Mal musste Blut fließen, eine Menge Blut, sonst würde die Schlampe niemals mehr so gehorchen, wie es sich für eine Dorfmatratze gehört.
Jetzt kam die scheiß Tusse zu ihm. Er würde ihr erst mal eine reindonnern müssen. Wäre sie doch einfach in der verfickten Wohnung geblieben! Aber nee, sie musste ja rauskommen! Selbst schuld, wenn‘s dafür aufs Maul gibt. Aber da waren all die neugierigen Wichser auf der Straße. Sollte er Jacqueline hier schon verdreschen oder erst in der Wohnung, wo es keiner sehen konnte? Er entschied sich für Variante zwei, aber dafür würde die Abreibung wesentlich heftiger werden. So einfach sollte diese scheiß Schickse nicht davonkommen.
Jacqueline lief über den Rasen auf Jaden-Horst zu und wollte ihm hochhelfen. Dessen wutverzerrter Gesichtsausdruck ließ sie erstarren. Sie bekam erneut diese Angst. Jene Angst, die sie klein und verletzlich machte. So wie damals, wenn der Vater abends in ihr Kinderzimmer kam. Er fesselte seine kleine Tochter immer an das Bettgestell und schlug auf sie ein. Nicht mit der Hand. Nein. Er berührte sie nie. Er hatte eigens eine Dachlatte glattgeschliffen. Mit dieser hieb er so lange auf Jacqueline ein, bis die Kleine ihre Besinnung verlor. Meist erwachte Jacqueline erst Stunden später wieder. Am ganzen Körper fühlte sie die Schmerzen der Misshandlung.
Damals wie heute fehlte ihr der Mut, jemandem davon zu erzählen. Zu tief saß der Schmerz, der Verrat. Angst fraß sich durch Jacquelines gesamte Existenz und gipfelte mit jenem Tag, als Jaden-Horst sie zum ersten Mal brutal peinigte.
Jetzt lag er als Opfer von Gewalt vor ihr und heulte bitterlich. Jacqueline verharrte. Salzsäulengleich stand sie vor ihm. Es schien ihr unmöglich, auch nur den kleinen Finger zu rühren, als würde dieser Körper nicht mehr ihr gehören. Sie wollte schreien, wollte weglaufen. Aber es ging nicht.
Jaden-Horst richtete sich mühsam auf und blickte gehässig auf sie hinab. Er raunte ihr zu: „Warte, bis wir zu Hause sind, Du verhurtes Stück Scheiße!“
Jacqueline konnte nur zu ihm aufschauen. Ihr Körper wollte nicht gehorchen. Weil sie wie angewurzelt dastand, stieß Jaden-Horst sie böswillig vor sich her. Bis hinein in die gemeinsame Wohnung. Kaum war die Wohnungstür zugeworfen, holte er mit geballter Faust aus und drosch Jacqueline mitten ins Gesicht. Dabei platzten nicht nur die sonst so schönen Lippen auf, sondern er brach ihr mit diesem Faustschlag gleichzeitig die zierliche Nase. Sie fiel der Länge nach auf den Steinboden im Flur. Den Aufschlag des Kopfes auf dem harten Granit nahm sie nur noch unterschwellig wahr.
Jacqueline schmeckte Blut. Den Schmerz der gebrochenen Nase konnte sie, wie auch den der aufgeplatzten Lippe, einigermaßen unterdrücken. Sie würde nicht weinen, niemals. Auch nicht vor Schmerz oder Angst. Schon ihr Vater schaffte es irgendwann nicht mehr, sie zum Vergießen von Tränen zu bringen. Was auch immer er ihr angetan hatte, egal, wie viel Schmerz sie ertragen musste, Jacqueline weinte nie. So auch bei ihrem jetzigen Peiniger. Jaden-Horst würde es unter keinen Umständen schaffen, sie jammern zu sehen. Der Schmerz und die Angst waren deswegen aber nicht weniger. Sie hatte sich im Laufe ihrer einundzwanzig Jahre angeeignet, den Schmerz zu unterdrücken, ihn niederzuringen. Jaden-Horst holte wieder aus. Er rammte seine Faust von oben in den Solarplexus des Mädchens. Jacqueline krümmte sich vor Schmerz, in dem Flur der Wohnung des Menschen, der ihr Tyrann geworden war. Weil aber Jaden-Horst seinem Spitznamen alle Ehre machen wollte, schlug er wieder und wieder zu. Sein Name war „Klatscher“. Und mit jedem Schlag klatschte es lauter. Anfänglich nur in Jacquelines Gesicht. Dann, nach vielen Schlägen, klatschte Jacquelines Kopf bei jedem Treffer an die Wand hinter ihr. Weil sie keinen Mucks von sich gab, geriet Klatscher immer mehr in Rage. Er schlug immer derber zu. Drosch seine große Faust wie einen Presslufthammer immerzu auf ihren Körper. Jede Wut auf den Blondschopf, der ihn vorhin so bloßgestellt hatte, bekam diese Schlampe nun zu spüren.
Nachdem Jaden-Horst sich endlich genügend abreagiert hatte, ging er zum Kühlschrank hinüber, griff sich eine Flasche Wein und sog den gesamten Inhalt in einem Zug hinunter. Er brauchte diesen fortdauernden Rauschzustand. Benebelt sein half, die Wut besser zu kanalisieren. Es half dabei, seine Aggressionen nur gegen andere zu richten.
Früher, lange vor Jacqueline, richtete er seine Wut manchmal gegen sich selbst. Er war einfach zerstörerisch mit seinem Körper umgegangen. Er hatte sich selbst geritzt. Davon war sein Oberkörper mit unzähligen Narben übersät. Später kamen die Tattoos darüber, die gingen auch schmerzhaft unter die Haut. Er verband mit jedem Tattoo die Erinnerung an den süßen Schmerz, wenn der Tätowierer mit den Nadeln die Haut durchstieß. Aber mittlerweile brauchte er den anderen Kick, einen wesentlich besseren. Er ließ seine Wut, sein inneres Verlangen nach Gewalt, an seinen Mitmenschen aus. Vor allem und mit Freude an Frauen, weil die sich nicht wehren konnten.
Allmählich, angenehm ansteigend zeigte die hinuntergekippte Flasche Wein Wirkung. Er beruhigte sich langsam. Wurde schläfrig. Wohlig entwich sein Denken hinab in den entstehenden Rausch. Innerhalb weniger Minuten verdrängte der Schlaf das Wachsein. Soll mir doch der nächste Tag seine beschissene Fratze zeigen, dachte er.
Jacqueline raffte derweil all ihre Kräfte zusammen und zog sich an der Garderobe hoch. Wie lange sie hier gelegen hatte, wusste sie nicht. Mit einem Blick ins Wohnzimmer sah sie den tief schlafenden Jaden-Horst. Sie schwankte ins Bad und machte sich daran, ihre Wunden zu versorgen. Sie desinfizierte die aufgeplatzte Lippe und betastete vorsichtig die blaugeschlagene, gebrochene Nase. Wie sollte sie so nur arbeiten? Und wenn sie nicht arbeiten konnte, wie sollte Geld in die Kasse kommen? Sie musste anschaffen gehen. Musste Geld heimbringen. Sonst würde Jaden-Horst sie nur noch übler zurichten. Sie musste dringend einen Ausweg finden. Vordringlich aber brauchte sie einen Arzt. Sonst würde die gebrochene Nase so schief im Gesicht stehen bleiben, wie sie hier im Spiegel aussah. Mit welchem Geld sollte sie den Arzt bezahlen? Eine Krankenversicherung hatte sie seit mehr als einem Jahr nicht mehr, seit Jaden-Horst in ihr Leben getreten war und sie zwang, anschaffen zu gehen. Was also sollte sie tun? Ohne hübsches Gesicht keine Freier mehr, ohne Freier kein Geld.
Diese Negativspirale, aus der es wohl keinen Ausweg gab, begann, sich in ihrer Gedankenwelt zu drehen. Dieser Wirbel drohte ihr kurzes Dasein strudelartig zu erfassen, alles einzufangen und mit in den Abgrund zu reißen.
Vor dem Spiegel, ganz für sich allein, bahnten sich einige Tränen der Verzweiflung ihren Weg über die Wangen und fielen in das mittlerweile blutverschmierte Waschbecken. Keine Tränen des Schmerzes, nein. Tränen tiefer Angst und Trauer. Trauer über den schweren Verlust ihrer Chancen, über ihre unbeholfene Dummheit. Nicht nur über ihre Ohnmacht in der Beziehung zu dem gewalttätigen Mann, der sie auf den Strich schickte. Letztlich auch darüber, weil ihr der Mut fehlte, aufzubegehren. Nicht fliehen können, weil die Angst sie ausbremste. Diese innere Taubheit, die sie in dieser Situation festband, war erdrückend.
Jacqueline brauchte ziemlich lange, um sich zu sammeln. Sie wusch ihr Gesicht und humpelte – aufgrund der Schmerzen – in den Flur hinaus. Jaden-Horst schlief tief und fest. Sicherlich würde er vor dem Morgengrauen auch nicht aufwachen. Wie immer, wenn er besoffen war. Sie nahm sich die Handtasche und den Schlüssel von der Garderobe und ging hinaus. An der Nachtluft konnte Jacqueline ein wenig durchatmen. Die frische Luft wirkte wie ein Ventil.
Sie fasste einen Entschluss!
Alle Hoffnung ruhte in dem eben erdachten Plan. Dazu müsste sie eine Stunde Fußmarsch hinter sich bringen. Sie besaß kein Auto, auch keinen Führerschein, nicht einmal eine Monatskarte für den Bus. Selbst das Handy hatte Jaden-Horst ihr abgenommen und kaputtgetreten. Also blieb nur der Fußmarsch, um zu Jörn zu gelangen.
Jörn war früher mal ihr bester Freund gewesen. Er war erst Krankenpfleger und studierte mittlerweile Medizin. Sie hoffte, er könne sich ihrer Nase annehmen. Obwohl sie Jörn nun schon viele Jahre kannte, genauer gesagt seit ihrer Geburt, hatte sie ihm nie von ihrem Martyrium erzählt.
Weder von den Vorfällen mit ihrem Vater damals noch von den zahlreichen Vergewaltigungen durch ihren ersten Freund. Auch die Folter durch Sebastian hütete sie wie einen geheimen Alptraum. Und heute, da Jaden-Horst der Tyrann war? Es gelang ihr wieder nicht, dem besten Freund zu vertrauen. Ihm zu berichten. Wie auch? Sie durfte ihn ja mittlerweile schon über ein Jahr nicht mehr sehen. Jaden-Horst untersagte jeden Kontakt zu Außenstehenden. Er drohte von Anfang an, sie wesentlich schlimmer zu quälen als bisher, wenn sie Kontakte pflegen würde. Also gehorchte Jacqueline. Sie grüßte nicht einmal mehr die direkten Nachbarn, aus Angst davor, bestialisch gezüchtigt zu werden.
Eines wollte sie ergänzend tun, bevor sie aufbrach. Auf dem Rasen vor der Wohnanlage nahm sie die Schlüssel von Jaden-Horst und warf sie mitten auf den Gehweg, direkt vor die Eingangstür des Widerlings. Soll halt jemand den Schlüssel finden und am besten gleich bei Jaden-Horst einbrechen, dachte sie, drehte sich um und zog von dannen.
Jeder ihrer Schritte brannte wie Feuer. Je länger sie durch Trier lief, umso mehr schwanden ihre Kräfte. Der beginnende Regen spülte die Blutspur auf den Wegen, auf denen Jacqueline gelaufen war, fort. Sie verlor Unmengen der lebenswichtigen Körperflüssigkeit, immer mehr schwanden ihr die Sinne.
Sie erreichte die vertraute Gegend ihrer Jugendzeit, ihrer Kindheit, und ein Gefühlschaos ergriff Besitz von ihr. In ihrem Inneren spiegelte sich jenes grausame Bild wider, als sie die geschändete Leiche ihrer Mutter entdeckt hatte.
Die damals zwölfjährige Jaqueline fand ihre Mutter inmitten einer nicht enden wollenden Blutlache – erstochen vom Vater. In Mamas Kopf steckte ein riesiges Messer. Eigentlich gehörte es in den Messerblock neben dem Herd. Der Vater war danebengestanden und trat beständig auf die Leiche seiner Frau ein. Irgendwas hatte er auch gesagt, aber was, das wusste Jacqueline nicht mehr. Selbst als die Polizei kam, trat er beständig weiter auf ihre tote Mutter ein. Sie mussten ihn mit drei Mann von der Leiche wegzerren. Erst viel später, als er mit Handschellen im Polizeiwagen saß, hörte er auf zu toben. Sie würde nie die hasserfüllten Augen vergessen, mit denen sein Blick das kleine Mädchen traf. Endlich war sie erwachsen, aber dennoch voller Angst.
Sie eilte, trotz der kaum auszuhaltenden Schmerzen, wie eine Flüchtige mit taumelnden Schritten die kleine Sackgasse entlang. Bis hin zu den Stufen des kleinen Hauses am Ende der Sackgasse. Sie hielt inne und las auf dem bekannten Klingelschild den vergilbten Nachnamen ihres Freundes: WEIZMANN.
Mit ausgestrecktem Zeigefinger wollte sie den Klingelknopf betätigen, schaffte es aber nicht. Die schwindenden Kräfte hatten sie bis hierhergebracht, verließen aber jäh den Körper des gequälten Mädchens. Sie brach vor der Haustür in sich zusammen. Um sie herum wurde es schwarz. Sie war einfach „weg“.
Es war Herrgott höchst selbst, der es zuallererst bemerkte. Er vernahm es von seinem Thron aus. Dieser Thron stand, wie sollte es anders sein, auf Wolke sieben. Zunächst sprang Herrgott vom Thron auf und lief wild um diesen herum. Eben genau so, als würde er hektisch etwas Wichtiges suchen, was er verloren glaubte. Natürlich wirkte Herrgott immer etwas hektisch. Klar, jeder der ihn wirklich kannte, würde vermuten, Herrgott leide unter ADHS, weswegen es eigentlich nicht verwunderte, dass er auf allen vieren um seinen Thron herumflitzte. Nur sein aufgeregtes Dopsen war neu. Er hatte nie zuvor auf Wolke sieben gedopst. Denn die war eigentlich Herrgotts Rückzugsort, hier war er für sich allein, an seinem Platz der Ruhe, sah man von Gabriel und Michael ab, die fortwährend den Platz neben dem Thron belagerten. Von hier aus konnte Herrgott alles überblicken. Er wurde immer aufgeregter und brachte vier weitere Umrundungen des Throns hinter sich. Er sprang von Wolke sieben auf Wolke sechs hinab. Jede weitere Wolke wurde mühelos übersprungen, bis er auf dem glänzenden Dielenboden des Wohnzimmers landete. Seine kleinen Pfötchen schlitterten auf dem glatten Holzboden. Dessen ungeachtet, flitzte Herrgott, so schnell ihn seine winzigen Beinchen trugen, auf Jörn zu. Er sprang auf dessen Schoß, wedelte wie wild mit seinem kleinen Stummelschwänzchen und drehte sich wie rasend auf Jörns Schoß um die eigene Achse. Aufgescheucht hüpfte er wieder auf den Dielenboden zurück und sprang in Richtung Haustür. Vor der Haustür blieb der Rehpinscher namens Herrgott stehen. Er kläffte die geschlossene Tür an, als sei dahinter etwas Wichtiges verborgen.
Kurz darauf riss Jörn die Haustür auf und der kleine Herrgott eilte zu der bewusstlosen Jacqueline, um ihr das Gesicht abzuschlabbern.
Jörn Weizmann rief panisch seine Mutter.
„Mama, schnell! Und bring Deine Tasche mit! Es ist Jacqueline, sie ist bewusstlos. Schnell!“
Jörn bückte sich hinunter zu Jacqueline, um ihren Puls zu fühlen. Als wäre sie eine Feder, hob er sie auf und trug sie behutsam durch den engen Flur hinein. Herrgott überwachte alles und beäugte kritisch, wie sein Herrchen Jacqueline durch das Haus in die Wohnstube trug. Dort legte Jörn sie vorsichtig auf das Sofa neben dem Kamin. Seine Mutter rannte derweil durch die Küche und suchte einige Sachen zusammen. Unter anderem auch ihre Behandlungstasche. Ruth Weizmann war mittlerweile im Ruhestand, hatte aber bis dahin als Ärztin in einer Notaufnahme gearbeitet. Ihr Sohn Jörn studierte Medizin.
Um sein Studium finanzieren zu können, arbeitet er als Pfleger in der Notaufnahme, deren Chefärztin seine Mutter bis vor zwei Jahren war. Beide agierten als gut eingespieltes Team. Er wusch das geschundene Gesicht der Patientin, entkleidete sie und untersuchte die Verletzungen. Seine Mutter verabreichte ihr währenddessen ein Beruhigungsmittel und eine leichte Narkose. Mit einem einzigen Handgriff richtete sie die Nase zurück in die von der Natur angedachte Position. Viele Untersuchungen folgten. Mutter und Sohn entschieden, Jaqueline zunächst mal ein wenig ausruhen zu lassen, bevor sie es wagen wollten, sie aufzuwecken. Denn vor allem brauchte der geschundene Körper nun Ruhe und Zeit zum Heilen.
Als der Morgen dämmerte, erwachte Jaden-Horst mit dröhnendem Schädel in seiner Wohnung. Offenbar war dies nicht nur die Nachwirkung des abendlichen Alkoholgenusses, sondern vor allem des Angreifers wegen, der ihn zur Minna gemacht hatte.
Sein Blick streifte suchend durch die Wohnung. Etwas war anders. Jacqueline fehlte. Wo war die Fotze nun schon wieder? Wo zum Teufel konnte die Schlampe stecken? Er quälte sich von der Couch hoch und durchsuchte alle drei Zimmer der gemeinsamen Wohnung. Jacqueline war nicht zu finden. Auch auf dem Klo keine Spur der Schlampe. Zorn setzte bei ihm eine Eigendynamik in Gang, sich immer weiter zu steigern. Er neigte – ohne geeignetes Ventil – dazu, sich selbst, aber vorzugsweise auch andere zu verletzten. Derartiges galt es zu vermeiden. Wo ist die Drecksfotze? Die Schlampe bringe ich um, geisterten Sätze maßloser Wut in ihm herum. Die gestern Nacht verabreichte Abreibung und die gebrochene Nase würden ihr geringstes Problem sein, sobald er sie fände, legte er im Stillen fest. Doch zuallererst musste er sie finden.
Kapitel 1.1.3.1
Draußen ist es dunkel, als um vier Uhr mein Wecker klingelt. Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Mein Name ist Dr. Franz-Erwin Rodalben, 35 Jahre alt, meines Zeichens Sachbearbeiter beim Finanzamt in Idar-Oberstein. Ich wohne in einer Trierer Nobelwohnanlage, habe kurze blonde Haare und für mein Alter schon eine stattliche Tonsur am Hinterkopf. Aber diese stört mich genauso wenig wie mein kleines Bäuchlein, das ich vor mir hertrage, oder meine kleine Zwangsneurose, die mich täglich beschäftigt. Endlich wieder Montag, denke ich, während ich meinen Wecker ausstelle und mich erst mal strecke.
„Wenn es nach mir geht, bräuchte ich kein Wochenende. Das wird eh überschätzt.“, gebe ich zum Besten, während ich auf dem Weg ins Bad bin, um mir die Hände zu waschen. Ich befolge zum Händewaschen immer einen ganz peniblen und strikten Ablaufplan. Sollte mich jemand dabei stören oder unterbrechen, beginne ich einfach von vorne – ganz egal, bei welchem Schritt ich gerade bin. Diesen Ablauf möchte ich kurz erläutern. Ich beginne wie jeder andere auch: Wasser an, Hände zehn Sekunden ohne Seife waschen. Ich greife doch die saubere Seife nicht mit den vom Schlaf verunreinigten Fingern an. Seife greifen und dann erneut zehn Sekunden einschäumen. Seife weglegen und die Handzwischenräume, zehn Sekunden pro Zwischenraum, ordentlich reinigen. Danach greife ich mir die Wurzelbürste, um den Dreck unter den Nägeln zu entfernen. Auch hier sind es zehn Sekunden, die ich pro Finger investiere. Als nächstes lege ich die Wurzelbürste weg und wasche mir die Seife von den Händen. Diesen Ablauf werde ich neun Mal wiederholen, bevor ich mir meinen ersten Kaffee gönne. Zu meiner Routine gehört, während dem ersten Händewaschen den morgendlichen Ablauf ständig im Kopf durchzugehen, bis ich den ersten Kaffee getrunken habe. Dieser sieht nach dem ersten Waschen wie folgt aus: Kaffee, Hände waschen, erster Toilettengang, Hände waschen, Gesicht rasieren, Hände waschen, duschen, Hände waschen, Körperhaarkontrolle, Hände waschen, anziehen, Hände waschen, zweiter Toilettengang, Hände waschen, erstes Mal kontrollieren, ob alles ausgeschaltet ist und ob die Klamotten richtig sitzen, Hände waschen, zweites Mal kontrollieren, ob alles aus ist, Hände waschen und dann mit dem Auto auf die Arbeit. Durch die strikte und sehr penible Planung meines morgendlichen Ablaufs kostet mich das Händewaschen nur 1,5x10 Minuten. Doch zum Glück ist morgens um diese Uhrzeit wenig los und ich komme grundsätzlich pünktlich zur Arbeit.
Nach der Dusche stehe ich nackt im Bad und suche, wie jeden Morgen, meinen Körper nach überflüssigen Haaren ab. Meiner Meinung nach sind Haare an bestimmten Körperstellen ekelhaft. Nachdem die Vorderseite meines Körpers komplett enthaart ist, wende ich mich der Rückseite zu. Als ich die Arschfalte mit der Hand entlangfahre, spüre ich, dass dort wieder ein enormer Busch gewachsen ist. Ich nehme meine Kaltwachstreifen aus der zweiten oberen Schublade des linken Schränkchens. Davon kann man wirklich nie genug zu Hause haben. Ich fange an die Streifen zwischen meinen Händen zu reiben, um diese zu erwärmen. In mir beginnt Vorfreude aufzusteigen. Mein ganzer Körper fängt an zu kribbeln, während ich den erwärmten Wachsstreifen auf die linke Innenseite meines Hinterns klebe. Langsam und mit zitternden Fingern streiche ich den Streifen in der Arschfalte glatt. Während der Kaltwachsstreifen abkühlt, wasche ich mir die Hände. Durch diese zusätzliche Reinigung wird sich mein sonst so penibler Plan um 9x10 Sekunden nach hinten verschieben. Alle zehn Tage, wenn ich mir den Arsch enthaare, passiert mir dieses Missgeschick. Mit einem heftigen Ruck ziehe ich mir den ersten Streifen aus der Arschritze und muss mich an der Badezimmerwand abstützen. Der Schmerz ist jedes Mal unangenehm. Vor allem kostet es mich zehn Sekunden wertvoller Zeit, bis sich mein Körper wieder beruhigt hat und nicht mehr bebt. Nun nehme ich einen zweiten Streifen und beklebe die andere Innenseite der Pobacke. Bei dem Versuch, den zweiten Streifen abzuziehen, konnte ich nicht genug Kraft aufbringen, um ihn komplett abzureißen. Jetzt kleben mir außerdem drei Viertel des Streifens am Hintern. Nach mehrmaligen, leider erfolglosen Versuchen, den Wachsstreifen zu entfernen, muss ich wohl oder übel mit einem Wachsstreifen, der mir aus dem Arsch hängt, vorliebnehmen. Ich versuche den raushängenden Teil mit einem Waschlappen zu bekleben, weil ich nicht möchte, dass meine Unterhose an dem Streifen festklebt und ich mir die Arschfalte wundscheuere. Welch ein unangenehmes Gefühl, denke ich mir und versuche den Waschlappen so in der Arschritze zu verstecken, dass er sich nicht durch Hose abzeichnet. Mit dem Lappen im Arsch unzufrieden, verlasse ich die Wohnung. Als wäre der Tag nicht schon schlimm genug, werde ich auf dem Weg zu meinem Auto fast von einem Fahrradkurier über den Haufen gefahren.
„Blöder Idiot!“, brülle ich dem Kurier hinterher. Ohne abzubremsen, dreht sich der Radfahrer um und ruft zurück:
„Ach, fick dich doch!“, und fährt einfach weiter. Nachdem ich mich wieder ein wenig beruhigt habe, denke ich mir: Was ein scheiß Tag. Erst der Lappen und nun der Typ. Aber zum Glück habe ich mir den Namen der Firma gemerkt, für die der Crétin arbeitet. Flitz-Bike. Da ist der Name wohl Programm. In meinem Auto sitzend fällt mir auf, wie spät es schon ist. Ich will punkt sieben Uhr im Amt sein. Um es wie immer rechtzeitig zu schaffen, muss ich jetzt richtig Gas geben. Es ist schon kurz vor sechs Uhr und ich brauche zwischen 6,5x10 und 7x10 Minuten bis Idar-Oberstein.
Pünktlich, aber abgehetzt komme ich in der Hauptstraße 199, dem Standort meines Finanzamtes, an. Im Großraumbüro angekommen, schaue ich mir wie jeden Morgen zuerst in aller Ruhe meinen Schreibtisch an. Das Namensschild steht – wie es ein soll – auf der vorderen rechten Seite des Schreibtischs. Meine Stifte sind auf der linken Seite aufgereiht nach Dicke und Farbe der Mine. Der PC-Bildschirm steht genauso wie meine Tastatur in perfektem Abstand zur Tischkante. Perfekt, so soll es sein. Man will sich ja auch bei der Arbeit wohlfühlen.