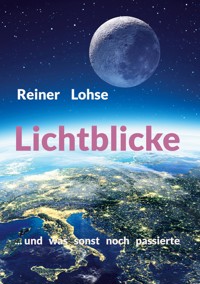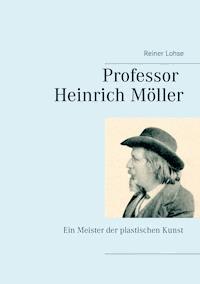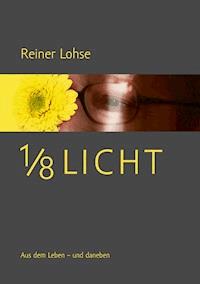
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sehen ohne Licht ist undenkbar, Leben ohne Licht, ohne Sonne ebenso. Das Buch will zeigen, wie ein Mensch mit Handicap, mit nur 1/8 Sehvermögen, auf einem Auge blind, auf dem anderen mit nur einem Bruchteil normalen Sehens das Leben bewältigen kann. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher gesellschaftlicher Verhältnisse, der Nachkriegszeit, der Sowjetischen Besatzungszone, danach der DDR und schließlich dem vereinigten Deutschland beschreibt der Autor in spannender Form Gedanken, Handlungen und Erlebnisse aus sieben Jahrzehnten, gewürzt mit lustigen, humorvollen Erzählungen, die dem Leser gewiss ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Mehr noch: Der Autor zeigt anhand eigener Erfahrungen, wie es möglich ist, trotz persönlicher Einschränkungen zielorientiert zu leben, Erfolge zu erreichen, aber auch mit Misserfolgen umzugehen und daraus neue Energie zu schöpfen. Zugleich zeigt er mögliche Perspektiven, Ideen und zahlreiche Tipps für Menschen, die besser leben wollen und somit für wirkliche Veränderungen offen sind, mit der lebensfrohen Absicht, glücklich und erfolgreich das Leben zu gestalten. Erfreuen Sie sich an den zahlreichen Geschichten aus dem Leben - und daneben. Sie werden begeistert sein!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist unseren Kindern und unserer lieben Enkelin Carlotta gewidmet.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel: Damals – vor meinem Leben
Familienalbum
Rettung von Mutter und Kind
Neues Leben
Brüderchen und Schwesterchen
Politische und gesellschaftliche Veränderungen
Kapitel: Von Handicaps, Freiheit, Licht und Lebensmut
Kapitel: Kindheitstage
Als die Russen kamen
Der Schwimmwagen
Freitags wird gebadet
Stöcke roden
Der Alleskönner
Der Lichtkasten
Kaisers Bockbierfest
Der Feiertag der Kinder
Die Pfingstpartie
Wie ich zu einem Fahrrad kam
Es brennt
Mühlenabenteuer
Opel P4
Radios groß und klein
Im Ferienlager
Zollvergehen
Im Hochgeschwindigkeitsrausch
Tod auf dem Hühnerhof
Kartoffeleinsatz
Kunst und Kunstgeschichte
Eisenbahnträume
Stinkender Skandal
Kirschen hier und Kirschen da …
Christliche Nächstenliebe
Spielzeug gestern und heute
Kapitel: Jugendmut und Tatendrang
Klinische Fotografie
Die Stärken des Dr. Wolfgang L
.
Einen Beruf – was sonst?
Gymnasiale Umleitung
Heiße Eisen
Motorisierung
Das Studium
Zukunftsgedanken
Politik und Gesellschaft
Kapitel: Persönliche Veränderungen
Wie ich Jutta kennen lernte
Eine Beziehung wächst
Tatra-Urlaub
Auf Hochzeitskurs
Doppelte Eheschließung
Unter einem Dach
Verbotene Kontakte
Wenn der Nachbar seine Frau mit dem Stuhlbein frisiert
„Freundliche“ Nachbarn
X. Weltfestspiele
Baby-Glück
Seltsame Autopanne
Geheimnisvolle Pakete
Versperrte Aussichten
Ferien für BRD-Kinder
Georgs „Rundfahrt“
Heißer Sommer
Verführerische Düfte
Der Traum vom schöneren Wohnen
Club-Geschichte
Verliebt in eine Waschmaschine
In Pelzkuhl auf der Jagd
Politikstudium
Schwanenhälse
Sexualität und Gesellschaft
Betrugsverdacht
Rechthaberei
Belohnter Diebstahl
Neue Herausforderungen
Kapitel: Auslandseinsatz Polen 1981–1985
Neubeginn in Warschau
Familie mit ersten Eindrücken
Gedanken um unsere Botschaft
Herbststürme
Kriegszustand
Unerwarteter Weihnachtsbesuch
Kartoffeln aus Minsk
Kohlen-Rouladen
Honeckers Staatsbesuch
„Kein schöner Land“
Drei-Länder-Urlaub
Unsere Kinder in Polen
Der Zwischenfall von Brest
Am Schwarzen See
Symposium der Superlative
Die Peking-Ente
Kapitel: Wendepunkte
Rückkehr
„Junger Mann“ und neues Glück
Das Ende der DDR und die Einheit Deutschlands
Verordnete Umschulung
Praktiken verweigerter beruflicher Anerkennung
Einkommensfragen
Wie ich zu einem eigenen Geschäft kam
Verwirrungen um Ziele
Dann kam alles ganz anders …
Die nächste Generation
Kapitel: Was sonst noch passierte
Der Gaul und die Kaffeekanne
Schüsse vor dem Haus
Kriminalfall ohne Beispiel
Missbrauchte Hilfe
Die Schlüsselfrage
Schweizer Träume
Wie wir zu 500-€-Scheinen kamen
Der Berggeist spukt
Nachwort
Literaturverzeichnis
Vorwort
Wie sah unser Leben in vergangenen Zeiten aus, unter den Bedingungen der Nachkriegszeit, in der Zeit der DDR „auf dem Weg zum Sozialismus“ und auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands? Mehr noch: Wie hatten auch Eltern und Urgroßeltern in schwierigen Zeiten gelebt? Wie könnte man unsere Lebenseinstellung beschreiben? Welche Rolle spielten Humor und Fröhlichkeit in vergangenen Tagen? Diese und andere Fragen wurden mir immer wieder gestellt. So fasste ich eines Tages den Entschluss, Erlebnisse und Umstände aus meinem Leben (und daneben) aufzuschreiben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, nicht von untergeordneter Bedeutung, war mein Leben mit Handicap. „1/8 Licht“ bezieht sich auf extrem reduziertes Sehvermögen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für Persönlichkeitsentwicklung, Familie, Beruf und Umfeld. Mit drastischen gesundheitlichen Einschränkungen müssen sehr viele Menschen zurechtkommen. Sie werden davon lesen, warum eingeschränkte Sicht (oder ein anderes Handicap) nicht automatisch eine negative Sichtweise auf die Dinge des Lebens erzeugen muss, sondern durchaus eine optimistische Lebenseinstellung hervorbringen kann. Deshalb stelle ich bewusst eigene Erlebnisse und Erfahrungen voran, um genau ihnen Mut zu machen, immer wieder nach neuen Lösungen zu suchen und nie aufzugeben. Dabei vergesse ich nicht, wie eng der Lebensrahmen bei Behinderungen sein kann und welche erhebliche Einschränkungen in allen Facetten persönlicher Freiheit sich täglich zeigen.
Nun ist eine Sammlung von spannenden Erzählungen, lustigen Episoden und merkwürdigen Ereignissen von der Zeit nach dem 2. Weltkrieg bis in die Gegenwart entstanden. Viele Darstellungen enthalten wertvolle Lebenserfahrungen und Gedanken, die sich der Leser für die eigene Entwicklung in übertragenem Sinne nutzbar machen kann. Das Buch zeigt auch, wie man aus einfachen, simplen Dingen durchaus Großes hervorbringen kann. An persönlichen Erlebnissen wird dargestellt, wie man Kinder für eine Sache begeistern und sie mit eigenen Gedanken zu kreativem Tun führen kann. Zu vieles wird in der heutigen Zeit den Jüngsten gewissermaßen „tafelfertig serviert“, anstatt ihnen Raum für eigene Ideen und ihre Verwirklichung zu geben.
Manche Episode ist auch ziemlich lustig gehalten, manch andere wieder in „kabarettistischem Stil“, wenn es darum ging, Missstände und bürokratisches Verhalten von Personen, Behörden und Einrichtungen kritisch zu bewerten.
Sie werden erfahren, wie wir in der Zeit der DDR gelebt und gearbeitet haben. Wie wir mit diesen Bedingungen fertig geworden sind, erzählt auch dieses Buch, wohlgemerkt aus meiner Sicht, unbeeinflusst vom Gefasel gewisser medienabhängiger Schreiberlinge oder stimmgewaltiger Besserwisser, die das Geschehen im „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ selbst nie erlebt haben.
„Warum schreibt da einer gerade ein solches Buch“, werden Sie jetzt vielleicht denken. Und doch ist da etwas Besonderes, eine ganze Menge von Erlebnissen, die sich wie wertvolle Perlen an einer Kette aneinanderreihen und bestimmend für mich und andere Menschen waren. Jede Perle davon kann Schicksal oder Schmuckstück sein, wie Sie noch lesen werden. Jeder Mensch ist einzigartig, in seinem Wesen, seinem Charakter, seiner Lebenshaltung, seiner Freiheitsauffassung, seiner Handlungsfähigkeit, seinem Ideenreichtum, seiner Kreativität, seiner Fähigkeit, Veränderungen zu verkraften oder welche herbeizuführen. Genau das ist die Leitlinie dieses Buches.
Es lohnt sich so sehr, wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen, aber auch Ideen und Vorschläge, die zur Gestaltung des eigenen Lebens von Bedeutung sein können, an Menschen neben mir und an künftige Generationen weiter zu geben. Dabei vergesse ich nicht, dass viele Erscheinungsformen im Alltagsleben an die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse gebunden waren und sind. Auch übersehe ich nicht, die Vergangenheit nicht mehr ändern zu können, sondern nur das ist zu ändern, was jetzt und in Zukunft passiert.
Wie sich im Laufe der Jahrzehnte zeigte, lagen auch in DDR-Zeiten Erfolg und Enttäuschung dicht beieinander. Machenschaften von Partei-und Staatsfunktionären brachten meine Frau und mich so manches Mal in schier ausweglose oder eigenartige Situationen, deren Hintergründe wir erst nach der Wendezeit aufspüren konnten. Auch davon werden Sie lesen.
So richte ich das kleine Werk an alle diejenigen, die ihr Leben zum Positiven verändern oder einfach besser leben wollen, immer unter den gegebenen Umständen und persönlicher Konstitution und Verfügbarkeit. Mit Ideen, Anregungen und Vorschlägen für eine abwechslungsreiche und kreative Lebensgestaltung kann das Geschriebene dazu beitragen, Lösungen für sich selbst und andere zu finden. Wenn Sie das Buch zweimal lesen, werden Sie Wege zu einer positiven und optimistischen Lebenseinstellung finden und erkennen können. Lassen Sie sich dabei nicht vom Geschwätz oder Gerüchten anderer Leute und auch nicht von den so genannten „Umständen“ verführen, treiben oder beeindrucken. Jeder Mensch hat nur ein Leben und sollte aus jedem Tag das Beste machen.
Dennoch: Optimistisch in die Zukunft zu schauen, immer wieder nach neuen Möglichkeiten zu suchen, musste meinen Lebensstil und den meiner Familie prägen, weil nur eine positive Lebenseinstellung förderlich sein kann. Damit möchte ich an Sie, liebe Leser, appellieren, nie auf zugeben, sich selbst nicht und überhaupt.
Viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst
Reiner Lohse
Freiberg, 15. Juli 2015
1. Kapitel: Damals – vor meinem Leben
Familienalbum
Mutter war eines der 5 Kinder von Lina und Louis. Die Waldarbeiterfamilie lebte in geduldeter Armut in der Freimühle nahe dem Dorf Langenau, nicht weit von der Bergstadt Freiberg in Sachsen. Ilse war die jüngste der Kinder, 1911 geboren. Ihre Geschwister Frieda, Rosa und Willi waren genauso herzensgut. Bruder Paul war es sicher auch, doch musste er 1916 im 1. Weltkrieg in Flandern sein Leben lassen. Er war „für Volk und Vaterland gefallen“ – wurde mit der Todesnachricht im Stile militärischer Eroberungen mitgeteilt. So blieben sie nur 4 Geschwister, von denen jeder seinen Lebensweg ging.
Großeltern Louis und Lina Clausnitzer mit Kindern 1914. Hintere Reihe von links Paul, Willi, Rosa und Frieda; vorn stehend Ilse.
Mutter lernte nach der Schulzeit in einer Nudelfabrik „Nudelmacherin“. Noch während der Lehrzeit und vor allem danach waren die flinken Hände der jungen Mädchen sehr gefragt. Für einige Groschen Wochenlohn wurden die jungen Frauen unter Aufsicht von Aufsehern zur Arbeit angetrieben. Die Ergebnisse ihrer Arbeit, oder besser den Profit daraus, eignete sich der Fabrikbesitzer an.
Nach einiger Zeit bewarb sich Ilse in einem Milchgeschäft als „Milchmädchen“ und musste im Ort und den Nachbardörfern Milch austragen bzw. Milchprodukte verkaufen. Auch hier war der Verdienst gering, aber durch längere Arbeitszeiten von 10 bis 12 Stunden kamen ab und zu einige Groschen mehr heraus.
1902 in Brand-Erbisdorf geboren, wuchs mein Vater Kurt im Hause seiner Eltern auf. Diese betrieben ein Milchgeschäft, das sich um 1912 bereits mit beachtlichem Umfang in der Bergstadt sehen lassen konnte. Sie verkauften Milch und Milchprodukte, also auch Butter, Quark und Käsesorten. Neben dem Verkauf im Geschäft des eigenen Hauses wurden die Waren auch „ausgetragen“, d.h. zu den Kunden nach Hause gebracht, entweder getragen oder mit Karren, Handwagen oder Fahrrad transportiert. Vater Adolf führte noch das landwirtschaftliche Anwesen mit Kühen und Pferden, wozu auch die Bestellung einiger Felder mit Getreide, Kartoffeln und Gemüsesorten gehörten.
Vater Kurt bei der Feldbestellung.
Kurt und sein älterer Bruder Emil wuchsen in ziemlich ärmlicher Kindheit auf. Schon sehr frühzeitig wurden die Jungen zu Arbeiten auf dem Feld oder im Stall herangezogen oder mussten selbst Milch mit austragen. Er konnte selbst gut mit Pferden umgehen und wenn es Gelegenheit gab, verdiente er sich mit Pferdefuhrwerken oder Kutschen ein paar Groschen bei einem Großbauern dazu, was seiner Mutter Selma ganz und gar nicht gefiel, denn auf dem eigenen Hof gab es genug Arbeit, Tag für Tag. Doch außer Essen und Unterkunft hatte Kurt nie aus Tätigkeiten im elterlichen Anwesen irgendwelche Zuwendungen erhalten und war so durch körperlich schwere Arbeit praktisch zu nichts gekommen, weshalb er sich vornahm, sein Geld anderweitig zu verdienen. Das führte zu Unverständnis seiner Mutter Selma und zu lang anhaltenden Zerwürfnissen.
Dann erlernte er den Beruf eines Maurers. Nach dem 1. Weltkrieg 1919 aber lag die Wirtschaft am Boden und war von Arbeitslosigkeit und Armut geprägt. Deshalb beschloss er zusammen mit drei weiteren Handwerksgesellen auf Wanderschaft zu gehen. Sie zogen von Ort zu Ort nach Süddeutschland, nur mit dem Nötigsten im Gepäck und einem Fahrrad. Sinn der Wanderschaft war, sich in verschiedenen Handwerksbetrieben um Arbeit zu bemühen und zugleich handwerkliche Erfahrungen in mehreren Gewerken zu sammeln. So konnte sich Vater neben Maurer- und Betonarbeiten auch Kenntnisse und Fähigkeiten im Holzbau und Zimmermannshandwerk aneignen. Über ein Jahr sollen sie unterwegs gewesen sein, bis in den Raum München. Vater erzählte mir, dass er sich in dieser Zeit ein stattliches Sümmchen an Geld erarbeiten konnte. Drei Jahre später war von dem Ersparten nicht mehr viel übrig, nur die Beträge auf den Scheinen und in den Sparbüchern wurden mit immer mehr Nullen versehen und immer größer! Die Inflation griff um sich.
Bald lernte er das Mädchen Ilse kennen, die für das Milchgeschäft der Eltern Milch austrug und sich damit einen kümmerlichen Lohn erarbeitete. 1928 wurde Marianne, ihr erstes Kind, geboren. Es kam zu erheblichen Differenzen mit Mutter Selma, die die Beziehung weder akzeptierte noch eine Heirat befürwortete. Schließlich bezogen sie eine kleine Wohnung im Ortsteil Erbisdorf und heirateten 1929. Zwei Jahre später wurde Töchterchen Gertraute geboren. Alles schien sich zum Besseren zu wenden, nur die Zweizimmerwohnung wurde zu eng. Anfang der 30er Jahre legte die Baugesellschaft GAGFAH ein neues Projekt zum Bau von Siedlungshäusern auf, das mit Hypotheken gefördert werden sollte. Kurt und Ilse entschlossen sich dazu, ein solches Haus, eine Doppelhaushälfte, zu bauen. Der Bau wurde im Sommer 1933 abgeschlossen und konnte nun durch die junge Familie bezogen werden. Jetzt waren mehr Platz und ein Gartengrundstück von 1000 qm gegeben, das zu bebauen, zu bestellen und zu pflegen war. Zugleich aber stellte das Grundstück die Grundlage für eine bessere Versorgung der Familie mit Obst und Gemüse dar. Nach einigen Jahren pachtete Vater noch Felder auf dem Kuhberg und an der Kohlenstraße für den Anbau von Getreide, Kartoffeln, Rüben und Grünfutter für einige Haustiere in Kleintierhaltung. Die Felder wurden meist manuell bestellt. Dazu wurden die Ackergeräte mit Zugstangen und Seilen durch Familienmitglieder und Bekannte gezogen. Eine mühsame Schinderei. Wenn es sich ergab, lieh sich Vater mal ein Pferd von einem Bauern aus.
Beim Hausbau 1932.
Nach der Machtergreifung der Faschisten 1933 geriet auch Brand-Erbisdorf und das neue Siedlungsgebiet unter ständige Kontrollen und Gewaltakte der SA und der Gestapo. Es gab Durchsuchungen und auch Verhaftungen, brutal und rücksichtslos. Auch Kurt geriet seit ungefähr 1935 in die Umtriebe der Nazis, weil er Bekannten und Freunden, die sowohl religiös als auch Kommunisten waren, geholfen hatte, sich in Verstecken den Verfolgungen zu entziehen. Aufgeschichtete, hölzerne Teile von großen, gerodeten Baumstümpfen und der Eiskeller des elterlichen Milchgeschäftes boten dafür hinreichende Bedingungen und konnten in Gefahrensituationen kurzzeitig genutzt werden, bis die Nazis verschwunden waren. Vater sprach nicht viel über seine Art von Hilfeleistung. Er tat einfach, was im richtigen Moment notwendig war, um das Leben von Menschen zu schützen.
Noch vor Kriegsbeginn hatte Vater mehrere Operationen wegen schwerer Darmerkrankungen über sich ergehen lassen müssen. Deshalb musste ihm 1941 letztlich ein künstlicher Darmausgang gelegt werden. Mit der Zeit konnte er auch damit einigermaßen umgehen und bewältigte mit dieser Art Behinderung die Herausforderungen des Lebens. Sein gesundheitlicher Zustand war es, der ihn vor dem Einzug in die Wehrmacht und damit vor der Metzelei an den Fronten bewahrte. So wurde er zu Tätigkeiten des Arbeitsdienstes vor Ort herangezogen.
Die Großeltern mütterlicherseits wohnten in der Freimühle, die sich an der Straße von Mönchenfrei nach Langenau befand. Obwohl sie schon sehr alt waren, ging ich als Kind immer gern zu ihnen. Beide hatten ein Herz für Kinder. Zwar lebten sie in ärmlichen Verhältnissen, aber für uns Kinder ließen sie sich immer etwas einfallen.
Die Freimühle bei Langenau im Winter 1963.
Opa Louis war eine Seele von einem Mensch, gutmütig, humorvoll mit herzzerreißenden „trockenen“ Bemerkungen, manchmal mit einem lustigen Unterton, wenn es um seine Frau Lina, also meine Oma, ging. Großvater war vor allem Kindern gegenüber herzensgut und stets bereit, ihnen etwas Vernünftiges bei zu bringen. Als gestandener Waldarbeiter war er sein ganzes Leben lang mit der Natur verbunden und er kannte wohl die Tücken und Geheimnisse des Waldes am besten. Holz war seine Leidenschaft und zugleich „Lebensrohstoff Nr. 1“, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Sommer wie Winter. Aus diesem Naturstoff kleine „Kunstwerke“ zu fertigen, machte ihm besonders Spaß und begeisterte uns Kinder.
Ein schweres Arbeitsleben lag hinter ihm, immer bemüht, für die Natur des Waldes das Beste zu tun, denn der Baum des Waldes sorgt schließlich für die Lebensfähigkeit künftiger Generationen. Wie wahr das auch heute noch ist!
Die Tätigkeit als Holzfäller war mehr als beschwerlich. Säge, scharfe Axt oder Beil, ein paar Keile oder Kieleisen und Brechstangen waren damals die wohl einzigen und wichtigsten Werkzeuge. Eine wahrhaft körperlich anstrengende Arbeit, von den schwersten Transporten des gefällten Holzes ganz zu schweigen. Dafür standen nur die eigene Körperkraft mit einigen Hilfsmitteln, wie Seile und Brechstangen, zur Verfügung, für den Abtransport dann zugkräftige Pferde. Von Kränen, Hubladern oder Motorsägen – wie sie heute verwendet werden – keine Spur, nicht mal ein Gedanke daran.
Großvaters Arbeitsgebiet lag meist in den umliegenden Wäldern. Oft war es damals üblich, dass die Kinder das Mittagessen in einem einfachen Blechgeschirr und Getränke bringen mussten. So gingen auch Tochter Ilse und die anderen Kinder „Essen tragen“, wie man damals zu sagen pflegte, oft auf weiten, beschwerlichen und auch nicht ungefährlichen Waldwegen und völlig allein in Wald und Flur.
Es war die schwere körperliche Belastung, die bei Großvater zu einer spürbaren Verschlechterung seines Sehvermögens führte. Die damaligen Erkenntnisse der Augenmedizin waren noch nicht dafür ausreichend, dem Einhalt zu gebieten, so dass es zu seiner Erblindung kam. 27 Jahre lebte er noch „im schwarzen Dunkel“, sonst körperlich noch durchaus gesund, in bescheidener „Waldarbeiter-Zufriedenheit“.
Großvater war nicht besonders gesprächig, aber wenn er uns Kindern erzählte, waren es spannende Geschichten, Erlebnisse, die er mit den Tieren des Waldes hatte, kleine Waldabenteuer eben, die uns faszinierten wie die schönsten Märchen. Dabei saß er entspannt und ruhig in seinem Sessel neben dem alten gusseisernen Ofen in der Küche, die zugleich Wohnstube war, oder im Sommer auf der Bank vor der Mühle.
Er hatte ein unglaubliches Gespür dafür, ob wir seinen Erzählungen auch aufmerksam zuhörten. Da er nichts sehen konnte, streute er in seine Geschichten die eine oder andere „galante“ Frage an uns ein, etwa: „Was hättet ihr gemacht, wenn ihr dabei gewesen wärt?“ Oder: „Hättest du denn eine Idee, wie man das hinkriegen kann?“ Oder so ähnlich. Er hatte die Gabe, uns zum Nachdenken zu bewegen, und das fand ich sooooo interessant!
Aber mehr noch: Wie ich schon schrieb, war er auch ein „kleiner Künstler“ und konnte für uns Kinder interessante Dinge aus einem Stück Holz hervorbringen. Von den kleinen einfachen Holzfiguren, wie Tiere und Bäume , für uns Kinder (meist war ich das allein oder mit meinem Cousin Hubert oder mit Herbert von der Nachbarfamilie in der Freimühle zusammen) bin ich noch heute begeistert, wenn ich bedenke, dass er alles nach Gefühl machen musste, ohne auch nur einen Lichtschein zu sehen. Unglaublich mit welcher Geschicklichkeit er es verstand, mit den schärfsten Messern aus einem unscheinbaren Stück Holz etwas für uns Wunderbares zu zaubern! Nur bat er darum, ihn dabei nicht zu stören, damit er sich geistig auf die Formgebung konzentrieren konnte. In Zeitabständen besprach er immer die nächsten Schritte mit uns.
Opa erklärte mir auch die verschiedenen Holzarten und wie man sie unterscheiden konnte, so auch, dass Linde für das Schnitzen am besten geeignet und deshalb besonders wertvoll sei. Einmal brachte ein Förster einige Scheiben verschiedenen Holzes mit, die für die Schule in Langenau als Anschauungsmaterial bestimmt waren. Da der Förster ein ziemlich strenger Mann war, wandte ich mich ohne zu überlegen an Opa, er solle mir doch zeigen, welches Holz das alles sei. Zu meinem Erstaunen tat er das auch, mit fachmännischem Können, mit Nase und Fingern. Damals muss ich so fünf, sechs Jahre alt gewesen sein. Es war die reinste Zauberkunst für mich. Nach dem Geruch des Holzes, seinem Harzgehalt und der Oberfläche konnte Opa Louis mit 100%iger Sicherheit alle Holzarten bestimmen.
Im Sommer zeigte uns Opa, wie man aus einem Aststück eine Pfeife machen konnte und auch viele andere Dinge, wie Schiffchen die wir den Bach hinunter steuerten. Das war das reinste „Waldparadies“ für uns Kinder.
Man sollte es nicht für möglich halten, aber eines Tages entdeckte ich Opa Louis sogar beim Holzhacken, und es gab nicht mal eine Verletzung oder einen Unfall! Die Holzscheite schnitt er dann noch akkurat in dünne, lange Späne, die er immer wieder brauchte, um ein ordentliches Feuer im Ofen zu entfachen. Wir Kinder spielten gern mit den langen Holzstäbchen und legten damit große Figuren auf dem Holzfußboden. Bevor man die Freimühle betrat, fiel wohl jedem auf, dass hier ein Waldarbeiter wohnen musste, denn neben dem Schuppen waren die gesägten Baumstücke oder das gehackte Holz meterhoch exakt gestapelt, für den nächsten Winter.
Gezeichnet von einem arbeitsreichen Leben, aber dennoch liebevoll und urgemütlich, so lernte ich Oma Lina als Kind in ihren letzten Jahren kennen. Wenn ich bei Oma zu Besuch war, gab es oft eine kleine Überraschung, etwa was Gebackenes oder eine Schüssel köstlicher Waldbeeren, die sie selbst gepflückt hatte. Später dann ging sie mit mir gemeinsam auf „Beerensuche“ und zeigte mir die schönsten Stellen im Wald, die den größten Ertrag brachten. Sie zeigte mir aber auch, wo Fuchs und Dachs ihr „Zuhause“ hatten, und sie machte mich immer wieder darauf aufmerksam, wie man in die Natur hineinhören müsse, um die Stille des Waldes zu fühlen. Manchmal pflückten wir gemeinsam Wiesenblumen am Waldesrand neben der Mühle. Einmal berichtete Großmutter von einem schweren Gewitter, bei dem durch Blitzschlag ein Baum in zwei Teile gespalten wurde. Gespannt stand ich vor diesem Riesenbaum und konnte kaum begreifen, wie ein Blitz so was fertig bringen konnte, mit welcher riesigen Gewalt. Ein anderes Mal zeigte sie mir die Stellen, wo sich gerne Kreuzottern aufhielten und ich sollte gut aufpassen, um nicht auf eine solche zu treten. Ein Schlangenbiss sei giftig und damit gefährlich. Auch erzählte sie davon, wie sie eines Tages eine gefährliche Kreuzotter mit einer Axt erlegt hatte. Dabei beobachtete sie, dass die Schlangenstücke noch bis zum Sonnenuntergang lebendig beweglich waren. Erst danach sei die Schlange tatsächlich tot gewesen.
Einige Zeit später, als ich schon Fahrrad fahren konnte, kam ich erschrocken mit Kreuzottern in Berührung. Ich war dabei, zu den Großeltern zu fahren und benutzte kurz vor dem Ziel den „Forstweg“. Ich vermutete zunächst, es seien Kuh- oder Pferdehaufen, doch Kreuzottern hatten sich in der Mittagssonne auf dem Weg gemütlich zusammengerollt, was ich nicht sofort bemerkt hatte. Erst als ich eine überfahren hatte und ein lautes Zischen zu hören war, wurde mir klar, was passiert war. Ich trat kräftig in die Pedale und war froh, noch mal davon gekommen zu sein.
Zum Frühstück oder auch zum Kaffee nachmittags war es Großmutters Angewohnheit, Brötchenstücke in ihren Milchkaffe oder in die frische heiße Kuhmilch zu geben, sicherlich deshalb, weil ihr Gebiss nicht mehr vollständig war. Eingeweichte, „geditschte“ Brötchen jedoch, konnte ich nie leiden, bis heute nicht.
So waren Geborgenheit und Güte die wesentlichen Eigenschaften meiner Großeltern in der Freimühle. Nur zu gern war ich bei ihnen und genoss als Kind ihre Liebe und Wärme, die sie mir gaben. Die Erkenntnisse, die sie mich entdecken ließen und ihre oft einfachen Ratschläge und Erfahrungen waren für mich ein Reichtum besonderer Art, für den ich heute noch dankbar bin.
Eine diamantene Hochzeit ist wohl ein recht seltenes Fest. Meine Großeltern durften es 1953 noch erleben. Ich war zusammen mit meinen Eltern dabei. Es war ein wunderbarer Sommertag, am Waldesrand blühte alles in Hülle und Fülle. Die Feier fand deshalb zum großen Teil auf der großen bunten Sommerwiese gegenüber der Freimühle statt. Urenkel Christel spielte begeistert auf dem Akkordeon. Hubert und ich vergnügten uns mit allerlei Spielchen auf der Waldwiese am Bach. Es war für mich wunderschön, mit Oma und Opa an diesem Festtag zusammen zu sein.
Selma schließlich war meine Oma väterlicherseits und von ihrem Verhalten und ihrem Charakter her das ganze Gegenteil von Oma Lina.
Sie bewohnte einige Räume im Erdgeschoss ihres Hauses im Zentrum Brand-Erbisdorfs und betrieb lange Zeit bis nach dem Krieg noch ihr Milchgeschäft, das über viele Jahre ganz gut florierte, dann aber allmählich dem Untergang geweiht war, denn das Aufkommen an landwirtschaftlichen Produkten war in der Nachkriegszeit gering und der Bezug von Waren auf Lebensmittelkarten wurde eingeführt. In die Jahre gekommen, war sie nicht mehr in der Lage, das Geschäft weiter zu führen. Ihr Mann Adolf, also mein Opa, war bereits 1936 verstorben.
Die Räumlichkeiten des Milchgeschäftes befanden sich immer noch im Keller und im Erdgeschoss des eigenen Hauses, ein Verkaufsraum, ein Eiskeller und noch mehrere Nebenräume. Zum Grundstück gehörten noch eine große Lagerhalle, die in den 50er Jahren an eine Ofenfirma vermietet wurde und noch mehrere Schuppen. Oma lebte nun schon viele Jahre allein und hatte das Milchgeschäft aufgegeben, weil sie es nicht mehr bewältigen konnte. Ebenso war ihr es praktisch unmöglich geworden, Haus und Grundstück in Ordnung zu halten. Also blieb diese Aufgabe für meinen Vater, der sich nach Kräften bemühte, das Haus einigermaßen durch eigene handwerkliche Leistungen zu erhalten.
Selma wurde schließlich bettlegerisch und musste versorgt werden. Diese Aufgabe fiel nun Mutter und Vater zu, neben Instandhaltungsmaßnahmen am Haus, das Selma gehörte. Mit fortschreitendem Alter wurde sie immer grimmiger, uneinsichtiger und verständnisloser, bis hin zu ihrer ausgeprägten boshaften Haltung. Bösartigkeit dieser Weise betraf nicht nur meine Eltern, sondern alle Menschen, die an ihr Bett traten oder in ihre Nähe kamen. Ihre übertriebene, herrschsüchtige Verhaltensweise rief Unverständnis und Abscheu bei fast allen hervor. Obwohl ich damals die Zusammenhänge nicht verstand, bewunderte ich Vaters Geduld dabei. Kinder, also auch mich, konnte sie überhaupt nicht leiden, was mich beizeiten dazu brachte, ihr aus dem Weg zu gehen. Eine unsympathische Oma und eine geizige dazu konnte ich nicht ertragen.
Ein Beispiel: Auf dem Schillerplatz vor ihrem Haus wurde ein Eiswagen zum Verkauf von Speiseeis aufgestellt. Eine Kugel 10 Pfennig, damals. Aber ich kenne keine einzige Gelegenheit, zu der mir Oma Selma mal einen Groschen für ein Eis gegeben hätte. Das tat für mich immer nur Vater. Obwohl sie es hätte tun können, habe ich von ihr kaum ein freundliches Wort oder irgendeine Geschichte gehört, ganz zu schweigen von ein paar Pfennigen für die Sparbüchse. Wenn Vater mit Arbeiten am Haus beschäftigt war, war auch ich oft dabei und wenn es mal um eine Flasche Limonade oder etwas vom Bäcker ging, dann war er es, der mir das nötige Kleingeld gab.
So blieben mir von Oma Selma nur unangenehme Erinnerungen, Sturheit, Verdruss, Hass, Unleidlichkeit gegenüber Kindern. Heute kann ich sagen, dass sie in hohem Alter kaum mehr Willens war, andere Menschen zu akzeptieren, geschweige denn ihre Hilfe mit Dankbarkeit anzuerkennen. Ein Dankeschön habe ich nie von ihr gehört. Nie! Mein Vater Kurt sagte mir Jahre später, er habe gleiches erlebt, nie ein Dankeschön.
Die letzten Monate ihres Lebens verbrachte sie in einem Pflegeheim in Olbernhau im Erzgebirge. Eine Pflege zu Hause war unmöglich geworden. Oma verstarb dann 1953 und meine Eltern mussten sich entscheiden, ob sie das Erbe antreten wollten oder nicht. Wahrscheinlich hatte mein Vater nicht überblicken können, was da auf ihn zu kam. Die Mieten waren extrem niedrig, die laufenden Kosten für das Haus und die Instandhaltung hoch. Die Mieteinnahmen konnten die Ausgaben niemals decken. So entstanden ihm Belastungen bis an die Grenze des Möglichen. Ende der 50er Jahre überschrieb mein Vater das Grundstück schließlich der Stadt Brand-Erbisdorf ohne Verrechnung, denn sein gesundheitlicher Zustand hatte sich enorm verschlechtert. Die Gebäude wurden in den 90er Jahren abgerissen. An der gleichen Stelle wurde ein modernes Wohn- und Geschäftshaus errichtet.
Rettung von Mutter und Kind
Herbert aus Dresden war der Cousin meines Vaters Kurt. Zwischen ihnen gab es viele Gemeinsamkeiten. Ab und an gab es gegenseitige Besuche, Vater war fasziniert von der Kunststadt Dresden und Herbert war ab und an mal froh, das Großstadtleben zu verlassen und ein paar Tage auf dem Lande in Brand-Erbisdorf zu verbringen. Bereits am 15. August 1939 wurde Herbert, wie viele junge Männer im wehrpflichtigen Alter, zur Wehrmacht eingezogen. Herbert musste in den Krieg ziehen. Er hatte mit meinem Vater vereinbart, falls in Dresden etwas Schlimmes passieren würde, Gertraut unbedingt zu helfen, wenn er nicht vor Ort sei. Er hatte seine Frau im Sachsenwerk Niedersedlitz kennen gelernt, wo beide arbeiteten. Herbert war gelernter Kaufmann und Gertraut fand eine Ausbildung als Stenotypistin.
13. Februar 1945 zwischen 21:00 und 22:00 Uhr: Die Sirenen kündigten Luftalarm an. In Brand-Erbisdorf war ein übernatürliches lautes Brummen aus westlicher Richtung zu hören, für jeden unüberhörbar! Minuten später sah man in östlicher Richtung „Christbäume“ am Himmel. So nannte man die Markierungen für Bomber zu einem bestimmten Zielgebiet. Vater hatte recht: Es konnte hier nur gegen Dresden gehen. Einige Minuten später hörte man gewaltige Detonationen, schlimmer als Donner bei einem schweren Gewitter. Bald darauf färbte sich der Himmel im Osten glutrot. Ein gespenstisches Bild! Vater befürchtete das Schlimmste. Noch in der Nacht machte er sein Fahrrad klar, um Getraut aus Dresden heraus zu holen, denn für ihn war klar, dass es von Dresden nach Freiberg keinerlei Verkehrsverbindungen mehr gab, keinen Zug, einfach nichts ging mehr.
Im Morgengrauen des 14. Februar nahm Vater Kurt mit seinem Fahrrad Kurs auf Dresden, vorbei an vielen Flüchtlingen, die Dresden wegen der schweren Bombenabgriffe angloamerikanischer Bomber fluchtartig verlassen mussten, vorbei an einer Unmenge von Toten, die den Angriff oder die Flucht nicht überleben konnten. Die fast 50 km müssen für Vater grausam gewesen sein. Unvorstellbar, wie er es trotzdem schaffte, bis in die Innenstadt von Dresden vor zu dringen, denn alles war mit Trümmern übersät, keine Straße mehr normal passierbar. Vater erzählte mir von der Verbrennung ganzer Berge von Leichen auf dem Altmarkt und einem entsetzlichen Gestank, von der Ohnmacht noch lebender Menschen, die nach Hilfe schrien. Zunächst blieb ihm nur der Ausweg, bis in die Neustadt vor zu dringen und seine Tante Anna (Gertrautes Schwiegermutter) in dieser Trümmerwüste zu suchen. Das tat er und fand schließlich Anna unverletzt und einigermaßen beherrscht vor. Glücklicherweise war sie noch von Gertraut informiert worden, dass sie mit ihrem Kind die Stadt über Gönnsdorf verlassen würde, um sich dann nach Brand-Erbisdorf durch zu schlagen. Also wusste Anna über die beiden Bescheid. Vater war nun darüber informiert, was geschehen war und was die beiden zu ihrer Rettung unternommen hatten.
Zwischenzeitlich gab es einen weiteren Bombenangriff, in den auch Vater verwickelt wurde, konnte ihn aber in einem Neustädter Luftschutzkeller gerade noch überstehen. Nach dem Angriff packte er das Nötigste an Gepäck von Anna auf sein Fahrrad und kämpfte sich wieder zurück bis nach Freiberg durch. Es muss eine äußerst strapaziöse Fahrt mit großer körperlicher Anstrengung gewesen sein.
Erst in der Nacht zum 18. Februar kam Vater abgekämpft aus Dresden mit seinem Fahrrad zurück. Gertraut hatte in aller Not mit Heidi einen anderen Weg nach Brand-Erbisdorf nehmen müssen und somit hatte seine Rettungsaktion zunächst keinen Erfolg. Doch war etwas später die Freude riesengroß, als sich alle in die Arme schließen konnten und Getraut mit Töchterchen Heidi endlich in Brand-Erbisdorf eintraf. Beide erreichten Brand ebenfalls über Umwege, über Niedersedlitz, Heidenau, Altenberg, Moldau (Moldava) und Berthelsdorf unter Benutzung von Nebenbahnen, denn die Strecke Dresden – Freiberg war größtenteils zerstört.
Die Familie rückte zusammen. Vater machte für Mutter und Kind eine Kammer im ersten Stock zurecht, so dass sie beide ungestört über längere Zeit ganz gut untergebracht werden konnten. So war auch für Gertraut und klein Heidi zumindest für das Nötigste gesorgt. Sie erinnerte sich noch Jahre danach mit Tränen in den Augen daran, als meine Mutter ein „festliches Mahl“ auf den Tisch zauberte: Darauf wurde ein Berg frischer Pellkartoffeln geschüttet – und alle durften sich endlich mal wieder satt essen! Es muss Gertraut wie ein „kleines Paradies“ in Kriegszeiten vorgekommen sein, denn Heidi konnte sich auf dem Lande bald recht gut erholen. Die Dresdnerin half im Garten und bei der Feldbestellung im Frühjahr, auch oft unter der Gefahr des Angriffes von amerikanischen und englischen Tieffliegern, so dass sie ihre Arbeit oft unterbrechen mussten. Gertraut nähte auch verschiedene Kleidungsstücke für die Familie. Das konnte sie besonders gut.
Die Furcht vor Luftangriffen war bei allen nach wie vor groß. Deshalb hatte mein Vater Kurt auf dem Feld einen Unterstand gebaut, in dem etwa 8 Personen unterkamen. Das Objekt war außerordentlich gut mit Bäumen und Sträuchern getarnt, so dass man schon ziemliche Mühe hatte, um es zu entdecken. Wie sich zeigen sollte, war das eine sehr weise Idee meines Vaters, denn selbst bei Angriffen mit Tieffliegern erwies sich das Ganze als perfekte Schutzmaßnahme für die Familie.
Um Frauen und Kinder zu schützen, verwirklichte Vater noch eine andere Idee: Er hatte über Jahre einen großen Vorrat an Wurzelholz aus dem Wald angelegt, da in Kriegszeiten weder Kohle noch andere Brennstoffe zu kriegen waren. Die meterhohen großen Holzhaufen, wir nannten sie „Stöcke“, waren gut geeignet, Frauen und Mädchen der Familie vor Übergriffen zu schützen. Deshalb baute er auch in einem der Holzhaufen einen Unterstand aus, in dem die weiblichen Familienmitglieder im Gefahrenfall Unterschlupf finden konnten. Das erwies sich als besonders notwendig, als Anfang Mai die russischen Soldaten auch in unser Gebiet um Freiberg einzogen und Vergewaltigungen an der Tagesordnung waren.
So verblieben Mutter und Kind letztlich in noch gut behüteter ländlicher Umgebung fast ein Vierteljahr und kehrten erst im Mai wieder in ihre Heimatstadt zurück, mit dem ersten Güterzug, der wieder bis an den Stadtrand Dresdens fuhr.
Neues Leben
Im September 1945 erblickte ich das Licht der Welt. Im Sternbild „Jungfrau“ mein Leben zu frönen, schien keine schlechten Aussichten erkennen zu lassen. So war die Freude von Ilse und Kurt doppelt groß, nun auch noch einen Jungen in der Familie zu haben. Etwas quirliger als meine beiden älteren Schwestern Marianne und Getraute soll ich schon gewesen sein und man hatte sicherlich einige Mühe mit mir, mich auf eigene Füße zu stellen. Aber Bewegung ist nicht alles. Schreien konnte ich auch, und zwar laut und ziemlich gut, was meinen Eltern manche Nacht geraubt haben soll. Im Dezember kam es zu einem Besuch von Gertraut aus Dresden, die sich auf besondere Weise für die herzliche Aufnahme im Hause meiner Eltern nach dem Bombenangriff auf Dresden bedanken wollte. Während des Besuchs bemerkte Gertraut an dem Baby in den Augen eine Grautrübung, was nicht normal zu sein schien. Meine Mutter selbst hatte es nicht bemerkt. Die Folge aus dieser Beobachtung war Gertrautes Empfehlung, das Kind schnellstens einem Augenarzt vorzustellen. Anfang 1946 endlich kam es zu einer Vorstellung in einer Dresdener Augenklinik, die nur noch teilweise erhalten geblieben war. Augenarzt Dr. Baas diagnostizierte „angeborenen Grauen Star“, womit die Richtigkeit der beobachteten Linsentrübung bestätigt war. Nun blieb nur die Möglichkeit einer Operation auf beiden Augen, und das unter den schlechtesten und ungünstigsten Bedingungen, die man sich nur denken kann. Außer an herkömmlichen Operationsinstrumenten fehlte praktisch alles. Außerdem war ständig mit Unterbrechungen der Elektrizitäts- und Wasserversorgung zu rechnen. Unter diesen Umständen verlief die Staroperation im Lebensalter von einem halben Jahr so recht und schlecht, aber auf keinen Fall zufriedenstellend. Schon wenige Tage nach der Operation wurde klar, mit erheblichen, noch unvorhersehbaren Komplikationen rechnen zu müssen.
Heute sind Staroperationen kaum noch ein unbeherrschbares medizinisches Problem. Viele Eingriffe sind auch ambulant möglich. Inzwischen haben sich Medizintechnik, Operationsverfahren und Therapiemöglichkeiten auf ein hohes Niveau weiterentwickelt. Heute weiß man aus wissenschaftlichen Untersuchungen wesentlich mehr über Ursachen des Grauen Stars. Besonders starken Einfluss auf das Entstehen dieser Augenkrankheit haben in erster Linie Vitamin- und Mineralstoffmangel, in zweiter Linie auch Vererbungsfaktoren. Hinzu kommen Fehlernährung sowie Angst- und Stress-Situationen, die eine Starentwicklung zusätzlich begünstigt haben sollen, so die Aussagen mehrerer Augenärzte und Wissenschaftler nach jüngsten Forschungsergebnissen.
Die Operation gelang unter unsagbar schwierigen Bedingungen also nur teilweise, so dass ich bereits als Kleinkind mit großen Sehschwächen klar kommen musste. Dabei war es mit dem rechten Auge stets schlechter bestellt, als mit dem linken. Räumliches Sehen war auch nach der Operation praktisch unmöglich. Bis heute habe ich räumliches Sehen niemals wahrnehmen können, was ich insgesamt als eine unbeschreibliche Freiheitseinschränkung empfand. Bei allem, was ich tat, fehlte jegliches räumliches Empfinden, das jeder Mensch hat, wenn er mit beiden Augen normal sehen kann. Also musste ich unter erschwerten Bedingungen erst lernen, ein eigenes Raumgefühl ohne voll funktionsfähige Augen zu entwickeln, was für mich hieß, mit den Auswirkungen des „Grauen Stars“ mein Leben zu verbringen.
Kindheitsfoto 1948
Die Taufe des „Kleenen“ sollte im Dezember 1945 stattfinden, in der Adventszeit, kurz vor Weihnachten. Der Krieg war zwar vorbei, die Nachwirkungen immer noch entsetzlich. Doch auch unter diesen Umständen sollte meine Taufe ein fröhliches und freudiges Ereignis werden. Nach der „göttlichen Zeremonie“ in der Kirche ging es mit den Gästen zurück in unser Siedlungshaus am Rande der Stadt. Die kurze Taufpredigt soll zum Inhalt gehabt haben, „Gott würde alles dafür tun, dass ich in Gesundheit und Glück leben könne und aus mir ein kluger und fleißiger Mensch werde“. So erzählte es mir in meiner Schulzeit Patenonkel Hermann.
Jedenfalls müssen Eltern und Gäste ziemlich lustig gewesen sein. Da es sonst nichts gab, hatte Vater eigenen Obstwein angesetzt, mit Beeren und Früchten aus dem eigenen Garten. Mutter Ilse hatte eine riesengroße Emailleschüssel mit Kartoffelsalat gezaubert, für den Nachmittag wurde ein Kuchen gebacken und Kaffee gab es auch. Am Abend nahmen wieder alle am großen Küchentisch Platz, der strapazierfähig mit dunkelgrünem Linoleum bezogen war. Der „große Asch“ (so nannte Mutter die Schüssel in sächsischem Dialekt) mit dem Kartoffelsalat wurde auf den Tisch gestellt und jeder konnte sich nach Herzenslust bedienen. Endlich einmal satt essen – das war wohl der Leitspruch für diese Tauffeier in der schweren Zeit, da viele hungern mussten.
All das kombiniert mit Vaters Hausweinsorten soll alles in allem ein fröhliches Fest gewesen sein. Besonders das so genannte „Gläselrücken“ war am späten Abend noch ein aufregendes und lustiges Erlebnis, von dem jahrzehntelang noch gesprochen wurde.
Brüderchen und Schwesterchen
Marianne und Gertraute waren ein ganzes Stück älter als ich, 17 bzw. 15 Jahre älter. Marianne wurde 1928 geboren und hatte Kontoristin gelernt. Gertraute erblickte 1930 das Licht der Welt und wurde als Strickerin ausgebildet. Dann gab es mich. Die Verwandten nannten mich immer einen „Nachzügler“, was ich weder begreifen noch leiden konnte, denn ich fühlte dabei einen bitteren Beigeschmack von Geringschätzigkeit und Unwichtigkeit. Logisch, dass die beiden jungen Damen in der Zeit von 1945 bis 1950, als ich Kleinkind war, ganz andere Interessen hatten als ich. Verständlicherweise waren also auch ihre Gedanken ganze andere als die um ein Brüderchen. Vielleicht war ich in den ersten Lebensmonaten noch ganz interessant für die beiden und sie konnten mit mir allerlei liebevolle Dinge anstellen oder waren auch für Mutter eine große Hilfe in der Babybetreuung.
Als ich dann etwas größer war, änderte sich das Zusammenspiel mit den beiden Schwestern in „geheimnisvoller“ Weise. Jetzt lernte ich nicht nur wichtige Dinge von Mutter und Vater, sondern ganz bewusst auch von meinen Schwestern. Es waren wieder ganz andere Erfahrungen, die sie gemacht hatten. Beispielsweise brachte mir Marianne erste Schritte im Malen und Zeichnen bei und beschäftigte sich damit, mir Farben zu lernen. Gertraute wiederum war es, die gern und leidenschaftlich „Mensch ärgere Dich nicht“ oder „Halma“ spielen konnte. Von ihr erlernte ich die Spiele, aber verlieren konnte ich nicht so gut und es gab manche Tränen.
Zusammen mit meinen Schwestern Marianne und Gertraute.
Als die beiden Schwestern verheiratet waren, kamen endlich zwei Schwager hinzu, die mir auf ganz andere Weise das Eine und das Andere beibrachten. Während Rudolf gerne mit mir Drachen baute, auch riesengroße, brachte mir Heinz kleine Kniffe im Umgang mit Farben bei, denn er war Maler von Beruf. Noch später lernte ich von Heinz alles, was für Malerei und Tapezieren wichtig war, unbezahlbare kleine und große handwerkliche Tricks. Aber was mich am meisten faszinierte, waren seine Modellbahnanlagen. Die Begeisterung für die Modellbahntechnik ließ mich nicht mehr los.
Gertraute und Rudolf wiederum ließen mich ab 1957 zusammen mit Tochter Ulrike an verschiedenen Ausflügen teilnehmen, denn sie hatten inzwischen eine schnittige BK 350, ein Motorrad mit Seitenwagen. Unvergesslich sind für mich die Fahrten ins Erzgebirge und in den Tharandter Wald.
Während meiner Lehrzeit, als ich zusätzlich im Abendstudium das Abitur machte, gewährten mir Marianne und Heinz oft Unterkunft, besonders während der Wintermonate. Unglaublich, dass sie auch das noch auf sich nahmen. Ein besonders herzliches Verhältnis verband mich mit ihren beiden Kindern Bernd und Heidi, die ich auch gern bei Schulaufgaben unterstützte.
So kann ich behaupten, ich hatte die besten Schwestern, die besten. Noch heute kann ich nicht begreifen, warum gerade sie so früh von uns gegangen sind. Gertraute verstarb nach langer schwerer Krankheit 1993 an Leukämie. Marianne konnte nach einem Gehirnschlag nicht wieder ins Leben zurückgeholt werden und verschied 1998.
Ich verehrte auch Tanten und meinen Onkel als Kind sehr. Sie waren gütig und hatten ein Herz für die Jüngsten. Meine Tante Frieda war die Älteste meiner zwei Tanten. Oft war sie zu Geburtstagen oder Festtagen bei uns und spielte gern mit uns Kindern. Wenn ich sie in ihrer Wohnung gegenüber dem Freiberger Bahnhof besuchte, erfuhr ich in spannenden Geschichten vieles von früher. Und sie konnte gut und spannend erzählen, was mir besonders gefiel. Gemeinsam unternahmen wir Gänge in die Stadt und sie berichtete dabei, was sich in der Bergstadt früher abgespielt hatte und dass es sogar eine Straßenbahn gab. Immer aber wollte Tante Frieda auch von mir so allerhand erfahren. Ständig fragte sie, was ich am liebsten anstellte und machte mir Mut, meine Vorstellungen auch umzusetzen. Bei Gelegenheit spielte sie mit mir und meiner Nichte Ulrike gern mal Federball und konnte sich daran erfreuen, dass wir Kinder besser und schneller waren als sie selbst.
Dann gab es Tante Rosel, die ihren Mann auch im 2. Weltkrieg verloren hatte und nun etwas einsam, aber glücklicherweise mit der Familie von Tochter Inge versuchte, ihr Leben zu leben. Auch Tante Rosel war gütig. Wir Kinder, ihr Enkel Hubert und ich, gingen oft mit ihr in den Wald auf dem Weg zu den Großeltern in die Freimühle. Und sie kannte die besten Stellen, um eine üppige Beerenernte einzubringen. Mir machte das Ganze immer Spaß, Hubert liebte mehr das Waldabenteuer mit Stöcken und allerlei Unsinn. Mir sind noch gut die Tage in Erinnerung, als Tante Rosel mit uns Kindern nach Freiberg fuhr und ein bekanntes Café auf der Erbischen Straße besuchte, um mit uns gemeinsam frisch geschlagene Sahne und Eis zu genießen. Ein Erlebnis der Sonderklasse war das für uns Kinder.
Auch Onkel Willi, der mit seiner Frau Dora ein altes Bergmannshaus in Brand-Erbisdorf bewohnte, war ein sehr gütiger Mensch, aber mit deutlich erkennbarer Zurückhaltung, die ich mir bis heute nur schwer erklären kann. Doch sind mir die wenigen Besuche bei uns in guter Erinnerung. Wenn er aber bei uns war, hatte er ein Herz für uns Kleinen und brachte uns bei, wie man aus Baumzweigen Pfeifen oder andere Dinge leicht herstellen konnte. Er war es auch, der mir die ersten Tipps im Schnitzen von Holz beibrachte. Aber für Unternehmungen mit uns Kindern konnten wir ihn nie überzeugen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, seine Frau Dora hatte hierzu das entscheidende Wort gesprochen.
Politische und gesellschaftliche Veränderungen
Der Beginn meines Lebens lag also wenige Monate nach Kriegsende, gewissermaßen noch unter altkapitalistischen Verhältnissen und einer totalen Katastrophe, die die faschistische Diktatur hinterlassen hatte. Deutschland hatte den Krieg verloren und in den vergangenen Jahren anderen Völkern unermessliches Leid zugefügt. An den Fronten mussten Millionen Menschen für einen sinnlosen Krieg ihr Leben opfern. Millionen von Menschen wurden in Konzentrationslagern umgebracht. Nun war Deutschland durch die Siegermächte in Besatzungszonen aufgeteilt worden. Der Osten Deutschlands stand unter sowjetischer Hoheit, wo sich neue gesellschaftliche Verhältnisse auf friedlicher und demokratischer Grundlage mit sozialistischer Orientierung entwickeln sollten. Ein Umwälzungsprozess, in dem die meisten Menschen nur einen Wunsch verspürten: Frieden, nie wieder Krieg! Die Menschen hier waren froh, endlich wieder in eine friedliche Zukunft blicken zu können und glaubten fest an eine schöne Zeit und ein besseres Leben ohne nationalsozialistische Tyrannei, ohne Rassenhass und Menschenverfolgung. Fieberhaft gingen sie an die Beseitigung der Trümmer und an den Wiederaufbau.
Der Westen Deutschlands war durch die Besatzung der westlichen Siegermächte USA, Großbritannien und Frankreich dominiert. Durch zahlreiche westliche Hilfen, vor allem Kapitalhilfen, setzte sich hier der Wiederaufbau und die Wiederbelebung der Wirtschaft bedeutend schneller durch als im Osten. Das zeigte sich auch in der schnellen Verbesserung des allgemeinen Lebensniveaus. Schon 1948 waren deutliche Unterschiede zwischen westlichem und östlichem Lebensniveau erkennbar. Andererseits war unübersehbar, dass die Westmächte, allen voran die USA, in engem Zusammenwirken mit dem westdeutschen Monopolkapital den Einfluss der Sowjetunion auf die Entwicklung in den westlichen Besatzungszonen in keiner Weise zulassen wollten. Mit anderen Worten: Einflüsse kommunistischer Art sollten in jedem Falle verhindert werden. Die Einführung einer separaten westdeutschen Währung, der DM, war letztlich der Ausgangspunkt für die Gründung der Bundesrepublik. Tage danach folgte die Gründung der DDR. Die Spaltung Deutschlands war für Jahrzehnte neue Realität und brachte für das Leben der Menschen in Ost und West gewaltige Veränderungen.
Einen großen Teil meines Lebens, immerhin 40 lange Jahre, verbrachte ich in der ehemaligen DDR. Ohne alle Unzulänglichkeiten, von Diktatur bis Machtmissbrauch, die inzwischen hinreichend aufgedeckt worden sind, „schönreden“ oder „verharmlosen“ zu wollen, vollzog sich das Wesentliche meiner Entwicklung gerade eben hier in diesem Staat, der sich mit dem Prädikat „Sozialismus“ schmückte. In dem festen Glauben, Gutes für den Frieden und die Republik zu tun, gab ich mein Bestes. Andere taten das genau so auf ihrem Gebiet, Sportler, Wissenschaftler, Künstler, Architekten, Ärzte … und nicht zu vergessen die Arbeiter in den produzierenden Betrieben und die Bauern im landwirtschaftlichen Bereich. Ihnen allen zolle ich höchste Anerkennung für tatsächlich erbrachte Leistungen, oft auch Höchstleistungen, die unter einfachsten Bedingungen unter Aufbietung höchster körperlicher und geistiger Kräfte erreicht werden konnten. Mit etwas Abstand sehe ich heute, dass diese Anstrengungen oft nicht oder nicht genügend gewürdigt, bewertet oder anerkannt wurden. Dem entgegen bleibt mir heute (unter kapitalgesteuerten Verhältnissen) allerdings die Feststellung, dass der Wert von Arbeitsleistungen unter exponierten, oft schwer zu erkennenden Ausbeutungsbedingungen noch wesentlich schlechter bewertet werden. Das Ziel, die sozialistische Gesellschaft zu errichten, blieb Programm und in den Anfängen stecken. Weder das Bewusstsein der Menschen noch die Wirtschaftskraft, weder die Politik der SED noch die mit dem Mauerbau 1961 geschlossenen Grenzen waren hinreichend, um dieses Ziel zu erreichen. Zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den politischen Verhältnissen, mit der gesamten Lebenslage, mit der Versorgung und eingeschränkter Freiheit sowie Reiseverboten in das kapitalistische Ausland führten 1989 schließlich zu einer friedlichen Revolution außergewöhnlicher Art in der DDR, die letztlich Ausgangspunkt für die Wiedervereinigung Deutschlands und weitreichende Veränderungen in ganz Europa wurde.
2. Kapitel: Von Handicaps, Freiheit, Licht und Lebensmut
Sehen ohne Licht ist gänzlich unmöglich. Wir brauchen unsere Augen, um unsere Umwelt wahrzunehmen. Und wir brauchen Licht, um Personen, Tiere, Gegenstände, Landschaften erkennen zu können und mit ihnen umzugehen. Wir brauchen unsere Augen, um unser Leben wirklich leben zu können, Gefühle zu entwickeln, Schönheit zu empfinden, Farben zu lieben, Natur und Landschaft zu genießen. All das geschieht mit Licht. Dazu gibt es keine Alternative. Keine!
Denken Sie einmal nach: Sie haben zwei Augen. Zwei! Normalerweise sehen Sie mit dem linken Auge 100 % und mit dem Rechten ebenso viel. Teilen Sie das Ganze in Achtel für das gesamte Sehvermögen auf, so sehen Sie also links 4/8 und rechts 4/8. Was aber passiert den Menschen, die von dem Ganzen nur noch einen Bruchteil davon, vielleicht nur 1/8, zur Verfügung haben? Folglich fehlen 7/8. Im konkreten Fall: Rechtes Auge blind, linkes Auge nur noch 1/8 Restsehvermögen. Deshalb nimmt dieses Buch diese Situation zum Ausgangspunkt für eine positive Lebenshaltung, weil ein Handicap solcher oder anderer Art nicht notwendigerweise eine negative Lebenseinstellung erzeugen muss. 1/8 Licht bedeutet also nicht zwangsläufig auch nur 1/8 Sicht auf die Dinge des Lebens.
So begann mein Leben im Kleinkindalter zunächst mit Hindernissen und Einschränkungen, was mir erst viel später bewusst wurde. Die Operation hatte mir zwar die Linsentrübung genommen, doch sah ich auf dem linken Auge nur noch etwa 30 % und auf dem rechten höchstens 10 %, was man nie so genau ermitteln konnte. Räumliches Sehen war völlig unmöglich, also musste ich im Wesentlichen mit einäugiger Orientierung zurechtkommen. Aus heutiger Sicht bedeutet das: Mein künftiger visueller Lebensverlauf war damit vorgezeichnet, was als Kind zu begreifen zunächst unmöglich erschien und auch so war. Was mir immer klarer wurde: Ich musste damit fertig werden und lernen, mit meiner eigenen Situation bestmöglich um zu gehen. Im Folgenden will ich von einigen Passagen und Erlebnissen schreiben, wie mir das gelang oder auch, wie mir es nicht gelang. In diesem Sinne verdanke ich meinem Vater Kurt und meinem Großvater Louis (der übrigens lange Jahre blind war) sehr viel, die mir immer wieder sagten: „Junge, mach einfach weiter, du wirst es schon schaffen!“
Unter diesen Umständen also wuchs ich auf. Noch kam ich niemals auf die Idee, mir über mein Handicap irgendwelche Gedanken zu machen. Tag für Tag gewöhnte ich mich als Kleinkind Schritt für Schritt an meine Umgebung, etwa vergleichbar damit, als Baby das Laufen zu lernen. Nie hatte ich erleben können, meine Umwelt wirklich räumlich wahr zu nehmen. So blieb mir die einfache Erkenntnis: Die Welt war für mich so, wie ICH sie selbst wahrnehmen, leben und erleben konnte. Anders war sie für mich nicht vorstellbar. Neben der Unfähigkeit räumlichen Sehens kamen bedeutende Schwierigkeiten infolge mangelhaften Sehvermögens hinzu, was sich negativ auf zahlreiche körperliche Funktionen und Tätigkeiten auszuwirken begann. Unzureichende Erkennungsfähigkeit und mangelhaftes Beobachtungs- und Vergleichsvermögen waren damit verbunden. Mit all diesen Bedingungen hieß es also fertig zu werden.
Bald, so mit drei, vier Jahren, musste ich lernen, wie bedeutsam Licht für mich war. Wollte ich bei meinen Beschäftigungen und im kindlichen Spiel etwas erreichen, war ausreichendes, gutes Licht Voraussetzung, um Dinge und Vorgänge überhaupt erkennen und verfolgen zu können. Am günstigsten waren für mich immer Plätze in gutem Tageslicht, in Räumen am besten in Fensternähe. Die Abende waren für mich besonders anstrengend, denn oft gab es eine „Stromsperre“, weil in der Nachkriegszeit nicht genügend Strom in den Kraftwerken erzeugt werden konnte. Dann wurde die Versorgung mit Elektroenergie einfach für Stunden unterbrochen. Nun half nur Kerzenlicht. In der Dämmerungszeit hielt Mutter ab und zu eine „Dämmerstunde“ ab und erzählte Märchen oder Geschichten von früher.
Vater hatte auch begriffen, wie wichtig richtige Beleuchtung für mich war. So besorgte er später eine Zuglampe über dem großen Küchentisch, damit man die Intensität der Beleuchtung am Platz nach Bedarf mit der Höhe der Lampe einstellen konnte. Das half bei vielen Dingen.
Seither hat Licht für mich nicht nur große, sondern sogar herausragende Bedeutung. Zuweilen setze ich Licht mit „Augenlicht“ gleich. Wie sonst, wenn nicht mit den Augen, sollte man Licht in all seinen Variationen wahrnehmen können. Wenn Sie als Leser selbst genau wissen und erfahren wollen, wie wichtig Ihnen Licht und Augenlicht sind, dann verbinden Sie sich mit einem schwarzen Tuch beide Augen für ein paar Stunden und versuchen Sie, in dieser Zeit in Ihrer gewohnten Umgebung genau das zu tun, was Sie in dieser Zeit schon immer getan haben. Ihre Erkenntnisse werden Sie verblüffen und Ihnen zu neuen Überzeugungen verhelfen, wenn Sie offen dafür sind.
Um die Wirkungen solcher eigenartigen Umstände zu verdeutlichen, einige Beispiele:
Unser Haus war Teil einer langgezogenen Siedlung im Süden der Stadt. Das Grundstück war groß genug für mich, um mich als Kind nach Herzenslust entfalten zu können. Natürlich wollte ich auch gern mit den anderen Kindern auf der Straße spielen. Diese aber war in einem unbeschreiblich schlechten Zustand. Beim Bau der Siedlung hatte man sie zwar anlegen müssen, aber Schotter und Steine nur mit Sand und Erde verfüllt, so dass die scharfen spitzen Steine zentimeterhoch herausragten. Die meisten Kinder kamen trotz alledem gut damit zurecht, nur ich nicht. Das mir fehlende räumliche Sehen hatte häufiges Stolpern und Stürze zur Folge. Aufgeschlagene Knie und andere Verletzungen an Beinen und Armen waren an der Tagesordnung. Weinend und blutüberströmt suchte ich mein Zuhause. Es dauerte Jahre, bis ich ein Feingefühl in den Füßen entwickelt hatte, um derartige Unfälle zu vermeiden. Erst im Schulalter mit etwa 10 Jahren war ich in der Lage, die „Stolpersteine“ zu besiegen.
Eine andere Angelegenheit waren Ballspiele. Jedes Kind spielte gerne mit Bällen, auch ich. Solange ich allein spielte, fiel mein Handicap kaum ins Gewicht. Erst die Fälle, wo es darum ging, den Ball nicht nur zu werfen, sondern ihn auch zu fangen, brachten mich jahrelang fast zur Verzweiflung, weil mein räumliches Sehvermögen dafür fehlte. Das habe ich als Kind noch hingenommen. Schlimmer aber war die emotional negative Wirkung, die dadurch in der Folge ausgelöst wurde, denn in den meisten Fällen war ich der Verlierer der Spiele oder die Kinder lehnten es boshaft ab, mit mir zu spielen oder mich in die Spielgruppe einzubeziehen. Das machte nicht nur mutlos, sondern später in der Schulklasse auch abweisende Tendenzen meiner Mitschüler mir gegenüber deutlich. In den ersten Schuljahren befand ich mich deshalb in einer ernsten Lage. Demgegenüber lernte ich gern und eifrig, konnte von Anfang an gute bis sehr gute Ergebnisse aufweisen.
Beizeiten, noch im Kleinkindalter, begriff ich allmählich, wie wichtig Farben für mein Empfinden und meine Lebensfähigkeit waren. Ziemlich schnell lernte ich Farben bewusst zu unterscheiden und die gefühlsmäßige Wirkung auf mein Befinden kennen. Rot, Gelb, Blau und Grün waren meine Favoriten, wenn es um einfühlsame Einblicke und Überblicke ging. Doch nicht nur das. Mit meinem bescheidenen Sehvermögen kam es vor allem darauf an, die Erkennungsfähigkeit von Dingen durch Farben zu unterstützen. Kontraste spielen für mich seit ich denken kann eine herausragende Rolle dabei, was mir hilft, das tägliche Leben zu meistern. Kombinationen aus Schwarz und Weiß, Rot und Gelb, Blau und Weiß beispielsweise haben mein Umweltempfinden stark beeinflusst. Noch heute sind starke Kontraste für mich im täglichen Leben wichtig, besonders wenn es um die Ablage und das Wiederauffinden von Dingen geht. Hier achte ich darauf, beispielsweise meine dunkelgraue Brille nicht auf eine dunkelgraue Unterlage abzulegen, sondern vielleicht auf ein weißes Tischtuch oder ein helles Handtuch. Auch werden Sie noch davon lesen, was mir später Zeichnen, Malen und künstlerisches Gestalten bis hin zu moderner Grafik bedeuteten. Hierbei ist meine kontrastreiche, eher plakative Entwicklungslinie nicht zu übersehen.
Wer nicht genügend gut sehen kann, benötigt früher oder später Sehhilfen. Damals wie heute war das für mich die Brille, die ich kurz vor meiner Schuleinführung vom Augenarzt verordnet bekam. Mit Widerwillen habe ich seine Entscheidung zur Kenntnis genommen, doch half es nichts, die Brille abzulehnen, wenn ich in der Schule einigermaßen bestehen wollte. Ab dem ersten Schultag saß ich in der ersten Bankreihe, also nahe der Tafel. Trotzdem hatte ich alle Mühe, Buchstaben, Texte und Zahlen an der Tafel zu erkennen. Das brachte mich von Anfang an in Unsicherheiten und führte zu extremer Zurückhaltung. Hinzu kam ein eigenartiges Gefühl der Zurückweisung etlicher Schüler meiner Klasse mir gegenüber. Dennoch versuchte ich das, was ich nicht sehen und erkennen konnte, durch fleißige Arbeit zu Hause wieder auszugleichen, was mir dabei half, mich nicht selbst aufzugeben.
Manchen meiner Mitschüler war allein meine Brille ein Dorn im Auge, dazu noch meine guten schulischen Leistungen. So musste ich mir eingestehen, dass Kinder zu bestimmten Dingen sehr rücksichtslos und brutal sein können. Es kam ziemlich oft vor, dass mich Mitschüler auf dem Nachhauseweg verfolgten und grundlos auf mich einschlugen, von Beschimpfungen wie „Brillenschlange“, „blinder Mistkäfer“ oder „Brillenschreck“ (das waren noch die harmlosesten Ausdrücke) ganz abgesehen. Mehrmals wurde meine Brille zerstört und ich kam hilflos nach Hause. Trotz Auseinandersetzungen der Eltern und Lehrer mit den Eltern der Übeltäter tat sich einige Tage nichts mehr, dann begann alles von vorn. Die Anführer einer wilden Gruppe von fünf Jungen meiner Klasse waren Siegfried M., Peter E. und Hilmar M. Davon war Siegfried M. der Täter mit den gefährlichsten und verbrecherischsten Einfällen und Taten, hervorgegangen aus einer brutalen SA-Familie. Nebenbei sei bemerkt, dass bei vielen der Zwischenfälle Erwachsene vorübergingen, ohne einzugreifen oder Hilfe zu leisten. Das stimmt mich nachdenklich bis heute.
Mit den Jahren verlor sich kindliche Gewalt mir gegenüber, denn ich konnte mich mit ansehnlichen Leistungen behaupten, während die meisten der Gewalttäter eine oder mehrere Klassen noch einmal oder auch mehrmals ausprobieren durften. So begann etwa ab Klasse 5 für mich endlich eine Entwicklungsphase, in der ich mich auf das Lernen wesentlich besser konzentrieren konnte, ohne ständigen Bedrohungen oder Gewalttaten ausgesetzt zu sein.
Sehr wertvoll und hilfreich für mich bei diesem Entwicklungsprozess waren Freundschaften, die sich mit der Zeit aufbauten. Da waren Schüler meiner Klasse, die Freunde wurden und auch Kinder auf unserer Straße, mit denen ich einen großen Teil meiner Freizeit verbringen konnte, mit Spaß und Spiel. Enge Freundschaften entwickelten sich mit Jörg, Meinhard, Sabine und Dietmar, was sich auch bald in gegenseitiger Hilfe bei Hausaufgaben als günstig erwies. Oft zeigte sich auch, wer die wahren Freunde waren, wenn es um ernste Situationen und Auseinandersetzungen ging. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit waren mir dabei am wichtigsten.
Was Behinderungen betraf, war meine Dauerbefreiung vom Sportunterricht durch ärztliche Anordnung während der Schul- und Ausbildungszeit für mich eine hochgradige psychische Belastung, denn ich konnte mich nicht wie die anderen Kinder an sportlichen Aktivitäten beteiligen. Augenarzt und Sportarzt beurteilten meine sportlichen Möglichkeiten unter zwei Aspekten: Erstens war durch das geringe Sehvermögen und den Verlust des räumlichen Sehens Sport unter den üblichen Bedingungen für mich kaum möglich. Die Ärzte befürchteten eine überhöhte Unfallhäufigkeit gerade deswegen. Selbst Ball- und Wurfspiele lehnten sie ab, weil sicheres Fangen und Zielwerfen unmöglich schienen. Zweitens befürchtete Augenarzt Dr. Brosche Netzhautablösungen auf beiden Augen, die durch sportliche Belastungen ausgelöst werden konnten. Demzufolge reduzierte sich mein sportlicher Ehrgeiz auf tatenloses und langweiliges Zuschauen oder auf Leistungen nach eigener Einschätzung, wie Laufen, Wandern, Radfahren.
Schwimmen gehörte zu den Disziplinen, die der Augenarzt trotz mehrerer Vorsprachen immer wieder ablehnte, weil er die Auffassung vertrat, die körperliche Anstrengung könnte Netzhautschäden oder sogar Blindheit verursachen. Trotz dieser Argumente werte ich heute die Tatsache, nicht schwimmen zu können, als bedeutsamen Verlust an Lebensqualität und persönlicher Freiheit. Überdies gäbe es unter heutigen Bedingungen nach den neuesten Forschungen der Sportmedizin auch für mich Trainings- und Betätigungsmöglichkeiten im Sport, so auch im Schwimmen.
Zudem gab es ein Ereignis im Schulsport während meiner Berufsschulausbildung, das meinem positiven Denken in Sachen Sport nicht gerade gut tat. Mit meiner Befreiung vom Sportunterricht an der Gewerblichen Berufsschule Freiberg gab sich der Sportlehrer nie zufrieden. Er bestand auf meiner Teilnahme am Sportunterricht und an sonstigen Wettkämpfen mit der Aufgabe, exakte Protokolle und Auswertungen für jede Unterrichtsstunde zu führen, und zwar nach den sportlichen Regeln in der entsprechenden Disziplin und seinen Vorstellungen. Das war hart. Zudem beurteilte er meine Niederschriften akribisch genau nach seinen Vorstellungen und Erfahrungen als Diplom-Sportlehrer, der an der DHFK Leipzig studiert hatte und dort ausgebildet worden war. Das führte zu extrem widersprüchlichen Auseinandersetzungen zwischen Sportlehrer und mir. Von dieser Art „zwangssportlicher Verpflichtungen“ musste ich mich trennen. Ein auf meine Situation zugeschnittenes Trainingsprogramm, wenn auch mit Abstrichen, wäre für mich wichtiger gewesen.
Mit den Klassen 7 und 8 schälte sich eine neue Etappe heraus, mich gehandicapt durch das weitere Leben kämpfen zu müssen. Diesmal hingen mit meiner Entwicklung grundlegende Entscheidungen zusammen, die meine Eltern und ich zu treffen hatten. Erste Gedanken zur möglichen beruflichen Entwicklung traten auf. Was war es, was mich faszinierte und woraus sich eine berufliche Perspektive ableiten ließ? Ich war JEMAND, der das Handwerk liebte. Holz in allen seinen Facetten war ein Traumwerkstoff für mich, zudem war er leicht zu bearbeiten. Meine Begegnung mit einem Tischlermeister in den Jahren zuvor hatten mich für den Beruf des Tischlers begeistert. Von ihm hatte ich als Kind bei meinen Besuchen in seiner Tischlerwerkstatt viele Tricks und Kniffe gelernt. Der Beruf war einfach genial für mich! Das war die eine Seite der Wahrheit. Die andere war der Einspruch mehrerer Ärzte, infolge verminderter Sehfähigkeit und fehlenden räumlichen Sehens bestehe erhöhte Unfallgefahr bei Maschinenarbeiten und dazu Bedenken zur Erfüllung der Normen in Qualität und Genauigkeit. Die Folge: Ärztliche Ablehnung wegen nicht ausreichender gesundheitlicher Eignung. Der Traum vom Holz war dahin.