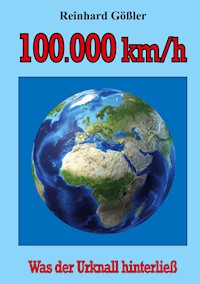
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine locker geschriebene, populär-wissenschaftliche Betrachtung unseres Sonnensystems mit zumeist allgemein bekannten Tatsachen, die man sich dennoch selten vor Augen führt. So verliert unser Zentralgestirn in jeder Sekunde vier Millionen Tonnen an Eigengewicht, ohne dass deshalb der Weltuntergang bevorsteht. Die Antwort auf Fragen nach der (Un-)Endlichkeit von Raum und Zeit sind so etwas wie ein modernes Glaubensbekenntnis, das trotz der unumstößlichen Faktenlage genügend Freiraum für individuelle Interpretationen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Unbegreiflich
Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass wir in diesem Augenblick (und in allen anderen schon gewesenen und noch kommenden) mit über 100.000 Kilometern pro Stunde durch das Weltall rasen? Dies ist die Geschwindigkeit, die unsere Erde vorlegen muss, um es innerhalb eines Jahres einmal rund um die Sonne zu schaffen.
Und sie, die Sonne selbst, baut bei ihrer strahlenden Tätigkeit in jeder Sekunde (!) rund 4 Millionen Tonnen Eigengewicht ab, und zwar seit vielen Milliarden Jahren! Da sie dies aller Voraussicht nach auch noch weitere Jahrmilliarden tut, brauchen wir uns diesbezüglich keine Sorgen um Energieknappheit zu machen.
Dennoch sind dies Zahlen, die zum Nachdenken oder gar Grübeln anregen. Im folgenden finden Sie noch viel mehr Fakten, mit denen wir tagtäglich leben, ohne sie uns ständig vor Augen zu führen. Und am Ende bleibt die Frage stehen, wo der Ursprung dieses gewaltigen Universums liegt, von dem wir nur einen klitzekleinen Ausschnitt betrachten wollen, nämlich das Sonnensystem um uns herum.
Da dies keine wissenschaftliche Abhandlung ist sondern eine allgemein verständliche Darstellung, sind alle Zahlenwerte so weit gerundet, dass sie in unser Vorstellungsvermögen passen – oder vielleicht doch nicht. Weil sämtliche Fakten allgemein zugänglich sind (z.B. über Wikipedia), gibt es hier auch keine spezifischen Quellenangaben.
Um die Lesbarkeit nicht künstlich zu verschlechtern, bleibt das Gendern außen vor; dies stellt ausdrücklich keine Geringschätzung irgendeines Personenkreises dar. Es wird also die Rede von der bemannten Raumfahrt sein, weil „befraut“ nun doch etwas daneben liegt.
Ach ja: Die kleine Sonne vom Buchrücken wird ab Seite 34 erklärt.
Und nun wünscht Ihnen der Autor unterhaltsame Lektüre.
Inhaltsverzeichnis
Weltbilder
Und sie dreht sich doch
Systematik
Unser Sonnensystem
Mutter Erde
Eher Kartoffel als Kugel
Unser Erdtrabant
Guter Mond in aller Stille
Die Wandelsterne
Mit Affentempo unterwegs
Riesenhaft
Innere und äußere Planeten
Die Jahreszeiten
Das Ergebnis einer schiefen Achse
Frühlingserwachen
Die Sonne vom Buchrücken
Das Zentralgestirn
Eine unglaubliche Energieverschwendung
Eine neu Ära
Aufbruch ins Raumfahrtzeitalter
Mondmenschen
Ausgestattet mit offenem Zweisitzer
Blutzoll
Überschattet von zahlreichen Fehlschlägen
Weltraumspäher
Sonden liefern detailreiche Erkenntnisse
Fahrplanmäßig
Die Angst vor der großen Langeweile
Am Tellerrand
Ein Blick darüber hinaus
Raum und Zeit
Keine Chance an Grenzen zu stoßen
Lösungsansätze
Mythen und Mythologie
Weltbilder
Dieses Modell geht auf den griechischen Astronomen, Mathematiker und Philosophen Claudius Ptolemäus zurück, der vor fast 2000 Jahren gelebt hat (ca. 100 – 160) und das nach ihm benannte ptolemäische Weltbild ersann. Seine Schriften waren bis in die frühe Neuzeit hinein die Standardwerke über die Astronomie.
Ptolemäus aber konnte sich mit seinen umfassenden, in zahlreichen Schriften dokumentierten Beobachtungen durchsetzen, wonach die Erde der Reihe nach von Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn umkreist wird; seinerzeit waren nur die fünf genannten Planeten bekannt. Alle Bahnen waren seiner Meinung nach exakt kreisförmig und lagen ziemlich genau in einer Ebene, d.h. bei seitlicher Betrachtung befinden sie sich alle auf einer Scheibe. Diese Erkenntnisse sind umso ungeheuerlicher, als sie „freiäugig“ erlangt wurden (astronomischer Fachausdruck), d.h. ohne Zuhilfenahme eines Fernrohrs. Dass es zur Erfassung der Zeit noch keine technischen Hilfsmittel gab, versteht sich am Rande.
Wie ein Anachronismus mutet daher die Kritik an, die bis in die Jetzt-Zeit über das Wirken des Ptolemäus laut wird. So sollen viele seiner Beobachtungsdaten gar nicht von ihm selbst stammen, und man hat ihm sogar Lügen oder Plagiat vorgeworfen (abschreiben – aber von wem?). Diese Anschuldigungen stammen von einem französischen Astronomen, der sie 1817 vorgebracht hat. Es ist kaum zu glauben, dass sie im Jahr 1985 in vollem Umfang von einem amerikanischen Naturwissenschaftler wiederholt wurden. –
Nachdem wir seit mehreren Jahrhunderten vom geozentrischen Weltbild abgerückt sind, ist eine Herabwürdigung der uralten Leistungen mehr als fragwürdig. Möglicherweise wollen sich die zeitgenössischen Astronomen, die sich daran beteiligt haben, auf diese Weise profilieren, falls sie dies anderweitig nicht geschafft haben. Vor dem genannten Hintergrund der fehlenden technischen Hilfsmittel ist und bleibt der alte Grieche einer der Pioniere der Astronomie – was keinesfalls im Widerspruch dazu steht, dass er mit seinen Ansichten falsch gelegen hat.
Es dauerte immerhin bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, als Nikolaus Kopernikus (1473 – 1543) die Welt im wahrsten Wortsinn auf den Kopf stellte. Eigentlich war er Domherr in einem preußischen Bistum, betätigte sich aber auch als Arzt und Astronom. In seinem Hauptwerk beschreibt er kurz vor seinem Tode ein heliozentrisches Weltbild, bei dem sich die Erde wie alle anderen Planeten um die Sonne dreht. Damit leitete er die so genannte Kopernikanische Wende ein, die man als Ende des Mittelalters und den Beginn der Neuzeit ansieht.
Er erntete mit seinen Vorstellungen allerdings keine Zustimmung auf breiter Front, sondern eher Abneigung und Ignoranz. Insbesondere stieß er bei der Kirche – und zwar bei beiden Konfessionen – auf Ablehnung, weil man die Lehre von der Erde als Mittelpunkt als unumstößlich ansah.
Es bedurfte aber noch weiterer, intensiver Forschungsarbeit, um die These von den Planetenbahnen zu untermauern. So war es Johannes Kepler (1571 – 1630) vorbehalten, physikalische Gesetzmäßigkeiten zu formulieren, die in ihrer Grundaussage noch heute Gültigkeit besitzen (Drei Keplersche Gesetze über die Bewegung der Planeten). Eine wesentliche Neuerung gegenüber früheren Modellen besteht darin, dass die Bahnverläufe keine Kreise sind, sondern Ellipsen, bei denen sich die Sonne in einem der beiden Brennpunkte befindet.
Man muss sich vergegenwärtigen, dass in diese Zeit der Dreißigjährige Krieg fiel (1618 – 1648), und die Menschen andere Sorgen hatten als die Umgewöhnung an ein neues Weltbild.
Fundamentiert wurde die neue Lehre durch experimentelle Untersuchungen des italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei (1564 – 1642), der so lange als Ketzer verfolgt wurde, bis er sich 1633 offiziell von seinen Ansichten lossagte, fortan aber nicht mehr dozieren durfte. Der Überlieferung nach soll er beim Verlassen des Inquisitionsgerichts die legendären Worte gemurmelt haben: „Und sie [die Erde] bewegt sich doch!“
Trotz späterer Zugeständnisses seitens der Kirche, dass die Ansichten von Galilei rein hypothetischer Natur seien und keine gesicherten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, brauchte der Vatikan bis zum Jahr 1992 (!), um den in Ungnade gefallenen Naturforscher vollends zu rehabilitieren...
Systematik
Wir sprechen ganz selbstverständlich von unserem Sonnensystem, so, als hätten wir Eigentumsanteile daran. In Wirklichkeit geht es aber nur um die Abgrenzung gegenüber anderen Galaxien, die vordergründig nicht „zu uns“ gehören.
Es handelt sich also um etwas Systematisches, wie etwa dem Periodensystem der chemischen Elemente. Weil jedes von denen sogar eine individuelle Ordnungszahl bekommen hat, ist dies an Systematik kaum zu übertreffen. Verglichen damit ist das System von unserer Sonne mit deren Planeten recht überschaubar, jedenfalls von der Anzahl her. Was dessen Ausdehnung betrifft, strapaziert es unser Vorstellungsvermögen doch schon recht arg.
Zur Systematik gehört auch die mathematische Beschreibung unserer Erde, die in späteren Kapiteln eine Rolle spielen wird. Damit man sich auf der Oberfläche orientieren kann, hat man die Erdkugel (als die man sie idealisiert betrachten kann) mit einem Gitternetz überzogen: Rundum verteilen sich 360 Längengrade, die von Nord nach Süd verlaufen und in zwei Hälften aufgeteilt sind: So gibt es 180 westliche und 180 östliche Meridiane, wobei die senkrechte Nulllinie durch die Sternwarte von Greenwich, einem Londoner Vorort, führt. Vom Äquator aus, der horizontalen Nulllinie, verlaufen bis zu den Polen jeweils 90 nördliche bzw. südliche Breitengrade.
Beim Blick von „oben“ stellt man fest, dass sich alle Planeten gleichsinnig um die Sonne drehen, und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn. Dies ist eine Besonderheit unseres Systems, die man auf dessen Entstehung zurückführt. In anderen Systemen geht es weitaus turbulenter zu, weil die Planetenbahnen dort sehr unrund (d.h. stark elliptisch), gegeneinander gekippt oder auch gegenläufig sind. Wie schon gesagt sind die Umlaufbahnen nicht exakt kreisförmig und nur bei genauem Hinsehen als Ellipsen zu erkennen. Mit dieser wesentlichen Erkenntnis konnte Kepler Ungereimtheiten (d.h. zeitliche Ungenauigkeiten) bei den Planetenbewegungen erklären.
Aufgrund der Ellipsenform ist der Abstand zur Sonne nicht konstant, sondern er schwankt zwischen einem größten und kleinsten Wert, die sich allerdings nur um wenige Prozente unterscheiden; daher entsteht der oberflächliche Eindruck eines Kreises. Angegeben wird in der Regel der Mittelwert aus den beiden Extremen.





























