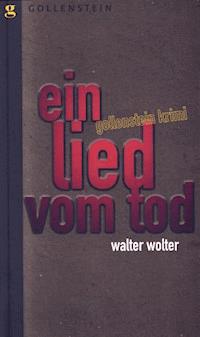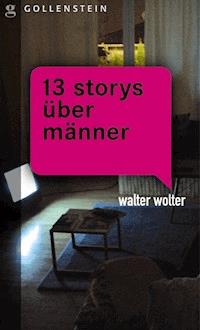
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gollenstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
13 ganz normale Männer, 13 unterschiedliche Typen, 13 knallharte Storys. In seinen 13 Geschichten über Männer beleuchtet Wolter Momente im Leben von Männern, die gerade noch die Kurve kriegen - oder aus ihr getragen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
13 storys über männer
walter wolter
gollenstein
impressum
Alle Rechte an dieser Ausgabe
© 2014 Gollenstein Verlag c/o O.E.M. GmbH, Saarbrücken
www.gollenstein.de
ISBN
inhaltsübersicht
der werber
der träumer
der lügner
das messer
der tierfreund
der wiedergänger
der pizza-bote
der feuilletonist
der schließer
der wettkönig
der söldner
der detektiv
die freunde der indianer
der werber
Heinz Poller hatte einen miesen Job. Er musste die Leute irgendwie dazu bringen, den Kurier zu bestellen. Wenn ihm das glückte, waren beide Seiten bedient. Poller hatte einen Schein und damit einen Anschiss weniger vom Vertriebschef, und der Kunde hatte zwei Jahre lang eine Zeitung im Briefkasten, die in ihrem Provinzialismus aufs Tüpfelchen dem Landstrich entsprach, in dem er sein Leben verschlief, versoff oder vereinsmeierte.
Das Revier, in dem Poller sich seit vier Tagen die Absätze schief lief, hatte er sich nicht ausgesucht. Ein Wohngebiet für Bessergestellte, die an diesem sanften Südhang in ihren rundum exotisch begrünten Zitadellen des Zasters nobler dahinlebten, als es an anderen Plätzen der Kleinstadt möglich war. Nein, für dieses Pflaster war Poller nicht der richtige Mann. Die geistig übertrainierten Gattinnen der Manager und Submanager des Pharmaunternehmens und der Brauerei, der Katzenstreufabrik und des Zweigwerks für Slipeinlagen waren von einem Kerl der Kategorie Heinz Poller weiß Gott nicht zu beeindrucken. Ganz selten, dass eine dieser Damen den Ausdruck leichten Angewidertseins unterdrücken konnte, wenn sie dicht vor der Nase des Zeitungswerbers die Haustür ins Schloss schob. Ein Typ mit Kunstlederjacke, Pomade im Haar und aufdringlich-billigem Rasierwasser war hier so fehl am Platz wie ein Leprakranker am kalten Buffet des örtlichen Gewerbevereins. Für Poller war das nichts Neues, und er litt auch nicht sonderlich darunter – bis auf die bittere Tatsache, dass er an diesen vier Tagen keinen einzigen Schein geschrieben hatte.
»Guten Tag, gnädige Frau. Ich komme vom Kurier.«
»Vom Kurier? Sind Sie Journalist?«
»Nein, nicht direkt. Ich würde Ihnen bloß mal gerne …«
»Wir haben bereits eine überregionale Zeitung im Abonnement.«
»Aber Ihr Mann als prominente Persönlichkeit, da braucht man doch …«
»Mein Mann hat den Boten in der Firma. Da brauchen wir nicht noch den Kurier. Und nun gehen Sie bitte!«
Die Dialoge waren knapp und eisig und ohne die geringste Möglichkeit, nachzuhaken oder das Gespräch zu verlängern. Scheißviertel! In Mietskasernen und muffigen Altstadthäusern kam Poller besser klar. Dort nahm man’s meistens gelassen hin, wenn er – bewährte Masche – mal schnell auf die Toilette musste. Schon war er in der Wohnung und damit seinem Ziel ein Stückchen näher.
Für ältere Kunden hatte er eine ganz gute Nummer einstudiert. War ihm der Vorstoß in die gute Stube gelungen, gab er mit gebrochener Stimme – je nach Geschäftsverlauf auch unter Tränen – das Schmierenstück von der krebskranken Ehefrau. Das rührte viele, vor allem die Verwitweten. Undenkbar, einem derart schwer Geprüften die Tür zu weisen. Einem Mann, der seiner todgeweihten, lieben Frau das letzte halbe Jahr so angenehm wie möglich gestalten wollte und das Geld dafür durch Abonnementsverkauf zusammenkrampfte.
Zwanzig Scheine im Monat sollte er bringen, um sein Fixum zu rechtfertigen. Für alle weiteren Scheine gäbe es eine Provision. Aber daran war kaum noch zu denken. Seit Monaten geigte der Vertriebschef auf ihm herum, weil Pollers fünfzehn, sechzehn Abonnementsabschlüsse ihm zu wenig waren.
»Ich werde Sie auf Trab bringen, Poller, dass Ihnen die Socken qualmen.« Das war die weiche Tour.
»Ich werde Ihnen den Arsch aufreißen, Poller! An Luschen wie Ihnen geht der Verlag kaputt.« Das war die gemäßigte Gangart.
»Ich schmeiß dich raus, du Arschloch, wenn du nicht bald mehr Produktion bringst. Ganoven wie du haben außer faulen Tricks ja nichts gelernt. Aber verlass dich drauf, ich werde dich so madig machen, dass du graben wirst wie ein Erdferkel! Wie ein Erdferkel, sag ich dir!« Das war der normale Ton.
Furcht oder Hass – Poller wusste nicht, welches Gefühl stärker in ihm loderte. Er hätte ihn umbringen können, den grauhaarigen Tyrannen. Wie konnte man bloß ein solcher Kotzbrocken sein? Dabei war Poller lange genug im Geschäft, um das Wesen von Vertriebsleitern bei Regionalblättern zu kennen: diese Männer fürs Grobe, die insgeheim darunter litten, dass der Anzeigenchef glatter und geschmeidiger und der Chefredakteur eloquenter und kompetenter und permanenter um den Verleger herumwuselten.
Bis in die Außenstelle, für die Poller durch die Gegend dackelte, wirkte die Feinabstufung der Bedeutsamkeit. Der ehrpusselige Redaktionsleiter mit dem Schreibtalent eines Katasterbeamten wähnte sich ganz oben. Auf der zweiten Etage wienerte der lokale Anzeigenleiter durch die Räume und bestärkte seine gehetzten Inseratenjäger in der Ansicht, dass Redakteure arrogante Wichtigtuer seien, die den Verlag nur Geld kosteten.
Ganz unten zitterte sich der Vertriebsinspektor von Tag zu Tag, dass die Zeitungszustellung nur ja reibungslos klappte, weil sonst der Vertriebsleiter aus der Zentrale heranschoss, um auch die letzten Fasern seines Selbstwertgefühls durch den Wolf zu drehen.
Fußabstreifer von Natur aus – und ohne Aussicht auf Änderung – waren die Werber. Poller war der einzige fest angestellte Klinkenputzer in dieser Außenklitsche. Die beiden anderen, Schinowski und Lauterbach, hatten nicht einmal ein Fixum. Nach Pollers Auffassung war das völlig in Ordnung, denn der eine war zugewanderter Polendeutscher und der andere noch nicht sehr lange aus der Haft entlassen. Außerdem herrschte Futterneid zwischen den Werbern. Jeder hatte seine eigene Trickkiste und hätte eher das Gelöbnis abgelegt, vierzehn Tage lang nicht zu lügen, als sich von einem Kollegen in die Karten spicken zu lassen.
In mageren Zeiten wie diesen waren die Werber wie Wölfe untereinander. Sogar in den guten Revieren war ein Zwei-Jahres-Schein wie ein kleiner Lottogewinn. Allgemein hatten die Zeitungen einen schweren Stand. Das regionale Nachrichtenmonopol war dahin, seit Radio und Fernsehen und Stadtmagazine und billig zugetextete Anzeigenblätter aus allen Rohren Informationen wie aus einer Bonbon-Kanone vom Karnevalswagen des Infotainments unters Volk schossen. Seitdem kämpften die Lokalzeitungen um Auflage wie ein tatterig gewordener Abgeordneter um Wählerstimmen. Auf Teufel komm raus wurden Prospekte ausgestreut.
»Leser werben Leser« hieß eine auf die Schnäppchen-Mentalität zielende Stoßrichtung, die den Werbern das Geschäft vergällte. Wer die Zeitung bestellte, bestand auf einer Schlagbohrmaschine. Oder einem Mixer. Oder einem Entsafter. Oder einer Friteuse. Oder einem Trampolin fürs Kinderzimmer. Die Begehrlichkeit der Leute war für Poller eine wirtschaftliche Katastrophe. Denn als Werber durfte er nichts von der ganzen Präsent-Palette einsetzen. Dagegen suchten die ausschließlich auf Provision arbeitenden Freibeuter Schinowski und Lauterbach die Kaufhäuser auf eigene Rechnung nach billigen Entsaftern und Toastern made in China ab, die sie bei einem Abonnementsabschluss als Dreingabe auf dem Küchentisch stehen ließen. Es war eine schiere Verzeiflungstat, denn die Provision lag nur noch ein paar Mark über dem Einsatz für das Bestechungsgeschenk.
Für Poller war selbst dieses Schlupfloch dicht. Denn als Angestellter erhielt er erst ab dem zwanzigsten Schein Provision. Also kam er über sein kümmerliches Fixum nicht mehr hinaus. Den Unterhalt für seine erste Ehefrau schuldete er seit Monaten; die zweite hatte gottlob wieder geheiratet und deshalb keine Ansprüche. Aber da waren noch die längst fälligen Alimente für ein eheliches und zwei nicht eheliche Kinder und die Forderungen des Finanzamts, das von seiner kleinen Nebentätigkeit als Anpreiser von Heizdecken und Nahrungsergänzungsmitteln bei Kaffeefahrten Wind bekommen hatte. Sein Fixum war bis auf den Mindestsatz heruntergepfändet. Wäre Poller nicht ein so durchtriebener Hund gewesen, hätte er sich geradewegs mit einem umgestülpten Hut und zwei jungen Hunden in die Innenstadt setzen können.
Unter den Kurier-Damen im Schalterraum, die sich mit Reklamationen, Kleinanzeigen und Urlaubsnachbestellungen herumschlugen, hatte er sich Elvira ausgeguckt. Anna war über sechzig, und Elke mit den Storchenbeinen hatte ein Verhältnis mit einem Anzeigenvertreter. Blieb also noch Elvira. Sie war Ende dreißig, hatte einen bitteren Zug um den Mund und wusste nur so viel über Männer, was einem etwas späten Mädchen, das Tür an Tür mit seiner Mutter schlief, gestattet war.
Bei ihr hatte Poller Pionierarbeit geleistet und dabei einen Vulkan aufgerissen. Schon nach dem ersten Mal in seiner vergammelten Einzimmerbehausung mit Eierlikör und Vorspiel waren alle Schleusen geöffnet. Jetzt wollte sie immer und überall. In Pollers halbtotem Ford. Im Wald. Auf dunklen Parkplätzen. Auf dem Tisch und unter dem Tisch und im Stehen. Seitdem war sie nicht mehr tablettensüchtig und hatte sich dieses hysterische Augenaufreißen abgewöhnt, wenn ein Typ sie angrinste. Stattdessen riss nun Poller die Augen auf, wenn sie ihn mit ihren Nachstellungen nervte, und die wurden von Tag zu Tag unerträglicher. Aber Poller hätte seine goldene Gans geschlachtet, wenn er ihr den Laufpass gegeben hätte. Also strengte er sich an, und sie wand sich wie ein weißer Wurm in Ekstase und machte einen Lärm, als wollte sie die Schwingungen jahrelang unterdrückter Lust bis ins Schlafgemach der Frau Mutter vibrieren lassen. Er strengte sich an, weil sie seine Komplizin war und – aus dem Blickwinkel eines Werbers gesehen – an der Quelle der Macht saß, nämlich an der Kasse der Kurier-Außenstelle.
Einbis zweimal in der Woche schob Poller ihr diskret einen Schein zu, den er mit »Maier« oder »Bamberger« oder »Frau Moser« unterschrieben hatte – und Elvira zahlte ihm jedes Mal hundertfünfzig Mark bar aus der Kasse. Niemand durchschaute diesen Schwindel. Weder die Buchhaltung, weil es immer wieder mal Gelegenheitswerber gab, noch das Finanzamt, weil mehrere Namen im Spiel und die Beträge im Einzelnen nicht auffällig hoch waren.
Obwohl doch alle Welt darauf aus war zu raffen, was das Zeug hielt, gab es immer noch diese Spezies der Verzichter, die unverhofft am Schalter standen und die Zeitung bestellen wollten. Einfach nur die Zeitung bestellen wollten, ohne Werbegeschenk, ohne Leser-werben-Leser-Prämie – und ohne dass ein Werber auch nur einen Pfennig davon gehabt hätte. Dem Verlag waren solche Asketen natürlich am liebsten. Auch Poller empfand neuerdings eine gewisse Sympathie für sie, und das hing unmittelbar mit seiner Rolle als Sexualtherapeut seiner Schalterdame zusammen. Von den prämienfreien Bestellscheinen, die sofort an die Zentrale weitergeleitet werden mussten, hielt Elvira gelegentlich welche zurück, damit Poller seine Vertreternummer draufkritzeln konnte.
So war innerhalb von vier Wochen aus der Symbiose zweier Unterprivilegierter eine kleinkriminelle Verstrickung geworden, die Elvira ein neues Selbstwertgefühl und Poller ein paar Extra-Scheine bescherte.
Jeden Mittwoch rollte der Vertriebsleiter seine graue Dienstlimousine drohend vor die Außenstelle. Mittwochs hielt er Gericht. »Vertriebsbesprechung« nannte er das. Der Angstarsch von Vertriebsinspektor hielt vor jeder Hinrichtung eine halbe Stunde die Etagentoilette besetzt. Er kriegte auch immer am meisten ab. Wenn Silberlocke – so nannte man den Vertriebsleiter heimlich in jener seltsamen Gefühlsmischung aus Hass und Hingabe –, wenn Silberlocke seinen großen, wuchtigen Autoritätskörper hinter dem ständig für ihn reservierten Schreibtisch in den Sessel senkte, den Krawattenknoten mit aggressivem Griff herunterzog und den gefürchteten grauen Aktenkoffer aufspringen ließ, begannen die Schweißflecken auf dem Hemd des Inspektors mit der Expansion.
»Wir haben dreizehn Abbestellungen. Vier, weil die Lokalredaktion Scheiße geschrieben hat. Zwei aus dem Altersheim, weil die Scheintoten angeblich nicht mehr lesen können. Einen Arbeitslosen. Zwei ohne nähere Angaben.«
Pause. Bange Erwartung.
»Und vier«, donnerte Silberlocke, »weil die Zustellung nicht funktioniert!«
»Das kann ich erklären …«, knödelte der Inspektor, »der neue Träger …«
»Ich bin noch nicht fertig«, sagte Silberlocke scharf.
»Riskieren Sie es nicht noch einmal, mir das Wort abzuschneiden! Wenn die Trägerbezirke 119 und 124 bis nächste Woche nicht top in Ordnung sind, top sage ich, werde ich persönlich dafür sorgen – persönlich, hören Sie? –, dass Sie hier nur noch den Hof fegen. Kapiert!?«
Der Inspektor duckte sich ergeben.
»Selbstverständlich«, nuschelte er.
An diesem Mittwoch wurden nach dem Inspektor der Werber Schinowski und die im Schalterdienst ergraute Anna eingestampft. Schinowski hatte einem Alzheimer-Opa bei der Unterschrift die Hand geführt – aber leider war bei der ersten Abbuchung dessen Tochter dahintergekommen und hatte einen Riesenzoff am Schalter veranstaltet. Anna bekam ihr Fett ab, weil sie nicht clever genug gewesen war, den zeternden Racheengel rechtzeitig zu besänftigen. Deshalb erfuhren ein paar gebückt schreibende Kleinanzeigen-Kunden, dass der Kurier ein Neppladen war, der seine Betrüger ausschwärmen ließ, um geistig weggetretene Opas auf zwei Jahre zu verpflichten. Und weil zufällig ein mitteilungsfreudiger Redakteur in die Szene gelatscht war, erfuhr schließlich und zuletzt – direkt vom Verleger! – auch Silberlocke von der Tragödie.
Das Tribunal war so gründlich, dass es sogar Silberlocke erschöpfte. Schinowski war fahl im Gesicht und atmete flach. Anna hatte die Fassung verloren und war schluchzend aus dem Zimmer gerannt.
»Poller«, sagte Silberlocke mit verausgabter Stimme, aber unüberhörbar zynischem Unterton, »Sie scheinen ja langsam aus dem Leistungsloch zu kommen. Diesen Monat haben Sie endlich mal Ihr Soll erfüllt.«
»Man tut, was man kann«, erwiderte Poller mit stolzer Bescheidenheit. »Wie geht’s denn dem Hund?«
Eine Sekunde lang wirkte Silberlocke überrascht. Er hielt einen mannscharfen Schäferhund, über dessen Kadavergehorsam er in entspannten Momenten Wunderdinge erzählte. Normalerweise musste man warten, bis Silberlocke von sich aus auf das Thema kam. Doch Poller, der an diesem Mittwoch so gut wie nie zuvor davongekommen war und vom vergangenen Mittwoch noch in Erinnerung hatte, dass dem Köter irgendetwas nicht bekommen war und er dünnes, gelbes Zeug vor Silberlockes Garage geschissen hatte, wagte die Vertraulichkeit.
»Wenn Sie mich für senil halten, sagen Sie’s gleich rundheraus, Poller!«
Silberlocke fauchte.
»Auch mit Arschkriecherei kommt einer wie Sie bei mir nicht an. Merken Sie sich das!«
O verdammt – Poller hätte sich ohrfeigen können. Er fühlte Druck auf den Schläfen und wäre am liebsten davongerannt. Was war er auch für ein Idiot, die Situation so granatenmäßig falsch einzuschätzen! Als ob ein Chef wie Silberlocke sich von einem durch tausendfache Demütigungen weichgeklopften Klinkenputzer einwickeln ließe! Schon die Idee kam Poller im Nachhinein tollkühn vor. Er war tatsächlich das Erdferkel, das Silberlocke aus ihm gemacht hatte.
Der missgestimmte Vertriebsleiter konnte offenbar Gedanken lesen.
»Das Einzige, was ich von Ihnen erwarte, Poller, ist Folgendes: Graben Sie wie ein Erdferkel! Das haben Sie nämlich immer noch nicht richtig drauf. Warum Sie in letzter Zeit mehr Scheine gemacht haben, weiß ich noch nicht.« Silberlocke lächelte diabolisch. »Aber das werde ich noch rauskriegen. Aus dem Gebiet, das Sie bearbeiten sollten, waren die Adressen jedenfalls nicht.«
Poller wurde es heiß und kalt. Hatte Silberlocke Lunte gerochen? Den weiteren allgemeinen Anweisungen und Vorhaltungen und Planungen folgte er ohne Konzentration. Er hörte, dass sein Name genannt wurde. Dass er am Samstag zur Standwerbung auf einer Gewerbeschau eingeteilt war, nahm er zwar mit ergebenem Nicken zur Kenntnis, aber er war nicht bei der Sache. Wie er diesen Sadisten hasste! Er hatte zwar keine reale Vorstellung vom Aussehen eines Erdferkels, aber er malte sich das Vieh mit scharfen Hauern und partisanenhafter Hinterhältigkeit aus. Eine Jagd, bei der Silberlocke seine letzte Patrone verschossen hatte und irritiert in die Gegend spähte – während hinter ihm und seinem dünnschissigen Schäferhund sich keilergroß das Erdferkel aus dem Dreck erhob, funkelnde Mordlust in den Augen ...
»Nochmals zum Mitschreiben, Poller. Am Freitagabend wird nicht gesoffen, weil Sie am Samstag wie ein zivilisierter Mensch aussehen müssen. Misten Sie Ihren Mottenschrank mal aus, vielleicht finden Sie noch ein brauchbares Jackett!«
»Alles klar«, sagte Poller.
Er durfte gehen. Im halbdunklen Korridor streifte er die Übergangsmäntel an der Wandgarderobe. Obenauf hing der eierschalenhelle Trenchcoat des Vertriebsleiters. Nach einem schnellen Rundumblick zückte Poller seinen Filzstift und kritzelte hastig ein paar Kringel auf den Mantelrücken. Mit klopfendem Herzen, aber berstend vor Freude eilte er am Schalter vorbei ins Freie. Die Genugtuung war gigantisch. Ein paar Schritte vor ihm ging ein Promenadenmischling zum Abkoten in die Hocke und glotzte ihn blöde an.
Die Gewerbeschau am Samstag war eine Strafe Gottes. Poller hatte am Freitagabend mit Pils begonnen und in der Morgenfrühe mit Korn aufgehört. Nun hielt er sich, die Augen glasig und eine Atemfahne zum Abwinken, an seinem Werbestand fest. Da nutzten keine Luftballons mehr etwas, keine Feuerzeuge, keine Flaschenöffner, keine Kugelschreiber und auch nicht der ganze übrige Ramsch mit Kurier-Aufdruck, weil die vorbeibummelnden Besucher um dieses Abbild menschlichen Lasters einen Bogen machten und alle Empörung der bürgerlichen Welt mit Blicken ausdrückten. Poller war noch zu besoffen, um das zu registrieren.
Kurz vor Mittag tauchte – weiß der Kuckuck, wer ihn alarmiert hatte – der lokale Anzeigenleiter auf. Ein Krawattenzwerg, den man sich nur gebügelt vorstellen konnte, sogar im Pyjama.
»Packen Sie Ihren Stand zusammen, Mann! Sie sind ja betrunken. Und das vor unseren Anzeigenkunden. Unmöglich. Uuunmöglich! Das wird Konsequenzen haben.«
Poller juckte es, ihm in die Fresse zu schlagen.
»Ist gut«, sagte er. »Ich packe zusammen.«
Unsicher scharrte er den Werbekrempel in eine Plastiktasche, streng beobachtet von dem Krawattenzwerg, der seine Macht als firmenrettende Ordnungskraft auskostete.
»Herr Meier-Hunkeler«, sagte Poller demütig, »bitte melden Sie mich nicht. Ich habe schon zwei Abmahnungen. Wenn Sie mich melden, bin ich meinen Job los. Silberlocke wartet doch nur drauf.«
»Wir werden sehen«, entgegnete der Krawattenzwerg kühl.
»Das werde ich Ihnen nie vergessen«, sagte Poller.
»So einen Chef wie Sie möchte ich auch haben, Herr Meier-Hunkeler.«
Nun war er ganz sicher, dass der Krawattenzwerg dichthalten würde.
Poller schnarchte ein paar Stunden zusammengekrümmt auf dem Rücksitz, dann steuerte er seinen kranken Ford in Richtung Heino’s Bierquelle, einer üblen Kaschemme, wo sich Männer ohne Zukunft und Frauen mit Vergangenheit trafen. Da fiel man mit Kunstlederjacke nicht aus dem Rahmen und konnte ungestört zum Pils ein paar ältere Buletten verdrücken. Aus der Kneipe wollte er Elvira anrufen. Am Montag brauchte er unbedingt zwei Direktscheine, um die abgestürzte Gewerbeschau-Aktion zu vertuschen. Silberlocke würde ihm sonst den Kopf abreißen.
Um auf dem Weg zu Heino’s Bierquelle eine bestimmte Haltebucht zu umfahren, die von der Polizei an Wochenenden als Führerschein-Grab für beduselte Autofahrer zweckentfremdet wurde, kurvte Poller durch ein Gewirr von Seitenstraßen.
Moment mal!
Dieser Wagen … diese Farbe … diese Nummer … Es war ein kuriergrauer Wagen, es war – sapperlot! – die Dienstkiste von Silberlocke. Poller hatte seinen Peiniger noch nie privat in dieser Stadt gesehen, die so klein war und überschaubar, dass einem auf Dauer niemand entging.
Poller vergaß Heino’s Bierquelle samt den älteren Buletten und richtete sich aufs Warten ein. Es war eine jener langweiligen Straßen mit einfallslos-zweckmäßigen, vierund fünfstöckigen Wohnblocks aus den 70er-Jahren. Die Häuser standen dicht an der Fahrbahn. Für Vorgärtchen gab es kaum Platz. Poller hatte Mühe, Deckung zu finden. In Steinwurfweite zirkelte er seinen Ford in eine Parklücke. Von hier aus hatte er alles im Blick.
Der Asphalt glänzte feucht. An den flächigen Fassaden der Quaderbauten leuchteten mal hier, mal dort, wie an riesigen Kontrolltableaus, die ersten Lichter auf. Der dämmerige Himmel sprühte Nieselregen vor die Fenster, hinter denen die Spießbürgerlichkeit des Samstagabends sich zu rekeln begann. Nervöses, graublaues Licht flimmerte aus den Stuben, deren Bewohner sich vom TV-Vorabendprogramm unterhalten ließen.
Poller hatte schwer gegen seine Natur zu kämpfen, die ihn zur spontanen Heimtücke drängte. Taschenmesser aufgeklappt, wieselschnelle Blicksicherung nach allen Seiten, Reifen durchgestochen – und ab durch die Mitte. Silberlocke würde die dreckigsten Flüche ausstoßen. Nein, so nicht. Das wäre zu wenig. Ruhig bleiben und abwarten – vielleicht steckte ja mehr dahinter. Er klemmte sich eine Filterlose in den Mundwinkel.
Leute kamen oder gingen. Von Silberlocke keine Spur. Um halb zehn hatte Poller keine Zigaretten mehr und kaum noch Motivation. Er fröstelte. – Da kam Silberlocke!
Beschwingt, geradezu federnd trat er aus dem Lichtquadrat des Hauseingangs, blieb Jungdynamiker auf dem kurzen Stück bis zu seinem Wagen und blickte hoch, während er den Schlüssel hervorholte. Im dritten Stock rechts vom Treppenhaus wurde ein Fenster geöffnet. Gegen das gelbe Licht hob sich die Silhouette einer schmalen Gestalt mit lockigen Haaren ab. Silberlocke warf eine Kusshand nach oben, stieg in sein Auto und brauste davon.
Poller klatschte in die Hände, hieb sich auf die Schenkel und war kindisch vergnügt.
»Ich hab die Sau!«, skandierte er vor sich hin und startete Richtung Heino’s Bierquelle.
Drei Schnapsnasen, abgestandene Luft und gähnende Langeweile – die übliche Samstagabendstimmung in Heinos Saftladen. Heino verschimmelte ungewaschen und verschlafen hinterm Tresen und sah kaum auf, als Poller auf den Hocker grätschte.
»Nicht so doll heute Abend«, sagte Poller.
»Ja, Scheiße«, antwortete Heino. »Samstag ist einfach Scheiße.«
Poller ließ das Pils rinnen und kaute an den Buletten, die noch schmieriger waren als sonst, aber das kümmerte ihn wenig. Er witterte die Chance, Silberlocke eins auszuwischen. Sonnenklar, was da ablief. Der angesehene Familienvater mit Eigenheim, Trillerpfeife und Schäferhund ging fremd. Für Poller, der die Moral eines Straßenköters hatte, eigentlich eine selbstverständliche Sache. Aber hier handelte es sich ja um bessere Kreise, um anständige Leute, wie der Volksmund sagte, und da wurden solche Späße wesentlich verschämter abgewickelt. Sehr schnell sprach man da von einem Skandal.
Poller tauchte ins Reservoir seiner miesen Fantasie. Ein anonymer Brief an Silberlockes Rechtmäßige? Mit Adresse der Rivalin und ein paar schmuddeligen Details? Oder eine kleine Erpressung? Silberlocke war schließlich kein armer Mann. Poller grübelte, kombinierte und verwarf, während er mit einem schnalzenden Geräusch Bulettenreste aus seinen schadhaften Zähnen sog. Sein untrainiertes Hirn war so gefordert, dass er nur unscharf das Flittchen registrierte, das drei Atemfahnen von ihm entfernt mit lasziver Trägheit den Hintern auf einen Hocker liftete.
Nach elf Pils hatte Poller einen Plan. Einen richtig hinterhältigen Plan.
Mit dem beschränkt wirkenden Machogrinsen eines Alkoholisierten drehte er sich frontal zu dem Weibsstück, wobei das Armband seiner Halbkilo-Rolex – eine billige Fälschung aus Bangkok – geräuschvoll über den Tresen schabte. Die angejahrte Nachtschwalbe biss sofort an. Sie hatte Augen wie Schminktöpfe. Poller hatte sie schon öfter gesehen. Sie war eine Art Verkehrsknotenpunkt und machte es umsonst.
»Hallo«, sagte Poller, »ich bin Blondinentester.« Sie lächelte sinnentleert-schmollmündig.
»Da hab ich aber Schwein«, sagte sie.
In dieser Nacht holte sich Poller den dreizehnten Tripper seines an One-Night-Stands reichen Trieblebens.
Wie ein geprügelter Hund schlich er am Montagmorgen um die unbefriedigte Elvira herum. Sie hatte wieder diesen bitteren Zug um den Mund, war bleich und abweisend. Er konnte nicht mit ihr reden, denn am Schalter war die Hölle los. In über einem Dutzend Straßen war der Kurier nicht zugestellt worden. Zusammen mit dem verzitterten Inspektor organisierte Elvira die Nachlieferungen, während Anna mit ihrer Leierstimme am Telefon immer dieselbe Litanei herunterbetete:
»Ja, wir wissen schon Bescheid … Ja, die Zeitung wird gleich gebracht … Der Träger hat ganz plötzlich ins Krankenhaus gemusst … Ja, ganz plötzlich … Es tut uns wirklich sehr leid und wird nicht wieder vorkommen … Ja, ich weiß, dass vorige Woche auch schon … Sie wollen abbestellen? Das müssen Sie schriftlich machen!«
In Wahrheit waren die Experten der Zentrale mit der Elektronik wieder nicht klar- und die Transporter mit den Zeitungspaketen nicht rechtzeitig weggekommen. Aber das durfte man einem verärgerten Leser ja nicht unter die Nase binden.
In dieses Montags-Tohuwabohu drängelten sich die Kleinanzeigenkunden. Gebrauchtes Kinderbett, neuwertiger Durchlauferhitzer, gut erhaltene Geige, zwei Fleckvieh-Bullenkälber, kastrierter Tigerkater entsprungen, tiefergelegter Jahreswagen mit Rallyestreifen und Sportlenkrad – umständehalber.
Poller nutzte das hektische Durcheinander und griff in die Schublade, wo der Schlüssel zum Allerheiligsten ruhte. Das war ein kleiner Raum, in dem all das gestapelt war, womit man eine mittelmäßige Lokalzeitung fürs Abonnement attraktiv machen konnte. Lockgeschenke vom Opernglas mit Plastikgehäuse bis zu »Leser werben Leser«-Prämien der besseren Sorte. Poller nahm, was ihm gut und teuer erschien. Im Kofferraum und auf dem Rücksitz seiner Rostkutsche stapelte er einen Radiorekorder, zwei Waffelpfannen, einen Elektrogrill, ein komplettes Reise-Set vom Koffer bis zum Kulturbeutel, obendrauf einen Besteckkasten und auf dem Beifahrersitz eine Popcorn-Maschine, einen chinesischen Wok und einen halben Meter in Folien eingeschweißte Konsalik-Romane. Unbemerkt legte er den Schlüssel zurück und fuhr los.
Poller erinnerte sich genau: Die Wohnung war im dritten Stock rechts vom Treppenhaus. Er drückte den untersten Klingelknopf, nuschelte etwas von »Paketdienst« und wurde eingelassen. Stück für Stück seiner Morgengaben schleppte er ins dritte Stockwerk und baute sie vor der Tür auf, an der auf einem Messingschildchen L. Peters zu lesen war. So also hieß die Schnepfe, die sich von dem Widerling niederrüsseln ließ. Poller ging auf Nummer sicher. Er läutete kurz. Es dauerte eine Weile, bis die Tür aufging und – Pollers Gesichtsausdruck degenerierte kurzzeitig zu dem eines Dorfdeppen – ein junger Mann in rotem Seidenmantel vor ihm stand.
»Was soll das?«, fragte er und deutete auf die Pakete. Er hatte eine schmale Figur und dunkles, lockiges Haar.
»Sagen Sie«, Poller räusperte sich, »sagen Sie, wohnt vielleicht noch jemand hier?«
»Nein«, sagte der Junge, »Sie sehen doch, dass da nur ein Namensschild ist. Ich heiße Lars Peters. Und nun verraten Sie mir bitte, weshalb Sie meine Tür mit Paketen zubauen.«
Es ging ein Duft von ihm aus, nicht unangenehm, aber nach Pollers Geschmack irgendwie unpassend. Und dieser Augenaufschlag. Der Lidstrich. Das Goldkettchen. Die langen Fingernägel.
»Ich bin vom Kurier«, sagte Poller. »Mein Chef schickt mich. Ich soll die Sachen hier abgeben. Sie wüssten Bescheid, hat er gesagt.«
Der Jüngling warf den Kopf in den Nacken und lachte mädchenhaft.
»Danke«, sagte er. »So ein verrückter Kerl!«
»Tja, also«, sagte Poller, »das wär’s dann wohl.«
»Momentchen«, lächelte der Jüngling und huschte in die Diele zurück. »Für Ihre Mühe«, sagte er sanft und drückte dem verdutzten Poller einen Zwanzigmarkschein in die Hand.
Als Poller über die Straße zu seinem Auto ging, war er immer noch zu fassungslos, um seinen Triumph zu feiern.
Das Monster Silberlocke verlor die Konturen. Pollers Weltbild, seine aus der knallharten Berufspraxis eines Werbers destillierte Menschenkenntnis, sein Instinkt, seine Angst – alles geriet ins Wanken. Eine Zigarettenlänge hielt er sich fast bewegungslos an dem abgegriffenen Lenkrad fest. Das irre Gefühl, Silberlocke zu bedrohen, vielleicht sogar demütigen zu können, war zu riesig, um durch das Ventil eines Freudenschreis gejagt zu werden. Er fuhr zwei Straßen weiter und rauchte wieder eine.
Alles war bestens eingefädelt. Es hätte gewiss auch geklappt, wenn in dem Liebesnest eine Herzensdame gesessen hätte. Durch dieses Schwuchtelchen aber war die Bombe richtig scharf geworden. Mit ein paar Versuchen nötigte Poller den jammernden Ford zum Anspringen. Während der Fahrt wuchs in ihm die vibrierende Ungeduld des Jägers.
»Poller killt den schwulen Tyrannosaurus!«, murmelte er durch den Zigarettennebel. »Das ist echt der Hammer.«
Er hastete an der beleidigten Elvira vorbei, spornstreichs in die Anzeigenabteilung zu Firmenretter Meier-Hunkeler. Ein besseres Medium für seine Absichten gab es im ganzen Haus nicht.
»Herr Meier-Hunkeler, ich möchte mich Ihnen in einer Sache anvertrauen, die das ... die das Unternehmen betrifft. Bis, wie soll ich sagen, in die Führungsetage.«
Der Krawattenzwerg lauschte erschüttert, war zunächst sprachlos – dann spielte er lustvoll alle Stadien eines erzloyalen Untertanen durch, der das Ungeheuerliche erfahren hatte und alles daransetzte, die Firma vor Plünderung und Brandschatzung zu bewahren. Dass Silberlocke, gegen den er schon deshalb eine tiefe Abneigung empfand, weil er körperlich schier das Doppelte hermachte, sich auf erotischer Skandalfährte befand, hätte er noch mit einem verächtlichen Schnauben abgetan. Doch dass dieser Abteilungsleiter, dienstwagenberechtigt und viel höher dotiert als ein lokaler Anzeigenleiter, schamlos Firmeneigentum verschob, um seine Amouren zu pflegen, war Hochverrat. Meier-Hunkeler war persönlich getroffen.
»Schicken Sie jemanden hin«, sagte Poller. »Am besten gleich. Die Kurier-Ware steht kartonweise in der Diele. Ich möchte ja nicht wissen, wie lange das schon geht.«
Meier-Hunkeler schritt zur Tat. Er sprach langsam und würdevoll, als er mit seinem Chef, dem Anzeigenleiter in der Zentrale telefonierte.
»Ein unerhörter Vorgang«, sagte er. »Ich empfehle zu handeln. Über die Abteilungsgrenzen hinweg. Das Unternehmen muss vor Korruption geschützt werden.«
Als er endlich auflegte, stand Erschöpfung in seinem Gesicht. Die Verantwortung zehrte an ihm.
»Darf ich Ihnen noch einen praktischen Tipp geben, Herr Meier-Hunkeler«, flüsterte Poller. »Damit die Tunte keinen Verdacht schöpft, sollte mal einer Ihrer Leute nach der Popcorn-Maschine fragen. Dass das Ding kaputt wär und er ein neues bringen würde. Bei solchen Leuten kann man nicht raffiniert genug vorgehen ...«
»Ja, ja.« Der Krawattenzwerg winkte unwillig ab. Er hatte für Poller nun keine Zeit mehr. Eine große Aufgabe stand vor ihm, deren Lösung möglicherweise seine Versetzung in die Zentrale bedeutete. Endlich.
Die Spannung bis zum Mittwoch war unerträglich. Pollers Tripper war in Fluss gekommen, und er hatte seine Spritze samt der üblichen Ermahnung empfangen. Elvira war immer noch zickig, nestelte an ihren Pillen und hatte das hysterische Augenaufreißen wieder angenommen.
Die »Affäre Silberlocke« wurde innerhalb des Verlages wie ein Staatsgeheimnis behandelt. Meier-Hunkeler eilte in wichtigtuerischer Verschwiegenheit durch die Räume. Pollers schüchterne Anfrage blockte er arrogant ab:
»Nur Geduld. Wir sind an der Sache dran.«
Tatsächlich, er sagte wir. Poller bereute es schon, dass er mit seiner meuchlerischen Aktion gegen Silberlocke dem Krawattenzwerg die Steigbügel für Höheres gehalten hatte. Meier-Hunkeler liebte offensichtlich den Verrat, aber nicht den Verräter.
Der Mittwoch verstrich ohne Vertriebsbesprechung, und auch am Donnerstag tat sich nichts. Poller war wie gelähmt und brachte keinen Schein zustande. Völlig überraschend wurde auf Freitagnachmittag eine Besprechung angesetzt, »informell«, wie es in dem Telefax hieß, das am Schwarzen Brett hing.
Gegen vier fuhr der graue Dienstwagen von Silberlocke vor. Poller hätte sich übergeben können vor Angst.
Ein junger, langer, dürrer Mensch arbeitete sich umständlich wie ein Stelzenmann aus dem Auto. »Jassmann«, stellte er sich vor, »Jens Jassmann.«
Der Inspektor komplimentierte ihn diensteifrig hinter den für Silberlocke reservierten Schreibtisch.
»Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter«, begann Jassmann förmlich und mit dünner Stimme, aus der eine Abneigung gegenüber Humor jeglicher Art herauszuhören war. »Der frühere Vertriebsleiter hat um neue Aufgaben gebeten. Er koordiniert jetzt die Vertriebsverwaltung. Bis zu einer endgültigen Personalentscheidung werde ich Ihr Ansprechpartner sein.«
Er machte eine Pause und sah Poller an, blickte ihm mit kalter Verachtung direkt in die Augen.
»Sie also sind Heinz Poller«, sagte er. »Von Ihnen habe ich gehört. Sie müssen an ganz kurzer Leine geführt werden, an ganz kurzer Leine. Verlassen Sie sich darauf, dass ich Ihnen das beibringen werde, was mein Vorgänger offenbar versäumt hat! Jemand wie Sie muss graben wie ein Erdferkel, damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Haben Sie gehört? Wie ein Erdferkel!«
»Ja«, sagte Poller, »aber natürlich.«
der träumer
Ein Lehrer, der keine Autorität hat, ist schlimmer bedient als ein Fußballspieler mit Knieproblemen, schlimmer als ein Redakteur mit Rechtschreibschwäche, sogar schlimmer als ein Politiker mit Wahrhaftigkeitsfimmel.
»Mäuschen« nannten die Schüler, vor allem die großen Lümmel der oberen Klassen, den etwas kurz geratenen Studienrat Gernot Löbsack. »Mäuschen, Mäuschen«, tönte es mit künstlich hellen Stimmen inmitten des Getrampels ungestümer Füße auf den Treppen und Korridoren des Gymnasiums. Auch auf dem Pausenhof war Gernot Löbsack vor den Nachstellungen der Spötter nicht sicher. Wo ein Pulk der fast erwachsenen Rüpel zusammenstand und Gernot Löbsack in seiner typischen Haltung – die Hände auf dem Rücken – vorbeikam, quäkte garantiert irgendein Unbarmherziger das gedehnte »M-ä-u-s-c-h-e-n« in die Runde, und alle lachten. Studienrat Löbsack fürchtete sich vor diesem Lachen. Er zensierte lieber fünfundzwanzig Klassenarbeiten am Stück, als eine einzige Pausenaufsicht zu machen.
Als junger Assessor hatte er noch Glauben und Hoffnung gehabt. Damals hatte er sich damit getröstet, sein Mangel an Autorität läge an seiner Jugend und an seiner Unerfahrenheit. Eine kurze Weile hatte er es mit schneidigem Auftreten und schlechten Noten probiert. Das war ihm gar nicht gut bekommen. Die napoleonische Attitüde hatten ihm nicht einmal die Fünftklässler abgenommen. Mit Ach und Krach in die Würde und Besoldungsstufe eines Studienrats gelangt, rang Gernot Löbsack um einen Modus Vivendi, eine Strategie des Überlebens, die kurz gefasst so lauten konnte: Löbsack hatte so lange Autorität, wie er sie nicht ausübte. Er wurde zum harmlosesten Pädagogen des Gymnasiums, der auch die schwächsten Kantonisten mit humaner Notengebung über die Runden brachte und dessen disziplinarische Druckmittel gegenüber den Rabauken sich in folgendem Dreisprung steigerten: Löbsack verbat sich mit dünner Stimme die Unflätigkeit. Löbsack verbat sich die Unflätigkeit mit dünner Stimme, in die er besonderen Nachdruck zu legen versuchte. Löbsack kündigte an, er werde unverzüglich zum Direktor gehen und ihn bitten, diese Klasse abgeben zu dürfen. Das wirkte noch am meisten, denn keine Klasse wollte den beherrschbaren Löbsack gegen einen der ultrascharfen Wadenbeißer eintauschen, die an diesem Gymnasium ebenfalls Geografie und Geschichte unterrichteten.
Für seine Kollegen war Gernot Löbsack eine Null. Sie rissen Witze über ihn. Der Direktor, ein mitleidloser Potentat, stellte ihn mit Vorliebe in den Konferenzen bloß. An dem kollegialen Kesseltreiben war auch Löbsacks zaghafter Versuch einer Beziehung zu einer verhuschten Musiklehrerin gescheitert. Zweimal waren sie zusammen ausgegangen, ganz züchtig, und waren prompt gesehen worden. Das erste Mal von einem Schüler, dessen Eltern das Lokal betrieben, in dem Löbsack der nur stellenweise ansehnlichen Kollegin zwei Stunden lang in die Augen geschaut hatte, das zweite Mal von einem petzsüchtigen Religionslehrer, der das schüchterne Paar bei dem Vortrag »Einander verstehen heißt einander respektieren« im St.-Anna-Gemeindesaal beobachtet hatte. Ein drittes Mal hatten die beiden nicht riskiert. Später hatte sich die scheue Musikpädagogin von einem Sportlehrer, einem geistigen Bodenturner, bedrängen und verführen lassen. Löbsack hatte sehr darunter gelitten.
Dass die junge Horde »Mäuschen« hinter ihm herrief, verstand Löbsack sogar. Er brauchte bloß in den Spiegel zu sehen – und die Ursache seines Spitznamens schaute ihn an. Es war nicht damit getan, dass Löbsack ein Fliegengewicht war, schmächtiger als ein Rennreiter. Als hätte der Schöpfer im Rosenmontagsrausch gehandelt, wurde Löbsacks Gesicht von einem Himmelfahrtsnäschen veralbert, das in seinem Schwung nach oben die Oberlippe mitnahm. Deshalb stand Löbsacks Mund immer ein bisschen offen und entblößte zwei Schneidezähne, was der ganzen Physiognomie den Stempel der Maushaftigkeit aufdrückte. Um von den Mäusezähnen und der Stupsnase ein bisschen abzulenken, hatte Löbsack sich in der Zone dazwischen ein Bärtchen wachsen lassen, das seiner Form nach im Volksmund als Mücke oder Rotzbremse bezeichnet wurde. Weil einst der oberste Bannerträger der Bewegung sich mit einem ähnlichen Requisit geziert hatte, war seit dem Einsturz des Dritten Reiches diese Kurzform des Schnurrbarts völlig aus der Mode gekommen.
Es gab wirklich nichts, was Löbsacks Mausgesicht von der ungewollten Drolligkeit hätte befreien können. Auch das Führer-Bärtchen erfüllte diesen Zweck nicht, im Gegenteil: Es machte den 42-jährigen Studienrat vollends zur Karikatur.
Gernot Löbsack lebte allein. In einer Wohnanlage, die den Charme aneinandergereihter Getreidesilos verströmte, besaß er eine Eigentumswohnung. Es waren vier Zimmer, von denen er nur zwei richtig bewohnte. Er hatte sich für eine Vier-Zimmer-Wohnung entschieden, weil er die Hoffnung, irgendwann eine Frau an sich zu binden, noch nicht aufgegeben hatte. Wenn es denn geschehen sollte, war das Nest gebaut.
In der Fantasie hatte Löbsack sich sein weibliches Ideal längst ausgemalt. Zierlich, weich, mit dunklen Locken und großen braunen Augen, in denen das kindhafte Staunen noch nicht erloschen war – so gefiel es Löbsack am besten. Ständig dachte er sich Geschichten aus, in denen er dieser Frau begegnete. Geschichten, in denen er, Gernot Löbsack, ein anderer war. Kein Schwächling mit Mausgesicht, sondern ein Mann, der sich Respekt verschaffte, einer, der aufräumte, wo es nottat – ein Held eben. So tigerte Gernot Löbsack in mancher Nacht durch die Vergangenheit, in der er sich dank seines Geschichtsstudiums hervorragend auskannte. Deutlich höher gewachsen als in Wirklichkeit, modellierte Muskelarme statt der weißen Streichhölzer, die Nase nicht so lächerlich himmelwärts gebogen, das Haar im Stirnbereich voller und heller, marschierte, ritt oder segelte Löbsack durch die Jahrhunderte.
Er war Pirat in der sonnendurchfluteten Karibik, raubte unermessliche Schätze von spanischen Schiffen und lachte der schönen Tochter eines Caballeros, die seine Gefangene war, wild ins Gesicht. Noch wehrte sie sich dagegen, ihn zu lieben. Noch.
Seine Fantasien wurden immer bildhafter und präziser.
Er war ein Bauernführer im Jahr 1524. Auf starkem Ross ritt er im südlichen Schwarzwald einem Haufen voran, der ihm lärmend mit Äxten, Mistgabeln und Dreschflegeln in den Kampf folgte. Über ihren Köpfen flatterte die Bundschuh-Fahne. Das Ziel war die Burg, in welcher der adlige Bauernschinder sich verschanzt hatte. An einem einsamen Gehöft rastete die kriegerische Rotte. Die dunkellockige Tochter des Einödbauern näherte sich ihm, dem Anführer Löbsack. Schüchtern, doch voller Anmut. In einem irdenen Becher bot sie ihm Wein an. Er trank durstig und bedankte sich mit einem Lächeln. »Ich werde für dich beten«, sagte das Mädchen. – Diese Szene gefiel Löbsack so gut, dass er sie x-mal wiederholte.
Ein anderes Mal war er ein geheimnisvoller Reiter mit breitkrempigem Hut, der sein Gesicht beschattete, und er ritt in ein verwinkeltes Städtchen, in dem eine aufgebrachte Menge eine Hexe verbrennen wollte. Im Büßerhemd, mit wirrem Haar und angstgeweiteten Augen klammerte sich die Frau seiner Träume an die Käfigstäbe des Karrens, der rumpelnd über das Pflaster gezogen wurde. Löbsack zog seinen Hut tiefer ins Gesicht und folgte der unseligen Prozession mit kaltem Blick, bis die Richtstätte mit dem aufgeschichteten Scheiterhaufen erreicht war. »Hex brenn! Hex brenn!«, grölte der Pöbel. In dem Moment, als die Henkersknechte den Käfig entriegelten und das vor Entsetzen schreiende Mädchen herausrissen, sprengte Löbsack mit seinem Rappen heran. Ringsum standen die Mäuler offen, als der Rappe die Knechte wegrempelte und Löbsack das schöne Kind zu sich aufs Pferd hob. Die zarte Schulter, über die das grobleinene Büßerhemd gerutscht war, zeigte Striemen von Peitschenschlägen. »Hohohoho«, rief Löbsack, gab dem Rappen die Sporen und ritt rücksichtslos mitten in die blutrünstige Menge, die schließlich demütig vor solchem Heldenmut eine Gasse bildete und ihn durchließ. Der Blick aus den braunen, unschuldigen Augen des geretteten Mädchens ruhte auf seinem Gesicht ...
Löbsacks Träume waren wundervoll. Ein bisschen glichen sie den Comics aus seiner Jugend, aber diesen Vergleich hätte Löbsack als Entweihung zurückgewiesen, denn immerhin hatte er Geschichte studiert, und seine Gedankenbilder waren originalgetreu. Löbsack legte großen Wert auf historische Genauigkeit.
Manchmal brachte er einen Traum nicht zu Ende, bewusst nicht, weil er ihn sich aufsparen wollte. Weil er am nächsten oder übernächsten Tag an die Abenteuer anknüpfen wollte. Für ihn war das so spannend, wie sich auf die Fortsetzung eines mehrteiligen Films zu freuen.
Die Erfüllung seiner Traum- und Wunschbilder aber war geradezu keusch. Nie endete eine Heldentat mit körperlicher Vereinigung. Sex war in Löbsacks Fantasien so tabu wie in den Filmen der 50er-Jahre. Andeutungen genügten. Höhepunkt des Geschehens war Löbsacks Anerkennung als starker, unbeugsamer Charakter. Als Sieger. Als Held.
Allfällige Demütigungen im Alltag glich Löbsack meistens noch am selben Abend mit einer Fantasiegeschichte aus.
Zum Beispiel musste er kürzlich die blamable Begegnung mit einem gefeuerten Schüler verarbeiten. Im Augiasstall, einer Studentenkneipe, wo Löbsack hin und wieder ein mit Limonade versetztes Bier trank, war der Kerl an seinen Stehtisch gekommen. Löbsack konnte sich nicht an den Namen erinnern, aber an das Gesicht. Ein Gesicht mit platter Boxernase und leeren, kalten Augen, in denen Löbsack als das erblickte, was aus dieser Sorte Jungs bedenken- und gewissenlose Schläger macht. Dass der Faulpelz von der Schule geflogen war, dafür war Löbsack so ursächlich gewesen wie der Fürst von Liechtenstein für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dem stämmigen Burschen allerdings war das ziemlich wurscht. Ihm genügte es völlig, dass Studienrat Löbsack an dem Gymnasium zu Gange war, das ihm den Laufpass gegeben hatte. Basta.
»Na, Mäuschen«, sagte er.
In seiner Stimme schwang die primitive Herausforderung eines schlagbereiten Komplexhaufens, in dem außer einer Ladung Frust mindestens sechs, sieben Pils gärten.
»Ich glaube, Sie verwechseln mich, junger Mann«, sagte Löbsack.
»Dich verwechseln? Ha! Eine Witzfigur wie dich verwechseln? Da müsste ich ja blind sein auf beiden Ohren, ey!«
Es war im ganzen Lokal zu hören.
»Ich möchte bitte zahlen«, sagte Löbsack zu Conny, der Aushilfszapferin. Sie war süß, hatte dunkle Locken und haselnussbraune Augen.
»Werden Sie belästigt, Herr Löbsack?«, fragte sie.
»Neinnein. Es ist schon in Ordnung. Nur eine Verwechslung.«
»Das ist MÄUSCHEN«, höhnte der Bursche. »Das müsst ihr doch kennen, das feige Arschloch.«
»Lassen Sie doch den Mann in Ruhe«, sagte ein Student.
»Pass auf deine eigene Fresse auf!«, drohte ihm der Schläger und riss mit der linken Hand an Löbsacks Krawatte, die rechte Faust abschussfertig in Kinnhöhe.
Der Student blickte erschrocken weg. Löbsack bekam keine Luft mehr und hatte höllische Angst. Er sah die rohe Faust, bei deren bloßem Anblick seine Zunge den Geschmack von Blut meldete.
»Lassen Sie mich bitte los«, krächzte er. »Ich habe Sie immer besser benotet, als ich gedurft hätte. Glauben Sie mir bitte.«
Der Bursche war total Herr der Lage und kostete es aus.
»Dann sag den Typen hier mal, was an deiner Penne für Idiotenpauker rumrennen! Los! Spuck’s aus, Mäuschen!«
»Jetzt reicht’s!«, sagte Conny und griff zum Telefon.
»Ich rufe die Polizei.«
»Untersteh dich!«, warnte der Schläger und drehte sich um, wobei er die Krawatte seines Opfers losließ.
Löbsack rannte davon.
Er stürzte aus dem Lokal, hechelte an verwunderten Passanten vorbei, bis er, gehetzt um sich blickend, mit zitternden Händen die Haustür aufschloss. Er wollte sterben vor Scham. Doch an Scham kann man leiden, aber nicht sterben.
Löbsack zog seine Schuhe aus und legte sich auf die Couch. Er machte die Augen zu und versetzte sich in das Jahr 80 nach Christus.
Gernot Löbsack sah sich als Gladiator.
Es ist das Jahr, in dem das Kolosseum in Rom eröffnet wird. Der dickliche Kaiser Titus hat eine Orgie von Grausamkeiten befohlen, die hundert Tage dauern und Tausende von Gladiatoren und wilden Tieren das Leben kosten soll.
Löbsack ist ein berühmter Schwertkämpfer, ein Secutor. Vor zwei Jahren noch war er ein germanischer Kriegsgefangener, ein verachteter Barbar aus dem Feindesland im Norden, »zur Arena« verurteilt wie andere Gefangene, Verbrecher und Sklaven. Seitdem hat er zwanzig Kämpfe gewonnen. Das ist immens. Die meisten Gladiatoren sind nach vier, fünf Kämpfen erledigt. Entweder werden sie im Gefecht tödlich getroffen – oder sie werden besiegt und sind damit der Gnade des Imperators oder der Zuschauer ausgeliefert.
Löbsacks heutiger Gegner ist ein Retiarier, ein Netzkämpfer. Mit seinem Wurfnetz wird er versuchen, Löbsack in einen hilflosen Zustand zu bringen, wie einen im Sand zappelnden Fisch, um ihn dann mit seinem Dreizackspieß zu erstechen.
Er heißt Exochus und stammt aus Thrakien. Löbsack hat schon viel von ihm gehört.
In Rom ist dieser Kampf eine Sensation. Beide Gladiatoren sind unbesiegt. In den Straßen der Hauptstadt ist für dieses Duell lautstark geworben worden. Sklaven hatten Fahnen umhergetragen, auf denen die Namen der beiden berühmten Kämpfer standen. Für die vielen Bürger, die nicht lesen konnten, hatten sie Details über den Kampf des Jahres hinausgeschrien. Reklame-Maler hatten in großen roten Buchstaben Vorankündigungen auf das Kräftemessen der Besten entlang der Hauptstraßen an die Hauswände gepinselt.
In die kühlen Katakomben unter der Arena des Kolosseums dringt von oben gedämpft das Waffengeklirr der Kämpfer. Wie durch dicke Vorhänge hört Löbsack das Gebrüll der vielen tausend Zuschauer.
Ein äthiopischer Sklave mit einem Ölkrug kommt herein. Löbsack legt seinen wollenen Überwurf ab und streckt sich auf der Steinbank aus. Der Sklave bestreicht ihn mit Öl und massiert mit kraftvollen Griffen seine Muskeln. Nur die Berühmten unter den Gladiatoren werden vor dem Kampf massiert.
Sein Trainer kommt. Er heißt Quintus Nasica und ist früher ein bekannter Faustkämpfer gewesen. Sein Gesicht ist eine Kraterlandschaft, denn in den caestus, den starken Lederriemen, den die Kämpfer sich um die Fäuste wickeln, sind Eisenkügelchen eingenäht. Fast jeder Treffer hinterlässt Spuren.
»Es ist soweit«, sagt der Trainer. »Leg die Rüstung an.«
»Wieviele Kämpfe sind es noch, bis ich drankomme?«
»Nur noch einer. Ein Venator aus Ägypten kämpft gegen einen Leoparden«, sagt Quintus Nasica und verzieht sein von Narbenwülsten bedecktes Gesicht zu einem unbekümmerten Grinsen. »Du musst einen sehr guten Kampf machen. Wir brauchen eine Steigerung. Die Zuschauer schwärmen nämlich noch vom gestrigen Abend. Da trugen ein paar Christen die toga molesta.«
»Die unbequeme Toga? Ah, ich verstehe, sie wurden verbrannt.«
»Die Tücher, in die sie eingewickelt wurden, waren mit Pech getränkt. Zwanzig lebendige Fackeln. Sie gaben Licht für den Kampf von vier Galliern gegen vier Thraker. Die Leute waren hell begeistert, sogar die Patrizier neben der Kaiserloge.«
Löbsack schnallt sich den breiten Ledergürtel um den dunkelgrünen Lendenschurz, sein einziges Textil im Kampf. Er schnürt die Ledersandalen, die bis zur Hälfte der Waden reichen. Um seinen rechten Unterschenkel bindet er sich eine Beinschiene aus Bronze. Mehr an metallischem Körperschutz ist dem Secutor – neben dem Helm – nicht erlaubt. Das Fleisch muss verwundbar sein, sonst wäre der Kampf nicht spektakulär genug für die Massen, die durch schaurigste Gemetzel verwöhnt sind.
»Komm, wir gehen«, sagt Quintus Nasica.
Der Sklave trägt den Helm, den viereckigen Schild und das Schwert. Quintus Nasica geht voran. Der unterirdische Gang ist von Wandfackeln schummrig erhellt. Das Licht reicht gerade aus, dass man sich zurechtfindet. In den Kammern links und rechts warten Gladiatoren auf ihre Stunde. Wird sie den Triumph bringen oder den Tod? Es herrscht eine gespannte Stille in den Gewölben.
Sie kommen an der Leichenkammer vorbei. Keiner der drei wirft einen Blick hinein. Ohne hinzusehen, weiß man, dass die Kammer am Nachmittag mit toten Gladiatoren voll ist wie ein Sardinenfass auf dem Fischmarkt.
»Secutor, heute stirbst du!« Die Stimme kommt von hinten aus dem Gang.
»Dreh dich nicht um!«, sagt Quintus Nasica. »Das ist Exochus mit seinem Gladiatorenmeister. Sie wollen deine Nerven bloßlegen.«
Sie gehen die Steinstufen hinauf. Ein Ozean aus Stimmen brandet ihnen entgegen. Die Arena liegt in gleißendem Sonnenlicht. Ringsherum spannt sich in gewaltigem Bogen das gigantischste Bauwerk seiner Zeit: das Kolosseum. Über vier Etagen sitzen die Zuschauer. Es sind fünfzigtausend. Die Ränge türmen sich über fünfzig Meter hoch. Über den Tausenden von Stecknadelköpfen ist ein riesiges Sonnensegel aufgezogen. Die Stoffbahnen hängen an waagerechten Rahen und werden von Seemännern der Kriegsflotte je nach Sonnenstand vor- oder zurückgezogen. Das Segel ist purpurfarben und taucht die Zuschauerränge in warmes Dämmerlicht, während der helle Sand im Oval der Arena im Sonnenglast liegt. Sklaven ziehen breite Rechen über den Sand, um die Blutspuren der Vorkämpfe unterzuharken.
Löbsack sieht erstmals seinen Gegner.
Das also ist der berüchtigtste Netzkämpfer im römischen Imperium! Der unbesiegte Exochus!
Er ist groß. Unter seiner eingeölten Haut spielen starke Muskeln. Sein Gesicht drückt höhnische Überlegenheit aus. Es ist das Gesicht des Schlägers, der Löbsack im Augiasstall gedemütigt hat. Gelassen betrachtet Löbsack die platte Boxernase, herausfordernd blickt er in die leeren, kalten Augen seines Todfeindes.
»Zum Imperator!«, sagt Quintus Nasica.
Sie treten vor die Kaiserloge. Die Fanfaren schmettern hell.
»Ave Caesar, morituri te salutant!«, ruft Quintus Nasica dem Mächtigen zu. »Heil dir, Kaiser, die zum Sterben gehen, grüßen dich!« – Das ist der klassische Gladiatorengruß.
Löbsack blickt hoch zu Titus, einem fülligen Mann, der drei Meter über ihm jenseits der Mauerbrüstung thront. Seine weiße Toga ist mit Goldbünden gesäumt. Zwei schwarze Sklaven stehen hinter seinem goldverzierten Sessel und befächern ihn mit prächtigen Federwedeln. Links neben ihm sitzt Senator Gajus Fabius, der die heutigen Spiele finanziert hat. Im Gefolge des Kaisers ist er einer der wohlhabendsten und einflussreichsten Greise Roms.
Der alte Senator hat seine Tochter mitgebracht. Eppia, die Schöne. Es ist schon das dritte Mal, dass sie Löbsack kämpfen sieht. Ihr schneeweißes Gewand, ihr sanfter Hals, ihr bezauberndes Gesicht, ihre haselnussbraunen Augen, ihre kunstvolle Römerinnenfrisur – sie könnte eine Zwillingsschwester sein von Conny, der Aushilfszapferin aus dem Augiasstall.
Löbsack verneigt sich vor dem Kaiser. Dann blickt er zu Eppia und neigt kurz den Kopf. Sie bemerkt, dass ihr der heimliche Gruß gilt, und neigt ebenfalls leicht den Kopf. Dabei lächelt sie ein wenig.
In der Mitte der Arena wartet der Kampfrichter. Er trägt eine schwarze Tunika und halbhohe Riemensandalen. In der Hand hält er einen Holzstab. Sein Gesicht mit dem gestutzten weißen Bart ist ernst.
»Geh jetzt«, sagt Quintus Nasica. »Ich wünsche dir Glück!«
Löbsack nimmt dem Sklaven Helm, Schild und Schwert ab und geht in die Mitte der Arena. Der Platz misst über achtzig Meter in der Länge und mehr als fünfzig in der Breite. Die Sonne sticht. Heißer Sand dringt in Löbsacks Sandalen.
Vor dem Kampfrichter stehen die beiden Gladiatoren sich gegenüber. Löbsack stülpt sich den bronzenen Visierhelm über den Kopf, hakt den Riemen unter dem Kinn ein, damit der Helm fest sitzt, packt mit der Linken den Schild und mit der Rechten das Schwert – zwei Pfund rasiermesserscharf geschliffenes Eisen.
»Ihr seid beide erfahrene Kämpfer. Ihr kennt die Regeln«, sagt der Kampfrichter.
»Welche Regeln?«, sagt Exochus.
»Halt den Mund!«, sagt der Kampfrichter.
Was er Regeln nennt, lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen: Wenn ein Kämpfer unterlegen ist, also eine schwere Wunde erlitten hat, streckt er zum Zeichen der Aufgabe einen Zeigefinger deutlich sichtbar in die Luft. Mit dieser Geste bittet er gleichzeitig um Schonung. Nun entscheidet der Kaiser oder der Veranstalter der Spiele, ob der besiegte Gladiator weiterleben darf. Doch überlassen die hohen Herren in den grün umkränzten Ehrenlogen gerne dem gemeinen Volk die Entscheidung. Schließlich werden die Blutorgien ja veranstaltet, um die Massen bei Laune zu halten. Panem et circenses, Brot und Spiele heißt das listige Motto der Herrschenden.
Wenn der besiegte Gladiator sehr populär ist und bis zu seinem Missgeschick draufgängerisch gekämpft hat, gehen die Daumen der ausgestreckten Hände möglicherweise nach oben. Dann ist er ein missus, ein in Gnaden Entlassener. Sklaven heben ihn auf und tragen ihn durch die Überlebenspforte der Arena, hinter der ihn ein Wundarzt erwartet.
Aber wehe, wenn die Plebejer richtig angeheizt sind und Blut sehen wollen! Selbst der Kaiser wird sich hüten, das Volk zu enttäuschen. Wenn Tausende von Mäulern heiser nach dem Tod schreien, senkt er den Daumen. Und das ist das Ende für den armen Kerl in der Kampfbahn. Der überlegene Gegner muss ihm den Todesstoß geben. Damit hat das Gesetz der Arena sich erfüllt. Auf einer Bahre wird der Leichnam durch die Pforte der Libitina, der römischen Göttin der Bestattung, hinausgetragen.