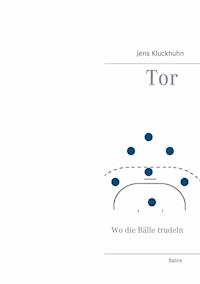Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In der Kurzgeschichtensammlung "15 Grenzen" werden die Protagonisten mit allen erdenklichen Formen von Grenzen konfrontiert. Mal kollidieren sie mit einer Grenze, die sie verschieben oder überwinden müssen, mal hoffen sie, dass eine Grenze nicht überschritten wird. Wir sprechen über Grenzen des Körpers und des Geistes und über Grenzen von Raum und Zeit. Letztlich sprechen wir über das Leben dies- und jenseits unserer Grenzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Geboren 1972 in Lemgo. Ein Lipper also, von Geburt an zu Sturheit und Geiz verpflichtet. Hat seinen Horizont erheblich erweitert, als er vor Jahren wegen einer tollen Frau nach Bielefeld gezogen ist und sein Herkunftsgefühl auf Ostwestfalen-Lippe ausgedehnt hat. Hat sich mittlerweile daran gewöhnt in einer Stadt zu leben, in der es mit der Straßenbahn ein Verkehrsmittel gibt, mit dem man im alten Fürstentum nur selten kollidiert und Millionenstädte in Verbindung bringt. Freut sich, dass BI nahe genug an LIP liegt, um auch weiterhin kaum ein Heimspiel des TBV Lemgo zu verpassen.
Autoren-Homepage:
www.jens-kluckhuhn.de
Folgende Titel dieses Autoren sind gleichfalls lieferbar:
Zoe
(Roman)
Broschiert - ISBN 978-3848212156
E-Book - ISBN 978-3844838626
Tor – Wo die Bälle trudeln
(Satire)
Broschiert - ISBN 978-3739220147
E-Book - ISBN 978-3739285290
Inhalt
Blütenpracht
Augenblicke
Ein Abschiedsbrief
Spieglein Spieglein
Willkommen in Asiopa
KI42
Final Table
Der Rechtsstaat
Die Geschichte vom Streuner
Der Tag
Der Eingriff
Auf ein Wort
Das Ebenbild
Herzenssache
Blütenpracht
Nora war im Sommer immer viel mit dem Fahrrad unterwegs und hielt oft bei einem der mobilen Verkaufsstände am Wegesrand, um frisches Obst oder ein paar Schnittblumen zu kaufen. Sie wollte sich gerade mit ihrem neuen Einkauf, einem Strauß bunter Feldblumen, auf den Weg nach Hause machen, als sie eine unscheinbare Pflanze bemerkte, die inmitten des farbenfrohen Blumenmeeres unterzugehen drohte.
»Was ist das denn?«, fragte Nora die Verkäuferin und deutete auf den Blumentopf.
»Eine Nekronie«, antwortete die Frau und sah ihre Kundin so lange und intensiv an, als wolle sie diese scannen. Nora verscheuchte den unangenehmen Gedanken und gab zu, noch nie von einer solchen Pflanze gehört zu haben.
»Glaube ich gern. Sie ist äußerst selten. Sie ist auch nicht zu verkaufen, denn sie wird nur durch Verschenken weitergegeben. Von Frau zu Frau, so will es die Tradition. Und sobald sie einmal geblüht hat, muss sie an die Nächste weiter verschenkt werden.«
»Ach«, sagte Nora, die ein Faible für Folklore dieser Art hatte. »Das klingt ja interessant.«
»Sie mögen die Pflanze, nicht wahr?«
Nora nickte, obwohl das Gewächs nicht allzu viel hermachte. Viel mehr als ein dicker, grüner Stängel mit einer an Hopfen erinnernden Knospe war nicht zu sehen, doch sie hatte noch Platz auf ihrer Fensterbank. Dort würde dich die Pflanze gut machen. Außerdem versprach die Blumenfrau, dass die Blüte alle Erwartungen übertreffen werde.
»Ich kaufe sie Ihnen gern ab«, sagte Nora.
Die Händlerin hob abwehrend die Hände: »Nein, nein. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Ich schenke Sie Ihnen gern, aber Geld kann ich dafür nicht annehmen.«
»Wenn Sie meinen …«
»Diese Pflanze sucht sich ihre neue Besitzerin praktisch selbst aus. Sie will zu Ihnen. Deswegen hat sie eben Ihre Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.«
»Nun, ich fühle mich geehrt.«
»Ich bin sicher, eines Tages werden Sie sehr gut verstehen, wovon ich spreche. Denken Sie bis dahin daran, viel mit ihr zu reden.«
»Das tue ich mit all meinen Pflanzen. Das Schöne an ihnen ist, dass sie nicht weglaufen können und zuhören müssen.«
»Erzählen Sie ihr alles, vor allem Ihren Kummer. Sie werden schnell sehen, dass die Pflanze etwas für Sie tun kann. Sie werden bestimmt Verwendung für ihre ganz besonderen Fähigkeiten haben.«
»Na, dann komm mal mit und zeig, was du kannst«, lachte Nora und nahm die Pflanze in Empfang.
In den nächsten Wochen goss Nora die Nekronie regelmäßig und beobachtete das Wachstum der Blätter ebenso gespannt wie die Entwicklung ihrer einzigen Knospe. Sie hatte versucht, Informationen über das Gewächs zu finden, doch nicht einmal das sich ansonsten allwissend gebende Internet konnte mit dem Suchbegriff Nekronie etwas anfangen. Nora musste im Umgang mit der Pflanze ganz auf ihr Geschick vertrauen, das allerdings gewohnt zuverlässig für reges Wachstum sorgte.
»Wenn es so weiter geht, brauche ich bald einen größeren Topf für dich«, sagte Nora, die schon immer viel mit ihren Pflanzen gesprochen hatte. Diese Gewohnheit hatte sie von ihrer Mutter übernommen, an die Nora in diesen Tagen mit einer Mischung aus Wohlwollen und Unbehagen dachte. Grund dafür war der neue Mann an Katjas Seite.
Nachdem Noras Vater vor einigen Jahren bei einem Unfall tödlich verunglückt war, hatte Katja sich zurückgezogen und vor dem Leben versteckt. Immer wieder hatte Nora versucht, ihre Mutter aus der selbst verordneten Isolation hervorzulocken, dabei jedoch lange Zeit keine nennenswerten Erfolge feiern können. Vor ein paar Wochen hatte Nora dann endlich Unterstützung vom Zufall bekommen, der in Person von Arno Katjas Weg gekreuzt hatte. Nora hatte den deutlich jüngeren Mann von Anfang an mit einiger Skepsis betrachtet, aber dessen ungeachtet wurde er zu einer festen Einrichtung im Leben ihrer Mutter. Da Katja seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr so glücklich und lebenslustig aufgetreten war, behielt Nora ihre Zweifel für sich. Nur der Nekronie erzählte sie, dass sie Arno nicht traute: »Ich glaube, er will nur ihr Geld. Ich kann es nicht beweisen, aber der Typ taugt nichts. Ich will nicht, dass ihr noch einmal das Herz bricht. Verstehst du das?«
Schon bald hielt Nora die Nekronie für die beste Zuhörerin unter ihren Pflanzen. Es lohnte sich, mit diesem Gewächs zu reden, denn sie honorierte es mit kräftigem Wachstum und einer immer üppiger werdenden Knospe. Nora war schon gespannt, wie die Blüte in voller Pracht aussehen würde, und sprach weiter zu ihr: »Du wirst es nicht glauben, was geschehen ist. Gestern war ich mit Katja und Arno im Restaurant. Wir sind mit seinem neuen Wagen gefahren. Wer den wohl bezahlt hat? Er nicht, glaube ich, aber darum geht es gar nicht. Na ja, vielleicht auch doch. Egal. Weißt du, was passiert ist?«
Nora gab der Pflanze großzügig zu trinken. Wie immer, wenn sie zu ihr sprach, hatte sie den Eindruck, dass die Knospe den Bewegungen ihres Kopfes folgte. Das war sicher nur Einbildung, aber dennoch gefiel ihr an dieser Pflanze außerordentlich. Die Aura des Geheimnisvollen, die sie seit dem ersten Tag unverändert umgab, tat ihr Übriges dazu. Es hatte nicht lange gedauert, bis Nora dem Gewächs den besten und sonnigsten Platz auf der Fensterbank gegeben hatte.
»Irgendwann musste Katja auf Toilette und ich saß mit Arno allein am Tisch. Da greift der Idiot nach meiner Hand und macht mir eine Liebeserklärung. Ich war viel zu überrascht, um ihm gleich eine zu knallen. Kannst du dir das vorstellen? Meine Mutter ist auf der Toilette, und der Typ gräbt mich an!«
Der Pflanze fehlten verständlicherweise die Worte, doch Nora reichte es völlig aus, wenn sie nur zuhörte. Die Frau mit dem grünen Daumen berührte den Blütenkopf vorsichtig mit der Handinnenfläche.
»Ich hätte ihn ohrfeigen und mit Mutter verschwinden sollen, doch sie wirkte gestern Abend so glücklich, dass ich nichts gesagt und gute Miene zum bösen Spiel gemacht habe, als sie zurückgekommen ist. Als sei nichts geschehen.«
Nora zögerte damit, den unangenehmen Gedanken auszusprechen, doch vor der Nekronie brauchte sie keine Geheimnisse zu haben: »Außerdem hatte ich Angst, dass sie mir nicht glauben würde.«
In den nächsten Tagen hatte Nora immer wieder überlegt, ob sie ihrer Mutter nicht doch von dem Vorfall berichten sollte, die Entscheidung aber immer wieder aufgeschoben. Mit jedem verstrichenem Tag wurde es schwieriger, es noch zu tun. Als sie dann auf einen Kaffee in Katjas Küche saß und wieder einmal darüber nachdachte, wie sie das Thema möglichst schonend ansprechen könnte, sagte ihre Mutter etwas, dass Nora seit einer Ewigkeit nicht mehr von ihr gehört hatte: »Das Leben ist schön.«
Natürlich war es großartig, diesen Satz aus dem Mund der eigenen Mutter hören, aber es war schrecklich zu wissen, dass diese Annahme auf einer Lüge basierte. Nach diesem Treffen ließ Nora den Gedanken, Katja doch noch von den Ereignissen des fraglichen Abends zu berichten, fallen und beschloss, die Sache ganz anders anzupacken.
Am nächsten Abend erzählte sie der Pflanze von ihrem Plan: »Meine Mutter ist heute mit einer Freundin im Theater und kann mir nicht in die Quere kommen. Ich fahre also gleich zu Arno und werde ihn zur Rede stellen. Was hältst du davon?«
Nora betrachtete die Knospe der Nekronie, die sich in den letzten Tagen zu öffnen begonnen hatte. Neben Rot und Gelb würde der Blütenkelch auch Orangetöne enthalten und sicher ein spektakuläres Bild abgeben. Nora beschloss, auf dem Weg zu Arnos Haus noch einmal an der Stelle vorbeizufahren, an der ihr die Händlerin die Pflanze geschenkt hatte. Sie wollte sich noch einmal bei der Frau bedanken und gleichzeitig versuchen, ein wenig mehr über Nekronien zu erfahren, doch wie sie kurze Zeit später feststellte, war der Stand in der Zwischenzeit abgebaut worden und die Händlerin weitergezogen. Ein wenig enttäuscht fuhr Nora weiter zu Arnos Wohnung, der ihr nach dem Öffnen der Haustür und einem kurzen Moment des Zögerns ein breites Lächeln zukommen ließ: »Wie schön, dich zu sehen«, sagte er und zog ganz falsche Schlüsse. Erstmals dachte seine Besucherin daran, mit diesem Besuch möglicherweise einen Fehler zu begehen.
»Möchtest du was trinken?«, fragte er, als er sie ins Wohnzimmer geleitet hatte, und machte Anstalten, ihr den Mantel abzunehmen.
Nora lehnte sowohl den Drink als auch die aufdringliche Hilfsbereitschaft des Gastgebers ab: »Nein, danke. Ich werde nicht lange bleiben.«
»Aha«, sagte Arno und wurde spürbar defensiver. »Was kann ich für dich tun?«
»Meiner Mutter geht es im Moment gut und ich möchte auch, dass es so bleibt. Deshalb möchte ich ihr eigentlich nicht sagen, was neulich passiert ist.«
»Deiner Mutter geht es so gut wie lange nicht. Das sind ihre eigenen Worte. Und an wem das liegt, liebe Nora, weißt du ganz genau, nicht wahr?«
Nora zog es vor, nicht zu antworten. Sie wusste es in der Tat, und genau das war das ganze Problem. Entweder würde Katja ihr nicht glauben und es zwangsläufig zu einem Streit zwischen Mutter und Tochter kommen, oder sie würde ihr glauben und wieder in das seelische Exil emigrieren, aus dem sie gerade erst wieder zurückgekehrt war.
»Außerdem … was ist denn neulich eigentlich passiert?«
Du dumme Kuh, dachte Nora über sich selbst. Er streitet es ab! Natürlich streitet er es ab, was hast du denn erwartet? Dass er sich einfach so in die Flucht schlagen lässt?
Nora erkannte, dass ihr Plan gar kein Plan war und versuchte, sich ihre Irritation nicht anmerken zu lassen: »Merk dir eins: Ich will nichts von dir wissen. Ich will nur, dass meine Mutter glücklich ist. Entweder benimmst du dich vernünftig ihr gegenüber, so wie sie es verdient, oder du verpisst dich besser ganz schnell.«
Arno machte zwei Schritte auf seine Besucherin zu. Das überhebliche Grinsen in seinem Gesicht drückte unmissverständlich aus, dass er sie nicht ernst nahm.
»Sonst …?«
»Das willst du gar nicht wissen«, sagte sie. Und wusste es selbst nicht.
Arno hatte das längst erkannt, dass sie nur heiße Luft verbreitete. Er stand nun bedrohlich nah vor Nora, die gegen eine aufsteigende Angst ankämpfen musste. Sie wollte nicht zeigen, dass sie am liebsten weglaufen würde.
Arnos Hände griffen schnell zu. Er fasste sie an ihren Po, zog sie zu sich heran und presste seinen Mund auf ihren. Nora wehrte sich. Sie versuchte, ihn zu beißen und schaffte es, ihn mit von Adrenalin unterstützter Kraft zurückzustoßen. Auf schnellstem Weg stürmte sie aus der Wohnung und versuchte gar nicht erst zu verstehen, was Arno ihr hinterherrief.
In der folgenden Nacht schlief Nora sehr schlecht. Sie hatte noch am Abend versucht, ihre Mutter zu erreichen und mehrere Nachrichten mit der Bitte um Rückruf hinterlassen, doch Katja hatte sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Nora machte sich gerade einen Kaffee, als es zu ungewöhnlich früher Stunde an ihrer Tür klingelte. Sie öffnete und stand ihrer Mutter gegenüber, die Tränen in den Augen hatte.
»Oh, Mama …«, sagte Nora und breitete die Arme aus, um sie zu trösten, doch stattdessen empfing sie eine schallende Ohrfeige.
Der Schrecken war größer als der körperliche Schmerz. Nora konnte sich nicht erinnern, jemals von ihrer Mutter geschlagen worden zu sein, doch jetzt starrte sie fassungslos in Katjas zorniges Gesicht.
»Ich hätte nie geglaubt, so was einmal zu sagen, aber du bist für mich gestorben. Schäm dich.«
Katja machte auf dem Absatz kehrt und ließ ihre Tochter verzweifelt zurück.
»Weißt du, was passiert ist?«, fragte Nora die Nekronie. »Das Arschloch hat meiner Mutter erzählt, ich hätte mich an ihn herangeworfen, und sie glaubt ihm. Die traut ihrer eigenen Tochter zu, dass sie ihr den Freund ausspannen will. Das ist doch nicht zu fassen, oder?«
Sie goss die Pflanze, die ihr geduldig wie immer zuhörte, und versuchte herauszufinden, auf wen sie wütender war, doch letztlich war die Antwort klar. Ihre Mutter hatte emotional reagiert und nicht nachgedacht, aber Arno schreckte auch vor den widerlichsten Verleumdungen nicht zurück und nahm keinerlei Rücksicht auf die Auswirkungen seiner Lügen. Er hatte seinen verkommenen Charakter eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Früher oder später würde ihre Mutter das erkennen, aber wahrscheinlich würde das mit großem Schmerz und neuem Leid für Katja verbunden sein. Nora war durch die Ohrfeige ihrer Mutter zwar gekränkt, verspürte aber bei diesen Gedanken dennoch nicht den leisesten Anflug boshafter Genugtuung.
»Soll er sich doch das Genick brechen und uns in Ruhe lassen«, sagte Nora abschließend zu diesem Thema.
Am nächsten Tag ging endlich die Blüte der Nekronie auf. Sie bot ein atemberaubendes Bild, wobei ihre wundervollen, an Feuer und Lava erinnernden Farben nicht im Mittelpunkt von Noras Interesse standen. Viel spektakulärer war, dass im Blütenkelch ein menschliches Gesicht zu erkennen war. Als hätte es ein talentierter Zeichner mit Grafit auf die Blätter aufgetragen.
Es war eindeutig Arno, der Freund ihrer Mutter.
Nora war angewidert und fasziniert zugleich.
Was hatte die Verkäuferin gesagt, als sie ihr das Gewächs geschenkt hatte? »Sie funktioniert nur bei bestimmten Menschen, aber dann erfüllt sie sehr spezielle Wünsche.«
Gestern Abend hatte Nora einen Wunsch geäußert. Sie dachte einen Moment darüber nach, was nun zu tun sei. Schließlich holte sie eine Schere und streichelte den Stängel der Pflanze: »Jetzt kannst du mir zeigen, was du kannst, meine Liebe.«
Dann schnitt Nora die Blüte ab.
Ein paar Tage später fand Arnos Beerdigung statt. Beim Beschneiden eines Baumes war er von der Leiter gefallen und hatte sich im eigenen Garten das Genick gebrochen. Katja hatte sich auf der Beerdigung, die von Arnos Eltern organisiert wurde, im Hintergrund gehalten. Sie kannte niemanden der Anwesenden auf der Trauerfeier und keiner der anderen Teilnehmer wusste, wer sie war und in welchem Verhältnis sie zu dem Toten gestanden hatte. Katja vermied es, den Schleier dieses Geheimnisses zu lüften, und ging unmittelbar nach dem Ende der offiziellen Zeremonie wort- und grußlos vom Friedhof, an dessen Ausgang ihre Tochter auf sie gewartete hatte. Katja machte keine Anstalten stehenzubleiben oder ihr auch nur einen Blick zu gönnen.
»Bleib doch bitte mal stehen«, rief Nora ihrer Mutter hinterher, doch Katja dachte nicht daran und ging einfach weiter.
Irgendwann aber sprachen die beiden Frauen wieder miteinander. Katja besuchte Nora auf einen Kaffee und honorierte damit die Sturheit ihrer Tochter, die nicht aufgegeben und immer wieder versucht hatte, mit ihr ins Gespräch zu kommen und das Missverständnis auszuräumen.
»Ich verstehe, dass du Arno glauben wolltest«, sagte Nora und meinte das tatsächlich so. Auf der einen Seite war da der Freund, der der Mutter den lange vermissten Lebensmut zurückgegeben hatte, auf der anderen Seite die Tochter, die womöglich ein wenig eifersüchtig auf den Eindringling in das mütterliche Leben reagiert hatte. Ein Dilemma. »Ich wüsste selbst nicht, was ich an deiner Stelle geglaubt hätte«, sagte sie und verzichtete auf den Hinweis, sich eine etwas gemäßigtere Reaktion als eine Ohrfeige und wochenlanges Schweigen gewünscht zu haben. Insgeheim musste sie bei diesem Gedanken lächeln, denn auch Arno hätte sich von ihr vermutlich eine etwas gemäßigtere Reaktion gewünscht als jene, die sie mithilfe der Nekronie gezeigt hatte.
Insgesamt verlief der Nachmittag zäh, aber Nora freute sich trotzdem. Nach und nach würde das Eis schmelzen und ihre Mutter irgendwann, eines nicht allzu fernen Tages, fühlen, dass ihre Tochter die Wahrheit gesagt und Arno versucht hatte, sich an sie heranzumachen und nicht umgekehrt. Alles nur eine Frage der Zeit, glaubte Nora. Sie empfand schon eine gewisse Vorfreude auf die in Reichweite befindliche Versöhnung.
Katja erhob sich, um aufzubrechen. Sie blickte aus dem Fenster, um das wechselhafte Wetter zu taxieren, und sah dabei eher zufällig auf eine etwas karge Pflanze auf der Fensterbank.
»Was ist das denn?«
»Eine Nekronie.«
»Eine fleischfressende Pflanze?«
»Nein«, sagte Nora, »kann man nicht sagen. Gefällt sie dir?«
»Sie ist … ganz interessant. Obwohl sie eigentlich nicht viel hermacht.«
Nora zögerte einen Augenblick. Sollte sie diese Pflanze an ihre Mutter verschenken? Sie dachte an die Worte der Verkäuferin. Die Pflanze sucht sich ihre neue Besitzerin selbst und muss, nachdem sie einmal geblüht hat, von Frau zu Frau weitergegeben werden. Dass es sich dabei um Mutter und Tochter handelte, war kein bekanntes Ausschlusskriterium. Eher schon die Tatsache, dass die Differenzen zwischen Mutter und Tochter noch nicht ganz ausgeräumt waren, doch schließlich wischte Nora alle kritischen Gedanken beiseite: »Ich würde sie dir gern schenken, Mutter. Traditionell muss das Gewächs von Frau zu Frau weiter verschenkt werden, nachdem sie einmal geblüht hat.«
»Ach. Und wer hat sie dir geschenkt?«
»Eine Händlerin, bei der ich ein paar Blumen gekauft habe.«
»Und was hat es mit dieser Tradition auf sich?«
Nora winkte ab. Sie merkte, dass ihre Mutter sie genauestens musterte. Wie früher, als sie noch ein kleines Mädchen war und etwas ausgefressen hatte. Schon damals war es ihr immer schwergefallen, sie zu belügen oder ein Geheimnis vor ihr zu bewahren. Nora entschied sich, gar nichts mehr zu sagen, drückte Katja die Pflanze in die Hand und bugsierte beide zur Tür. Sollte sie doch selbst herausfinden, ob diese Pflanze ihr jemals einen Gefallen tun konnte.
Die Nekronie wurde in ihrem neuen Heim, in dem sie wie schon zuvor bei Nora den besten Platz auf der Fensterbank im Wohnzimmer bekommen hatte, gehegt und gepflegt. Es wurde viel mit ihr gesprochen, wie es bei den Frauen in Katjas Familie Tradition war, und schon recht bald öffnete sich die Knospe und zeigte der neuen Besitzerin ein wunderbar blühendes Farbenmeer. Inmitten dieser farblichen Offenbarung gab es an diesem Morgen aber etwas viel Außergewöhnlicheres zu bestaunen – das wie mit Grafit gezeichnete Antlitz ihrer Tochter.
Katja hatte immer gewusst, dass es richtig ist, mit Pflanzen zu sprechen. Das hier war die Antwort auf die Gespräche, die sie mit der Nekronie geführt hatte. Noch am Tag zuvor hatte sie dem Gewächs erzählt, dass sie ihrer Tochter nicht glauben konnte und trotz zwischenzeitlicher Zweifel immer noch davon überzeugt war, dass Nora sich an ihren Freund herangemacht hatte. Das war unverzeihlich für Katja, die den Wunsch, nicht mehr mit Nora zu tun haben zu müssen, gegenüber der Pflanze deutlich artikuliert hatte: »Ich wünschte, ich hätte keine Tochter mehr.«
Katja betrachtete das einmalige Porträt und dachte lange nach, bevor sie in die Küche ging. Als sie nach kurzer Zeit mit einer großen Schere ins Wohnzimmer zurückkehrte, lächelte sie die Pflanze an.
»Danke«, sagte sie.
Und schnitt den Stängel der Nekronie durch.
Augenblicke
Die Türklingel weckte Daniel, der trotz der noch frühen Stunde auf seinem Sofa eingeschlafen war. Er brauchte eine Weile, bis er die Wohnungstür geöffnet hatte, um einer fremden Frau fragend in das attraktive Gesicht zu blicken.
»Hallo, ich bin die Sonja und wohne jetzt unter Ihnen. Wir ziehen dieses Wochenende ein«, sagte seine neue Nachbarin und streckte ihm lächelnd die Hand entgegen.
»Wir?«, gähnte Daniel und schüttelte Sonjas Hand. Sie war etwa zehn Jahre jünger als er, hatte ihr langes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und trug legere, zu einem Umzug passende Kleidung.
»Mein Freund Roman und ich.«
»Aha«, sagte Daniel und suchte nach ein paar angemessenen Worten. »Die erste gemeinsame Wohnung?«
»Nein, wir haben schon vorher zusammengewohnt, aber ich habe hier einen guten Job gekriegt und Roman kann hier ebenso gut studieren wie in unserer alten Heimat.«
»Na dann«, befand Daniel, dessen Informationsbedarf über fremde Menschen engen Grenzen ausgesetzt war. »Auf gute Nachbarschaft.«
»Ja, aber ich wollte Sie noch etwas fragen. Es ist etwas peinlich, aber es hilft ja nichts … uns ist das Toilettenpapier ausgegangen. Zum Einkaufen kommen wir heute nicht mehr. Können Sie uns vielleicht aushelfen?«
»Oh! Ja, ich denke schon. Warten Sie kurz.«
Ein paar Sekunden später drückte Daniel seiner neuen Nachbarin zwei Rollen Toilettenpapier in die Hand: »Hier, das gute Dreilagige.«
»Vielen Dank für die Nachbarschaftshilfe! Ich sage Ihnen die Tage Bescheid, wann unsere Einweihungsparty stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind.«
Daniel hatte seit der Trennung von Lena nur noch selten etwas vor. Auch für diesen Samstag hatte er keine Pläne. Er lag an den Wochenenden oft auf der Couch und döste, doch nach dem unerwarteten Besuch war er zu wach, um sich wieder hinzulegen und brach in einem eher seltenen Anfall von Aktivität zu einem Spaziergang auf. Eine Stunde später saß er am Tresen einer Kneipe und wartete auf sein erstes Bier. Hier war er in den vergangenen Wochen häufiger zu Gast gewesen. Das Bier schmeckte ihm, das Lokal war zu bestimmten Zeiten nicht zu voll und das Personal war unaufdringlich. Man konnte dort gut an der Theke sitzen und nachdenken. Oder einfach nur die Zeit totschlagen.
»Neu hier?«, fragte Daniel den jungen Zapfer, der gerade einen Strich auf den Deckel machte.
»Ja, erster Einsatz ohne Aufsicht heute.«
Daniel nahm das Glas auf und prostete der Luft zu. Die anderen Gäste auf den Barhockern waren mit Knobeln beschäftigt und nahmen keine Notiz von ihrer Umwelt. Die ruhige Atmosphäre des Lokals zu dieser Uhrzeit kam Menschen entgegen, die wie Daniel nicht viel mit Gesellschaft anfangen konnten. In ein, zwei Stunden war mit zahlreichen weiteren Besuchern und zusätzlichem Personal zu rechnen. Daniel würde sich dann recht bald verabschieden, doch momentan öffnete sich die Eingangstür nur selten. Als sie es das nächste Mal tat, trat eine Frau ein, die direkten Kurs auf den Zapfer einschlug und ihn mit einem Kuss begrüßte: »Hallo, Schatz«, sagte die Frau, der Daniel erst vor knapp zwei Stunden mit ein paar Rollen Toilettenpapier ausgeholfen hatte. Sie erkannte Daniel sofort, als sie sich auf einen Hocker setzte und sich im Lokal umsah: »Oh, Herr Nachbar! So schnell sieht man sich wieder.«
»Hallo«, sagte Daniel, »Feierabend für heute?«
»Ja, zumindest für mich. Aber mein Freund muss noch arbeiten. Das ist Roman, mein Lebensgefährte.« Sie deutete auf den Mann hinter der Theke. Daniel wusste von ihm, dass er ein manierliches Bier zapfen konnte. Mehr musste er gar nicht wissen, doch Sonja wollte die beiden Männer miteinander ins Gespräch bringen. Offensichtlich versuchte sie, sich gut einzuleben und ab dem ersten Augenblick in ihrer neuen Heimat Kontakte zu knüpfen. »Roman, das ist unser Nachbar, der uns mit dem Toilettenpapier ausgeholfen hat.«
Roman hatte breite Schultern, die nach Fitnessstudio aussahen, kurze Haare und tätowierte Unterarme. Er reichte seine Hand über den Tresen: »Freut mich«, sagte er, und auch Daniel murmelte etwas Freundliches, während er die dargebotene Hand schüttelte. Er suchte zwar nicht unbedingt die Nähe zu seinen neuen Nachbarn, aber ein gutes Verhältnis zum Mann hinter der Theke ist immer ein Vorteil.
Am nächsten Mittag wachte Daniel mit Kopfschmerzen auf. Er war in der Kneipe hängen geblieben und hatte mit Sonja und nach Romans Feierabend auch noch mit ihm etliche Male auf gute Nachbarschaft angestoßen. Er zog vom Schlafzimmer auf seine Couch in den Wohnbereich um und schaltete den Fernseher ein, um wie üblich beim Zappen nichts von Interesse zu finden.
Bis er Sonja sah.
Sie saß in einem Fernsehstudio und las Nachrichten vor.
»Mein Gott«, sagte Daniel nach einem respektvollen, der Verwunderung geschuldeten Moment des Schweigens und versuchte die Gespräche der vergangenen Nacht zu rekonstruieren.
Hatte Sonja von einem Job als Nachrichtensprecherin erzählt?
Nein, daran würde Daniel sich doch erinnern. Von einer Stelle als Assistentin der Geschäftsleitung in irgendeiner Computerbude hatte sie gesprochen, an etwas anderes konnte Daniel sich nicht erinnern. Jetzt aber saß sie frisch wie der Frühling, was angesichts der durchzechten vergangenen Nacht reichlich unverschämt war, auf der anderen Seite der Mattscheibe und erzählte mit einem ebenso charmanten wie unpassenden Lächeln vom x-ten erfolgreichen Raketentest auf einer asiatischen Halbinsel. Daniel stand auf und trat näher an den Bildschirm heran, um seine Wahrnehmung zu überprüfen, doch auch nach eingehendem Studium der Bilder hatte er keine Zweifel.
Das ist Sonja, war er sich sicher.
Oder?
Die Stimme klang etwas anders, doch er hörte sie jetzt nicht aus unmittelbarer Nähe, sondern nachdem sie den Umweg über einen Satelliten genommen hatte. Er suchte sein Smartphone, fand Sonja unter seinen Kontakten und fragte mit einer Textnachricht, ob sie eine Zwillingsschwester habe. Er beobachtete den Bildschirm, als würde er erwarten, sie dort zu ihrem Handy greifen zu sehen.
Natürlich tat die Nachrichtensprecherin das nicht.
Vielleicht ist die Sendung kurz vorher aufgezeichnet worden, dachte Daniel. Oder, viel naheliegender, sie hat ganz einfach das Handy nicht dabei. Es ist jedenfalls kein Beweis, dass sie es nicht ist, wenn sie nicht antwortet.
Sekunden später gab sein Smartphone ein Signal. Er hatte eine Textnachricht bekommen: Nein, ich bin ein verwöhntes Einzelkind. Warum fragst du?
Die Frau im Fernsehen hatte in diesen Sekunden keine Nachricht geschrieben, darauf hatte Daniel geachtet. Er schaltete alle Geräte aus und ging wieder ins Bett.
Offensichtlich war er noch nicht wieder ganz fit.
Am nächsten Abend tankte Daniel auf dem Heimweg von der Arbeit seinen Wagen voll und ging zur Kasse, um zu zahlen.
»Guten Abend«, sagte der Kassierer und Daniel hob seinen Blick, um die Begrüßung mit einem Mindestmaß an Höflichkeit zu erwidern.
»Ach«, staunte er. »Hallo, Roman. Das ist ja eine Überraschung.«
» Wie bitte?«
Der Kassierer neigte den Kopf und sah den Kunden schief an.
»Erkennst du mich nicht? Ich bin es, dein neuer Nachbar. Daniel«
»Nein, ich erkenne Sie nicht, mein Herr.«
»Mensch, ich bitte dich. Wir haben doch Samstagabend zusammen …«
In Romans Blick war keine Spur des Erkennens ausfindig zu machen, dafür allerdings eine unübersehbare Skepsis. »Was haben wir Samstagabend zusammen …?«
Gar nichts haben wir zusammen, sagte der Blick des Verkäufers eindeutig, aber Daniel gab noch nicht auf: »Wir haben die ganze Nacht durchgefeiert, zusammen mit deiner Freundin. Erinnerst du dich nicht? Gestern muss dir doch auch schlecht gewesen sein!«
»Mir ging es gestern gut und heute auch, aber ich frage mich, wie es Ihnen gerade geht?«
Die Situation war peinlich. Hinter Daniel wartete eine Frau darauf, an die Reihe zu kommen, und fragte sich derweil, ob der Typ vor ihr nur verrückt oder auch noch gefährlich war. Daniel erlitt einen Schweißausbruch und hätte sich nur zu gern in Luft aufgelöst. Beim Versuch, schnellstmöglich von diesem Ort zu verschwinden, fielen ein paar Münzen von seinem Wechselgeld auf den Boden. Er ließ sie einfach auf dem Boden liegen, als hätte er die Tankstelle überfallen und nicht auch nur den Bruchteil einer Sekunde zu verlieren.
Nachdem Daniel in der folgenden Nacht keinen Schlaf finden konnte und er einen unruhigen Tag verbracht hatte, klingelte er abends bei Sonja und Roman und versuchte herauszufinden, welchen Nebenjobs die beiden nachgingen. Beide wunderten sich über Daniels Frage und sein konkretes Interesse an ihren Lebensumständen, gaben aber weder einen Job beim Fernsehen noch einen an der Tankstelle an: »Ich arbeite in der Kneipe, sonst nirgends«, sagte Roman. »Und du? Arbeitest du nebenbei für das Finanzamt, oder warum stellst du solche Fragen?«
Daniel hatte nicht den Eindruck, dass sie ihn zum Narren hielten, war aber weiterhin davon überzeugt, sie eindeutig im Fernsehen und ihn hinter dem Verkaufstresen der Tankstelle identifiziert zu haben. Er hätte ein Vermögen darauf gewettet, von Roman abkassiert worden zu sein, und fragte wie zuvor schon Sonja auch ihn nach der Existenz eines Zwillings. Den Blick, den sich das Pärchen daraufhin zuwarf, konnte Daniel leicht und zu seinen Ungunsten interpretieren, doch er hatte ganz andere Sorgen als die Meinung, die sich seine neuen Nachbarn gerade über ihn bildeten. Er verabschiedete sich hastig, nachdem Roman seine Frage verneint hatte, und wälzte sich auf der erfolglosen Suche nach einer logischen Erklärung, die die Zweifel an seinem Wahrnehmungsvermögen zerschlagen konnte, eine weitere Nacht schlaflos im Bett herum.
In den nächsten Tagen nahm Daniel dankbar die Gelegenheit wahr, die Selbstzweifel und die damit einhergehenden unangenehmen Fragestellungen unter dem Schutt der zahllosen Ereignisse des Alltags zu verstecken. Er war mit der Überarbeitung eines Angebotes beschäftigt, als er in das Büro seines Verkaufsleiters zitiert wurde. Von unguten Gefühlen begleitet machte er sich auf den Weg in den benachbarten Gebäudetrakt. Die Möglichkeit einer positiven Nachricht kam ihm gar nicht erst in den Sinn. Er wusste, dass Effektivität und Produktivität in den letzten Monaten unter den Folgen der Trennung von Lena gelitten hatten. Zuvor hatte er jahrelang gute Arbeit geleistet, weshalb er bei seinem Verkaufsleiter bislang auf Milde gestoßen war, doch irgendwann war die Erinnerung an vergangene Sonnentage kein ausreichendes Fundament mehr für eine weitere Zusammenarbeit, da sie nicht zu akzeptablen Verkaufszahlen führte. Aus Sicht eines Umsatzverantwortlichen war es an der Zeit für eine unmissverständliche, aber im Ton gerade noch moderate Ansage.
Daniel zog halbherzig verschiedene Verteidigungsstrategien in Betracht. Seine Arbeit war ihm ziemlich gleichgültig geworden, seit er in Person von Lena etwas ungleich Wertvolleres verloren hatte. So glaubte er auf fast alles gefasst zu sein, als er nach dem Anklopfen die Tür öffnete, doch die zur Begrüßung des Vorgesetzten zurechtgelegten Worte blieben ihn im Halse stecken. Hinter dem Schreibtisch erhob sich Roman und zeigte mit einer sparsamen Geste auf einen Stuhl am Besprechungstisch. Daniel blieb wie versteinert im Türrahmen stehen.
»Nun nehmen Sie schon Platz. Und schließen Sie bitte die Tür«, sagte Verkaufsleiter Roman ungeduldig und wartete auf Daniel, der abgesehen von großen Augen und einem offenstehenden Mund jedoch keine Reaktion zeigte. Er stand einfach an ungünstiger Stelle da und starrte seinen Verkaufsleiter an, der allmählich die Geduld verlor: »Was ist los mit Ihnen? Kommen Sie endlich herein und machen Sie die Tür zu. Ich habe mit Ihnen zu reden.«
Endlich setzte sich Daniel in Bewegung. Langsam und mit verwirrtem Gesicht, aber immerhin. »Was … was machst Du hier?«
»Bitte?« Der Ton des Verkaufsleiters beinhaltete unterschiedliche Stimmungslagen, doch keine von ihnen war positiver Natur. »Was soll diese dumme Frage, Herr Kuhn?«
»Aber … du bist doch Roman. Was … was machst du hier?«
Daniel betrat die Praxis und empfand Erleichterung, als er an der Anmeldung die langjährige Sprechstundenhilfe seines Hausarztes und nicht etwa Sonja erkannte. Zwei Stunden später saß er immer noch im Wartezimmer von Dr. Hofer, den er seit seinem Eintritt in die Pubertät kannte. Wenn Daniel mit einem Menschen offen reden konnte, dann mit seinem Hausarzt, den er eher wie einen Onkel betrachtete. Vielleicht lag das daran, dass Daniel noch nie ernste gesundheitliche Probleme gehabt hatte und bei seinen Besuchen bisher immer ein Scherz in der Luft gelegen hatte. Dieses Mal machte Daniel sich allerdings echte Sorgen, die mit jeder Minute im Wartezimmer größer wurden. Seit sein Verkaufsleiter ihn praktisch zum Arztbesuch gezwungen hatte, schaffte er es nicht mehr, die negativen Gedanken an den Rand seines Bewusstseins oder, im optimalen Fall, ein Stückchen darüber hinauszudrängen. Endlich wurde er aufgerufen und begab sich in das Sprechzimmer, in dem er schon so oft gesessen hatte. Von Routine konnte diesmal allerdings keine Rede sein, dafür lag die Vermutung, dass etwas nicht stimmte, zu nahe. Als die Tür aufging und Dr. Hofer eintrat, fühlte es sich an, als würde sich eine Schlinge um Daniels Hals enger ziehen.
»Hallo, Daniel«, sagte der Arzt und verrieb Desinfektionsmittel in seinen Händen. »Was führt dich zu mir?«
Daniel zwang sich dazu, Hofer anzusehen. Er atmete auf, als er in das mittlerweile recht faltige, aber vertraute Gesicht seines Hausarztes sah und nicht seinen Nachbarn erkannte. In kurzen Worten berichtete der Patient von seinen jüngsten Erlebnissen, die Hofer wortlos zur Kenntnis nahm. Es folgten einige Untersuchungsmaßnahmen, die ein Arzt immer gut mit seiner Krankenkasse abrechnen kann, und ein paar Fragen: »Hattest du in letzter Zeit viel Stress?«
»Geht so. Habe mich von Lena getrennt. Oder sie sich von mir.«
»Das tut mir leid. Wann war das?«
»Vor drei Monaten.«
»Und seitdem? Viel Alkohol?«
»Hm, nein. Ich glaube nicht.«
»Du glaubst nicht?«
»Vielleicht ein bisschen zu viel.«
»Nimmst du irgendwas anderes?«
»Was?«
»Drogen? Medikamente, beispielsweise Schlafmittel? Oder Stimmungsaufheller?«
»Nein, da behalte ich lieber meine schlechte Laune.«
Der Arzt ging nicht auf den müden Scherz ein und tastete ein paar Stellen am Patientenkörper ab, drückte hier und da und fragte, ob bei Berührung Schmerzen auftraten.
»Nein.«
»Sonst irgendwelche Beschwerden? Kopfschmerzen?«
»Nein, höchstens Mal vom Alkohol, aber ich denke, das meinen Sie nicht.«
»Hattest du in letzter Zeit Sehstörungen? Siehst du etwas doppelt oder verschwommen? Punkte vor den Augen oder Sterne, etwas in der Art?«
»Hm … nein …«
Oder doch?, fragte Daniel sich insgeheim und rutschte auf seinem Stuhl herum.
»Ist dir öfter schwindelig oder musst du dich häufiger erbrechen?«
»Ich … nein … ich … ich weiß nicht …«
»Wir sollten ein paar Sachen ausschließen, deswegen ziehen wir einen Neurochirurgen hinzu.«
»Was … was bedeutet das?«
»Nichts. Wir wollen nur sicherstellen, dass keine körperliche Ursache vorliegt. Dabei hilft uns der Kollege. Heute gibst du uns bitte noch etwas Blut und Urin und morgen Abend kommst du in die Sprechstunde. Dann sehen wir weiter, okay?«
Dr. Hofer wirkte nicht so lustig wie bei vielen vorherigen Besuchen, fand Daniel. Und versuchte sich selbst davon zu überzeugen, dass er sich das nur einbildete.
Am Abend ging Daniel in die Kneipe und bestellte bei Roman ein Bier und einen Klaren. Er suchte etwas Zerstreuung und ein wenig nicht zu anspruchsvolle Konversation. Da Roman keine Anstalten machte, das Gespräch zu eröffnen, stellte Daniel ihm eine unverfängliche Frage: »Und? Gut eingelebt?«
»Was?«, fragte der Wirt nicht gerade freundlich. Offensichtlich hatte er schlechte Laune.
»Ob du dich schon etwas eingelebt hast?«
»Was? Wovon redest du?«
»Na … hier … in der neuen Stadt. Und in eurer neuen Wohnung?«
Daniel bekam nasse Hände. Er hatte das Gefühl, alle Anwesenden würden ihn anstarren. Beim Betreten des Lokals waren nur wenige Plätze besetzt, doch jetzt schien der Raum bis auf den letzten Platz mit Menschen gefüllt zu sein, die alle nichts Besseres zu tun hatten, als ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Szene, in der ein Gast einem Wirt auf die Nerven ging, zu richten.
»Wovon redest du? Ich bin nicht umgezogen. Ich stehe hier seit Monaten und zapfe dein Bier, also was soll das Gerede?«
Daniel vergaß Schnaps und Bier und sprang vor Schreck von seinem Barhocker. Ihm war schwindelig. Einen Moment lang glaubte er, nicht auf den Füßen bleiben zu können. Vielleicht wäre es nicht das Schlechteste, einfach umzukippen und nicht wieder aufzustehen, dachte Daniel, schaffte es aber irgendwie, ohne Sturz Richtung Toiletten zu taumeln.
»Was ist los mit dir, Mann?«, rief ihm jemand hinterher.
Wie ein Flüchtender, dem die ihm folgende Meute so dicht auf den Fersen ist, dass er sie schon hören kann, stürmte er in den Sanitärbereich des Lokals und verbarrikadierte sich in einer der Kabinen. Ihm kamen die Tränen. Zum ersten Mal seit etlichen Jahren weinte Daniel. Nicht einmal die Trennung von Lena hatte ihn dazu gebracht.
Er hatte Angst.
Er versuchte sich zu beruhigen und brauchte einige Zeit, bis er glaubte, den Menschen wieder unter die Augen treten zu können. Als er den Toilettenbereich verließ und wieder den Hauptraum betrat stand nicht mehr Roman, sondern tatsächlich Ralf, der ihm in den vergangenen Monaten ungezählte Biere gezapft hatte, hinter der Theke. Und nach wie vor war das Lokal spärlich besucht und weit davon entfernt, wegen Überfüllung die Türen schließen zu müssen.
»Alles klar?«, fragte Ralf.
Daniel murmelte eine Entschuldigung und ging nicht weiter auf die Frage ein. Sollte er ausgerechnet Ralf erzählen, dass er Angst davor hatte, verrückt zu werden oder es längst geworden zu sein? Oder ernsthaft erkrankt zu sein? Nein, denn davon wollte Ralf ganz sicher nichts hören. Unter dem misstrauischen Blick des Wirtes trank Daniel das schal gewordene Bier in einem Zug aus und kippte den warm gewordenen Schnaps hinterher. Dann legte er einen Schein auf die Theke und verließ, nur von Ralf beachtet, die Kneipe, um an die frische Luft zu kommen.
Daniel ging die Straßen entlang, ohne auf Weg oder Zeit zu achten. Irgendwann passierte er eine Haltestelle, an der ein Bus mit geöffnetem Einstieg stand und auf Fahrgäste wartete. Er sah hinein und war nicht sonderlich überrascht, als er Sonja am Steuer des Fahrzeugs erkannte. Sie bemerkte seinen Blick und starrte zurück, ohne eine Spur von Erkennen zu zeigen. Daniel verzichtete auf eine Fahrt und ging zurück nach Hause, wo er auf dem Weg zu seiner Wohnung im Treppenhaus stehen blieb und auf die Tür zu der Wohnung starrte, in die Sonja und Roman erst vor ein paar Tagen eingezogen waren.
Das ganze Elend, dachte Daniel, hat erst mit ihrem Einzug begonnen. Vielleicht hatte er vorher ein paar Probleme gehabt, aber längst nicht in einem solchen Ausmaß. Blinde Wut stieg in ihm auf, und nachdem er sie im Treppenhaus stehend aufgestaut und mit kruden Gewaltfantasien angereichert hatte, klingelte er an der Tür des jungen Paares, um es zur Rede zu stellen. Er war ungeduldig und begann praktisch gleichzeitig mit einer Faust gegen die Tür zu hämmern: »Los, macht die Tür auf! Kommt raus!«, schrie er und veranstaltete ein Heidenspektakel.
Es war mitten in der Woche und mitten in der Nacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden im Bett lagen und schliefen, war hoch und es lag nahe, dass es allein deshalb länger dauern konnte, bis die Tür geöffnet wurde, doch Daniel war für logische Argumente vorübergehend nicht erreichbar. Er legte alle Hemmungen ab, bearbeitete die Tür mit beiden Fäusten und nahm, als seine wütenden Schreie nach den feigen Schweinen, die sich endlich herauszukommen trauen sollten, nicht sofort den gewünschten Effekt zeigten, seine Füße zur Hilfe. Endlich öffnete sich die Tür. Daniel war bereit, wie eine Raubkatze auf der Jagd in die Wohnung zu springen und Sonja und Roman zur Rechenschaft zu ziehen, doch bevor er agieren konnte, traf ihn etwas Hartes am Kopf. Schlagartig wurde es dunkel um ihn herum. Und endlich war es im Treppenhaus wieder ruhig.
Als Daniel wieder zu sich kam, wusste er zunächst nicht, wo er sich befand. Als er dann das Treppenhaus erkannte, wusste er nicht, warum er in ebendiesem lag und Kopfschmerzen verspürte. Er fragte sich, ob er gestolpert war und stöhnte auf, als er mit dem Finger eine pochende Stelle an seinem Kopf berührte.
War er derart betrunken gewesen?
In unmittelbarer Nähe wurde eine Tür geöffnet, aber er war zu benommen, um den Kopf in Richtung des Geräusches zu drehen.
»Er ist wieder wach«, sagte eine männliche Stimme zu irgendwem. Und zu Daniel: »Steh auf, du Arschloch.«
»Ich … was … ich … kann nicht …«
Sein Kopf bestand aus Beton, in dem jemand mit einem Bohrer einzudringen versuchte, und war in etwa so beweglich wie ein Brückenpfeiler. Er hatte das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen. Bei all diesen Eindrücken hatte er kaum wahrgenommen, von der Stimme beleidigt worden zu sein.
»Nimm den anderen Arm, wir ziehen ihn hoch«, sagte die gleiche Stimme nun. Sekunden darauf spürte Daniel, wie er links und rechts an den Armen gefasst und hochgezogen wurde.
»Kannst du stehen oder verlierst du das Gleichgewicht?«
»Was … was ist passiert? Mein Kopf tut weh.«
»Geschieht dir recht«, sagte Roman, den Daniel nun erkannte, und der ihn mit Sonjas Hilfe an die Wand lehnte. »Hast du dich wieder eingekriegt?«
Daniel wusste nicht, wovon Roman redete. Er wirkte mühsam beherrscht, was sich Daniel nicht erklären konnte. Angestrengt navigierte er seinen Schädel in Sonjas Richtung und bemerkte, dass sie seinem Blick auswich.
»Was ist los? Warum seid ihr so komisch?«
»Das fragst du uns?«
»Ja, sicher.«
»Weißt du denn nicht, was eben passiert ist?«
»Nein!«
Roman überlegte, ob er seinem Nachbarn glauben konnte, aber letztlich machte das keinen großen Unterschied. So oder so lief es auf das Gleiche hinaus: »Ich glaube, du hast ein ziemlich großes Problem, Mann.«
Der gleichen Meinung war am nächsten Tag auch Dr. Hofer, den Daniel mit den Worten »Hallo, Roman« begrüßte, da er den Kopf seines Nachbarn oberhalb des weißen Kittels ausfindig machte.
»Bitte?«
»Ich sehe heute das Gesicht meines Nachbarn auf Ihren Schultern, Dr. Hofer.«
»Du erlaubst dir doch keinen Scherz mit mir, Daniel, oder?«
Die Blut- und Urinuntersuchung hatten zunächst keine Auffälligkeiten ergeben. Die Recherche des Hausarztes nach ähnlichen Fällen war ergebnislos verlaufen und auch die von ihm kontaktierten Kollegen hatten nicht weiterhelfen können. Nachdem Daniel verneint hatte, stellte der Arzt ein Rezept aus – »Das wird dich etwas beruhigen.« – und informierte Daniel, dass er bereits am nächsten Tag einen Termin in einer radiologischen Praxis habe.
»So schnell?«, fragte Daniel.
»Ja, so schnell. Wenn irgendwas ist, weißt du, wo du mich findest.«
Daniel stellte keine weiteren Fragen mehr, da er das Risiko der möglichen Antwort scheute. Er beeilte sich, an die frische Luft zu kommen, versäumte es aber trotzdem nicht, sich von Sonja, die hinter dem Schreibtisch am Empfang saß und ihrer Arbeit nachging, zu verabschieden.
Am nächsten Tag wachte Daniel relativ entspannt auf. Er hatte gut geschlafen. Die Tabletten, die Dr. Hofer ihm verschrieben hatte, zeigten Wirkung. Er trank einen Schluck Wasser, stellte sich unter die Dusche und tastete seinen Kopf ab, um zu fühlen, ob ein möglicher Tumor über Nacht stark genug gewachsen war, um seinen Kopf eine veränderte Form zu geben. Er ging zum Bäcker, um hinter der Theke statt der Frau des Bäckermeisters, die ihm sonst immer seine Brötchen verkaufte, Sonja vorzufinden, die ihm seinen Einkauf über die Ladentheke reichte. Danach stieg er in sein Auto, um zum Röntgen zu fahren und war nicht überrascht, als während einer Rotphase an der Ampel auf der Fahrspur neben ihm ein Radfahrer hielt, der auf den ersten, zweiten und dritten Blick niemand anderes als Roman war. Nur schade, dass Roman gar nicht Fahrrad fuhr.
So ging es in den nächsten Tagen weiter. Er wurde von verschiedensten Ärzten auf den Kopf gestellt, alles an und in ihm wurde geröntgt, alle erdenklichen Flüssigkeiten abgezapft und im Labor analysiert. Sehr seltene Erkrankungen wurden in Betracht gezogen und wieder verworfen, denn das Ergebnis aller Tests war immer gleich: ohne Befund.
»Du bist gesund«, sagte ihm Dr. Hofer nach dem vorläufigen Abschluss aller Untersuchungen und hörte sich dabei so an, als könnte er es selbst nicht glauben. Das ärztliche Bulletin wäre eine gute Nachricht für Daniel gewesen, wenn Hofer sich nicht zu einer kleinen Einschränkung gezwungen gesehen hätte: »Zumindest körperlich.«
»Das heiß also, dass ich verrückt bin?«
Daniel war sich selbst nicht sicher, ob er eine Frage gestellt oder eine Aussage getroffen hatte. Das ehrliche, aber ratlose Achselzucken seines Arztes half ihm bei der Einordnung seines Zustandes auch nicht weiter. Hofer empfahl einen Kollegen, der sich exzellent mit den Befindlichkeiten und Besonderheiten der menschlichen Psyche auskannte, und drückte Daniel die Karte des Psychiaters in die Hand. »Und wenn du körperliche Probleme hast, kommst du einfach wieder zu mir.«
Im Laufe der nächsten Wochen lernte Daniel viel über die Unterschiede zwischen Psychologen und Psychiatern. Sie brachten ihn dazu, tiefer in sich hineinzuhorchen, als er es aus freien Stücken und aus eigenem Antrieb jemals getan hätte, und fand dabei eine ganze Menge über sich selbst heraus. Mit dem Phänomen, von dem er heimgesucht wurde, stand das alles aber nicht im engeren Zusammenhang, und sein Zustand verbesserte sich nicht.
Im Gegenteil.
Immer mehr Menschen trugen die Gesichter von Sonja und Roman auf ihren Schultern. Erschwerend kam hinzu, dass sie immer häufiger dauerhaft den falschen Kopf behielten und ihr altes Gesicht einfach nicht wieder zurückkehrte. So hatte Daniel seine Mutter bei den letzten drei Begegnungen nicht mehr als Marlene, sondern ausschließlich als Sonja gesehen. Nur durch ihre Stimme und dem Ort, an dem sie einander begegneten, war es ihm möglich, sie zweifelsfrei zu identifizieren. Ähnlich war die Situation bei seiner Arbeit, in die er sich nach seiner Rückkehr ins Büro hineinkniete wie nie zuvor, da sie ihn wenigstens zeitweise von seinen Problemen abzulenken vermochte.
Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, ab dem ihm sein Verkaufsleiter Tag für Tag als Roman begegnete. Im Büro seines Vorgesetzten war das kein Problem, aber anderswo konnte er ihn nur anhand seiner Kleidung von den immer mehr werdenden Kollegen, die auch das Gesicht seines Nachbarn zur Schau trugen, unterscheiden.
Auch außerhalb seines Arbeitsplatzes nahm die Zahl der Menschen, die den eigenen Kopf in Daniels Augen gegen den von Roman oder Sonja eingetauscht hatten, von Woche zu Woche zu. Soweit er feststellen konnte, trugen ausschließlich Frauen Sonjas Konterfei und ausschließlich Männer das ihres Freundes, doch das war auch schon alles, was ihm das Schicksal an Orientierungshilfen an die Hand geben wollte. Daniel versuchte, soziale Beziehungen zu den Menschen aufrecht zu halten oder zu intensivieren, deren Kopf sich nicht verändert hatte, doch schon bald musste er erkennen, dass sich diese Vorgehensweise schnell erschöpft haben würde.
Er versuchte zu verstehen, warum sich das Gesicht seiner Kollegin Nadja zunächst nur dann und wann und eines Tages dann doch für immer in das Sonjas verwandelt hatte, das seines Kollegen Michael aber bis jetzt immer unverändert geblieben war. Wie mit vielen anderen Kollegen sprach er mit Nadja praktisch nur noch auf Anfrage, da er die obligatorischen Schwierigkeiten hatte, sie eindeutig zu identifizieren. Bei Michael hingegen konnte er seinen Augen trauen und sicher sein, den richtigen Namen bei der Ansprache zu verwenden und peinliche Situationen, zu denen es trotz aller an den Tag gelegten Vorsicht immer wieder kam, vermeiden zu können. Hinter Daniels Rücken tuschelten die Kollegen wegen einiger unpassender Reaktionen längst über ihn und seinen Geisteszustand, doch das war seine geringste Sorge. Viel schlimmer war, dass nach und nach alle bisher unveränderten Köpfe zu Sonja oder Roman wurden. Entgegen Daniels Hoffnung machte auch Kollege Michael keine Ausnahme von dieser Regel, was zu einer erheblichen Abkühlung ihres Verhältnisses führte und Daniel sowohl inner- als auch außerbetrieblich noch weiter isolierte.
Daniel besuchte seine Eltern häufiger als früher. Zwar waren auch ihre Köpfe mutiert, doch da er sie ausschließlich in ihrer Wohnung antraf, fiel ihm der Umgang mit ihnen vergleichsweise leicht. Allerdings wurde es immer schwerer, unverfängliche Gesprächsthemen zu finden. Irgendwann hatte seine Mutter das Offensichtliche lange genug ignoriert und fragte: »Was stimmt mit dir nicht, Daniel?«
Damit hatte er längst gerechnet. Schon als Kind hatte er nie etwas lange vor ihr verheimlichen können. Er war dankbar dafür, dass sie diese Frage stellte, als sein Vater, der nicht über so feine Antennen wie seine Frau verfügte, irgendwas im Keller zu tun hatte. Daniel hatte mehrfach darüber nachgedacht, sich ihr anzuvertrauen und ihr zu erzählen, dass für ihn fast alle Menschen gleich aussahen und er auch seine Eltern nicht mehr an ihrem Gesicht erkennen konnte, doch was hätte das gebracht? Entweder hätte sie ihm nicht geglaubt und für verrückt gehalten, oder sie hätte ihm geglaubt und für krank gehalten. So der so hätte es sie traurig gemacht. Das wollte Daniel vermeiden, aber seine Mutter spürte, dass er etwas Großes vor ihr zu verheimlichen versuchte, was sie auch ohne Kenntnis der Wahrheit traurig machte. Das wiederum konnte Daniel nur schlecht ertragen, weshalb er nach diesem Gespräch mit seiner Mutter die Besuche bei seinen Eltern bis auf weiteres einstellte und es bei gelegentlichen Telefonaten beließ.
Seine Isolation wurde immer umfassender, seine Einsamkeit immer größer.
Für das, was Daniel geschah, gab es keinen Namen. Weder Mediziner noch Psychologen waren in ihrer Praxis zuvor auf einen vergleichbaren Fall gestoßen, und auch die medizinischen Enzyklopädien hüllten sich in Schweigen.
»Du bist eine Sensation«, hatte Dr. Hofer gesagt. »Die Wissenschaftler werden sich darum schlagen, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn dein Fall publik wird.«
Doch Daniel wollte therapiert und nicht seziert werden. Er wollte sein altes Leben mit allen Macken, die es hatte, zurück und suchte Lena, seine Ex-Freundin, auf. Seine Ratlosigkeit hatte ihm vorgegaukelt, dass die Trennung von ihr einen enormen seelischen Stress ausgelöst haben könnte, dessen Folge die Uniformierung der Köpfe war, doch nach einem durchaus freundlichen Gespräch änderte sich weder an ihrem Beziehungsstatus noch am Erscheinungsbild seiner Mitmenschen etwas. Immerhin wurden die Folgen der Trennung für Daniel ein wenig erträglicher, da nun auch auf Lenas Hals Sonjas Kopf thronte.
Er traute sich immer seltener aus dem Haus und ging auch nicht mehr zur Arbeit. Diese Entwicklung spitzte sich weiter zu, bis er das Bett schließlich nur noch verließ, um menschlichen Bedürfnissen nachzugehen oder die Medikamente zu besorgen, die sein Leben mühsam am unteren Rand der Erträglichkeit hielten. Wenn es an seiner Tür klingelte, öffnete er meist nicht, doch eines namenlosen Tages erwies sich jemand als penetrant genug, Daniel aus dem Bett zu klingeln. Vermutlich der Fahrer eines Paketdienstes, dachte Daniel und öffnete die Wohnungstür, obwohl er keine Lieferung erwartete. Er sah Romans Gesicht, aber kein Paket.
»Nanu«, sagte Daniel, »ich sehe ja gar kein Paket.«
»Was? Ein Paket? Wovon redest du, Junge?«
Panik vertrieb alle Reste von Souveränität, die noch in ihm steckten. Der erste Impuls verlangte, die Tür einfach zuzuwerfen und die groteske Situation auf diese Weise zu beenden, doch die Lähmung, die ihm befallen hatte, war stärker. Außerdem hätte sein Vater, den er am ungeduldigen Tonfall und der Körperhaltung, mit der er vor der Tür stand, identifizieren konnte, die Angelegenheit nicht so einfach auf sich beruhen lassen.
»Äh … ja … hallo … was kann ich für dich tun?«, stammelte Daniel und hielt sich mühsam auf den Beinen.
»Ich wollte sehen, wie es dir geht, Junge. Scheint ja höchste Zeit zu sein. Nimmst du Drogen? Oder bist du betrunken?«
Wenn es einen geeigneten Moment gab, seinem Vater die alles zu erklären, war es dieser, doch Daniel konnte die alte Frage, ob die Wahrheit hilfreich sein würde, immer noch nicht bejahen. Niemand auf dieser Welt wusste, was mit ihm los war, und das war für Daniel beunruhigender, als es die Kenntnis über einen fortschreitenden Tumor in seinem Kopf gewesen wäre. Vermutlich galt das auch für seine Umwelt.
»Nichts dergleichen«, antwortete er also und sah, wie sein Vater Romans Kopf schüttelte.
»Wie du meinst, Junge. Ich habe es versucht.«
Nach einem letzten vom Schweigen begleiteten Blick auf seinen Sohn machte Daniels Vater kehrt und begab sich auf den Rückweg zu seiner Frau, die ihn geschickt hatte. Das Gespräch zwischen Männern hatte nicht stattgefunden, aber Daniels Vater war mit sich im Reinen. Er hatte getan, was er tun konnte.
Das galt auch für Daniel. Er war am Ende seiner Kräfte angekommen. Sein Vater hatte ihn vielleicht abgeschrieben, aber seine Mutter war mit Sicherheit noch nicht dazu bereit. Spätestens am nächsten Tag rechnete er mit ihrem Besuch, doch auch ihr würde er nichts anderes sagen können. Wie sollte er erklären, was er selbst nicht verstehen, im Grunde genommen nicht einmal selbst glauben konnte? Mittlerweile war er sich nicht einmal mehr sicher, ob ihm die Ärzte noch glaubten. Dr. Hofer betrachtete ihn immer häufiger mit merkwürdigen Blicken aus Romans Gesicht. Der Zweifel, ob Daniel ihm und allen anderen nicht einfach nur ein erfundenes Leiden vorgaukelte, war zwar noch nicht ausgesprochen worden, doch das war wohl nur noch eine Frage der Zeit.
Nein, lange würde Daniel das alles nicht mehr aushalten können, und immer noch gab es weit und breit niemanden, der ihm Hoffnung machen und eine Lösung für das Dilemma in Aussicht stellen konnte. Er ging auf die Toilette, verrichtete das Notwendige und stellte sich zum Händewaschen ans Waschbecken. Automatisch sah er dabei in den Spiegel.
Dieser Blick war so was wie die letzte Rückzugsbastion für Daniel. Solange er dort sein eigenes Gesicht sah, konnte er Hoffnung haben, und sei es auch eine noch so vage.
Jetzt aber …
Jetzt sah er das andere Gesicht, das so viele vertraute und bekannte Gesichter von ihrem Platz verdrängt hatte.
Jetzt sah er Romans Gesicht im Spiegel.
Es hatte weit aufgerissene Augen und machte sich in Daniels Spiegel breit. Er hörte seinen eigenen Schrei und sah auf das Oval, zu dem sich Romans Mund verformt hatte. Er verstand in dieser Sekunde, was Munch in seinem Gemälde hatte darstellen wollen, aber der Anblick war für ihn unerträglich.
Daniel schlug mit aller Kraft nach dem verhassten Gesicht im Spiegel und brachte das Glas zum Zersplittern. Er verletzte sich an der Hand, bemerkte es aber nicht mal.
Das alles musste ein Ende haben. Jetzt und sofort.
Es ging nicht mehr. Nicht eine Sekunde länger konnte er es aushalten.
Ohne einen weiteren Gedanken die Luft zum Atmen zu geben, rannte er in sein Wohnzimmer und riss die Tür zum Balkon auf, dessen Geländer das letzte Hindernis auf seiner Flucht darstellte.
Dritter Stock, dachte er noch.
Das musste einfach ausreichen, um endlich etwas anderes zu sehen.
Ein Abschiedsbrief
Mein Lieber,