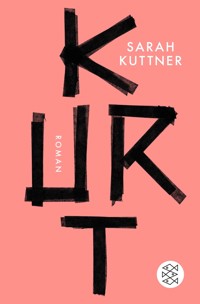Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman von Sarah Kuttner Nachdem ihr Vater die Familie verlassen hat, ist Jule mit ihrem Bruder und ihrer selbstmordgefährdeten Mutter aufgewachsen. Als Erwachsene hat sie sich einen Alltag geschaffen, in dem sie alles nur noch irgendwie erträgt: ihren Job als Sängerin, die unzähligen Anrufe ihrer Mutter, den ganzen Hass in ihr, der sie fast verschwinden lässt. Als auch ihre Beziehung zu bröckeln beginnt, flieht sie zu ihrem Bruder nach England, auf der Suche nach Ruhe und Anonymität. Doch dort trifft sie auf ihren Vater, der im Sterben liegt. Zaghaft beginnt Jule einen letzten Versuch, sich dem Mann anzunähern, von dem sie sich ihr Leben lang im Stich gelassen gefühlt hat. Eine tragikomische Road-Novel über das komplizierte Verhältnis zu den eigenen Eltern und den Wunsch, Urlaub von sich selber machen zu können.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Kuttner
180 Grad Meer
Roman
Über dieses Buch
Nur selten kann Jule richtig abschalten. Zu viele Dinge lassen die ganze Wut hochkommen, die sich bei ihr über die Jahre angesammelt hat. In ihrem Alltag versucht sie, allen Problemen aus dem Weg zu gehen: Den Kontakt zu ihrem Vater hat sie abgebrochen, die Anrufe ihrer depressiven Mutter würde sie am liebsten ignorieren, und ihr Job kostet sie von Tag zu Tag mehr Überwindung. Einzig bei ihrem Freund hat sie sich einen Rückzugsort geschaffen, aber als auch der in Gefahr ist, flüchtet sie zu ihrem Bruder nach England. Doch dort trifft sie ungewollt auf ihren Vater. Ihr wird schließlich klar, dass sie sich ihren Problemen stellen muss.
Sarah Kuttner blickt in ihrem neuen Roman aufrichtig und berührend, aber gewohnt humorvoll auf die Widersprüche des Lebens, die es in unserer Zeit auszuhalten gilt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Ludwig Kaimer und Sarah Kuttner
Coverabbildung: Zen Zsigo
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403717-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
I
Vorspann I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
II
Vorspann II
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
für Eric
Ich möchte irgendwas für dich sein
Am Ende bin ich nur ich selbst
Tocotronic
I was afraid to be alone
But now I’m scared that’s how I like to be
Azure Ray
I
Ich bin kein schöner Mensch.
Meine Aura ist irgendwie zahnfarben. Nicht offwhite, nicht creme. Nicht einmal neutral beige.
Das diffus Unangenehme, das zahnfarben verheißt, nehme ich voll und ganz für mich in Anspruch. Meine Präsenz fühlt sich an wie ein Kuss von jemandem mit schlechtem Atem, der sich aber gerade eben die Zähne geputzt hat: eine irritierende Nuance unter neutral.
Ich weiß das, denn die meisten Menschen reagieren ganz leicht auf mich. Sie merken es kaum, doch sie fühlen sich minimal unbehaglich in meiner Nähe, können aber nicht den Finger drauf legen. Oft gelingt es ihnen noch nicht einmal, es konkret an mir festzumachen. Aber ich bin es. Und ich weiß es. Wenn sie dieses winzige bisschen irritiert wirken, will ich sagen: »Das bin ich! Ich mache, dass du dich unwohl fühlst.« Selbstverständlich tue ich das nicht.
Ich bin nicht greifbar. Wie ein winziger Schauer, der einem über das Rückgrat fährt, ein Wort, das einem nicht einfällt, das ungute Bauchgefühl, wenn doch eigentlich alles glattgelaufen ist.
So bin ich.
Und ich nehme darauf keinen Einfluss, ich ändere es nicht.
Nicht weil ich mich so irre gut finde, sondern weil es das Einfachste ist.
1.
Daniels kurze Finger wabern auf dem Klavier herum, als wollten sie eigentlich woanders sein, hätten aber hier noch einen unangenehmen Job zu erledigen. Wobei, genau so ist es ja. Nur scheint ihr Besitzer den Job zu lieben, und da müssen die Finger eben mitspielen.
Daniel verachtet mich. Ich finde das grundsätzlich nicht unangebracht, ich verachte ihn auch, allerdings verachte ich mich selbst hier gerade mehr, daher scheint es mir doch nicht gerecht, dass ich von zwei Menschen verachtet werde, er nur von einem.
Der Rest der Bar liebt uns.
Kein Wunder, wir spielen die beschissensten Songs der Achtziger, der Neunziger und das Beschissenste von heute. Und wenn es nicht beschissen ist, dann sorgen wir dafür, dass es beschissen klingt. Denn das ist es, wofür uns die Menschen lieben. Weshalb man uns bucht. Gefällige Musik, mit einer ordentlichen Portion Soul. Die Menschen lieben ordentliche Portionen Soul, zumindest in Bars tun sie das. Während sie ihre Weine oder Whiskys oder Cosmos trinken, während sie einander in die Augen sehen, Liebe spielen, Business spielen oder nur Geselligkeit spielen.
Soul macht alles gehaltvoller, deeper.
Also singe ich jeden Song auf unserer Setlist, als hätte ich mit Aretha Franklin gefrühstückt. Ich mache das ganze Programm: Ich phrasiere mich dumm und dämlich, meine Finger zittern ekstatisch am Mikrophon auf und ab, und mein Gesicht spielt, in zufällig erscheinender Reihenfolge, immer wieder dieselben drei Formen von Leidenschaft: 1. Versunken in Emotionen (Augen geschlossen, Kopf wahlweise nach oben, unten oder schräg zur Seite geneigt, aber immer leicht nickend, ein verträumtes Lächeln, als wäre ich in einer ganz anderen, eigenen Welt), 2. Ekstase (Augen, wenn möglich feucht vor Glück, weit aufgerissen, Kopf gen Himmel, die freie Hand auch, ein gejauchztes »Jesus« würde passen, wäre aber zu viel) und 3. Die Überraschung. Was Überraschung in Soul zu tun hat, weiß ich nicht so richtig, ich habe es aber oft bei anderen schlechten Performern gesehen, es scheint eine Bedeutung zu haben. Die Überraschung entsteht meistens aus Versunken in Emotionen und wird mit einer ruckhaften Kopfbewegung nach vorn am besten ausgeführt. Dazu die Augen wieder aufgerissen, dieses Mal aber nicht feucht vor Glück, sondern streng und gradlinig mit direktem Blick in das Gesicht des Nächstbesten. Vielleicht sagt Die Überraschung, dass Soul keinesfalls langweilig oder sanft ist. Nein, sagt sie, Soul ist auch konkret und kraftvoll und geht jeden was an. Eventuell ist Die Überraschung auch die falsche Bezeichnung für diesen Profiblick, aber all die Souldiven sehen unfassbar überrumpelt aus, wenn sie diesen merkwürdig harten Blick benutzen, und außerdem weiß ja eh niemand, wie er heißt, der Blick. Fakt ist: Er funktioniert. Er rüttelt die Leute auf. Hui, denken sie dann, jetzt aber nicht einlullen lassen, diese wunderschöne Musik, die berührt mich, ja, aber sie fordert mich auch. Und zack haben alle Beteiligten das Gefühl, selbst ein bisschen Soul zu sein. Sie haben ja schließlich indirekt mitgewirkt.
Zumindest ist es das, was die Gesichter der Menschen sagen, wenn ich ihnen, was ich selbstverständlich versuche zu vermeiden, ins Gesicht sehe. Sie sagen: Ich bin zwar hier mit meiner Frau/Businesspartner/superguten Freunden und ja, ich habe eine enorm gute und entspannte Zeit, aber ich passe auch auf. Dein Soul ist mein Soul, sagen die Gesichter.
Daniel glaubt auch an Dein Soul ist mein Soul. Er begleitet mich jetzt seit zwei Jahren am Klavier und diese drei Abende in der Woche bedeuten ihm viel. Ich bedeute ihm nichts, ich bin nur sein Weg zum Ziel. Weil ich persönlich aber ausschließlich Weg ohne Ziel mache, verachtet er mich. Er spürt, dass mir all das, generell eigentlich alles, nichts bedeutet, und das nimmt er mir übel. Unsere gegenseitige Verachtung ist die Schmiere, die unseren Zauber geschmeidig hält, sollte man meinen, aber es ist wirklich nur Verachtung. Daniel will hoch hinaus, ich will nichts. Aber er kann sich nicht verpissen, denn die Leute wollen uns als Duo. Wir wirken eingespielt, aufgrund meines Versunken in Emotionen-Blickes sogar manchmal verliebt, zumindest aber sexuell aufgeladen. Nichts davon stimmt, natürlich. Aber die Menschen wollen auch nicht mehr sehen als das, was wir ihnen geben.
Was sie konkret sehen, ist eine recht große Frau Anfang dreißig, eher dürr als schlank, mit verwirrendem Haar. Ich habe unfassbar stark gelocktes Haupthaar. Obwohl niemand in meiner Familie auch nur leichte Wellen hat, kräuseln sich auf meinem Kopf winzige, dicke Locken. Von hinten denken viele, ich hätte afrikanische Vorfahren. »Hey, eine kleine Schokopuppe!« habe ich schon mehr als einmal von angetrunkenen Männern, deren Frauen gerade auf dem Klo waren, in den Nacken gehaucht bekommen. Bis ich mich umdrehe. Dann sieht man ein durchschnittliches, sehr europäisches Gesicht mit eher knappen Features: kleine, ein wenig zu eng zusammenstehende Augen, eine kurze Nase, schmale Lippen. Verhärmt, würde meine Mutter sagen. Diese unfassbar weit auseinanderklaffende Schere zwischen aufregendem Haar und egalem Rest ist mir zuwider, weshalb ich meine Haare große Teile meines Lebens immer entweder auf ein Minimum gekürzt habe oder unter diversesten Kopfbedeckungen verstecke. Hier allerdings passt und gefällt es, wie der furchtbare Rest. Hier im geheimen Land des beschissenen Geschmacks gilt das als exotisch.
Zusammen sind Daniel, dessen vietnamesische Mutter ihr Erbgut zwar eher rezessiv weitergegeben hat, aber immerhin genug, um ihn ausreichend asiatisch anmuten zu lassen, und ich Paradiesvögel. Also lasse ich die dämlichen Haare wachsen und schmiere Kokosnussöl rein, weil man das so macht und es mir egal ist. All das ist mir egal.
Daniel ist all das nicht egal. Er glaubt daran, dass wir Paradiesvögel sind. Er glaubt an unsere exotische Ausstrahlung, er hegt und pflegt sie. Auch er hat raue Mengen Haar und versucht es, so sehr es geht, wie Jamie Cullum zu stylen. Auch er sieht durchschnittlich aus und trägt eher schlecht sitzende Anzüge, was uns aber in die Hände spielt, denn die Leute in Bars wollen nicht, dass der Typ am Klavier besser aussieht als sie selbst, das wäre zu viel, angesichts des vermeintlich eh schon unfassbaren Talents. Es ist ganz wichtig, dass die Begleitung der Sängerin nur medioker aussieht. Das männliche Publikum muss zumindest die Möglichkeit erahnen, mich abschleppen zu können. Und die Frauen befriedigt es, dass die talentierte und geheimnisvoll anmutende Sängerin nicht auch noch zu allem Überfluss einen heißen Klavierspieler ihr Eigen nennen darf. Das wäre einfach unfair, das würde man mir nicht gönnen. Gleichzeitig stärkt es ihr eigenes Selbstbewusstsein: Ach, wir schönen Powerfrauen brauchen keine Männer, um glücklich zu sein, wollen sie denken. Wir sind unabhängig, wir können uns nehmen, was wir wollen. Wenn sie diesen nur oberflächlich emanzipierten Mist nicht schon von alleine mitbringen, möchten sie ihn von mir vermittelt bekommen.
Bitteschön. Ich vermittle das. Ich vermittle alles, was sie wollen, diese Menschen in Bars. Ich bin eine Prostituierte der menschlichen Emotionen.
So ein Abend erreicht seinen Höhepunkt (Sicht: Publikum und Daniel) und Tiefpunkt (Sicht: ich) immer dann, wenn wir »Smooth Operator« von Sade spielen. Dieser Song berührt, aus einem mir vollkommen unerfindlichen Grund, das Belohnungszentrum der meisten Menschen, die gegen 21.30 Uhr in einer Bar sind. Wobei hier im Grunde noch mal spezifiziert werden muss: Wir spielen eigentlich in einem Restaurant, das sich nach 21.00 Uhr irgendwie in eine Bar verwandelt. Wir fangen um 20.00 Uhr an zu spielen, für einen richtigen Künstler ist das eine denkbar undankbare Zeit, denn da läuft der Restaurantbetrieb auf Hochtouren und es fühlt sich an, als würde man in einem Hauptbahnhof auftreten. Kellner hetzen durch die Gegend, der ganze Raum ist erfüllt von zahlreichen Hallos und Endlichs und Wiegehtesdirs und Kommdocherstmalans. Es macht keinerlei Sinn, zu dieser Uhrzeit eine Sängerin an ein Klavier zu stellen, aber mir soll es egal sein, ich stehe einfach da und singe, die Gespräche der Gäste mit meinem Soul störend. Als wir vor zwei Jahren hier anfingen, hatte ich einen lauen Versuch gestartet, Andreas, dem Besitzer des Ladens, zu bedenken zu geben, dass man sich beim Essen in einem eh recht wuseligen Restaurant von Livemusik vielleicht eher gestört fühlen könnte, aber Andreas fragte nur: »Wollt ihr den Job oder nicht?« Also dachte ich nein und sagte ja und ließ mich leidenschaftslos von Andreas ficken, und seitdem stören wir die Menschen beim Essen ab acht.
Interessanterweise ist das ganze Hetzige ab 21.30 Uhr schon wieder vorbei. Als ob die Menschen hier tatsächlich Punkt acht alle gleichzeitig ankommen, essen und fertig sind. Dann verwandelt sich die Atmosphäre nahezu schlagartig in etwas Barähnliches. Zwei Drittel der Gäste gehen, der Rest schaltet die Körpersprache auf Krawatte-lockern um, und uns wird plötzlich zugehört. Und dann kommt eben »Smooth Operator«, ein Song, den ich schon immer gehasst habe, und es wird sogar geklatscht. Immer von Männern im Übrigen. Gefälliges Grinsen auf den Lippen inklusive. Meine Theorie ist, dass kaum einer der Herren weiß, was ein Smooth Operator ist. Es hört sich einfach sexy an, smooth eben. Sicher ein lässiger Typ, schlau aber eben auch jemand, der die Frauen versteht, dieser Operator. Die Zeile »His eyes are like angels but his heart is cold« singe ich immer mit dem eindringlichen Die Überraschung-Blick, direkt in eine dämliche gelockerte Krawatten-Fresse rein. Die dämliche gelockerte Krawatten-Fresse missversteht das immer und zwinkert mich dann smooth an.
Jede halbe Stunde pausieren Daniel und ich und setzen uns für zehn Minuten an die Bar. Immer nach »Smooth Operator«. Es ist nicht so, dass wir die Pause brauchen, aber Andreas findet, dass es irgendwie dazugehört. Dass es gut aussieht. Also sitzen wir rum, zischen uns genervt an und vergessen nicht dabei, wie ein gutes, erschöpftes Team auszusehen.
»Du singst zu langsam.« Daniel rührt mit nervösen Fingerspitzen in einem Robert de Niro-Freshness. Ein Mädchendrink: irgendwas mit Aperol und Campari und Prosecco und Orange, aber ihm gefällt der Name.
»Hörst du?«, fragt er nach, den Blick auf den Spiegel hinter den Whiskyflaschen gerichtet: Das Haar muss Jamie Cullum bleiben, sonst hat ja gar nichts mehr Stabilität.
Unauffällig sehe ich auf mein Telefon. Andreas will nicht, dass wir das vor den Leuten tun. Es gibt den Gästen das Gefühl, wir wären auch nur Menschen mit verpassten Anrufen. Gott bewahre!
Ich bin ein Mensch mit sechs verpassten Anrufen. Alle von Monika. Eingegangen im Abstand von durchschnittlich zwei Minuten. Zwei Mailbox-Nachrichten, fünf WhatsApp-Nachrichten. Meine Mutter gibt nicht auf.
»Jule, hörst du mir zu? Du singst zu langsam. Du machst, was du willst! Das geht nicht, wir sind ein Team, verdammt!«, sagt Daniel immer noch zu seinen Haaren im Spiegel, während der siebte Anruf meiner Mutter in meiner Hand vibriert. Ich drücke ihn weg, lösche die Mailbox-Nachrichten und gleich die gesamte Kurznachrichten-App dazu. Andreas kommt aus seinem Büro hinter der Bar, nickt mir zu, was sowohl das Zeichen für »Ihr könnt weitermachen« als auch für »Lass uns später noch ficken« ist.
Ich schalte mein Telefon aus, wackle gleichgültig Richtung Piano und schließe die Augen für den Versunken in Emotionen-Blick, während Daniel die ersten Takte zu »Someone Like You« von Adele spielt. Ich kriege sie alle kaputtgesoult. Auch die guten Songs.
Als ich aus Andreas’ Büro komme, ist es halb zwölf und das Restaurant so gut wie leer. Keine Ahnung, wie sich dieser Laden überhaupt finanziert, wenn nur anderthalb Stunden lang gegessen und zwei Stunden lang getrunken wird, aber Andreas kann es sich trotzdem leisten, dreimal die Woche Livemusik anzubieten. Vielleicht kann er es sich auch nicht leisten, und es ist nur ein eher komplizierter und teurer Weg, an einen Blowjob zu kommen, jedenfalls ist es das, was er eben von mir bekommen hat, während ich an meine Mutter dachte und dabei aufpassen musste, nicht so wütend zu werden, dass ich Andreas’ Gesundheit gefährde.
»Du weißt, dass du wie keine andere bläst, richtig?«, fragte er und ich versuchte den Gedanken an meine Mutter, wie sie meine kindliche Hand nicht loslässt, als sie sich vor das Taxi wirft, loszuwerden.
Als wir fertig sind, drückt mir Andreas die Gage des Abends in einem Briefumschlag in die Hand. Ein witziges Bild, findet er, als hätte er mich für duweißtschonwas bezahlt, aber wert sei ich es in jedem Fall gewesen und ob ich morgen mal was von Whitney Houston singen könne.
Daniel sitzt immer noch an der Bar, im Gespräch mit einer Frau Anfang vierzig. Sie trägt ein Paillettenkleid, was ihr gut steht, dem Donnerstagabend steht es allerdings nicht so gut, aber was soll sie sich das von einer Frau mit Afro und rotem Nuttenkleid erzählen lassen. Ich schlüpfe in ein Paar Turnschuhe, auch etwas, was Andreas nicht gerne sieht, aber Andreas glücklich machen wurde heute bereits abgehakt, also stecke ich die 29-Euro-Plateaus in meine Tasche, drücke Daniel seinen Anteil der Kohle in die Hand und verlasse den Laden, ohne mich zu verabschieden.
2.
Vor meiner Wohnung stehen Tims Schuhe. An den Schnürsenkeln ordentlich mit einer Schleife zusammengebunden. Tim macht das so. Er macht es schon so, seit er eine Schleife machen kann. Nachdem er es im späten Alter von erst neun Jahren endlich gelernt hatte, gab es für ihn weder Halten noch Gründe dafür, die Schuhe nur am Fuß zu binden. Stattdessen wurden sie auch außerhalb des Körpers gebunden. Verbunden. Miteinander. Er tut das mit all seinen Schuhen. Und mit allem, was man zu einer Schleife binden kann. Tunnelzüge von Jogginghosen und Jacken, die geflochtenen Schnüre an meiner Mütze. Ist eine Schleife nicht möglich, verbindet er die Dinge eben anders. Er stopft nicht nur Socken paarweise zusammen, er macht es auch mit Handschuhen. Wenn er meinen BH öffnet, schließt er ihn außerhalb meines Körpers wieder. Es scheint, als möchte er, dass die Dinge zusammengehören. Stecker elektrischer Geräte, die nicht in eine Steckdose eingesteckt sind, machen, dass er sich ein bisschen unwohl fühlt. In seiner Welt gibt es keinen Grund dafür, dass auf der einen Seite ein A ist, das perfekt in das B auf der anderen Seite passen würde, diese einladende Möglichkeit aber nicht genutzt wird. Er bildet gern Paare. Wenn es zwei bewegliche Komponenten in der unmittelbaren Nähe voneinander gibt, sollen sie miteinander verbunden sein. Bestenfalls mit einer Schleife.
Ich streife meine Turnschuhe, ohne sie zu öffnen, ab und stelle sie zu Tims Schuhen. Sie sind beide mit einer Schleife gebunden, aber eben nicht miteinander, kann also sein, dass Tim das später noch erledigen wollen wird.
In meiner Wohnung riecht es nach Würstchenreis. Tim hat gekocht, dem Geruch von erkaltetem Fett nach zu urteilen, allerdings schon vor Stunden.
»Hey.«
»Hey. Deine Mutter hat angerufen.« Tim sitzt auf dem Bett und blättert in einer Zeitschrift über Fotografie. Er sieht nur kurz auf.
»Dich?«, frage ich.
»Ja. Ich hab gesagt, du arbeitest und würdest zurückrufen.«
Mein Magen fängt an zu brennen, und kurz fürchte ich, dass mir Reste von Andreas’ Ejakulat plötzlich wieder hochkommen, was mir Panik macht, denn das hier ist kein Ort für Andreas. Das ist ein Ich-Ort, da hat Fremdes nichts zu suchen. Also schlucke ich und spüle mit Wasser aus dem Hahn nach.
Das Brennen hört nicht auf, es wird zu einem kleinen festen Ball, der in meinem Oberkörper heiß gegen die Rippen schlägt.
»Warum hast du gesagt, ich würde zurückrufen?«, frage ich Tim scharf. Mein Ton lässt ihn überrascht aufsehen. Er sieht verletzt aus, fängt sich aber wieder und antwortet schulterzuckend: »Was sollte ich sonst sagen? Dass du sie hasst und sie sich aus deinem Leben verpissen soll?«
»Ja.«
Tim tut so, als würde er über den scheinbaren Witz lächeln, und blickt wieder in seine Zeitschrift.
»Wie war es in der Bar?«, fragt er, nachdem wir beide etwas durchgeatmet haben. Es war kein guter Start, nun versucht er, eine Schleife zu binden.
»Kacke.«
Tim seufzt und bindet als Ersatz die Schleife seiner Kapuzenpullischnüre neu.
Er möchte gern sagen, dass ich doch kündigen soll, wenn alles so furchtbar ist. Dass ich das Geld doch überhaupt nicht brauche, dass ich mir stattdessen mal was Gutes tun soll. Mich belohnen, reisen zum Beispiel. Aber Tim weiß auch, dass dieses Gespräch uns den Abend versauen würde, genau wie ein Gespräch über meine Mutter, also steht er stattdessen auf und erhitzt den Würstchenreis für mich.
Würstchenreis ist alles, was wir kochen können. Es ist außerdem unsere gemeinsame Kreation: Reis, gebratene Würstchen und Zwiebeln, Currypulver, Cayennepfeffer und Ketchup. Lauter Lieblingslebensmittel in einer Pfanne zusammengemischt.
Ich ziehe mein furchtbares rotes Kleid aus. Es ist eigentlich gar nicht so furchtbar, das Kleid, aber eben meine Berufskleidung und somit umgehend abzulegen. Stattdessen ziehe ich ein wahlloses Best-of der rumliegenden Kleidungsstücke an. Ich lande in bedruckten Leggings, einem Unterhemd von Tim und einer Windjacke aus Baumwoll-Popeline. Die Haare verbanne ich unter meine Ohrenmütze, entscheide mich dann aber nochmal um und setze stattdessen ein Basecap auf, damit Tim mir aus den geflochtenen Ohrenzipfeln keine Schleife unter dem Kinn machen möchte. Während Tim still den Würstchenreis in der Pfanne hin und her wälzt, setze ich mich, mit dem Rücken zu ihm, an den winzigen Tisch meiner winzigen Einzimmerwohnung und beobachte Tim im Spiegel. Die heiße Kugel in meinem Bauch wütet immer noch über meine Mutter, wird aber kurzzeitig von einem Schwall Selbstverachtung verdrängt. Da sitze ich, meinen kochenden Freund nur über Bande im Spiegel beobachtend, dabei könnte ich einfach die Position wechseln und ihn ganz direkt ansehen. Anfassen sogar. Wir haben uns gar nicht geküsst zur Begrüßung, fällt mir auf. Nach dem »Hey« kam direkt Monika zwischen uns. Und dann lauter lose Enden, die sich nicht in Schleifen legen ließen, und nun sitze ich, wie zur Bestrafung, mit dem Rücken zu Tim und starre ihn heimlich an. Vermutlich fühlt auch er sich bestraft, denke ich und ärgere mich nur noch mehr. Tim soll nicht bestraft werden, Tim hat keine Strafe verdient, Tim muss liebgehabt werden, er ist der einzige Mensch in meinem Leben, dessen Nähe ich will, ertrage.
Ich atme ein, um irgendetwas zu sagen, was das klarmacht, aber mein Mund bleibt nach dem Öffnen stumm und atmet einfach weiter.
»Hier. Ist vielleicht zu wenig Ketchup dran. Ich bin nicht sicher«, sagt Tim und stellt mir einen Teller hin. Ich bedanke mich und warte, bis er sich setzt. Dann erst fange ich an, den Reis mit der Gabel auf dem Teller plattzudrücken, bis er aussieht wie eine unappetitliche Pizza. Es ist ein Ritual, das ich, obwohl ich nicht hungrig bin, automatisch exerziere. Wenn der Reis ganz platt ist, kann man kleine, feste Brocken mit der Gabel aushebeln. Ich plätte mein Abendbrot unerträglich lange, ich kann jetzt nicht essen, zu wütend bin ich über Monikas Anrufe und mich und Daniel und mich und Andreas und mich. Und mich. Immer bin ich wütend. Wie anstrengend das sein muss. Ist.
Obwohl Tim mir nun gegenübersitzt, sehe ich ihn weiterhin im Spiegel an. Dieses Mal sehe ich nur seinen Rücken. Und mein Gesicht. Obwohl ich wegen des Basecaps nur die untere Hälfte sehen kann, sehe ich hart aus. Die sichtbare Hälfte meines Gesichtes sieht aus wie Wachs. Nicht schön, denke ich und konzentriere mich wieder auf Tims Rücken im Spiegel.
»Alles o.k.?«, fragt er. »Willst du lieber allein sein? Ich kann gehen.«
»Nein. Bitte bleib. Sorry. Ich fang mich gleich wieder«, sage ich zu Tims Rücken im Spiegel und wage dann einen ganz kleinen Blick in sein Gesicht, wie ein kurzer Umweg meiner Augen auf dem Weg zum Teller, wo das Essen platt und traurig darauf wartet, endlich in Brocken geteilt zu werden.
Später liegen wir in meinem schmalen Bett und drücken uns. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um entspannt genug dafür zu werden. Während Tim abgewaschen und weiter in Zeitschriften geblättert hat, habe ich 90 Minuten im Bad damit verbracht runterzukommen. Meine hässliche Fassade, die für das Leben da draußen bestimmt ist, abzukloppen. Nun fühle ich mich staubig und erschöpft, aber auch anwesend genug, um gedrückt zu werden. Wir liegen ganz still und atmen Körpergeruch. Tim riecht schon immer ungewöhnlich neutral. Er benutzt kein Deo, kein Parfum und riecht oft nur ganz leicht nach Seife und Mensch. Ich mag das gern, weil ich mich so immer ein bisschen anstrengen muss, um etwas Geruch zu erwischen. Also rutsche ich mit dem Gesicht ein wenig tiefer in seine Achselhöhle und finde tatsächlich etwas Schweiß. Ich liebe Achselhöhlen, ich mag, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes kleine Höhlen sind, in die man reinkriechen muss, um etwas zu finden. Für mich sind sie der intimste Ort eines Menschen. Oder sagt man Körperteil? Vermutlich nicht, eine Achselhöhle ist nichts, was man klar definiert abschneiden und in Gefriertüten verpacken könnte. Kein Teil also, ein Ort.
Tim atmet in mein Haar, vermutlich ist sein Gesicht vollkommen verschwunden in dem Chaos auf meinem Kopf, vielleicht sieht er auch aus, als hätte er einen sehr dichten Vollbart. Mein Blick sucht den Spiegel, um dies unauffällig zu überprüfen, dieses Mal ist der Blickwinkel aber ungünstig, also bleibe ich in meiner sicheren Achselhöhle und atme.
»Kann ich dich was fragen?«, fragt Tim.
»Bitte nicht«, murmle ich in die Höhle.
Ich möchte nicht sprechen. Sätze, die so anfangen, münden in der Besprechung eines Problems. Ich möchte keine Probleme. Nicht diskutieren. Nicht einen Standpunkt hören und meinen verteidigen müssen. Kein angeblich lösungsorientiertes Gespräch über ein vermeintliches Problem führen, das dann im Endeffekt doch nur gewälzt und nicht gelöst wird. Ich möchte Probleme nicht lösen. Nicht auf zwischenmenschlicher Ebene. Sie sollten gar nicht existieren. Warum kann es zwischen Menschen nicht einfach nur Liebe geben? Bedingungslose, über Konflikten schwebende Liebe. Wofür muss geredet werden, Bedürfnisse geäußert, Anschauungen ausgetauscht werden? Ginge man davon aus, dass eh immer alles einfach so ist, wie es ist, und Veränderungen des menschlichen Charakters, Verhaltens oder Bedürfnisses nur zu höchstens 5 % möglich sind, könnte man diesen dennoch so furchtbar beliebten Schritt einfach übergehen und sich nur mit dem Ist-Zustand anfreunden. Keine Selbstanalysen, kein sich permanent selbst Beobachten, kein die gesunde Mitte finden. Generell nicht dauernd nachdenken, nachfühlen. Nur ganz oder gar nicht, Liebe oder Hass. Ich habe beides in rauen Mengen in mir. Warum kann das nicht reichen? Warum muss gesprochen und verändert und bemüht werden? Lasst uns nehmen, was wir kriegen können, und einfach gehen, wenn es nicht genug ist. Liebe oder Verachtung. So einfach.
»Wo bist du die ganze Zeit?«, ignoriert Tim meinen Wunsch. »Ich meine natürlich nicht körperlich, sondern, keine Ahnung, dein Geist, dein Herz, Du. Wo bist du die ganze Zeit?«
»Ich bin hier. In deiner Achselhöhle«, versuche ich einen Ausweg.
Tim ignoriert diese mit affiger Babystimme vorgetragene Albernheit und hakt nach: »Du bist irgendwie ganz selten hier. Also natürlich bist du hier, aber ganz oft bist du hier und gleichzeitig woanders. Oder hier und jemand anderes.« Ich merke, dass Tim sich ärgert, weil diese Feststellung so abgedroschen klingt. Menschen, die körperlich anwesend, aber im Geiste ganz woanders sind. Er weiß aber nicht, wie er es besser beschreiben kann, und das muss er auch nicht, ich weiß ja, was er meint.
Also öffne ich die Augen, so dass meine Wimpern Tims Achselhaare berühren, verharre noch einen letzten Moment und rutsche dann aus der Sicherheit meiner warmen Höhle heraus. So fühlt es sich vermutlich an, geboren zu werden: Man tauscht unfreiwillig etwas Vertrautes, Warmes, Enges gegen etwas Fremdes, Kaltes und unendlich Weites. Furchtbar.
Ich möchte nicht antworten. Tims Bedürfnis nach diesem Gespräch lässt automatisch einen Alarmknopf einrasten. Meine Mauer, an der jeder, auch Tim, abprallen wird, fährt ganz langsam hoch. Ich kann das leise Schieben und Kratzen förmlich hören. Ich fühle mich bereits jetzt angegriffen, in Gefahr. Ich möchte aber im Moment bleiben. Dieser seltene Zustand von Zufriedenheit und Liebe. Keine Gedanken, nur warme Achselhöhle. Mir genügt das. Aber Tim genügt es nicht.
»Dann lass es mich anders fragen«, versucht er es weiter. Auch er hört, wie meine Mauer sich hochschiebt, aber er kann jetzt nicht ablassen. »Bist du glücklich?«
Mit einem letzten leisen Geräusch rastet die Wand zwischen uns ein. Ab jetzt hat Tim kaum noch eine Chance. Ich werde ihn verletzen. Ich werde ihn dafür verachten, dass er meine Zufriedenheit mit einem vollkommen überflüssigen Problemgespräch stört, und ich werde mich dafür verachten, dass ich ihn verachte. Ich wünschte, ich könnte denselben Teufelskreis mit Liebe haben.
»Ich glaube nicht an das Glück als andauernden Zustand«, sage ich und muss mich sehr anstrengen, ihn nicht spüren zu lassen, wie wütend ich werde.
Tim lässt sich das durch den Kopf gehen, nickt nachdenklich, aber das ist ihm nicht genug, also schiebt er nach: »Bist du dann zumindest zufrieden?«
Für einen kurzen Moment kann ich durch meine eigene Mauer sehen und Tims Würstchenatem riechen, an diese schöne, allabendlich komplizierte Suche nach seinem Geruch denken, die Befriedigung, wenn ich ihn finde, an seinem geheimsten Ort, und denke: Ja. Ich bin zufrieden. Aber ich bin es nur hier, unter deinem Arm und meiner Decke, in meinen vier Wänden. Wir zusammen in diesen verschiedenen Höhlen in Höhlen. Ich bin das kleinste Püppchen einer Matroschka, umschlossen von drei kleinen Höhlen, und hier drinnen bin ich etwas, das Zufriedenheit sein könnte. Aber draußen ist eine Welt, die mir zuwider ist. In der meine Mutter und alle anderen ausschließlich mit sich selbst beschäftigt sind, in der jeder eine Maske aufhat und Aufmerksamkeit will. Eine Welt, in der erwartet wird, dass man empathisch ist, dass man sich Mühe gibt für andere. Eine Welt, in der ich einfach nicht zu funktionieren scheine, in der mir alle und ich mir selbst zuwider sind.
»Nein«, sage ich.
Ganz manchmal, wenn ich mich in einem seltenen Zustand zwischen Wut und Zufriedenheit befinde, also fast neutral, lasse ich es zu, über mich selbst nachzudenken. Ich gehe dann im Kopf ganz langsam mein Leben zurück, wie jemand, der irgendwann im Laufe des Tages seinen Schlüssel verloren hat, und versuche zu rekapitulieren, ob es Momente in meinem Leben gab, in denen ich anders war. Gütiger, weniger gleichgültig. Was waren Momente, in denen ich mich wohl gefühlt habe, was gab mir Gelassenheit? Und dann laufe ich und laufe ich und kucke rechts und links und finde immer nur nichts.
Im Grunde war ich mein ganzes Leben lang nur dann entspannt, wenn ich weg war. Weg von zu Hause, weg von meiner Mutter, weg von Problemen oder Menschen mit Problemen.
Als Kind habe ich mich am wohlsten bei meinen Großeltern gefühlt. Das waren die einzigen Menschen, die nichts von mir wollten. Ich erinnere mich an meine Oma, die während des Mittagsschlafes neben mir liegt und mir zeigt, dass sich die Geschwindigkeit unseres Atems wie durch Zauberei aneinander anpasst, wenn wir ganz nah nebeneinanderliegen. Ich hatte nie das Gefühl, dass das stimmt, denn klammheimlich hatte ich einfach meinen Atem an den von Oma angepasst, weil es ein schönes Gefühl war, als wären Oma und ich eine Person mit doppelter Ausstattung von allem. Zwei Köpfe, vier Arme und Beine, aber ein Atem. Und ein Atem bedeutet nur ein Mensch. Einen Mittagsschlaf lang war ich nicht ich, sondern meine Oma. Eine leise und warme Frau, die ihr Enkelkind liebt und tröstet und Kind sein lässt.
Zuhause war ich das nicht. Zuhause war ich der Mann in der Familie, eine Verantwortung, die ich zu Recht tragen musste, war der echte Mann der Familie ja durch meine Schuld nicht mehr da. Ich erinnere mich, dass meine Oma zu meinem Opa einmal leise sagte, dass das Kind mehr Kind sein müsse. Das Kind würde seit der Trennung der Eltern von seiner Mutter nicht mehr wie ein Kind, sondern wie ein Therapeut behandelt. Ich verstand nicht, was ein Therapeut ist, aber ich fühlte mich immer unfassbar schuldig.
Als mein Vater mich mal mit einer fremden Frau im Arm vom Kindergarten abgeholt hatte, erzählte ich es meiner Mutter. Ich fand das aufregend. Wie lieb das von meinem sonst so distanzierten Vater ist, dachte ich, dass er nicht nur meine Mutter liebhat, sondern auch noch diese freundliche Frau. Ich mochte diesen Mann, der seine Liebe zeigte. Wem, war mir fast egal, aber dieses verliebte Gesicht stand ihm gut. Machte ihn weicher. Meine Mutter sah das anders, und ich begriff, dass ich einen Fehler gemacht hatte.
Monate später, kurz vor meiner Einschulung, fragte sie mich beim Abendbrot, ob ich fände, dass sie sich von meinem Vater scheiden lassen solle. Ich verneinte vehement. Sie tat es dennoch. Meiner Oma sagte sie, ich hätte darauf bestanden. Und wenn das Kind das will, dann darf man das nicht ignorieren.
Ich habe also meine Eltern zweimal auseinandergebracht. Ich dachte, was auch immer so ein Therapeut macht, wenn er verhindert, dass noch mehr schlimme Sachen passieren, wenn er Mamas Kaffee immer etwas abgekühlt serviert, damit sie sich nicht absichtlich damit verbrüht, dann bin ich eben so ein Therapeut. Ich passe auf, wende Leid ab, behalte Geheimnisse für mich. Wenn meine Mutter in den Hochphasen ihrer Traurigkeit (»Mach dir keine Sorgen, Julchen, Mutti geht es gut. Sie ist nur sehr traurig!«) so viele Beruhigungstabletten nimmt, dass sie nicht wach genug wird, um auf die Toilette zu gehen, dann wasche ich das Laken und hänge es auf dem Balkon zum Trocknen auf. Wenn die Nachbarn auf dem Nebenbalkon die Laken beäugen und fragen, ob ich nicht ein bisschen zu alt sei, um noch einzupullern, sage ich leise: »Ja«, und schäme mich, als wäre es tatsächlich mein Urin auf den Streublumen. Ich verrate nichts. Ich werde nie wieder etwas verraten. Schließlich hat Mama jetzt nur noch mich. Das sagt sie immer. »Ach mein Schatz, jetzt habe ich nur noch dich!« Manchmal, je nachdem wie traurig meine Mutter ist, wie viele Steine ihr das Leben in den Weg legt, ergänzt sie den Satz noch um: »Wenn ich dich nicht hätte, würde ich mich umbringen.«
Also sorge ich dafür, dass meine Mutter sich nicht umbringt. Und obwohl ich lange nicht genau weiß, was das überhaupt bedeutet, weiß ich immerhin, dass das nicht passieren darf. Und dass ausschließlich ich dafür zuständig bin. Also kümmere ich mich.
3.
»Warum gehst du nie an dein Handy? Ich dachte, dafür hat man die Dinger?«
Monika ist aufgeregt, fast hysterisch. Aber eigentlich ist sie immer aufgeregt, fast hysterisch, also greift bei mir kein Welpenschutz, und ich beiße direkt zu. Ich bin wütend, weil sie mich erwischt hat. Schlaftrunken bin ich ans Telefon gegangen, ohne darauf zu achten, wer anruft.
»Weil du nicht verstehst, wenn man nein sagt«, sage ich. »Wenn ich nein sage. Ich will nicht mit dir telefonieren und wenn du dir nicht grade ein Körperteil abgesägt hast und dringend Spenderblut brauchst, dann gibt es keinen Grund, mich mehr als ein Mal anzurufen!«
Meine Mutter spielt entrüstete Stille am anderen Ende der Leitung, aber eigentlich hat sie nur halb zugehört und plappert nach angemessener Wartezeit weiter: »Juliane, ich bin deine Mutter! Es hätte Gottweißwas passiert sein können!«
Sie ist so dumm, meine Mutter. Sie glaubt, dass das der finale Trumpf ist, den sie da in der Hand hält. Aber ich habe ihn, den finalen Trumpf: »Ist denn Gottweißwas passiert?«, frage ich.
Jetzt ist die Stille am anderen Ende echt.
Aber sie fängt sich schnell, meine Mutter. So einfach gehen ihr nicht die Worte aus. »Ich glaube, Josi und ich haben uns getrennt.«