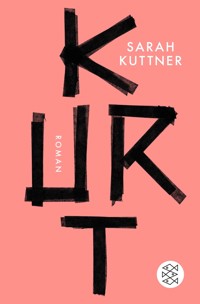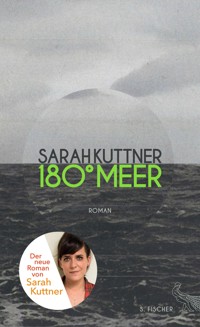Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Psyche ist so viel komplizierter als eine schöne glatte Fraktur des Schädels.« Karo lebt schnell und flexibel. Sie ist das Musterexemplar unserer Zeit: intelligent, selbstironisch und liebenswert. Als sie ihren Job verliert, ein paar falsche Freunde aussortiert und mutig ihre feige Beziehung beendet, verliert sie auf einmal den Boden unter den Füßen. Plötzlich ist die Angst da. Als auch die cleversten Selbsttäuschungen nicht mehr helfen, tritt sie verzweifelt und mit wütendem Humor ihrer Depression entgegen. Dem Wahnwitz unserer Gegenwart gibt Sarah Kuttner eine Stimme. Lustig und tieftraurig, radikal und leidenschaftlich erzählt sie von dem der Verlorenheit, die manches Leben heute aushalten muss.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sarah Kuttner
Mängelexemplar
Roman
Über dieses Buch
Karo lebt schnell und flexibel. Sie ist das Musterexemplar unserer Zeit: intelligent, selbstironisch und liebenswert. Als sie ihren Job verliert, ein paar falsche Freunde aussortiert und mutig ihre feige Beziehung beendet, verliert sie auf einmal den Boden unter den Füßen. Plötzlich ist die Angst da.
»Das richtige Buch zur richtigen Zeit« stern.de
»Ich war von der ersten Seite an einfach begeistert. Ein Buch, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer – jeden Alters.« Dieter Moor, ARD, ttt
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, Münchennach einer Idee von Jana Opitz© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2009Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400096-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Glück hinterlässt keine Narben.
»Eine Depression ist ein [...]
Ein Jahr zuvor
Ich beschließe, einfach mal [...]
In der folgenden Woche [...]
Meine neu gewonnene Hoffnung [...]
Mein nächster Termin bei [...]
Philipp und ich haben [...]
Anette richtet nie über [...]
Auch die nächsten paar [...]
Ich bin ziemlich gut [...]
Morgens traurig zu sein, [...]
Ich habe mir eine [...]
Ich kaufe Saugnapfhandtuchhalter im [...]
»Wir fahren jetzt in [...]
Der nächste Morgen ist [...]
Der nächste Morgen ist [...]
Mama und ihr Leben [...]
Psychiater, das wird oft [...]
Wieder mit Mama zu [...]
Ich wache mit einem [...]
Ich gebe dann jetzt [...]
Weiterhin versuche ich, alles [...]
Philipp bekleckert sich im [...]
In den kommenden Tagen [...]
Ich bin ein fleißiger [...]
Mamas Rücken und ich [...]
Ich wache sehr plötzlich [...]
Mein zweiter offizieller Check-out [...]
Ich habe eine Theorie [...]
Mein Leben normalisiert sich. [...]
Neben meinem normalen Leben [...]
Ich kann inzwischen gut [...]
Diese lustigen Typen vom [...]
David und ich wollen [...]
Es ist merkwürdig, mit [...]
Wir wachen auf, liegen [...]
Am nächsten Morgen ist [...]
Am Abend ruft David [...]
David und ich verhaken [...]
Und damit ist er [...]
In einer alten »Apotheken-Umschau« [...]
Auch Nelson und ich [...]
Kurz vor Silvester ziehe [...]
Und dann feiere ich [...]
Das neue Jahr gibt [...]
Am Wochenende ruft mich [...]
Max und ich sitzen [...]
Max spielt keine Spielchen. [...]
Meine jüngste Vergangenheit holt [...]
Mallorca ist so, wie [...]
Unsere Heimat öffnet ihre [...]
»Eine Depression ist ein [...]
Nach über einer Stunde [...]
Epilog
Danksagung
Glück hinterlässt keine Narben.
Aus Frieden lernen wir nicht viel.
Chuck Palahniuk, Das letzte Protokoll
»Eine Depression ist ein fucking Event!«
Meine Güte.
Mein neuer Psychiater gebärdet sich wie ein Popstar. Selbstbewusst sitzt er hinter seinem Schreibtisch, vor sich eine Flasche Bionade und auf dem Gesicht ein recht gefälliges Niels-Ruf-Grinsen.
Das verwirrt mich. Bionade und Niels Ruf kenne ich nämlich aus dem richtigen Leben, beide haben in meiner psychiatrischen Praxis bitteschön nichts verloren.
In meiner psychiatrischen Praxis erwarte ich etwas weniger Modernes. Ich weiß nicht so recht, was ich von all dem halten soll, also überlege ich, ob es die Situation auflockern könnte, wenn ich dem Arzt meine Gedanken mitteile.
»Sie sind ein bisschen wie Niels Ruf, nur weniger Arschloch.«
Sieh mal an, laut ausgesprochen klingt es mehr nach einer Beleidigung als nach einem witzigen Vergleich.
Findet er auch.
Ich fange an zu rudern: versichere, dass ich Niels Ruf im Grunde für sehr intelligent halte, nur eben auch für sehr präsent, und dass er, mein neuer Psychiater, natürlich nicht ansatzweise so selbstgefällig wie Niels Ruf ist, im Gegenteil, es hat auch eher etwas mit seinem selbstbewussten Auftreten zu tun, der flotten Krawatte zum pinken Hemd, mit dem jugendlich rasierten Kopf, und überhaupt finde ich seine Art, sich auszudrücken, ziemlich unkonventionell, was ja überhaupt nicht schlecht sein muss, und hey, wenn eine Depression ein fucking Event ist, dann ist das doch, ähm, cool.
Nur möchte ich meine Karten für dieses Event gerne bei eBay wieder verkaufen, wenn das bitte ginge?
Es geht nicht.
Deshalb bin ich hier. Wieder hier.
Denn ich habe wieder Angstanfälle, und ich bin traurig, und diese Angst macht mir noch mehr beschissene Angst und mich noch schlimmer traurig.
Eine sogenannte Angstspirale. Die Angst vor der Angst. Weiß ich schon alles, kenne ich gut.
Theoretisch kennt der Popstarpsychiater das auch alles, nur mich eben noch nicht. Ich wiederum bin sehr vertraut mit seiner Praxis und seiner Sprechstundenhilfe. Das verschafft mir einen klaren Heimvorteil.
Mein Gegenüber ist die Vertretung für meine erste Psychiaterin Frau Dr. Kleve. Die kennt mich seit einem Jahr, meine Geschichte, mein Leid, meine Angstspirale und meine Tränen, sie kennt Niels Ruf nicht, und sie trinkt Wasser und kuckt sehr interessiert und streng. Frau Dr. Kleve gefiel mir ausgesprochen gut. Ihrem Mann gefiel sie anscheinend auch ausgesprochen gut, denn sie ist jetzt seit ein paar Monaten im Mutterschutz.
Das freudige Ereignis kündigte sich schon vor einem Jahr an, damals habe ich mich sehr für sie gefreut, ich war, wie viele Anfänger, der Meinung, sie in ein paar Monaten eh nicht mehr zu brauchen.
Tschüssi, Frau Dr. Kleve! Viel Glück und viel Spaß mit dem kleinen Racker, bei Ihrem Job wird der sicher aufs Allerbeste erzogen, hahaha, wir beide werden uns ja wohl nicht so schnell wiedersehen, hahaha, na, besser ist das auch, nicht wahr, hahaha.
Und hier bin ich. Ein Jahr später, selber Raum, neue Tränen, neue alte Ängste und neuer Psychiater.
Ich bin ein großer Freund von messerscharfen Diagnosen, denn die versprechen Heilung. Sie gaukeln einem vor, dass das Problem erkannt ist und sich Mutti jetzt drum kümmern wird. Bis du heiratest, ist alles wieder gut!
Mir persönlich ist beispielsweise ein Bein, das aus Gründen einer messerscharf diagnostizierten Krankheit amputiert werden muss, deutlich lieber als Angstanfälle, die keiner versteht und die deshalb auch nicht abgeschnitten, ausgemerzt, über den Jordan geschickt werden können. Aber genau das ist wohl der Punkt. Ich habe zwar noch beide Beine, stecke aber in einer neuen Angstspirale.
Es ist so, als ob man im Radio sauteure Tickets für ein Konzert gewinnt, auf das man keine Lust hat. Eine Depression ist wie ein Madonna-Konzert: wirklich ein »fucking Event«. Allerdings ein beschissenes und unnötiges »fucking Event«. Der Popstarpsychiater versteht also doch etwas von seinem Beruf.
Das passt mir gut, denn ich bin verunsichert, ängstlich, kraftlos und vollgestopft mit überflüssiger Selbsterkenntnis jeder Couleur, die ich in einem Jahr Psychotherapie in meinem Kopf gesammelt und gestreichelt und hin und her gekullert habe.
Ich war brav. Ich habe während der letzten zwölf Monate Antidepressiva genommen, mein Leben geordnet, war gut zu mir selbst, habe versucht, mich »mehr zu spüren«, und verdammt, ich bin das erste Mal seit ziemlich langer Zeit richtig zufrieden, gar glücklich. Und in diesen wunderbaren Zeiten meiner fast jungfräulichen Zufriedenheit, im Stadium eines zart keimenden Glücks, tritt mir der blöde Penner Angst zwischen die nichtamputierten Beine und wirft mich um und lacht mich aus.
Ich meine es also ernst: Ich bin bereit, eine knallharte und auch gerne erschütternde Diagnose in Empfang zu nehmen. Ich meine, ich bin wirklich bereit. Sie in Empfang zu nehmen. Wie die Hostie in der Kirche, dünn und geschmacklos, aber eben unumstößlich existent.
Und der Popstarpsychiater sieht aus, als hätte er das Zeug und die Eier dazu und Lust auf eine top Diagnose.
Das einzige Problem ist: Er hat keine Ahnung von mir. Er weiß nichts von der allgemeinen Geschichte meiner siebenundzwanzig Jahre, der speziellen Geschichte des letzten Jahres und dem Auslöser für all die nur zäh abfließende Scheiße.
Nun denn, es sieht so aus, als käme ich hier nicht in zehn Minuten wieder raus. Der Popstarpsychiater hat Zeit, seine noch fast volle Bionade verspricht das auch – also auf ein Neues.
Ein Jahr zuvor
Ich bin anstrengend.
Das klingt erst mal ziemlich lässig.
Es klingt liebenswert und ein wenig kokett, selbstironisch, im Grunde genommen genau so, wie man sein Mädchen gerne mag. Cool, nicht zu lieblich, nicht zu damenhaft, vielleicht möchte man mit mir sogar Pferde stehlen.
Aber ich bin ein Stadtmädchen. Ich will auf keinen Fall Pferde stehlen. Auch kleinere Tiere nicht. Generell kann man mit mir nichts stehlen.
Ich bin anstrengend.
Ich werde sehr schnell wütend, traurig, überdreht und laut.
Auch das klingt zunächst sehr sympathisch: Ach, Karo ist eben einfach nur sehr emotional. In Zeiten, in denen Jugendliche sich, ohne mit der Wimper zu zucken, bei einer Cola Enthauptungsvideos im Internet ansehen, ist das doch toll, wenn jemand noch ordentlich was fühlt!
Aber ich kann versichern: Das ist anstrengend. Es ist anstrengend für mein Umfeld, und es ist vor allem anstrengend für mich.
Gefühle sind Stress. Natürlich ist man sich einig, dass Trauer, Schmerz und Enttäuschung sehr, sehr schlimm sind. Das weiß jeder. Aber auch Glück ist anstrengend. Ich finde nichts frustrierender, als neben einer auserwählten Person zu liegen und das Bedürfnis zu haben, ihr so nah wie möglich zu sein. Man kann sich umarmen und verknoten, bis man schwarz wird, man hat immer das Gefühl, noch näher sein zu wollen. Das sogenannte In-den-Partner-reinkriechen-Wollen. Aber man kann nun mal, von bestimmten Sexualpraktiken abgesehen, nicht in den Partner reinkriechen. Man wird nie nahe genug sein.
Oder Sehnsucht. Wie oft das Einander-Vermissen schon romantisiert, Chris-de-Burgh-isiert wurde. Sehnsucht ist fürchterlich. Wenn man vermisst, kann man sich nicht mal mit Kino ablenken, weil im Film am Ende doch immer alle einander haben.
Und nein: Vorfreude ist nicht die schönste Freude. Vorfreude ist die Zwillingsschwester von Sehnsucht und somit ein Haufen Mist.
So bin ich. Anstrengend. Und ich kokettiere damit nicht. Denn jegliches bei mir ankommende Gefühl, ob positiv oder negativ, potenziert sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Drama. In meinem Bauch bildet sich ein Feuerball, und ich sehe rot. Kleinigkeiten machen mich irre, wegen einer Mücke werde ich zum Elefanten. Und nicht zu einem dieser Pixar-Elefanten, sondern zu einem von jenen, die aus Rache töten.
Als mir mal, nach einer Dreiviertelstunde Suche, ein mir eindeutig zustehender Parkplatz von einer anderen Frau weggeschnappt wurde, bin ich zunächst ausgestiegen, um zu argumentieren. Als ich damit aber scheiterte, habe ich aus Wut einfach angefangen zu weinen und die Frau eine »blöde Schlampe« genannt. Sie war Mutter, wie ich am Kindersitz im Inneren des Autos sah. Also habe ich auch noch ihre abwesenden Kinder aufs Allerschlimmste verflucht.
Ich finde in solchen Momenten einfach kein Ende. Ich muss so lange streiten und krähen und kämpfen und bestrafen, bis mein Gegenüber zusammenbricht und sich entschuldigt. Da dies unbefriedigend selten der Fall ist, bin ich unbefriedigend oft wütend und enttäuscht und traurig.
Dieses Spektakel ist für die Betroffenen sicher unangenehm, aber für Außenstehende mag es, aus der Distanz betrachtet, auch ganz amüsant scheinen: Kuck mal, Karo kommt wieder Rauch aus den Ohren, und wie sie da mit hochrotem Kopf brüllend auf und ab hüpft, niedlich!
Ja, aus der Ferne gesehen, ist das ein Riesenspaß. Wobei ich leider selber überhaupt nicht in der Lage bin, mich von außen zu betrachten. Allein bei dem Gedanken an eine cholerisch zeternde junge Frau, die mit rauchender Birne eine Mutter mit Kleinwagen und Parklücke zur Sau macht, werde ich wieder so wütend, dass ich auf und ab hüpfen könnte.
Normale Menschen zählen in diesem Moment wohl bis zehn, aber ich komme gar nicht erst bis zur Zwei. Ich lege sofort los. Kickstart. Von null auf hundert! Wäre ich ein Sportwagen, die Brandenburger Dorfjugend würde sich um mich reißen!
Nach einiger Zeit ist mir die ganze Aufregung peinlich. Nicht in dem Moment, in dem ich den Kindern der Parkplatzdiebin lautstark wünsche, dass sie nie im Leben eine Ausbildung bekommen, und auch nicht in den folgenden Stunden, die ich damit verbringe, alle meine Freunde anzurufen, um die Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, zu teilen. Aber irgendwann später fange ich an, mich leise zu schämen. Taucht allerdings ein neuer Feind auf, bin ich wieder die am schnellsten beschleunigende Emo-Maschine der Welt. Ich lerne aus meinen Fehlern nicht.
Ich beschließe, einfach mal zu einer Psychotherapeutin zu gehen.
Eigentlich habe ich keine besonders großen Probleme. Nicht, dass ich überhaupt keine hätte: Mein cholerisch angehauchtes Ich macht mir schon zu schaffen, und mein Leben ist durchaus etwas im Ungleichgewicht: Ich habe einen ziemlich tollen Job bei einer Event-Management-Agentur verloren. Nach der Ausbildung war ich übernommen worden, und glücklicher hätte man mich nicht machen können. Der Job war mein Zuhause. Seit drei Monaten ist er weg. Jetzt überweist mir meine Oma jeden Monat heimlich meine Miete, und ich kellnere gelegentlich in einer Kneipe.
Die fehlende Arbeit gibt mir Zeit und Muße, in meinem Leben ein wenig aufzuräumen. Also sortiere ich einige zwischenmenschliche Beziehungen, die für mich nicht mehr funktionieren, einfach aus, manche ehemals enge Freunde sortieren sich selbst aus, und ich habe, um ehrlich zu sein, ein wenig das Gefühl, dass sie versuchen, sich freizuschwimmen vom übergroßen Emo-Monster Ich. Bitte sehr, sollen sie doch, ich kann nichts gebrauchen, was mich nicht lieb hat. Ich strauchele nicht. Ich kriege Sachen schon alleine irgendwie hin, muss ja, muss ja.
Ein weiteres Feuer in den Hollywood Hills meines Lebens ist mein Freund Philipp. Wir sind vermutlich einfach nicht füreinander gemacht. Wir versuchen aber schon seit über zwei Jahren sehr erfolgreich, diese kleine Ungereimtheit zu verdrängen. Im Grunde finden wir uns beide gegenseitig doof. Alles an ihm macht mich wahnsinnig, vieles an mir macht ihn wahnsinnig. Jeder von uns denkt regelmäßig an Trennung, keiner hat den Arsch in der Hose. Ich denke, wir haben einfach Angst, allein zu sein. Lieber eine Beziehung mit Streit und fehlenden gemeinsamen Interessen als keine Beziehung. So sind wir jungen Konservativen. Sicherheitsbedürftig, faul und feige.
Mein Leben ist also durchaus unbefriedigend, aber ich kann nicht sagen, dass ich einen enormen Leidensdruck verspüre. Ich fühle mich nicht im klassischen Sinne »reif für eine Therapie«, ich habe einfach Zeit, und ich bin neugierig. Ich möchte wissen, was eine Professionelle über mich denkt, wie sie mich einschätzt. Als ob man sich die Karten legen lässt oder so.
Meine Mama, eine Expertin in Sachen Psyche im Allgemeinen und Depression im Speziellen, ist auch ein großer Fan der Idee, dass ich mich mal mit jemandem unterhalte. Sie glaubt schon länger, etwas in mir schwelen zu sehen, und empfiehlt mir die Therapeutin einer Kollegin, Diplom-Psychologin Frau Görlich.
Telefonisch bekomme ich einen Termin für ein Casting. Ich bin sicher, dass Frau Görlich ein anderes Wort wählte, aber machen wir uns nichts vor, es ist eben doch eine Art Auswahlverfahren für eine Rollenbesetzung. Bin ich verkorkst genug, um ein Recht auf eine Therapie zu haben? Ist mein Lebenslauf steinig genug, um Hilfe zu beantragen? Diese Gedanken mache ich mir vor dem ersten Treffen. Ich ziehe sogar ein Themenoutfit in Erwägung, allerdings scheitert es am Kleiderfundus und vor allem an der nötigen Ahnung. Wie kleidet man sich denn, um möglichst psychisch hilfsbedürftig zu erscheinen? Und will ich überhaupt hilfsbedürftig wirken? Will ich nicht lieber hören, dass mit mir alles top in Ordnung ist?
Vermutlich gilt dieselbe Regel wie für alle anderen Castings auch: möglichst natürlich wirken! Sei ganz du selbst! Ich will so bleiben, wie ich bin! Make the most of now!
Völlig normal gekleidet, aber mit einer peniblen schriftlichen Auflistung meiner persönlichen Charakterschwächen und Probleme (ich neige dazu, wichtige Sachen zu vergessen. Ich bin eine von denen, die nach einem Streit noch mal anrufen: »Und was ich außerdem noch sagen wollte …«) sowie einem kurzen Abriss der wichtigsten Ereignisse meiner Kindheit und Jugend gehe ich also zum ersten Psychocasting meines Lebens.
Ich habe keine altbackene, verklärte Vorstellung davon, wie eine Therapeutin aussieht. Ich bin schlau genug, um keine Couch zu erwarten oder eine ältere Dame mit Gleitsichtbrille und Notizblock. Ich bin modern und aufgeklärt und abgewichst.
Ich halte eine Therapie nicht für etwas, das es zu verheimlichen gilt, ich weiß, dass jeder zehnte Deutsche unter einer Depression oder einer anderen psychischen Krankheit leidet, ich weiß, dass die Seele genauso krank werden kann und darf wie der Magen oder die Blutgefäße, ich weiß, dass man bereit sein muss, sich völlig zu öffnen, wenn man Hilfe erwartet.
Völlig offen und energiegeladen erklimme ich die Wendeltreppe zu Frau Görlichs Praxis. Ein wenig zu energiegeladen vielleicht, denn mir wird schwindlig. Frau Görlich erwartet mich schon in der Tür: »Immer mit der Ruhe!«
Damit benennt sie schon die erste tragende Säule meines Mackenlebens. Ich bin ungeduldig. Sachen müssen schnell und ohne Wartezeit geschehen. Alles muss zackzack gehen. Ich kaufe Kleidung, ohne sie anzuprobieren, denn ich weiß, was mir steht und was mir passt, ich habe keine Zeit für Umkleidekabinen. Ich koche nicht. Nicht, weil ich nicht kann, sondern weil ich keinen Nerv für den Aufwand habe. Buffet ist meine liebste Art, auswärts zu essen, denn das Essen ist sofort verfügbar. Sollte doch mal das Rührei in diesen Aufwärmbottichen zur Neige gehen, werde ich nervös. Ich zahle immerhin für die totale Verfügbarkeit. Also sagen Sie dem Koch bitte, dass das Ersatzrührei schon bereitstehen sollte, wenn sich im Bottich eine Zweidrittelleerung ankündigt. Danke.
Diese Schnelligkeit geht durchaus nicht mit fehlender Leidenschaft einher. Ich liebe Kleidung, und ich liebe Essen. Aber schneller bedeutet für mich oft auch mehr. Mehr schöne Kleidung kaufen und noch mehr wohlschmeckende Nahrung im Magen unterbringen. Keine Zeit zu verlieren. Ich werd nicht länger warten.
Etwas schwindelig sitze ich also vor Frau Görlich auf einem Ledersessel. Kein romantischer Opa-Ohrenledersessel, sondern einer dieser modernen, die wie das Haus der Hexe Baba Jaga auf einem Fuß stehen und sich drehen lassen. Das ist sehr gut, denn ich bin zappelig. Ich muss immer irgendwas bewegen. In Wartezimmern beispielsweise wippe ich ganz leicht auf meinem Stuhl vor und zurück. In dem Ohrensessel hätte mein Wippen autistisch ausgesehen, ein Eindruck, den ich beim ersten Treffen nicht hinterlassen will, obwohl es mir vermutlich ziemlich sicher ein Ticket für den Recall bescheren würde. Aber ich will mit meinen echten Problemen beeindrucken, also drehe ich mich einfach nur ganz leicht im Drehsessel hin und her.
Frau Görlich hat riesige, freundlich stechende blaue Augen und ein enorm offenes Gesicht. Ich überlege, ob Psychologen in der Zulassungsstelle für Berufe, die mit Menschen zu tun haben, nach ihrem Aussehen ausgewählt werden. Falls ja, wundert es mich nicht, dass sie ihre eigene Praxis hat. Sie ist um die vierzig Jahre alt, hat einen hübsch geschnittenen, natürlich gewellten Kurzhaarschnitt, und überhaupt wirkt alles an ihr so natürlich, dass ich mir plump und verkleidet vorkomme.
»Frau Herrmann, warum sind Sie denn hier?«
Auf die Frage bin ich bestens vorbereitet, ich rattere wie eine Zwölfjährige, die einen uninteressanten Vortrag halten muss, meine aktuellen Problemchen mit mir selbst, dem geliebten Ex-Job, den doofen Nicht-mehr-Freunden und dem ungeliebten Noch-Freund herunter. Außerdem den gesamten Teil meines Lebens, den ich für psychologisch relevant halte: »Ich hatte eine eher doofe Kindheit mit einer unglücklichen Mutter, der hin und wieder die eine oder andere Ohrfeige rausrutschte. Dann war da noch mein sehr bemühter Vater, der mich in jungen Jahren, in denen ich dringend ein wenig Liebe hätte gebrauchen können, lieber an die Perlen der Weltliteratur heranführen wollte. Meine Eltern sind außerdem geschieden, und ich habe einen angeheirateten Onkel, der mich als Kind auf eine Art ›lieb hatte‹, wie man ein Kind eher nicht lieb haben sollte, und mein sehr geliebter Großvater starb, als ich sieben Jahre alt war.« Etwas aus der Puste lehne ich mich zurück.
Ein kleines Potpourri an Stolpersteinen auf dem Entwicklungsweg eines gesunden jungen Menschen. Ich bin nicht sicher, ob ich damit überzeugen kann, lebe ich doch schon seit diversen Jahren mit dieser Vita. Es geht mir gut. Ich bin durch damit. Ist ja alles schon so lange her. Ich nehme an, dass die Der-böse-Onkel-Karte in dieser Aufzählung Trumpf ist, allerdings habe ich auch mit diesem Teil meines Lebens schon vor Jahren meinen Frieden geschlossen. Meine Sexualität scheint trotz allem gesund und problemlos, zu diesem hässlichen Teil meiner Familie hatte ich, wenn auch etwas spät, den Kontakt gänzlich abgebrochen. Etwas unsicher blicke ich noch einmal auf meinen Notizzettel, um sicherzugehen, dass ich nichts vergessen habe, und erwarte die erste professionelle Psychologen-Resonanz meines Lebens auf selbiges. Ich bin mit meiner Performance zufrieden und aufgeregt. Habe ich genug Mist im Rucksack, um weitere Audienzen gewährt zu bekommen? Reicht die Tatsache, dass ich eigentlich nur gerne weniger anstrengend sein möchte, aus, um eine Krankenkasse zu veranlassen, Frau Görlich hundert Euro pro Stunde zu zahlen? Oder habe ich Luxusprobleme? Schließlich bin ich nicht der einzige Mensch auf der Welt mit geschiedenen Eltern, anstrengenden Vätern und einem fragwürdigen Start in die Sexualität. Oder sind all die anderen auch in Therapie?
Frau Görlich sagt erst mal nichts.
Dann: »Atmen Sie mal richtig durch!«
Merkwürdig. Das mit dem Atmen scheint mir eigentlich eine der wenigen Sachen zu sein, die ich nun wirklich ganz gut allein beherrsche. Aber ich will folgsam und weniger aufmüpfig sein, also atme ich tief durch.
»Und jetzt atmen Sie mal in den Bauch!«
Gern, wenn mich das weiterbringt. Allerdings bin ich nicht sicher, was »in den Bauch atmen« bedeutet, ich habe im Moment auch eigentlich keinen Nerv für Atemübungen, ich will eine Diagnose. Ich wölbe den Bauch beim In-die-Lunge-Atmen einfach enorm weit aus meinem Körper heraus. Das kann ich gut, wie gesagt: Ich esse gern. Wenn es danach ginge, könnte ich auch überzeugend in den Hintern atmen, aber das wird nicht von mir verlangt.
Und dann sagt Frau Görlich endlich etwas Richtiges. Etwas überraschend Schlichtes. »Sieht so aus, als wären Sie zu oft alleingelassen worden.«
Ich habe grade noch genug Zeit, ein wenig enttäuscht zu sein über die Kürze dieser Diagnose, und dann fange ich an zu weinen. Als ob in meinem Inneren irgendetwas aufgedreht wird, fließt es überraschend aus mir heraus. Ich schluchze los wie ein Kind. Alles in mir ist plötzlich klein und traurig. Eine nahezu beschämend große Woge von Weltschmerz rüttelt mich durch. Ich fühle mich wie ein Surfer, der unter einer Welle verbummelt geht. Überall Wasser, überall viel.
Und weil ich keine Zeit verlieren möchte, denke ich schon während der Überschwemmung hektisch darüber nach, wie ich so unter Wasser geraten konnte. Und verblüffenderweise habe ich keinerlei Ahnung. Ich gehe im Geiste alle akuten Probleme durch, um zu sehen, auf welchen Topf der nasse Deckel gehört. Aber keiner scheint zu passen. Die Vergangenheit wiederum ist so weit entfernt, dass ich auch hier keinerlei Übereinstimmungen fühlen kann, und deshalb weine ich einfach erst einmal weiter, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen.
Meine Versuche der Selbstanalyse sind aber eh vorauseilender Gehorsam, zumindest werden sie augenscheinlich nicht von mir erwartet. Frau Görlich sieht mich nur sehr ruhig an und reicht mir ein Taschentuch, und ich muss kurz lachen, weil es so herrlich klischeehaft ist, diese Kleenexbox in perfekter Reichweite, aber dann werde ich wieder untergetaucht in mein nasses Jetzt.
Es ist nicht so, dass ich leide. Ich empfinde keine Schmerzen. Weinen ist für mich immer ein großes leuchtendes Fest und eine enorme Erleichterung. Irgendwer hat mir mal erklärt, dass bei zu viel emotionalem Stress im Kopf Stoffe oder Fette oder andere Dinger im Überfluss produziert werden, die mit dem Tränenfluss hinausbefördert werden. Quasi eine Darmspülung für den Kopf. Danach ist man leer und ruhig und bereit für neue Scheiße. Aber auch, wenn ich gerne weine, will ich wissen, warum etwas geschieht, und das ist hier grade nicht der Fall.
Frau Görlich lässt mich mit weiterhin freundlich ruhigem Gesicht ausbluten.
Als in meinem inneren Spülkasten endlich wieder die Spül-Stopp-Taste gedrückt wird, rutscht mir ein verschämtes »Huch« raus.
Frau Görlich lächelt, sagt aber immer noch nichts.
Der ungeduldige Kontrollfreak in mir sieht pflichtbewusst auf die Uhr, trocknet sich kurz ab und versucht, das Gespräch mit einem an die alte Eloquenz erinnernden »Und nun?« neu zu beleben.
»Atmen Sie noch einmal richtig durch!«
Also gut. Um Zeit zu sparen, tue ich von Anfang an so, als würde ich direkt in den Bauch atmen. Aber jetzt will ich Klartext. Was ist mit mir? Warum ist das passiert? Was geschieht nun? Habe ich bestanden? Kann man mir helfen?
Frau Görlich lächelt wissend. Ich hoffe blauäugig, dass sie mich zauberhaft findet, aber eigentlich weiß ich, dass sie meine Ungeduld belächelt. Schon wieder zu schnell gewesen.
Sie sagt sehr ruhig: »Beobachten Sie doch erst mal ein paar Tage, wie es Ihnen nach dieser einen Stunde geht. Und dann überlegen Sie, ob Sie sich vorstellen könnten, regelmäßig herzukommen. Ob Sie das Gefühl haben, dass ich die Richtige für Sie bin. So etwas ist sehr wichtig.«
Ich möchte am liebsten rufen: Ja, ich will! Na klar, und ob ich will! Was fragen Sie denn noch! Wann soll ich kommen, und wann, denken Sie, werden wir mich geheilt haben?
Meine jahrelange Erfahrung als Fernsehzuschauer verbietet mir allerdings diese Reaktion. Ich bin im Recall, das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir ein Album zusammen aufnehmen werden. Lässigkeit ist die neue Ehrlichkeit, also sage ich »o.k.« und vermerke mir einen nächsten Termin, eine Woche später.
Ich lerne aus meinen Fehlern und steige die Wendeltreppe bedacht und in gemäßigtem Tempo hinunter.
Obwohl ich leer geweint, verwirrt und erschöpft bin, fühle ich mich auf der Straße ein klitzekleines bisschen wie in einem französischen Film unter der Regie eines nur mittelguten Hollywood-Regisseurs. Dramatisch, aber nicht düster. Ich gehe jetzt also zur Therapie. Soso. Hat ja gar nicht wehgetan.
In der folgenden Woche legt sich ganz langsam eine dumpfe Traurigkeit über mich, wie eine dieser muffligen, braunen Wolldecken mit Pferdekopf-Motiven. Ich fühle mich permanent irgendwie entzündet.
Während eines durchaus entspannten Einkaufsbummels mit meinem Freund wird mein Herz schwer, die Äuglein werden feucht, und ich beschließe, vorsichtshalber irgendwo einzukehren, um Kaffee zu trinken. Philipp und ich sitzen uns gewohnt schweigend gegenüber. Philipp raucht, ich rauche, wenigstens das vereint uns. Ich starte einen trägen Versuch, ihn an meinem Leben teilhaben zu lassen, und erzähle ihm von der Therapiestunde und meiner neuen Schwermut. Sein Interesse wirkt laienhaft geschauspielert, sein Blick kippelt hektisch zwischen meiner Stirn und irgendetwas hinter mir hin und her, er trommelt mit den Fingern auf der schmierigen Glasplatte unseres Tisches und erbricht, wie gewohnt, nur schlecht durchdachte Floskeln: »Naja, läuft ja nun mal grad nicht alles rund bei dir, lass doch erst mal sacken, morgen ist ja auch noch ein Tag.« Top Idee, du Flachpfeife. »Morgen ist ja auch noch ein Tag?«, keife ich. »Noch ein Tag, an dem ich den Grund für diesen schleichenden Schmerz einfach nicht finden kann!«
Es ist zum Mäuse-Melken mit Philipp. Ich glaube, wir haben uns irgendwie in einer Art Spiegelkabinett verirrt: Wir sind miteinander gar nicht mehr wir selbst, sondern immer nur eine schlechte Kopie von dem, was der jeweils andere gern sehen möchte. In panischen Versuchen, es mir recht zu machen, denkt Philipp überhaupt nicht mehr nach und quatscht nur noch Seifenopern-Mist. Ich wiederum bin zu trotzig, um noch gefallen zu wollen, und teste ihn ständig, in der Hoffnung, dass er doch noch irgendetwas Überraschendes an sich hätte, das ich lieben könnte, nur um herauszufinden, dass da einfach nichts ist.
Eigentlich Grund genug, um traurig zu sein. Und doch ist es das nicht. Ich versuche immer weiter, dieses stumpfe, stinkende Gefühl einzuordnen, mit meinem aktuellen Leben abzugleichen. Aber egal, an welches Puzzlestück meines Lebens ich es halte, ich finde einfach nicht das passende Gegenstück.
Ich mache mir Sorgen und bin frustriert, immer wieder schwirrt mir Frau Görlichs Satz »Sie wurden einfach zu oft alleingelassen« durch den schweren Kopf.
Und plötzlich komme ich dahinter: Ich tue mir leid! Ich bin traurig über mich. Ich bemitleide die kleine Karo, die von Mama mit einem Hausschuh den Arsch versohlt kriegt, weil sie ihr Bett nicht gemacht hat. Ich bemitleide die kleine Karo, die von Papa viel lieber Umarmungen als Literaturtipps bekommen hätte, und ich bemitleide die kleine Karo, die sich mit zwölf Jahren endlich traut, ihrem Onkel mitzuteilen, dass sie ab nun bitte lieber nicht mehr auf den Po geküsst werden möchte.
Unwillkürlich fange ich an, mich zu schämen. Selbstmitleid ist eine Trauer, die man nicht mit erhobenem Kopf tragen kann. Selbstmitleid ist nicht schick, es schmückt nicht, es ist hässlich und entstellt.
Und rechtzeitig, bevor ich vor Selbstmitleid darüber, mein Selbstmitleid nicht wie eine Krone tragen zu dürfen, wieder anfange zu heulen, klopft schüchtern die nächste Erkenntnis an: Vielleicht bin ich nur wie ein oller Weisheitszahn. Ich habe die ganze Zeit leise unter einer Schicht Haut vor mich hin geeitert, und jetzt hat jemand die Wunde aufgeschnitten. Das schmerzt und eitert und stinkt erst mal vorübergehend noch stärker, aber nun befasst sich jemand mit dem Problem. Man wird die Wunde säubern und dann langsam ausheilen lassen. Es geht los! Der erste Schritt zur Besserung! The first cut is the deepest. Andererseits, was weiß Cat Stevens schon von so was.
Meine neu gewonnene Hoffnung wandle ich in blinden Aktionismus um und mache Hausaufgaben für die Seele, die mir niemand aufgegeben hat.
Ich möchte das Grab meines Opas besuchen.
Er war siebenundfünfzig Jahre alt, als er starb. Ich war damals sieben und weder auf seiner Beerdigung noch je an seinem Grab. Ich denke, ich war anfangs zu jung und später zu faul oder zu vergesslich.
Eigentlich eine schlimme Unverschämtheit, denn mein Opa war eine Wucht.
Aus Erzählungen weiß ich, dass er früher oft mit meiner Oma und Bekannten Strip-Poker gespielt hat. Vier Erwachsene, die nackig durch den Garten ihres Wochenendhauses gerannt sind! Seinen Kindern hat er oft Mutproben auferlegt und sie mit Geld bestochen. Meine Mama und ihr Bruder wurden genötigt, steile Berge hinunterzurollen oder sehr lange auf einem Bein zu stehen.
Im Sommer ist Opa, mit mir auf dem Fahrradkindersitz, durch die Wälder zur nächsten Kneipe gefahren und hat mir vom Krieg und der Natur erzählt. In der Schankwirtschaft angekommen, haben wir immer Bockwurst mit Kartoffelsalat gegessen, er bekam ein Herrengedeck, ich Fassbrause. Wir haben zusammen Wildschweine beobachtet und Pilze gesammelt. Vor dem Schlafengehen hat er mich in die dicke Daunen-Bettdecke eingewickelt und erklärt, dass ich nun die Marmelade in einem Eierkuchen bin. Wenn ich die Schnittchen, die Oma mir zum Abendbrot machte, nicht aufessen wollte, hat er sie hinter Omas Rücken für mich gegessen.
Natürlich gibt es auch andere Perspektiven auf meinen Opa. Meine Mutter lässt durchblicken, dass er als Vater sehr streng und als Ehemann lieblos war, aber das sind anderer Leute schlechte Erinnerungen, ich habe nur großartige. Und genau diese großartigen Erinnerungen machen mir regelmäßig ein schlechtes Gewissen, mich nie vernünftig von ihm verabschiedet zu haben.
Also tue ich es jetzt. Eine Therapie zu machen bedeutet ja schließlich, die Vergangenheit aufzurollen, sich mit alten Geistern zu konfrontieren und was die Leute sonst noch so sagen. Ich möchte all das auch, ich will gut sein, tapfer, das Richtige tun, dahin gehen, wo der Schmerz und die Angst sind. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was genau das bedeutet. Vergangenheitsbewältigung: und bitte!
Natürlich weiß ich nicht, auf welchem Friedhof mein Opa liegt. Ich lasse es mir von Mama erklären, sie macht eine Zeichnung. Das kann sie gut, ich wurde mit einer Zeichnung der Gebärmutter aufgeklärt.
Ich fahre zum Friedhof und fühle mich unerwartet wackelig auf den Beinen. Vielleicht weil es ein wenig so ist, als ob ich Opa wiedersehen würde. Mich ihm nach all den Jahren zeigen. Hier, Opa: So sieht die Marmelade aus dem Bettdeckeneierkuchen mit sechsundzwanzig Jahren aus. Auf der anderen Seite beschleicht mich plötzlich die Befürchtung, dass mein Körper vielleicht nur aufgeregt spielt und sich heimlich musikalische Untermalung von Coldplay wünscht. Weil es angebracht ist, sich in solchen Momenten mulmig zu fühlen. Ich schäme mich ein bisschen und versuche, vor mir selbst so natürlich wie möglich zu sein.