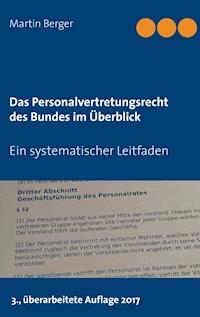8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarze-Zeilen Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Jahrhundert der Grausamkeiten
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Merg wandert als junger Mann zum Ende des 19. Jahrhunderts in das koloniale Neuguinea aus. Dort gehört er zu den weißen Kolonialherren. Sein Werdegang verläuft nicht gradlinig und er verdingt sich unter anderem als Zuhälter. Schließlich studiert er Medizin und auch die Position als Arzt verleiht ihm viel Macht. Eine Macht, die er immer wieder missbraucht. Der Autor untermalt die Erzählungen von Wilhelm Merg mit historischen Fakten und schafft so ein plastisches Bild jener grausamen Zeit. Als fiktive Autobiografie geschrieben, ist die Handlung des Ich-Erzählers von persönlichen Erlebnissen geprägt. Viele BDSM-Eskapaden und ein ausschweifendes sexuelles Leben zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kolonialherren alles und jeden in Besitz nahmen. Lassen Sie sich von Martin Berger in die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts entführen. Seien Sie gespannt, angeregt aber auch schockiert von dem was er berichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Martin Berger
1900
Arrogante Kolonialherren
ISBN 978-3-96615-020-0
(c) 2022 Schwarze-Zeilen Verlag, Konstanz
1. Auflage 2022
www.schwarze-zeilen.de
Alle Rechte vorbehalten.
Coverfoto: © Evgenia Tiplyashina – stock.adobe.com
Für Minderjährige ist dieses Buch nicht geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass das Buch Minderjährigen nicht zugänglich gemacht wird.
Die auf dem Cover abgebildeten Personen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Buchs!
Vorwort
Dieser historische Roman ist nur für Erwachsene geeignet. Es handelt sich, bei der vorliegenden Geschichte, um ein reines Fantasieprodukt, eingebettet in einen historisch, korrekt dargestellten Kontext. Historische Fakten sind kursiv dargestellt.
Die Sprache ist, der Zeit und Handlung entsprechend, oft unverblümt und sehr derb. Der Text enthält Szenen sexueller Darstellungen und es werden einvernehmlich ausgelebte Formen von Sadismus und Masochismus beschrieben. Sehr selten findet Sexualität – im weitesten Sinne - nicht einvernehmlich statt. Dies ist dem historischen Hintergrund geschuldet und dient der Veranschaulichung der alltäglichen Gewalt, die den Kolonialismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts prägten. Anders als in der historischen Realität, gibt es jedoch keine dauerhaften Verletzungen und keine Toten. Dennoch ist der Text für sensible Leser ungeeignet.
Der Verlag und der Autor distanzieren sich von jeglichen realen rassistischen und unterdrückenden Handlungen, Worten und Gedanken.
Die Ansichten des Protagonisten sind historisch geschuldet, die Geschichte wird aus der Sicht eines privilegierten weißen Mannes erzählt. Wir haben den Text von diskriminierenden Wörtern bereinigt. Dabei haben wir uns dafür entschieden Schwarz immer groß zu schreiben, selbst dann, wenn das Wort als Adjektiv verwendet wird. Schwarz ist dabei kein biologisches Merkmal und bezeichnet keine Hautfarbe. Dieser Begriff wird verwendet, um Personen einer Gruppe zuzuordnen, denen in der Vergangenheit ähnliches widerfahren ist und die, auch heute oft noch, gleiche Erfahrungen mit Diskriminierung machen.
Kindheit
1880 leben noch keine hundert Europäer auf Neuguinea. Im gebirgigen Norden gibt es, außer einigen Gebirgsflüssen, nur Urwald. Ein Dutzend Deutsche versuchen, im Nordosten der Insel ihr Glück mit dem Anlegen von Plantagen. Im Süden von Neuguinea gründeten einige Dutzend Briten mehrere kleine Niederlassungen.
***
Man taufte mich Wilhelm Merg. 1880 war ich 12 Jahre alt. Wir wohnten in einem der fünf Häuser der Neuendettelsauer Mission. Mama und Papa arbeiteten für die Mission. Sie sagten, sie würden Gott dienen. Eigentlich kümmerte sich Mama um kranke Menschen. Und Papa reparierte Sachen an den Häusern und pflegte den Garten. Manchmal half ich Papa im Garten. Oft durfte ich mir Äpfel vom Baum greifen. Oder einen von den Kohlrabis, die ich so gerne roh aß. Gerne erinnere ich mich auch an die süßen, unreifen Erbsen.
Ich ging in die Volksschule. Aber nicht gerne. Der Lehrer schlug uns oft. Wie sie ziepten, die Tatzen? Wenn der Herr Lehrer mit seinem Stöckchen auf meine Hand schlug.
Wenn er mich schlug, sagte er: »Stelle er sich vor, wie weh es mir selber tut.«
Ich stellte es mir vor. Aber ich glaubte es ihm nicht. Ich glaubte vielmehr, er mochte es uns zu schlagen.
Schön war es dagegen, am Sonntag in der Kirche. Da gab es oft spannende Geschichten aus der Bibel. Der Pfarrer konnte gut vorlesen. Mein Papa durfte auch manchmal etwas sagen. Dann war er immer ganz nervös. Zu Hause zeigte Papa mir in einem Atlas, wo die Geschichten der Bibel spielten. Natürlich zeigte er mir auch Deutschland und das angrenzende Frankreich. Vielleicht zeigte er mir auch Landkarten von Australien oder Neuguinea.
***
1882 treiben zwei deutsche Firmen Handel mit Neuguinea: die Deutsche Handels- und Plantagen-Gesellschaft und die Firma von Robertson & Hernsheim. In Berlin gründen einige Bankiers, wie Adolph von Hansemann und Großfinanziers, wie Gerson von Bleichröder das Neuguinea-Konsortium. Den Vorläufer der späteren Neuguinea-Kompagnie. Sie wollen in großem Stil Landbesitz auf Neuguinea erwerben. Urwald wird gerodet und Plantagen werden angelegt. Auf diesen ersten deutschen Plantagen arbeiten nur wenige Eingeborene aus Neuguinea.
***
Damals durfte ich mir viele Bücher aus der Leihbücherei holen. Meine Eltern freuten sich, dass ich viel las. Ich mochte vor allem spannende Geschichten aus fernen Ländern. Schon damals träumte ich davon, einmal selbst ein Abenteuer zu erleben. Vielleicht im Wilden Westen oder mit Löwen, Elefanten und Schwarzen in Afrika. Vermutlich entstand damals mein Interesse an Exotik.
Ich hatte ein paar Schulkameraden, mit denen ich in den Pausen und nach der Schule spielte. Meine Eltern waren nicht reich. Aber für Spielsachen, wie Murmeln, einen roten Reifen aus Holz und einen Brumm-Kreisel reichte ihr Geld.
***
1883 werben die Briten eingeborene Arbeitskräfte von deutschen Plantagen ab.
***
1884 vereinnahmt Großbritannien den Südosten Neuguineas für die britische Krone.
***
Mit 16 Jahren kam ich auf eines der neuen Realgymnasien. Die Klassen waren kleiner, als in der Volksschule und der Lehrer schlug uns seltener. Damals wollte ich Lehrer werden. Vormittags hatte man recht und nachmittags frei. So stellte ich mir das Leben, als Lehrer vor. Das Lernen fiel mir inzwischen sehr leicht und so machte mir die Schule inzwischen mehr Freude. Meine neuen Freunde vom Realgymnasium und ich bauten im Wald ein Baumhaus. In unserem Lager rauchten wir heimlich unsere ersten Zigaretten.
***
1884 wird Friedrich Hermann Otto Finsch (1839-1917) der Agent des Neuguinea-Konsortiums. Er ist ein deutscher Ornithologe, Forschungsreisender und Völkerkundler. Im Alter von 45 Jahren erforscht er – im Auftrag der Neuguinea-Kompagnie - den Nordosten von Neuguinea. Finsch und Kapitän Eduard Dallmann erkunden, per Dampf-Schiff, die ganze Nordostküste Neuguineas. Finsch entdeckt dabei sieben geeignete Naturhäfen und besetzt das neu entdeckte Land, indem er die deutsche Flagge hisst. Finsch kauft auch große Landflächen von eingeborenen Stammesführern. Besonders interessiert er sich für die Ebenen an den beiden großen Flüssen, Ramu und Sepik (Kaiserin-Augusta-Fluss), die er als erster Deutscher bereiste.
***
Wahrscheinlich wusste ich damals nicht einmal, dass Neuguinea existierte. Und erst recht nicht, wie eng mein weiteres Schicksal mit diesem tropischen Land verbunden sein würde. Meine Freude an der Schule war ungebrochen. Ich war sehr neugierig und lernte gerne. Das praktische Arbeiten lag mir nicht. Immer weniger mochte ich es, meinem Vater bei seinen Arbeiten, als Hausmeister in der Mission zu helfen. Auch die Arbeit im Garten der Mission war mir inzwischen zuwider. Neben der Schule hatte ich ein neues Interessengebiet: das andere Geschlecht.
***
Mein Klassenkamerad Uwe hatte eine, um zwei Jahre ältere Schwester. Ein blasses, hoch gewachsenes Geschöpf mit glattem, blondem Haar. Wie gerne hätte ich ihr Haar gestreichelt? Leider jedoch, versagte mein kindlicher Charme, nahezu gänzlich, bei dem älteren Mädchen. Sie ignorierte meine kleinen Neckereien. Sie sah mich kaum an. Sie ging in die Schule für höhere Töchter und spielte nicht mehr mit kleinen Jungs.
Wenn ich, nach der Schule, Uwe besuchte, konnte ich manchmal ein paar Blicke auf ihren Körper erhaschen. Sie malte sich die Augenlider an. Das war faszinierend. So verrucht. Sie hatte auch schon einen richtigen Busen. Und ihr Hintern wölbte sich neckisch unter ihren Kleidern, die immer züchtig an den Waden endeten. Im Sommer lief sie barfuß und ich konnte ihre wunderbaren Füße sehen. Ihre langen, schlanken Zehen. Der hohe Rist. Und die schlanken, weißen Waden, die unter ihrem Kleid verschwanden.
Einmal, als Uwe eine längere Sitzung auf der Toilette abhielt, wagte ich einen Blick in das Zimmer seiner Schwester. Ich wusste, dass sie nicht zu Hause war. Es erregte mich, an ihrem Kleid und an einem ihrer Schuhe zu riechen. Es roch ein wenig nach Schweiß. Seltsam. Aber nicht unangenehm. Abends, im Bett dachte ich oft an sie. Und ich stellte mir ihre wunderlich duftenden Füße vor. Dabei befriedigte ich mich. Damals schämte ich mich, für meine häufigen Selbstbefleckungen.
***
Ein anderes Mal neckte Uwe seine große Schwester. Obwohl er wusste, dass sie zu einer Freundin wollte, nahm er ihr einen Schuh. Sie wollte ihm den Schuh natürlich wegnehmen, aber er sprang zur Seite und rannte ein paar Schritte davon. Ohne nachzudenken verfolgte sie ihn. So zwang er sie zum Fangen-Spielen. Kurz bevor sie ihn einholte, warf Uwe ihren Schuh zu mir.
Ich fing ihn auf und überlegte nicht eine Sekunde, was zu tun war. Ich sprang davon und rief: »Fang mich doch! Hol ihn dir doch!«
Sie rannte ein paar Schritte hinter mir her. Als sie näherkam, warf ich den Schuh wieder zurück zu Uwe. Sie berührte meinen Arm. Nun war es wieder an Uwe, zu flüchten. Aber leider beendete meine blonde Angebetete, das lustige Spiel. Sie stellte die muntere Verfolgung ein und spielte die Beleidigte.
Sie maulte: »Ich muss doch weg. Bitte, Uwe gib´ mir jetzt meinen Schuh. Ich habe keine Zeit für eure Kindereien.«
Uwe warf den Schuh – und damit die Verantwortung – zu mir. Zum ersten Mal spürte ich das Gefühl von Macht. Macht gegenüber einem Mädchen. Sollte ich sie betteln lassen? Vielleicht zögerte ich einen Moment zu lange.
Jedenfalls sagte sie: »Wilhelm, gibt mir sofort meinen Schuh. Oder ich sage es deinem Vater.«
Der kurze Augenblick der Macht war vorüber. Ich liebte meinen Vater, aber ich fürchtete ihn auch. Rasch gab ich ihr den Schuh zurück und entschuldigte mich: »Bitte verzeih mir.«
Wortlos drehte sie sich um. Uwes Blick strafte mich mit Verachtung.
Uwe flüsterte »Feigling«.
Vielleicht war ich ein Feigling. Vielleicht war ich aber auch einfach klug. Meine Mutter lehrte mich von klein auf: »Lieber ein Leben lang feige, als einmal tot.«
Auch Vater sagte, dass Vorsicht besser sei als Heldentum. Ich verinnerlichte diese Lehren. Ich wünschte mir zwar Abenteuer, aber tollkühn war ich nie. Ich blieb mein Leben lang vorsichtig, berechnend und abwägend. Dennoch erlebte ich viele Abenteuer in fremden Ländern. Ich lernte Kannibalen kennen und Hexen. Ich erlebte Todesangst und die nahezu uneingeschränkte Macht über andere Menschen. Erst wenn man diese Dinge erlebt hat, weiß man, wozu man fähig ist.
Natürlich konnte ich damals nicht ahnen, dass mein Leben geprägt würde von Abenteuern und sexuellen Ausschweifung. Nicht vergleichbar mit meinen damaligen, harmlosen Phantasien beim täglichen Onanieren. Was ich erleben würde, ging weit über das hinaus, was meine guten und anständigen Landsleute als normal bezeichnen würden. Damals glaubte ich an die Tugenden meiner Landsleute, aus dem Volk der Dichter und Denker. Tugenden wie Vaterlandsliebe, Edelmut, Treue und gelebte, christliche Ideale. Ich glaubte, wir Deutschen wären Leute, die - selbstlos - ihren christlichen Glauben den Heiden brachten. Leute, die Tugenden und Zivilisation in der Welt verbreiteten. Heute sehe ich das anders. Heute weiß ich, was wir den Heiden brachten. Und was wir ihnen nahmen. Und ich weiß, dass wir Deutschen ganz gerne einmal einen Weltkrieg begannen.
Neuguinea
1885 gründet Otto Finsch, der Agent des Neuguinea-Konsortiums, die erste Station der Neuguinea-Kompagnie. Nicht ganz unbescheiden, nannte er den Ort Finschhafen. Um sich den militärischen Schutz der kaiserlich-deutschen Armee zu sichern, nennt die Neuguinea-Kompagnie den ganzen Nordosten von Neuguinea ein »Schutzgebiet« mit dem vielsagenden Namen »Kaiser-Wilhelms-Land«. Dafür bekommt die Neuguinea-Kompagnie vom Deutschen Reich die landeshoheitlichen Rechte; also das Recht zur Selbstverwaltung und das Recht den Landbesitz zu vergrößern.
***
In der Zeitung las ich zum ersten Mal von Neuguinea. Es ging in dem Artikel darum, ob sich das Deutsche Reich, um Kolonien bemühen sollte. Unser alter Reichskanzler Bismarck war eigentlich ein Gegner kolonialer Erwerbungen. Er dachte, sie würden einen Keil zwischen mein Heimatland und die Briten treiben. Diese diplomatische Haltung des alten Kanzlers sah ich damals als eine Schwäche. Ich musste eben noch viel lernen. Auch über kluge Politik.
Meine Eltern unterhielten sich nun oft über das ferne Land, Neuguinea. Offenbar wollte die Neuendettelsauer Missionen, genau dort, eine neue Missionsstation aufbauen. Mein Vater sah in der Auswanderung nach Neuguinea eine tolle Möglichkeit. Erstens könnte er so auch weiterhin für die Mission arbeiten und ein sicheres Einkommen wäre garantiert. Zweitens könnte er - gleichzeitig - eine eigene Pflanzung betreiben. So wäre es zumindest denkbar, zu bescheidenem Wohlstand zu gelangen.
Wäre er alleine gewesen, er wäre wohl sofort nach Neuguinea ausgewandert. Aber meine Mutter war nicht so spontan. Sie bestand darauf, dass ich meinen Schulabschluss machte. Und sie fürchtete sich vor dem Klima, vor den tropischen Krankheiten und nicht zuletzt vor den Eingeborenen.
***
1886 wird Georg von Schleinitz der erste Landeshauptmann der Neuguinea-Kompagnie. Dieser Kaufmann ist Chef der regionalen Verwaltung des Unternehmens. Somit regiert nun dieser Kaufmann, Georg von Schleinitz, das ganze Land der Neuguinea-Kompagnie. Bis 1899 wird alles neu entdeckte Land von privaten Kaufleuten, im Namen der Kompagnie, regiert. In der gerade gegründeten Stadt Finschhafen werden Gebäude errichtet, in denen der Landeshauptmann residiert. Der Namensgeber der Stadt, der Forschungsreisende, Otto Finsch, bleibt noch bis 1887, als Berater der Kompagnie in Neuguinea.
***
1886, kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag absolvierte ich die Maturitätsprüfung des Realgymnasiums. Als Jahrgangsbester Abschluss-Schüler, war ich besonders mit modernen Fremdsprachen und Naturwissenschaften vertraut. Ich sprach sehr gut Englisch, ziemlich gut Holländisch und leidlich Französisch. Große Freude bereiteten mir die Schulfächer Physik, Chemie, Biologie und Geografie. Man hatte mich zu größtmöglicher Weltoffenheit erzogen.
***
1886 kommt der Deutsche Johann Flierl (1858-1947), ein evangelisch-lutherischer Missionar nach Neuguinea. Er gründet die erste Neuendettelsauer Mission in Neuguinea. Flierl trat 17-jährig in die Neuendettelsauer Missionsanstalt ein und reiste mit 20 Jahren als Missionar nach Südaustralien. In Australien war er sieben Jahre lang unter den Dieri, den Ureinwohnern der Wüste, tätig. Nun ist er der erste protestantische Missionar in Neuguinea und gründet seine Missionsstation in Simbang bei Finschhafen.
***
Kaum hatte ich meine gymnasiale Reifeprüfung in der Tasche, wanderte unsere dreiköpfige Familie tatsächlich nach Neuguinea aus. Nur vier Monate nach dem Missionar Johann Flierl reisten Vater, Mutter und ich ihm nach. In unsere neue Heimat. Nach Neuguinea. Die Überfahrt in einem Dampfer verlief problemlos. Langweilig zwar, aber ohne, dass auch nur einer der Passagiere oder Matrosen ernsthaft erkrankten. Bezahlt wurde die Reise von der Neuendettelsauer Missionsanstalt. Mit an Bord waren zwei weitere Missionare und vier Missionarsschwestern. Alle vier waren bewährte Kolleginnen meiner Mutter.
Außer dem Kapitän ein paar Matrosen, einem Dutzend Soldaten waren einige Leute von der Kompagnie an Bord. Die Tage waren eintönig. Die Hitze in diesen Breiten - direkt am Äquator - war unbeschreiblich. Endlich, an einem späten Vormittag erreichte unser Schiff die Bucht von Finschhafen. Der Kapitän navigierte entlang der Fahrrinne. Wir tuckerten vorbei an brackigem Sumpf, voll watender Mangroven. Jetzt standen alle Passagiere auf dem Deck und sahen das Festland näherkommen.
In diesen Breiten war der Himmel oft bewölkt. Nur hier und da bohrten sich die Strahlen der allgegenwärtigen Sonne durch das Grau der Wolken. Silberhelle Seeschwalben zischten über den bleifarbenen grauen Himmel, wie hakenschlagende Pfeile. Wir standen an Bord und sahen den überwältigenden Massen von Meeresvögeln zu. Und dem Sonnenlicht, das auf dem Wasser flimmerte und gleißte. Zwischen den überwältigenden Massen von Meeresvögeln die im Wasser hockten oder aus der Höhe ins Meer hinabstießen, um nach Fischen zu jagen.
Die Küste war gesäumt von Mangroven. Kleine Bäumchen, die auf zahllosen Stelzen aus dem Wasser ragten. Überall aus diesem grünen Wald heraus schrillte, quakte und zirpte es.
Unser Schiff tutete laut, als es die Bucht durchpflügte und in den kleinen gemauerten Hafen einlief. Weiter oben am Strand saßen Scharen von schwarzen Vögeln. Ihre gelben Gesichter pickten mit dunklen Schnäbeln im Sand. Unten am Wasser warteten Tausende kleiner, gelblich-weißer Krabben. Sie winkten mit ihren viel zu großen Scheren. Ich achtete auf solche Nebensächlichkeiten.
Sicher hatten die wenigsten Passagiere ein Auge für diese Tiere. Sie sahen nur das bunte Treiben am Hafen. Hundert Menschen waren da versammelt, um den einlaufenden Dampfer zu begrüßen. Zwei Drittel dieser Leute hatten schwarze Haut und krauses, schwarzbraunes Haar. Die vielen Eingeborenen standen weiter hinten. In den ersten Reihen standen nur Europäer. Sie waren gut gekleidet und oft von kleinen Sonnenschirmen beschattet, die ein Schwarzer oder eine Schwarze für sie hielt. Die wenigen weißhäutigen Frauen trugen schöne Kleider, wie man sie in reichen deutschen Großstädten sah. Ihre Männer waren Beamte in Uniformen oder Händler in hellen Anzügen. Ich interessierte mich mehr für die hinteren Reihen.
Was ich da sah, war für mich ein wahrer Kulturschock: Schwarzhäutige Frauen mit nackten Brüsten. Ich war 18 Jahre alt und hatte noch nie die entblößte Brust einer Frau gesehen. Damals gehörten mir zwei Postkarten aus Paris, die ich, vor Jahren, einem älteren Mitschüler abgekauft hatte. Mein geheimer Schatz, den ich mir abends heimlich anschaute, um mir die rechte Bettschwere zu holen. Eine einzelne nackte Frau, bei der man sogar die Behaarung der Scham sah. Und zwei nackte Schönheiten, die sich eng umschlungen auf einem Sofa räkelten.
Und hier nun? Hier gab es nackte Brüste im Überfluss. Alte hässliche Schwarze mit riesigen, schlaffen Eutern. Schöne kraushaarige Frauen mit wohlgeformten Brüsten. Junge Mädchen mit kleinen, spitzen Zitzen. Faszinierend. Andere Länder - andere Titten. Die Frauen trugen nur Schürzen. Einige waren barfuß. Andere hatten Sandalen. Fast alle hatten Blüten und Federn im Haar und eine wilde Anzahl von quietschbunten Halsketten.
Auch die eingeborenen Männer trugen, als Kleidung nur Schürzen. Ihre Gesichter waren grell bemalt. Leuchtend gelb und rot. Sie trugen gebogene Schweinezähne und Knochen in den Nasen und Ohren. Und Halsketten, so ausladend, wir Krägen. Einige trugen Federn in den Haaren oder an den Hand- und Fußgelenken. Sie sahen wirklich erschreckend aus.
Und das waren die bereits »zivilisierten« Eingeborenen. Ich sah zu meiner Mutter. Man sah ihr die ehrliche Empörung über die Schamlosigkeit und Nacktheit an. Und die Furcht beim Anblick der wilden Männer. Auch die uns begleitenden Missionarinnen und Missionare atmeten heftiger als gewohnt. Auf was hatten wir uns da eingelassen?
Wir gingen über hölzerne Bohlen an Land. Am Ende der Bretter erwartete uns der heiße Sand. Dort mussten wir mit den Gesichtern ins Landesinnere stehen bleiben. Bis der letzte Passagier das Schiff verlassen hatte, quälten ein paar Blechbläser in deutschen Militäruniformen ihre Instrumente. Zu unseren Ehren.
Mit den Gesichtern zu uns – und dem Meer - gewandt, warteten circa hundert Menschen. Ganz vorne stand die Delegation der Neuguinea-Kompagnie. Der Landeshauptmann Georg von Schleinitz nebst Gattin gab uns die Ehre. Zwei dienende Schwarze hielten geflochtene Sonnenschirme über das herrschaftliche Paar.
Daneben standen einige Plantagenbesitzer und Kaufleute von der Kompagnie und deren Gattinnen. Allen war der Dampfer eine willkommene Abwechslung. Die schönen Kleider der Frauen sah ich schon an Bord. Aus der Nähe wirkten die Frauen weniger schön. Sie schwitzen furchtbar. Ihren Männern in den hellen Anzügen ging es nicht besser und die Einheimischen beschirmten die wichtigen Herrschaften.
Links und rechts von den Leuten der Kompagnie standen ein paar ranghohe Militärs. Die Uniformen der Soldaten sahen aus, wie zu Hause in Deutschland. Vertreter eine Militärmacht, vor der die Welt zitterte. In ganz Neuguinea gab es nur ein paar Dutzend von ihnen. Ein weiteres Dutzend war soeben mit dem Dampfer eingetroffen. Einige Offiziere wurden auch von Schwarzen beschirmt. Trotzdem tropfte auch ihnen der Schweiß in den Kragen.
In der zweiten Reihe der bunten Begrüßungsdelegation standen unbedeutendere Zivilisten. Sie trugen einfache und leichte Anzüge oder Kleider aus hellem Leinen oder Baumwolle. Neben ihnen standen Soldaten mit niedrigeren Rängen. Irgendwo dazwischen musste auch unser Vorgesetzter sein: Missionar Johann Flierl, der Gründer der ersten Missionsstation auf Neuguinea.
Mutter stieß mich an und sagte: »Das ist er, hinter dem roten Kleid. Sieh nur, er winkt uns zu.«
Gut. Ich hatte Johann Flierl gesehen. Hinter den Weißen standen die halbnackten Eingeborenen. Frauen und Männer. Viele. In jedem Alter. Ein paar Jugendliche drängten sich neugierig am Rand. Viele dunkelhäutige Kinder saßen oder spielten abseits im Dreck und bestaunten uns Neuankömmlinge und das riesige Boot.
Wie zwei Heere auf dem Schlachtfeld standen wir uns gegenüber. Ein seltsames Protokoll verhinderte eine normale Begrüßung. Nur einige wenige aus unserer Gruppe von Neuankömmlingen, wagten die Schritte hinüber zu den Einwohnern von Finschhafen. Wir von der Mission ertrugen das Zeremoniell.
Der Landeshauptmann hielte eine Begrüßungsrede. Er wollte würdevoll wirken. Er schwitzte sehr. Trotzdem konzentrierte er sich, die Macht im Lande zu repräsentieren. Er sprach sicher eine halbe Stunde. Salbungsvolle Worte über die Verantwortung der Herrenrasse. Deutsche Tugenden. Die Segnungen von Technik und Christentum.
Mir waren diese Halbwahrheiten zuwider. Zudem wurde ich von der unbarmherzigen Sonne gequält. Und nach ungefähr fünf Minuten begannen auch noch Fliegen uns zu belästigen. Aber ich ertrug es mannhaft. Wir Neuankömmlingen wartete mit dem Rücken zum Meer. Die Sonne traf uns von hinten. Dem schwitzenden Redner schien sie direkt ins Gesicht. Er fand dennoch kein Ende. Wir Leute von der Mission standen ganz hinten. So konnte ich mich, während der Zeremonie, ungeniert umdrehen.
Ich beobachtete, wie weiße Vorarbeiter die Entladung des Dampfers organisierten. Schwarze gingen an Bord und kamen beladen zurück. Tonnenweise musste die Ladung an Land gebracht werden. Zuerst die Gepäckstücke. Einige Passagiere waren - wie wir - Auswanderer und hatten folglich ihr ganzes Hab und Gut dabei.
Nach dem Gepäck entlud man viele Kisten und Fässer mit Lebensmitteln. Man verlud die Waren auf Handkarren und Pferdekutschen. Später werden die Gerätschaften, Werkzeuge und Maschinen vom Schiff geholt. Und ganz zum Schluss wird man die Baumaterialien an Land bringen: Metallrohre, Beton und Ziegel.
Unterdessen begannen Kinder und Frauen uns zu umringen. Ihr Interesse an der Rede war noch geringer als das meine. Sie begannen an unseren Kleidern zu zupfen. Sie boten uns Bananen und andere Früchte an. Sie hielten uns die offenen Hände hin und flüsterten: »Du kaufen?«
Andere sprachen unsere Sprache besser: »Schmeckt sehr gut. Und ist ganz billig. Willst du kaufen?«
Mutter war ganz Bange. Eine dicke Schwarze hielt erst ihr, dann mir - ein großes, gefesseltes Säugetier hin. Ich glaubte, sie wollte es mir verkaufen. Sollten wir es schlachten und essen? Es sah niedlich aus. Später erfuhr ich, dass das Tier ein Baumkänguru war.
Endlich war die Rede des mächtigen Landeshauptmannes vorbei. Als Nächstes sprach ein Offizier. Er beleidigte meine Intelligenz, indem er versicherte, dass wir Deutschen hier - mit Gottes Hilfe - ein Paradies erschaffen würden. Derzeit schwitzten wir künftigen Paradies-Erbauer, wie die Schweine.
Heimlich hatte ich die oberen Knöpfe meines Hemdes geöffnet. Ich sah auch unter den weißen Insulanern viele, deren Kleiderordnung - und Hemdkragen - inzwischen gelockert waren. Lockerer als in Deutschland. Neben mir stand meine Mutter. Sie und die anderen Missionsschwestern litten noch mehr unter der Hitze, als ich. Ihre hochgeschlossenen Schwestern-Trachten waren wahrlich nicht für diese Temperaturen gemacht. Bald würden sie sich leichte, weiße Blusen und Röcke aus Leinen besorgen.
Neben uns stand Susanne, die jüngste und fraglos hübscheste, der fünf Missionarinnen. Es gefiel mir, sie aus den Augenwinkeln zu beobachten. Unzählige, kleine Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Ihr dunkelbraunes Haar, das sie zu zwei Zöpfen geflochten hatte, war an der Stirn schon ganz nass. Ich sah Schweißflecke unter ihren Armen und am Ansatz ihrer Brüste. Sie litt. Ich lächelte sie an. Höflich und schüchtern lächelte sie zurück.
Ich schaute in die andere Richtung. Neben meiner Mutter stand die Oberschwester Hilda. Ein kleine, blonde und recht mollige – man muss schon sagen – fette Frau jenseits der vierzig. Ihr pausbäckiges Gesicht war rot und der Schweiß floss ihr in den Kragen. Der schwere Stoff ihrer Tracht war an vielen Stellen durchnässt. Sie sah meine Blicke und verdrehte die Augen, um mir ihr Leid anzudeuten. Ich nickte verstehend. Wir waren alle froh, als endlich auch der Missionsleiter Johann Flierl seine Willkommensrede beendet hatte.
Nun vermischten sich die beiden Menschenhaufen. Einheimische Frauen brachten uns Wasser. Tabletts mit Krügen und Gläsern. Ich trank mein Glas sofort leer. Wir alle waren dankbar für die notwendige Erfrischung. Es herrschte eine feuchte Hitze. Dämpfig war es hier. Eine extrem hohe Luftfeuchte. Luft wie Brei. Das Atmen fiel einem schwer.
Fischhafen bestand aus circa zwanzig gemauerten Gebäuden und ein paar Dutzend Hütten. Da waren die prächtigen Wohnhäuser der Kaufleute und Plantagenbesitzer. Sie standen verteilt auf und an den sanften Hügeln. Daneben die Scheunen für die Kutschen und Gerätschaften sowie die Ställe für die Kutschen-Pferde. Oder Ställe für Schweine, Ziegen und Rinder. Am Hafen scharten sich Lagerhallen und kleinere Häuser. Überall zwischen den Häusern der Deutschen duckten sich die Hütten von Eingeborenen. Aus Brettern und Blechen zusammengeflickt. Hässliche Zeugen von Armut und Gleichgültigkeit. An den Hütten hingen bunte Kleider und Tücher. Schwarze Frauen arbeiteten vor den Hütten. Sie schälten, mahlten oder häckselten Nahrungsmittel.
Überall streunten abgemagerte Hunde und pickende Hühner umher. Mächtige Kokospalmen schafften es nicht, die bunte Szenerie ausreichend zu beschatten. Fischerhütten auf Pfählen standen im Meer. Überall trocknete Wäsche und aufgespannte Netze, bereit den Fischreichtum des warmen Meeres zu ernten. Überall spielten Schwarze Kinder. Neben den Hütten und am Strand spielten sie krakeelend Fangen. Andere planschten im Meer. Ein paar der Kleinen quälten angeleinte, hühnergroße Laufvögel, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Überall wieselten kleine braune Füße durch den warmen Staub.
Zwei schwere Kutschen, jede gezogen von zwei Pferden, brachten uns von hier fort. Über einen staubigen und welligen Weg zockelten wir in unser Dorf - nach Simbang. Der Missionsleiter Johann Flierl lenkte das vordere Vehikel, in dem zwei Missionare, mein Vater und ich saßen. Die hintere Kutsche lenkte ein Mann der Kompagnie. Die Kompagnie hatte uns die Kutschen geliehen. In der hinteren Kutsche saßen meine Mutter, die fette Oberschwester Hilda, die hübsche Susanne und zwei weitere Schwestern, Marie und Erika.
***
Simbang, unsere neue Heimat, war ein Dorf im Dschungel, nur zwei Kilometer von Finschhafen entfernt. Als wir von Finschhafen nach Simbang fuhren, passierten wir große und kleine Anbauflächen. Diese Felder hatten kaum Ähnlichkeiten mit den schönen, rechteckigen Anbauflächen in Deutschland. Kleine Bäche mäanderten durch die Felder ins Meer. Verschiedene Pflanzen wucherten auf den schlampig gerodeten Flächen. Offenbar wuchsen die Pflanzen in diesem Klima mit rasender Geschwindigkeit. Nach vier Kilometern waren wir in Simbang.
Hier in Simbang gab es ungefähr zehn Hütten auf Pfählen, in denen Eingeborene hausten. Auch hier hing Wäsche auf Leinen, spielten Kinder im Dreck, liefen Hühner und Hunde frei umher. Dieselben Bilder. Zwischen den Hütten flossen die allgegenwärtigen Rinnsale aus dem Dschungel in Richtung des Meeres. Warum kanalisierte man sie nicht?
Hier in dieser Ansammlung von Elend hatte Johann Flierl, der Gründer der Station, ein erstes Haus gebaut. Eigentlich hatten das meiste die Eingeborenen gemacht. Nun stand das Haus Mission, wie eine kleine Burg, auf einer Anhöhe. Das Haus war nach deutscher Art errichtet. Aus Steinen und Beton. Mit einem schrägen Dach aus Balken und roten Ziegeln. Praktisch alles Baumaterial war, mit Johann Flierl, vor vier Monaten, per Dampfer aus Deutschland gekommen.
Der Weg führte circa 200 Meter den Hügel hinauf. Genau zum Haus des Missionars. Eine frische Brise wehte vom Ozean über den schmalen, gelbweißen Strand den Hügel hinauf zu uns. Und weiter bis zum Haus der Mission. So war es auszuhalten. Hier oben zu bauen, war klug. Die Pferde zogen uns unserer ersten Heimat in den Tropen entgegen. Das Land um das Haus der Mission war gerodet. Noch ragten einige Baumstümpfe aus dem Dreck. Keine hundert Schritte hinter dem Haus war der Urwald. Eine grüne Wand. Ich sah zum ersten Mal den Dschungel. Und ich hörte die schauerlichen Geräusche. Was für Kreaturen mochten sich hinter dieser grünen Wand verbergen? Mir wurde bange. Gerne hätte ich die Hand meiner Mutter gehalten. Ihre Kutsche holperte hinter uns.
Aus den Hütten, die das Missionsgebäude umringten, kamen uns Eingeborene entgegen. Neugierig besahen sie uns Neuankömmlinge. Sie sprachen Deutsch. Sie boten uns Früchte an. Sie fragten, ob sie unsere Wäsche waschen sollten, und sie sangen Zeilen aus bekannten Kirchenliedern. »Oh du fröhliche« klang es aus den Kehlen der Schwarzen. Sie halfen uns beim Ausladen der Kutschen. Ein Bursche - wohl in meinem Alter - trug einen Koffer in Missionshaus, kam zurück und setzten sich neben die Kutsche. Was hatte er vor? Er saß im Dreck und seine Finger spielten mit den Speichen der Räder. Ein kleines Mädchen kam zu ihm und plapperte etwas. Er stand auf, hob die Kleine auf den Arm und schlenderte lachend davon. Warum trug er sie? Warum trug er keinen zweiten Koffer?
Die Sonne kroch bereits, langsam, in Richtung Meeresoberfläche, als wir unsere Habe im Missionshaus verstaut hatten. Die Frauen hatten das Haus übernommen und unser Gepäck verstaut. Wir Männer hatten Gepäck getragen und ein provisorisches Dach aus Wedeln von Kokospalmen errichtet. Der Himmel war schon rot, als wir unser Lager für die erste Nacht aufschlugen.
Die ersten Nächte schliefen wir Männer im Freien. Die Frauen waren in Flierls Haus sicher untergebracht. Mir war wieder bange, als ich auf meinem provisorischen Lager lag. Direkt neben mir lagen die anderen Männer. Johann Flierl, mein Vater und die beiden Missionare schliefen schon. Ich lauschte noch lange den furchtbaren Geräuschen aus dem Wald. Auch nachts kühlte es kaum ab.
Johann Flierl war ein tüchtiger Organisator. Er hatte uns und die vielen, eingeborenen Helfer gut im Griff. Tagsüber bauten wir alle zusammen. Mein Vater und Flierl waren so etwas wie Architekt und technischer Leiter der Baustelle. Sie dirigierten uns und die eingeborenen Helfer und Helferinnen. Stein um Stein wuchsen die Mauern. Die Eingeborenen sprachen gutes Deutsch. Sie lebten schon seit Jahren mit den seltsamen Weißen zusammen.
Sie bewunderten und hassten uns Weiße. Später erfuhr ich, dass sie die Trachten der Ordensleute, für Zeichen von mächtigen Zauberern hielten. Zauberer und Zauberinnen, die mit neuen rätselhaften Göttern sprachen. Weiße Männer und weiße Frauen die Dinge vollbrachten, die ihnen unmöglich waren.
Die ersten Monate in der neuen Heimat waren damit ausgefüllt, uns Unterkünfte zu bauen. Das einzelne Haus auf der Anhöhe bekam einen Anbau. Hier wohnten später die beiden Missionare. Ein zweites Haus entstand. Für meinen Vater, den Hausmeister und seine Familie. Die Bauten wuchsen schnell. Meine Mutter war eine der fünf Missionsschwestern, die später mit der Pflege der Kranken betraut werden. Ein drittes Haus, der Konvent für die Frauen stand nach nur 2 Monaten. Zuletzt bauten wir eine kleine Kirche.
Nach der Arbeit auf der Baustelle beteten und aßen die Missionsbrüder und –schwestern gemeinsam. Automatisch gehörten auch mein Vater und ich dazu. Mit uns Missionaren war nicht nur das Christentum, sondern auch Geld nach Simbang gekommen. Johann Flierl bezahlte die Helfer und Helferinnen in Deutschmark.
Jeder Tag begann früh um 5 Uhr. Viele Wecker klingelten. Um diese Uhrzeit war die unerbittliche Tropensonne noch hinter dem Horizont. Im Licht von Kerzen tranken wir gemeinsam unseren Frühstückskaffee. Das Essen war deutsch. Unser Brot stammte von einem Bäcker aus Finschhafen, wie auch unsere anderen Lebensmittel. Fett, Butter, Zucker, Marmelade kauften wir in einem Krämerladen.
***
Eines Abends suchte ich die Nähe zu Susanne. Sittsam, wie es sich gehörte, sprachen wir über unsere Schulzeit. Sie war dumm, wie Brot. Sie erzählte mir von ihren strengen Lehrerinnen, von der Unbill, die sie zu Schulzeiten ertragen musste und von den ungerechten Noten, mit denen Gott sie prüfte. Sie plapperte etwas über ihren Freundinnen fürs Leben und von der Tiefe ihres christlichen Glaubens.
Ich selber hatte längst meinen kindlichen Glauben an lebenslange Freundschaft verloren. Und in der Kirche war ich meistens unandächtig. Auch die Lehre des Paulus schien mir inzwischen absurd: Gottessohnschaft und Dreieinigkeit. Von Römern erfunden. Dreihundert Jahre nach dem Tode von Jesus. In Nikäa zum Dogma erhoben. Von einem Kaiser, der wollte, dass man auch ihn, einen Sohn der Götter nannte. Später erfand man eine Hölle. Eine Vorhölle gar. Jesus, der Jude glaubte nicht an eine Hölle. Ich auch nicht.
Susanne aber wollte einen christlichen Gesprächspartner. Jemanden, der ihre naiven Sorgen teilte und verstand. Also lobte ich die Stärke ihres Glaubens und versicherte ihr, dass auch mir die Mission der Eingeborenen am Herzen liege. Das Wichtigste, was die Menschen hier bräuchten, sei der christliche Glaube.
Dass Impfungen und Medikamente gegen Darmparasiten auch wichtig wären, erwähnte ich nicht. Oder Unterricht in Sachen Ackerbau. Oder das Recht, auf dem eigenen Land, als freier Bauer zu leben? Ich behielt meine ketzerischen und kommunistischen Weisheiten für mich.
Zum Dank für mein Schweigen schlenderten Susanne und ich, nebeneinander. Wir spazierten die staubige Piste entlang, die hinab ins Dorf führte. Bei den ersten Hütten bog ein kleiner Weg in den Küstenwald ein. Das war kein dichter Urwald, wie oben am Hügel. Das waren lichtere Büsche und Kokospalmen. Wir wagten uns hundert Schritte weiter und setzten uns auf eine umgestürzte Palme. Zwischen uns war sicher ein Meter Platz. Berechnend, wie ich war, lobte ich Susannes Mut und ihren Fleiß. Aber auch ich war mutig. Mutig nahm ich ihre Hand und drückte sie, um ihr zu versichern, dass gerade sie es wäre, die den Schwarzen den Weg ins Paradies ebnen würde. Das machte sie glücklich.
Sie fand es abscheulich, wie die Wilden hier so nackt umherliefen. Natürlich erwartete sie wieder meine Zustimmung. Doch zu ihrem Entsetzen widersprach ich ihr.
»Ich finde die Nacktheit prima. Erstens muss man nicht so schwitzen und zweitens sehe ich gerne nackte Frauen.«
Empört verurteilte sie meinen Mangel an Züchtigkeit. Doch ich wies darauf hin, dass Eva vor dem Sündenfall noch rein und dennoch splitternackt war. Dass Rahab zwar eine unzüchtige, aber gottgefällige Frau war und dass Jesus nirgendwo etwas zu Kleiderordnungen gesagt hatte. Sie wollte mir nicht recht geben.
»Hast du schon einmal einen nackten Mann gesehen?«, fragte ich ungeniert.
Sie kicherte und erklärte: »Natürlich, ich bin doch eine Schwester, die sich um Kranke kümmert.«
Das hatte ich nicht bedacht und ergänzte: »Ich meine einen jungen, schönen Körper?«
Wieder kicherte meine dunkelhaarige Begleiterin und strich sich verlegen eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie sprach flüsternd,im Ton einer Verschwörerin.
»Einmal pflegte ich einen verletzten Soldaten. Ich habe alles gesehen«, sagte sie und nickte. Sie berichtete voll Mut und Stolz: »Als er schlief, habe ich seine Decke angehoben. Ich habe seine Männlichkeit genau gesehen.«
»Wirklich?«, sagte ich erstaunt.
Sie nickte energisch.
»Dann bist du aber wirklich sehr scheinheilig«, sagte ich ernst, »zuerst sagst du, meine Gedanken zu den nackten Wilden seinen sündhaft. Und nun das?«
Schuldbewusst biss sich die hübsche Susanne auf die Unterlippe und sah mich verlegen an.
»Wilhelm«, bat sie mich leise, »das darfst du aber niemandem verraten.«
Ich sah sie lange an und sagte vorwurfsvoll: »Du machst mich zum Mitwisser deiner Verfehlung. Und jetzt muss ich dieses Geheimnis bewahren? Das gefällt mir nicht.«
»Bitte, Wilhelm, sage es niemandem. Es war doch nur ein Mal.«
»Also ist Nacktheit und das Anschauen von Nacktheit, nun doch nicht so schlimm.«
Sie nickte.
Ich lächelte sie an und sagte freundlich: »Anschauen ist also nicht schlimm?«
Sie nickte.
»Dann zeige mir deine Brüste. Nur ein Mal.«
»Aber Wilhelm«, klagte sie, »das gehört sich doch nicht.«
»Schlafende, nackte Männer anzuschauen gehört sich auch nicht«, beschwerte ich mich, »da ist doch auch nichts dabei. Oder?«
Sie errötete und meinte leise: »Du erpresst mich.«
»Ja«, sagte ich und drückte ihre Hand ganz fest.
Sie schüttelte den Kopf.
»Du gefällst mir eben - so gut. Ich will dich so gerne sehen. Ich habe noch nie eine weiße Frau nackt gesehen. Bitte zeige mir nur deine Brüste. Sie sind sicher sehr schön.«
Ich schmeichelte ihr. Meine rechte Hand hielt die ihre. Meine Linke berührte ihre Schulter. Sie sah mir in die Augen. Ich lächelte. Sie schüttelte den Kopf.
»Bitte«, flüsterte ich.
Meine Finger krochen von ihrer Schulter über ihr Schlüsselbein. Ich schob ihr einen Finger unter den engen Ausschnitt ihrer weißen Bluse.
»Bitte«, hauchte ich in ihr Ohr, »nur ein Mal. Für mich.«
Meine Hand wurde mutiger. Meine Finger wanderten nach unten. Ich ließ ihre Hand los und griff ihr ans Kinn. Sanft bog ich ihr Gesicht in meine Richtung und hielt es fest. Sie wehrte sich kaum. Ich küsste sie zärtlich auf die Wange. Sie wehrte sich nicht. Sie schien es auch zu mögen. Mein nächster Kuss traf ihren Mund von der Seite. Meine Lippen berührten die ihren. Ich löste den Griff um ihr Kinn und legte meine Hand auf ihre bekleidete Brust. Ich konnte, durch den Stoff der Bluse, ihre Brustwarzen spüren. Ich hatte gehört, die Dinger sollen anschwellen können. Ich war neugierig.
Ich küsste ihre geschlossenen Lippen und bettelte: »Bitte. Ich will sehen, was ich berühre.«
Sanft drängte ich meine Oberlippe gegen ihre Zähne. Inzwischen waren meine Finger unter der Bluse nach unten gewandert und ich berührte zum ersten Mal die Brust einer Frau. Weich und doch fest. Mit beiden Händen streichelte ich ihre Brüste. Unsere Lippen knabberten aneinander. Ziemlich kräftig drückte sie ihre Lippen an meine Oberlippe. Sie spielte mit mir. Wir küssten uns eine ganze Weile. Es war schön.
»Aufknöpfen!«, befahl ich ihr.
Ganz leise sagte sie: »Mache du es. Bitte.«
Ich drückte inzwischen sanft die beiden Brustwarzen mit Daumen und Zeigefingern. Sie wuchsen tatsächlich, unter meiner Berührung. Interessant.
»Du wirst es selber machen!«, hauchte ich, küssend, in ihren Mund, »ich will, dass du sie mir zeigst. Tu es!«.
Susanne zögerte noch immer. Ihre Hände lagen inzwischen um meine Hüften und zogen mich heran. Ich aber zog meine Hände unter ihrer Bluse hervor, nahm ihr beiden Hände fest in die meinen und zog sie nach oben vor ihre Brust.
»Aufknöpfen!«, befahl ich erneut.
Ich ließ ihre Hände los und ging ein wenig auf Distanz. Zögerlich gehorchte sie. Knopf für Knopf öffnete sich die weiße Bluse. Ich machte es ihr nicht leicht. Ich nahm ihre Schultern in die Hände und schob sie auf Armeslänge von mir weg. Ich sah ihr ins Gesicht. Sie hatte die Augen gesenkt, als müsste sie beim Aufknöpfen konzentriert zusehen. Ich sah ihre Nasenflügel beben. Sie atmete ein wenig zu heftig. Ihr Brustkorb hob und senkte sich. Dann waren alle Knöpfe offen.
»Hol´ sie raus! Zeige sie mir!«, sagte ich, bestimmt.
Sie gehorchte. Susanne legte unter jede Brust eine offene Handfläche und hob ihre Halbkugeln an.
»So?«, fragte sie unterwürfig.
»Ja. So ist es gut. So gefällt es mir. Sie sind sehr schön«, sagte ich leise.
Susanne lächelte.
»Sehr schön«, hauchte ich noch einmal und berührte ihre Brüste.
Sie schloss die Augen.
»Du bist sehr schön«, flüsterte ich ihr ins Ohr.
Offenbar hörte sie das gerne. Ich drückte mich fest an Susanne und küsste sie wild auf den Mund. Sie erwiderte meinen Kuss. Jetzt wanderten meine Hände wieder zu ihren Brüsten, die sie mir noch immer hinhielt. Zwischen Daumen und Zeigefingern rieb ich die spitzen Knospen. Sie stöhnte beim Küssen.
»Mund auf!«, kommandierte ich.
Aus Büchern wusste ich, dass man sich beim richtigen Küssen die Zunge in den Mund schob. Ich tat es. Es war ein schönes Gefühl. Heiß. Sie schmeckte gut. Ich spürte kleinste Unebenheiten an ihren Zähnen. Meine Zunge an ihren Zähnen, an ihrer Zunge, ihren Lippen. Auch sie wurde mutiger. Es gefiel ihr auch. Ich spürte, wie langsam auch ihre Zunge in meinen Mund wanderte. Mir wurde sogar ein wenig schwindelig.
»Das ist schön«, lobte ich sie.
Ihre Augen waren geschlossen. Sie gab sich mir hin. Ihre Brustwarzen waren nun hart und groß. Ich drückte sie fester. Sie stöhnte. Das war offenbar fest genug. Noch eine ganze Weile küssten wir uns. Der leichte Schwindel hielt an. Es war ein fantastisches Erlebnis. Aber nun musste es enden. Das Erlebte reichte mir für den Moment. Ich befreite mich aus ihrer Umarmung und schob sie sanft von mir. Es dauerte etwas, bis sie begriff, dass ich unser Liebesspiel so jäh beendet hatte. Sie sah mich mit großen, fragenden Augen an.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragte sie.
»Nein. Es war sehr schön. Aber wir sind schon lange weg. Was sollen die anderen denken? Lass und zurück gehen. Bald treffen wir uns wieder. Ich will das wieder machen.«
Nun schämte sie sich dafür, was sie getan hatte. Sie blickte zu Boden.
»Es ist alles gut. Nichts ist passiert«, half ich ihr, »von mir wird niemand erfahren, dass wir uns geküsst haben. Kein Wort.«
»Danke«, wisperte sie und beeilte sich, ihre Bluse zuzuknöpfen.
Ich stand auf, zog sie an der Hand in die Senkrechte und sagte: »Komm, lass uns zurück zur Mission gehen. Es soll unser Geheimnis bleiben.«
Ganz fest drückte sie meine Hand.
Susannes Küsse
Gemeinsam mit den Eingeborenen zauberten wir einen recht stattlichen Komplex aus Gebäuden auf den Hügel. Nun bestand die Station aus einer kleinen Kirche, einem Wohnhaus für die Missionare, dem Häuschen für den Hausmeister, dem Konvent der Schwestern mit einer Küche, einem Behandlungs- und einem Klinikraum sowie einem Krankensaal. Zudem bauten wir ein halboffenes Schulgebäude. Die Mauern und die Dächer wuchsen täglich.
Die Temperaturen erreichten jeden Tag 26 oder 27 Grad Celsius. Fast jeden Mittag regnete es für eine halbe Stunde. Nie zuvor sah ich so viele und prächtige Regenbögen. Kaum aber waren die Tropenschauer beendet, verdampfte die Sonne die Flüssigkeit. Immer war es schwül. Überall dampfte der Boden. Überall hingen Nebelschwaden in den Bäumen. Diese täglichen Regenschauer schufen täglich neue Rinnsale durch die ersten Gemüsebeete, die wir auf dem Missionsgelände anlegten. Ich war neugierig, was mein Vater dagegen unternehmen würde.
Die Missionare und Missionarinnen tranken keinen Alkohol. Jesus, der für Hochzeitsfeiern, Wein herstellte und ihn auch mit seinen Kumpels ganz gerne trank hätte vielleicht gegen diese völlig unlogische Regel gepredigt. Ich nahm sie hin. Auch Rauchen galt als unchristlich. Nun hatte natürlich weder irgendein israelischer Prophet, noch ein neutestamentarischer Apostel oder gar der Sohn von Jahwes selbst, auch nur von Tabak gehört. Aber auch das Rauchverbot wurde mit dem Glauben an Jesus gültig.
Diese Verbote galten für alle Missionsleute. Also auch für meine Eltern und mich. Die restliche Bevölkerung in unserer Siedlung Simbang oder unserem Städtchen Finschhafen tranken Alkohol und rauchten. Die meisten der Männer und viele der Frauen – egal, ob mit weißer oder dunkler Haut - kämpften mit Alkohol oder Zigaretten gegen die dauernde Hitze.
In den ersten Wochen litt ich sehr unter dieser Hitze. So ging es allen Neuankömmlingen. Und das Wetter sollte noch schlimmer werden. Einhellig erzählten alle Bewohner von Simbang, dass es zu den Regenzeiten im April und im Dezember noch schwüler würde. Das erschien mir unvorstellbar.
Bis zur Regenzeit im April mussten unsere Häuser endgültig fertig sein. Wir arbeiteten fleißig. Unser Chef Johann Flierl bezahlte die Helfer am Anfang noch mit Deutschmark. Als das Geld ausgegeben war, bezahlte er die Einheimischen mit Gegenständen. Werkzeuge aus Stahl, wie Messer, Sägen oder Zangen. Aber auch billigen Plunder, wie Spiegelchen, Glasperlen oder bunten Glasstückchen waren bei den Schwarzen beliebt. Alkohol und Feuerwaffen als Entlohnung waren tabu.
Die meisten Schwarzen waren faul, man musste sie ständig antreiben. Ihnen fehlte jeder Ehrgeiz und jedes Durchhaltevermögen. Sie begriffen weder den Sinn ihrer Arbeit, noch erkannten sie den Nutzen unserer Plackerei. Man durfte sie erst nach getaner Arbeit entlohnen. Nie im Voraus. Hatten sie nämlich ihr Werkzeug oder ihren Schmuck erhalten, waren sie sofort verschwunden.
Eingeborene Männer, die für eine Säge mehrere Tage lang gearbeitet hatten, kamen - nach der Entlohnung - nicht mehr auf die Baustelle. Manchmal blieben sie für eine oder zwei Wochen weg. Man konnte sich nie auf sie verlassen. Wir Weißen und sie die Eingeborenen waren zu verschieden, um wirklich Freunde zu werden. Obwohl die Dunkelhäutigen unsere Sprache sprachen, verstanden wir uns nicht. Und wir verachteten uns gegenseitig.
Weder damals noch heute, konnte ich begreifen, wie jemand zusah und mithalf, ein Haus mit Keller zu bauen oder eine Zisterne aufzustellen, um dann zurück in seine wasserdurchlässige Hütte zu gehen und zu wissen, dass seine Frau täglich Stunden brauchte, um Wasser vom Fluss zu holen. Sie lernten nichts. Natürlich gab es große Unterschiede zwischen den Rassen.
Allerdings glaubte ich weniger an einen rassischen Unterschied, als vielmehr an eine Kluft, die durch die völlig andere Bildung der Eingeborenen entstanden ist. Ich dachte darüber nach, vielleicht später in der Missionsschule zu unterrichten. Wenn man ihnen den Nutzen der Technik von Grund auf erklären würde? Wenn ich ihnen zeigen würde, wie man sich durch Naturwissenschaft und Technik die »Erde untertan« machen konnte. Welch´ wunderbare Weisheiten boten doch meine geliebten Naturwissenschaften? Wie sehr erleichtert die Technik das Leben? Damals hatte ich noch so etwas, wie Missionseifer - in Sachen Bildung.
***
Inzwischen waren ständig Männer der Neuguinea-Kompagnie bei uns auf der Baustelle. Man besuchte uns gerne. Man half uns gerne. Bei uns gab es nämlich etwas, dass hier in Neuguinea sehr selten war: Weiße Frauen. Es waren Protestantinnen, die heiraten durften. Viele der Männer brachten den Schwestern kleine Geschenke. Meistens waren es Süßigkeiten. Kuchen oder Schokolade. Selbst die dicke Hilda, eigentlich eine echte Belästigung fürs Auge - hatte mehrere Verehrer. Inzwischen trug sie ihr blondes Haar nicht mehr als Pferdeschwanz, sondern offen. Es umrahmte ihr dickes Gesicht und hing ihr tief in die Stirn. Ob einer ihrer Verehrer jemals eine wirkliche Chance hatte, weiß ich nicht. Auch meine Mutter musste ihren Verehrern erklären, dass sie eine verheiratete Frau war. Ich glaubte, es schmeichelte ihr, dass sie von fremden Männern begehrt wurde. Meinem Vater gefiel es weniger. Aber er ließ es sich kaum anmerken.
Susanne wurde von Verehrern geradezu umschwärmt. Seit unserem Kuss war sie, ihnen gegenüber, viel abweisender. Vielleicht dachte sie, sie wäre nun an mich vergeben. Das musste ich klären. Sie war keineswegs an mich gebunden. Ich mochte sie nämlich nicht besonders. Sie war eben da. Ein Studienobjekt. Naiv und freundlich, wie sie war, würde ich - mit und an ihr - noch viele Erfahrungen sammeln können. Wenn Susanne und ich uns begegneten, lächelten wir uns an. Wir sprachen nur das Nötigste. Zwei Wochen nach unserem gemeinsamen Erlebnis versuchte ich sie wieder alleine anzutreffen. Sie machte es mir leicht. Sie spazierte im Dorf umher und unterhielt sich mit braunhäutigen Kindern. Sie trug die luftige Freizeit-Tracht. Weiße Bluse, weißer Rock, weiße Strümpfe und weiße Halbschuhe. Ich entführte den Schwarzen Kindern ihre große, weiße Zauberin. Ich nahm sie bei der Hand und flüsterte: »Lass uns küssen.«
Sie drückte zustimmend meine Hand und ließ sich schweigend zu der Stelle am Dorfrand führen, wo wir uns das erste Mal küssten.
»Danke Wilhelm«, sagte sie, »dass du den Anderen nichts erzählt hast. Es wäre mir so peinlich. Es ziemt sich nicht, was wir getan haben. Es war falsch.«
»Nein, Susanne«, widersprach ich, »wir küssten uns doch nur. Es machte uns Freude. Küssen ist nicht falsch.«
Ich schaute sie durchdringend an. Sie war sich da nicht so sicher. Schweigend gingen wir weiter bis zu unserer gefallenen Palme.
»Setzen wir uns«, sagte ich.
Es war mehr ein Befehl als ein Vorschlag. Sie gehorchte. Und ich ließ mich, sehr dicht neben ihr, auf dem Stamm nieder. Wie beim ersten Mal packte ich ihr Kinn und bog ihr Gesicht zu mir. Erschrocken schaute sie mich an. Doch ich ließ ihr keine Zeit zu reagieren. Ich küsste ihre Lippen. Erst sanft, dann fordernder. Bald berührten sich wieder unsere Zungen. Natürlich gefiel es ihr auch. Sie hatte die Augen wieder fest geschlossen.
»Hol sie wieder raus«, unterbrach ich unser Geknutsche.
»Aber…«, wollte sie einwenden, doch meine Lippen verschlossen ihren Mund.
Gehorsam öffnet sie ihre Bluse und präsentierte wieder ihre bleichen Brüste. Sofort griff ich mit beiden Händen zu und spielte wieder sanft mit ihren Nippeln. Während ich Susanne küsste, wuchsen die kleinen Zapfen wieder unter meinen Händen. Ich beugte mich zu ihren Brüsten hinab und legte meine Lippen um eine der Brustwarzen. Ich saugte nur ein wenig. Ganz sanft. Susanne stöhnte. Offensichtlich genoss sie die Wärme meines Mundes. Ihre Hand zerwühlte mein Haar. Mit beiden Händen umschloss ich die Brust, deren Zentrum von meiner Zunge liebkost wurde. Ich zog sie stärker an mich. Ihre Hände griffen mir, von unten, unters Hemd. Sie wollte sicher auch fremde Haut spüren.
Ich ließ ihre Brust los und griff ihr an die Taille. Von dort wanderten meine Hände unter ihren Rock. Ich glitt auf ihrer Haut nach unten. Von der Taille bis unter den Saum ihres Rockes. Noch ein wenig. Meine Hände schoben sich unter den Saum des Unterrockes. Ich berührte ihre nackten Po-Backen. Ich spürte die Wölbung, die durch das Sitzen entstanden war.
»Steh auf«, befahl ich.
Sie fürchtete sich.
»Hab keine Angst«, wisperte ich, »keiner wird uns sehen. Es bleibt unser Geheimnis. Steh auf!«
Langsam erhob sie sich.
Meine Hände behielten ihre Position. Durch ihr Aufstehen streiften meine Finger ihrem Po entlang nach unten. Dabei zog ich ihren Unterrock und Rock ganz langsam nach unten. Den Rest erledigte die Schwerkraft.
»Nein!«, rief sie erschrocken.
Diese Erschrockenheit war doch gespielt? Meine Hände umfassten ihren nackten Hintern oberhalb der Oberschenkel.
»Du willst es!«, sagte ich leise.
Und tatsächlich: Ihre Hände blieben unter meinem Hemd. Weil sie nun aber stand, waren ihre Handflächen unter meinen Achseln gelangt. Es störte sie nicht, dass ich dort vom Schweiß feucht war.
»Mein Rock?«, flüsterte sie.
Ich hatte ihr den Rock und den Unterrock abgestreift.
»Habe keine Angst. Liebe Susanne. Nur streicheln. Und schauen.«