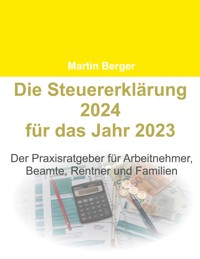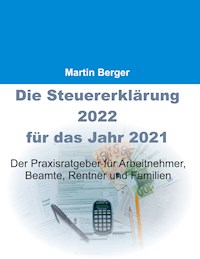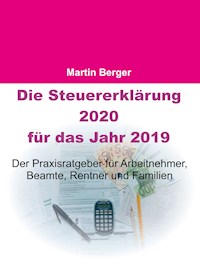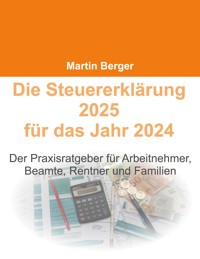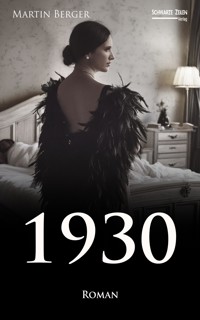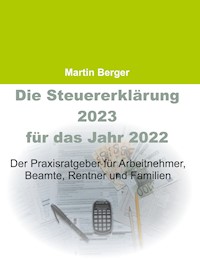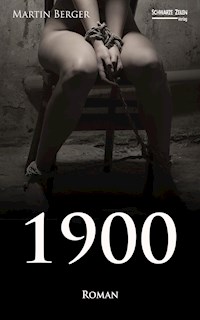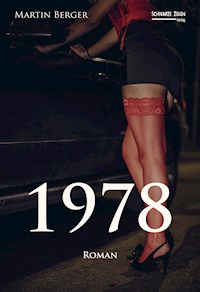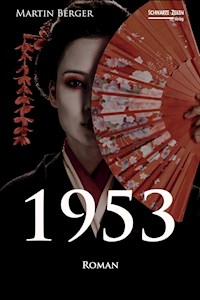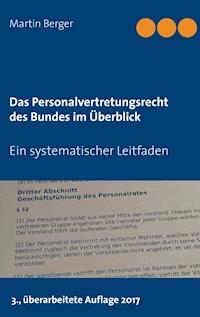
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Personalvertretungsrecht regelt die Beteiligung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den jeweiligen Dienststellen und stellt damit ein Pendant zu dem im privatrechtlichen Bereich geltenden Betriebsverfassungsrecht dar. Dieses Werk soll dem Leser einen ersten systematischen Überblick über das komplexe System des BPersVG vermitteln. Dargestellt werden insbesondere die Beteiligungsrechte der Personalvertretung und der Verfahrensgang vom Vorschlag einer betrieblichen Maßnahme bis zu deren Umsetzung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Werk entstand im Seminar „Recht des öffentlichen Dienstes“ bei apl. Prof. Dr. Christian Koch an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer im Wintersemester 2011 / 2012.
Dr. jur. Martin Berger
Speyer, Januar 2012
Inhaltsverzeichnis
A) Die geschichtliche Entwicklung bis zum BPersVG
B) Darstellung des Personalvertretungsrecht des Bundes
a) Anwendungsbereich
b) Wahl und Zusammensetzung des Personalrates
c) Vorbereitung und Durchführung der Wahl
d) Geschäftsführung des Personalrates
e) Rechtstellung der Personalräte
f) Stufenvertretung und Gesamtpersonalrat
g) Personalversammlung
h) Aufgaben des Personalrates
aa) Allgemeine Aufgaben
bb) Beteiligungsrechte
aaa) Mitbestimmungsrecht
aaaa) Verfahren
bbbb) Dienstvereinbarungen
cccc) Angelegenheiten der Mitbestimmung
bbb) Mitwirkungsrecht
aaaa) Verfahren
bbbb) Angelegenheiten der Mitwirkung
ccc) Anhörungsrecht
i) Sondervertretungen
j) Gerichtlicher Rechtschutz
k) Sonstiges
C) Das Bundespersonalvertretungsgesetz
Literaturverzeichnis
Altvater, Lothar
Bundespersonalvertretungsgesetz
Kommentar für die Praxis
6. Auflage 2008
Bund-Verlag Frankfurt a. M.
(zitiert: Altvater, BPersVG, §, Rn.)
Berger, Martin
Die autonome kirchliche Rechtsetzung zum
Dienstrecht der Ev.- Luth. Landeskirche Sachsens
Diss, Universität Leipzig 2011
Verlag Dr. Kovac Hamburg (zitiert: Berger, Die autonome kirchliche
Rechtsetzung)
Fischer, Alfred;
Personalvertretungsrecht des Bundes und der
Goeres, Hans
Länder
Joachim; Fürst,
Kommentar
Walther (Hrsg.)
Loseblattsammlung
Verlag Erich Schmidt Berlin (zitiert: Fischer/Goeres, BPersVG, §, Rn.)
Heussen, Benno
Funktionen und Grenzen des
Personalvertretungsrechts unter verfassungsrechtlichem Aspekt
Diss. Universität München 1972 (zitiert: Heussen, Funktionen und Grenzen)
Hoyningen- Huene, Gerrick,
Betriebsverfassungsrecht 5. Auflage 2002
v.
Verlag C. H. Beck München (zitiert: Hoyningen-Huene, Betriebsverfassungsrecht)
Hueck, Alfred;
Lehrbuch des Arbeitsrechts
Nipperdey,
Band 2
Hans Carl
7. Auflage 1967 Verlag Franz Vahlen Frankfurt a.M. (zitiert: Hueck-Nipperdey, 2.Bd.)
Ilbertz,
Bundespersonalvertretungsgesetz
Wilhelm;
Kommentar
Widmaier,
11. Auflage 2008
Ulrich;
Verlag Kohlhammer Stuttgart
Grabendorff,
(zitiert: Ilbertz/Grabendorff/Widmaier, BPersVG)
Walter; Windscheid, Clemens
Löwisch,
Betriebsverfassungsgesetz
Manfred;
Kommentar
Kaiser, Dagmar
5. Auflage 2002
Verlag Recht und Wirtschaft Heidelberg (zitiert: Löwisch/Kaiser, Betriebsverfassungsgesetz)
Meurer, Dieter (Hrsg.)
Bundespersonalvertretungsrecht systematischer Leitfaden mit Text des BPersVG und der BPersVWO
2. Auflage 1992 Verlag Luchterhand Neuwied (Meurer, Bundespersonalvertretungsrecht)
Ortwein, Heinz- Walter
Mitbestimmungsmechanismen im Öffentlichen Dienst
Diss. Universität Köln 1983 (zitiert: Ortwein, Mitbestimmungsmechanismen)
Raiser, Thomas
Mitbestimmungsgesetz Kommentar 4. Auflage 2002
Verlag De Gruyter Berlin (zitiert: Raiser, Mitbestimmungsgesetz)
Rob, Werner
Mitbestimmung im Staatsdienst im Lichte der Strukturprinzipien des demokratischen, sozialen Rechtsstaates
Diss. DHV Speyer 1998 (zitiert: Rob, Mitbestimmung im Staatsdienst)
Steiner, Harald
Der besondere Stellenwert der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst vor dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte gesetzlich normierter Mitbestimmungsregelungen PersV 86, 143ff.
Das Personalvertretungsrecht regelt die Beteiligung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den jeweiligen Dienststellen und stellt damit ein Pendant zu dem im privatrechtlichen Bereich geltenden Betriebsverfassungsrecht dar.
A) Die geschichtliche Entwicklung bis zum BPersVG
Die Entwicklung des Personalvertretungsrechts war unterschiedlich stark an die Entwicklung des Vertretungsrecht der privatrechtlich Beschäftigten geknüpft.
Die Wurzeln des modernen innerbetrieblichen Personalvertretungsrechts reichen weit zurück. Bereits im 6. Jahrhundert formulierte der Mönch Benedikt von Nursia (480-550) Klosterregeln, wonach die ganze Klostergemeinde bei wichtigen Fragen „quoties aliqua praecipua agenda sunt“ zusammenzurufen und um Rat zu fragen war1.
Der erste neuzeitliche Versuch zur Einführung von Arbeitnehmervertretungen in den Betrieben scheiterte 1848/49 jedoch an den Mehrheitsverhältnissen der Frankfurter Nationalversammlung2. Erst 1891 wurde eine Novellierung der Gewerbeordnung3 durch Kaiser Wilhelm II. durchgesetzt, wonach die Errichtung von Arbeiterausschüssen in den Betrieben ermöglicht wurde4. Diese sollten an der Schaffung von betrieblichen Arbeitsordnungen mitwirken. 1916 wurde die Bildung von Arbeiterausschüsse dann auch in allen kriegswichtigen Unternehmen mit mindestens 50 Arbeitern zwingend vorgeschrieben5. Dabei sollte der Arbeiterausschuss ein gutes Einvernehmen zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber fördern, sowie Anträge, Wünsche und Beschwerden der Arbeiterschaft dem Arbeitgeber mit eigenem Votum vortragen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit zur Bildung von selbständigen Angestelltenausschüssen geschaffen.
Die Beamten in den öffentlichen Verwaltungen wurden jedoch von diesen Regelungen nicht umfasst6.
Erste eigenständige Beamtenvertretungen bildeten sich in einzelnen Städten ab 1916, wobei diese sich erst ab 1918 auf Reichsebene durchsetzten7. Die Gründe dafür lagen in der preußisch-militärischen Prägung des Staatsdienstes, welcher sich insbesondere durch ein gesteigertes Gehorsam gegenüber dem Kaiser auszeichnete. Somit bestand ursprünglich kein Spielraum für eine Mitbestimmung der Beschäftigten im Staatsdienst. Dies änderte sich erst nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit dem Wandel des Selbstverständnisses der Berufsbeamten. Mit der Gründung des Deutschen Beamtenbundes gab es nun einen Lobbyverband, der die Interessen der Beamten in der postmonarchistischen Zeit vertrat.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieg verständigten sich die Gewerkschaften und die Industrie „zur Abwehr radikaler Forderungen nach Sozialisierung“ in allen größeren Betrieben Arbeiterausschüsse zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Arbeiterschaft einzurichten8. Diese Vereinbarung wurde 1919 in Art. 165 II Weimarer Reichsverfassung verankert9, auf deren Grundlage 1920 mit dem Betriebsrätegesetz die erste umfassende gesetzliche Mitarbeitervertretungsregelung erlassen wurde, die zwar die Angestellten in der öffentlichen Verwaltung umfasste10, jedoch die Berufsbeamten vom Geltungsbereich ausnahm11. Für die Beamten sah die Weimarer Reichsverfassung in Art.130 III die Schaffung einer eigenen gesetzlichen Vertretungsregelung vor, die jedoch bis 1933 trotz zahlreicher Regelungsentwürfe nicht erlassen wurde. Dennoch wurden vorläufige Beamtenausschüsse auf Grundlage von Verwaltungsvorschriften im Reich und in den Ländern gebildet, die jedoch lediglich eine beratende Funktion hatten12.
Unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Betriebsräte und die Beamtenausschüsse durch das „Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit“13 und durch das „Gesetz zur Ordnung der Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben“14 abgeschafft und durch Vertrauensräte ersetzt, die auf dem Führerprinzip basierten. Während den Arbeitern und Angestellten in der öffentlichen Verwaltung somit noch eine geringfügige innerbetriebliche Mitbestimmungsmöglichkeit verblieb, wurde das Vertretungsrecht der Beamten völlig aufgehoben15.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden zunächst ohne gesetzliche Grundlage in den privaten und öffentlichen Betrieben und Verwaltungen Betriebsräte gebildet16. Erst durch das Kontrollratsgesetz Nr.22 vom 10.04.1946 wurde der Bildung von Betriebsräten für Angestellte und Arbeiter legitimiert17, wobei umstritten blieb, ob diese Norm auch auf Beamte anzuwenden war18. Während sich zunächst in allen Sektoren Betriebsräte aus Angestellten, Arbeitern und Beamten bildeten, wurde ab 1947 in der Sowjetischen Besatzungszone das Berufsbeamtentum aus ideologischen Gründen abgeschafft und die freien Betriebsräte durch die politisch abhängigen Betriebsgewerkschaftsleitungen ersetzt.
In der Bundesrepublik wurde das Kontrollratsgesetz 1952 durch das Betriebsverfassungsgesetz und 1955 durch das Bundespersonalvertretungsgesetz abgelöst, welches seitdem mehrfach modifiziert wurde.
1 Jassmeier, Das Mitbestimmungsrecht der Untergebenen, S.7ff.; Berger, Die autonome kirchliche Rechtsetzung, S.331.
2 Raiser, fsgesetz, Einleitung, Rn.2. Löwisch/Kaiser, Betriebsverfassungsgesetz, Einleitung, Rn.4.
3 Gesetz, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1.7.1891, abgedruckt in: Deutsches Reichsgesetzblatt, 1891 Band Nr.18, S.251-290.
4 Vgl. §§ 134b ff. Gewerbeordnung (1891).
5 Vgl. §§ 4, 11f.. Gesetz, betreffend den Vaterländischen Hilfsdienst, vom 05.12.1916, abgedruckt in: RGBl. 1916, S.1333 ff.
6 Ortwein, Mitbestimmungsmechanismen (Fn.2), S.86; Heussen, Funktionen und Grenzen, (Fn.5), S.30.
7 Steiner in: PersV 86, 143 (147).
8 Raiser, Mitbestimmungsgesetz, Einleitung, Rn.3.
9 Die Verfassung des Deutschen Reichs, vom 11.8.1919, abgedruckt in: RGBl. 1919, S.1383.
10 vgl. § 9 S.1 Betriebsrätegesetz, abgedruckt in: RGBl. 1920, S.147.
11 vgl. § 10 S.2 Nr.1 Betriebsrätegesetz.
12 Ilbertz/Grabendorff/Widmaier, BPersVG, 11. Aufl. Einl. Rn.9.
13 Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit, vom 20.1.1934, abgedruckt in: RGBl. I 1934, S.45.
14 Gesetz zur Ordnung der Arbeit in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben, vom 23.3.1934, abgedruckt in: RGBl. I 1934, S.220.
15 Rob, Mitbestimmung im Staatsdienst, S.18.
16 Heussen, Funktionen und Grenzen, S.37.
17 Art. I des Kontrollratsgesetzes Nr.22 vom 10.04.1946, Abl. Des Kontrollrats vom 30.04.1946, Nr.6, S.133.
18 Ilbertz/Grabendorff/Widmaier, BPersVG, 11. Aufl. Einl. Rn.14.
B) Darstellung des Personalvertretungsrechtes des Bundes
Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen Landespersonalvertretungsregelungen erfolgt die Darstellung des Personalvertretungsrecht anhand des Bundespersonalvertretungsrechtes.
a) Anwendungsbereich
Während das Betriebsverfassungsgesetz lediglich für die in privaten Betrieben Beschäftigten gilt19, umfasst das Bundespersonalvertretungsgesetz alle Beschäftigten20 (Arbeitnehmer und Beamte) in der Verwaltung des Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie in den Gerichten des Bundes (§ 1 BPersVG), sofern deren Beschäftigung nicht überwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist oder die Beschäftigung überwiegend ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung dient (§ 4 V Nr.1, 2 BPersVG).
Für die Beschäftigten in den Verwaltungen, Gerichten, Schulen und Betrieben der Länder, der kommunalen Träger der Selbstverwaltung und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht eines Landes unterstehen, gelten die jeweiligen Personalvertretungsgesetze der Länder21.
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches des Personalvertretungsrechtes22 zum BetrVG erfolgt grundsätzlich anhand der Rechtsform der Organisation23. Dies gilt auch für bundeseigene Einrichtungen, sofern sie eine privatrechtliche Organisationsform (GmbH, AG, etc.) aufweisen24.
Ausnahmeregelungen bestehen lediglich für Beamte, die als Folge der Privatisierung von Post und Bahn in die neugegründeten Aktiengesellschaften übergeleitet wurden, wobei teilweise das BPersVG in diesen Aktiengesellschaften übergangsweise zur Anwendung kommt25.
Eine Sonderstellung nehmen auch die Religionsgemeinschaften, Soldaten und die Bundesfreiwilligendienstleistenden (ehemals Zivildienstleistende) ein.
Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Einrichtungen sind ausdrücklich vom Geltungsbereich des BPersVG (§ 112 BPersVG) und vom BetrVG (§ 118 II BetrVG) ausgenommen. Diese haben unabhängig von ihrer Rechtsform ein eigenes Personalvertretungsrecht zu setzen26. Das BPersVG umfasst jedoch zunächst Beschäftigte der Militärseelsorge, sofern ihre Ämter als Dienststellen des Bundes geführt werden27, wobei die Geistlichen aufgrund § 4 V, Nr.1 BPersVG nicht als Beschäftigte gelten. Ein Anwendungsbereich ergibt sich somit nur für nichtgeistliche Mitarbeiter der Militärseelsorge. Entsprechendes gilt für die Seelsorge innerhalb der Bundespolizei28. Sofern die Landespersonalvertretungsgesetze keine dem § 112 BPersVG entsprechenden Regelungen enthalten, ergibt sich aufgrund einer gebotenen verfassungsrechtlichen Auslegung nach Art. 140 GG i.V.m. Art.137 I, III WRV keine abweichende Rechtslage29.
Auch auf Soldaten findet das BPersVG grundsätzlich keine Anwendung, selbst wenn die Soldaten mit zivilen Funktionen in zivilen Bereichen des Bundes beschäftigt werden30. Für Soldaten gilt das Soldatenbeteiligungsgesetz (SBG), wonach eigene Vertretungseinrichtungen der Soldaten zu bilden sind. Nur ausnahmsweise wählen Soldaten Personalvertretungen, sofern sie nicht unter den Katalog des § 2 I i.V.m. § 49 SBG fallen. Das betrifft insbesondere die Stäbe der Verteidigungsbezirkskommandos, der Wehrbereichskommandos, der Wehrbereichskommandos/Divisionen und regelmäßig der Korps sowie entsprechende Dienststellen. Entsprechendes gilt für die Freiwilligen des Bundesfreiwilligendienstes (§ 10 BFDG). Diese wählen einen Sprecher31.
b) Wahl und Zusammensetzung des Personalrates
Die Wahlgrundsätze und die Zusammensetzung des Personalrates sind direkt im BPersVG geregelt. Die Durchführung der Wahl ist hingegen in der Wahlordnung zum Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVWO)32 normiert.
In den Dienststellen i.S.v. § 1 BPersVG sind Personalräte in geheimer und unmittelbarer Wahl33 für regelmäßig vier Jahren34 zu wählen, sofern in der Dienststelle in der Regel mindestens fünf Wahlberechtigte beschäftigt sind, von denen drei wählbar sind (§ 12 I BPersVG). Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, sofern sie am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht seit sechs Monaten unter Wegfall der Bezüge beurlaubt sind oder denen infolge Richterspruch das Wahlrecht für öffentliche Ämter aberkannt wurde (§ 13 I BPersVG). Wählbar sind hingegen alle Wahlberechtigten, die am Wahltage seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen oder von diesen geführten Betrieben beschäftigt sind und seit sechs Monaten dem Geschäftsbereich ihrer obersten Dienstbehörde angehören35 (§ 14 I BPersVG). Nicht wählbar sind hingegen die Beamten im Vorbereitungsdienst, Beschäftigte entsprechender Berufsausbildung36 und diejenigen, denen infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen, sowie die Führungspersonen in den Dienststellen37 (§ 14 III BPersVG).
Die Anzahl der zu wählenden Personalräte ist gestaffelt nach der Anzahl der wahlberechtigten Beschäftigten in der Dienststelle.
Wahl des Personalrats § 16 BPersVG
(1) Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel
5 bis 20 wahlberechtigten Beschäftigtenaus 1 Person,21 Wahlberechtigten bis 50 Beschäftigtenaus 3 Mitgliedern,51 bis 150 Beschäftigtenaus 5 Mitgliedern,151 bis 300 Beschäftigtenaus 7 Mitgliedern,301 bis 600 Beschäftigtenaus 9 Mitgliedern,601 bis 1.000 Beschäftigtenaus 11 Mitgliedern.Die Zahl der Mitglieder erhöht sich in Dienststellen mit 1.001 bis 5.000 Beschäftigten um je zwei für je weitere angefangene 1.000, mit 5.001 und mehr Beschäftigten um je zwei für je weitere angefangene 2.000.
(2) Die Höchstzahl der Mitglieder beträgt einunddreißig.
Der Personalrat besteht in Dienststellen mit in der Regel 5 bis 20 wahlberechtigten Beschäftigten aus einer Person; bei 21 bis 50 Beschäftigten aus drei Mitgliedern, wobei die Höchstzahl der Mitglieder einunddreißig beträgt (§ 16 I, II BPersVG)38.
Sind in der Dienststelle mehrere Gruppen (Beamte39 und Arbeitnehmer (ggf. Soldaten40)) beschäftigt, so muss jede Gruppe entsprechend ihrer Stärke im Personalrat vertreten sein, sofern dieser aus mindestens drei Mitgliedern besteht (§ 17 I 1 BPersVG). Die Wahl erfolgt dabei grundsätzlich gruppengetrennt in verschiedenen Wahlgängen, sofern sich die Gruppen nicht auf eine gemeinsame Wahl verständigt haben (§ 19 I BPersVG). Dabei werden die nach der Gesamtanzahl der zu wählenden Personalräte ermittelten Sitze auf die einzelnen Gruppen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl verteilt (§ 17 II BPersVG).
Gruppenstärke
§ 17 Abs.3 BPersVG: Eine Gruppe erhält mindestens
bei weniger als 51 Gruppenangehörigeneinen Vertreter,bei 51 bis 200 Gruppenangehörigenzwei Vertreter,bei 201 bis 600 Gruppenangehörigendrei Vertreter,bei 601 bis 1000 Gruppenangehörigenvier Vertreter,bei 1001 bis 3000 Gruppenangehörigenfünf Vertreter,bei 3001 und mehr Gruppenangehörigensechs Vertreter.Eine Gruppe erhält mindestens einen Gruppenvertreter bei weniger als 51 Gruppenangehörigen41. Dabei soll der Personalrat aus Vertretern verschiedener Beschäftigungsarten zusammengesetzten und die Geschlechter entsprechend dem Zahlenverhältnis vertreten sein (§ 17 VI, VIII BPersVG). Die Wahl findet grundsätzlich nach den Grundsätzen der Verhältniswahl statt, sofern nicht nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde42. Wahlvorschläge können die Beschäftigten in der Dienststelle oder die in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften machen, wobei jeder Wahlvorschlag von mindestens 1/20 der wahlberechtigten Gruppenangehörigen (mind. 3 Wahlberechtigten) unterzeichnet werden (§ 19 IV BPersVG)43. Jeder Beschäftigte kann jedoch nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden (§ 19 VII BPersVG).
Für die Durchführung der Wahl wird ein Wahlvorstand gebildet44. Dieser führt die Wahl durch und zählt im Anschluss die Stimmen öffentlich aus, hält das Ergebnis in einer Niederschrift fest und gibt es den Angehörigen der Dienststelle durch Aushang bekannt. Die Wahl darf dabei nicht behindert werden oder in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise beeinflusst werden, § 24 I 1 BPersVG. Die Kosten der Wahl trägt die Dienststelle, wobei Arbeitszeitausfälle aufgrund der Wahlvor- und durchführung keine Minderung der Dienstbezüge zur Folge hat, § 24 II BPersVG. Die Wahl kann durch mind. drei Wahlberechtigte, durch die vertretenen Gewerkschaften oder durch die Dienststellenleitung binnen 12 Arbeitstagen seit Bekanntgabe des Wahlergebnisses angefochten werden, wenn gegen wesentliche Wahlvorschriften verstoßen und diese nicht nachträglich berichtigt worden sind, sofern der Verstoß das Wahlergebnis geändert oder beeinflusst haben könnte (§ 25 BPersVG).