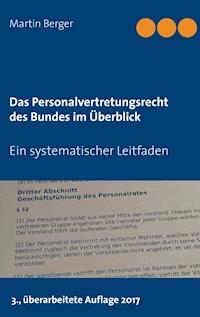4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarze-Zeilen Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Jahrhundert der Grausamkeiten
- Sprache: Deutsch
Heinrich Kirchner erlebt das Kriegsende als junger Erwachsener. Das junge Nachkriegsdeutschland erlebt er in all seiner Spießigkeit und Prüderie. Seine sexuellen Vorlieben haben dort keinen Platz. Aber er lernt auch eine andere, versteckte Seite kennen: das Rotlichtmilieu. Hier herrschen andere Normen. Er wird Zuhälter. Er macht es anders als in den billigen Bordellen üblich und er möchte besondere Kunden bedienen. So begründet er einen SM-Edelpuff in einer Villa und dort gibt es die ersten käuflichen Sklavinnen in Stuttgart ... Der Autor zeichnet ein lebendiges Bild jener Zeit, das mit historischen Fakten untermalt ist. Der Autor hat den fiktiven Charakter des Heinrich Kirchner eng mit der Realität verwoben. Die BDSM-Szenen unterstreichen dabei die Handlung und geben den Charakteren Tiefgang. Vieles, was im Buch geschildert wird, hat sich so zugetragen und vieles ist reine Fiktion. Doch wer weiß schon, wie es wirklich war? Eine fiktive BDSM-Biografie, erleben Sie das Gefühl der 50er bis 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im prüden Süden Deutschlands. Seien Sie gespannt, angeregt und auch schockiert von dem, was Sie lesen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Martin Berger
1978
Stuttgarts erste Sklavinnen
ISBN 978-3-945967-98-0
(c) 2021 Schwarze-Zeilen Verlag
1. Auflage 2021
www.schwarze-zeilen.de
Alle Rechte vorbehalten.
Bitte achten Sie darauf, dass das Buch Minderjährigen nicht zugänglich gemacht wird.
Die auf dem Cover abgebildeten Personen stehen in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Buchs!
Hinweis
Dieser historische Roman ist nur für Erwachsene geeignet. Es handelt sich, bei der vorliegenden Geschichte, um ein reines Phantasieprodukt, eingebettet in einen historisch, korrekt dargestellten Kontext. Historische Fakten sind kursiv dargestellt.
Die Sprache ist, der Zeit und Handlung entsprechend, oft unverblümt und sehr derb. Der Text enthält erotische Szenen und es werden einvernehmlich ausgelebte Formen von Sadismus und Masochismus dargestellt. Sehr selten findet Sexualität – im weitesten Sinne - nicht einvernehmlich statt.
Dies ist dem historischen Hintergrund geschuldet und dient der Veranschaulichung der damaligen Moralvorstellungen und Werte. Dennoch ist der Text für sensible Leser ungeeignet.
Der Verlag und der Autor distanzieren sich von jeglichen realen rassistischen und unterdrückenden Handlungen und Gedanken.
Kriegsende in Schwaben
Der SS-Mann Richard Kirchner hatte seine Verlobte Martha geheiratet. Aber trotz eifriger Bemühungen wollte sich zunächst kein Nachwuchs einstellen. Es dauerte über ein Jahr, bis Martha schwanger war. Im Mai 1932 kam ich zur Welt. Meine Eltern tauften mich auf den Namen Heinrich Kirchner.
***
1933 wird Württemberg zum Gau Württemberg-Hohenzollern. Stuttgart ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum im mittleren Neckarraum. In Stuttgart übernimmt die Gestapo das Hotel Silber in der Dorotheenstraße. Hier werden politische Gegner des neuen Regimes inhaftiert und gefoltert. Das Landgericht in der Archivstraße 12A wird zur zentralen Hinrichtungsstätte im südwestdeutschen Raum. Hier werden mindestens 419 Menschen ermordet.
***
Mama, Papa und ich wohnten im Schwarzwald. In Freudenstadt. Papa reiste viel. Mit dem Auto. Er war oft in Pforzheim und Stuttgart und suchte nach Verbrechern. Mama arbeitete als Lehrerin. Sie brachte den großen Kindern bei, wie man Englisch und Französisch spricht. Ich ging in Freudenstadt in den Kindergarten.
***
1938 wird in Stuttgart die Alte Synagoge niedergebrannt und die Friedhofskapelle der Jüdischen Gemeinde zerstört. Das November-Pogrom ist der Auftakt. In der Folgezeit werden mindestens 2498 Juden aus Württemberg ermordet.
***
Die Schule war ein prächtiger Ort. Lauter Freunde zum Spielen. Wir lernten Rechnen und Schreiben. Mama war sehr stolz auf mich.
***
1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Polen, Holland, Frankreich. Blitzkrieg.
***
Kaum, dass ich in die Schule ging, begann der Krieg. Vater wurde abkommandiert. Er diente unserem Führer nun in der Waffen-SS. Die nächsten Jahre war er in Frankreich. Später kam er nach Russland. Er sah mich, seinen Sohn, nur noch drei Mal. Er bekam nämlich genau drei Mal Heimaturlaub.
***
1941 sind rund 60 Prozent der Juden aus Stuttgart und Umgebung geflohen. Ab jetzt verhindert das Verbot der Auswanderung die weitere Flucht. 1941 fährt der erste Transportzug mit rund 1.000 jüdischen Menschen von Stuttgart nach Riga. In Riga werden sie ermordet. Bis Kriegsendewerden 2.500 weitere Juden aus Württemberg deportiert. Sie landen in Konzentrationslagern. Von diesen KZ-Häftlingen überleben nur 180.
***
An meinen Vater habe ich eigentlich keine Erinnerung mehr. Es war mehr die Erinnerung die Fotos, die bei uns in der Glasvitrine standen. Auf den Fotos war mein Vater ein stattlicher Mann. Mit den SS-Runen an der Uniform und dem Totenschädel an der Mütze. Mama hatte später alle Fotos verbrannt.
Es dauerte nicht lange, bis der Krieg nach Deutschland kam. Auch zu uns in den friedlichen Schwarzwald. Nun saßen wir im Keller. Manchmal. Wenn die Sirenen heulten. Wenn die feindlichen Flieger mit den Bomben kamen. Ich hatte Angst. Die Erwachsenen hatten auch Angst. Nur Mama nicht. Sie tröste mich, wenn ich weinte. Sie zeigte mir Fotos von Papa, der die bösen Männer in den Bombern schon besiegen würde. Aber Papa besiegte sie nicht. Ich war zehn Jahre alt, als Mama sagte, Papa wäre gefallen. Ich verstand nicht, warum er nicht wieder aufstand. Mama weinte. Ein Mal. Danach sah ich sie nie wieder weinen.
***
1944, am 12. September, wirft die britische Royal Air Force circa 75 schwere Luftminen, 4.300 Sprengbomben und 180.000 Brandbomben auf die Stuttgarter Innenstadt. Beim anschließenden Feuersturm sterben rund 1.000 Menschen. Bei insgesamt 53 Luftangriffen werden 68 % der Wohngebäude und 75 % der Industrieanlagen in Stuttgart zerstört. Insgesamt werden in Stuttgart 4.477 Menschen getötet und 8.908 Menschen verletzt.
***
Inzwischen war ich zwölf Jahre alt und verstand, was der Tod war. Meine Mutter und ich waren zu Fuß nach Stuttgart unterwegs. Wir schoben ein Fahrrad. Es war bepackt mit allerlei Lebensmitteln. Es war ein weiter Weg. Wir brachten die Lebensmittel nach Stuttgart. Zu einem Bekannten. Wir, in Freudenstadt, hatten genug Nahrungsmittel. Alle Häuser in Stuttgart waren kaputt. Zerbombt. Ausgebombt, wie man sagte. Gestern Nacht waren wieder Bomben gefallen. Die Menschen wurden von den Bomben verkrüppelt, zerrissen und verbrannt.
Die Verkrüppelten, krochen in den Ruinen ihrer Häuser. Sie schrien. Sie kamen auf die Straße, wo sie verbluteten oder eingesammelt wurden. Die Verbrannten sahen aus, wie schwarze Zwerge. Man schrumpft beim Verbrennen. Überall lagen die Verkohlten. Aufgereiht lagen sie auf den Straßen. Erwachsene versuchten herauszufinden, wer sie einmal waren. Manchmal waren die Eheringe nicht geschmolzen.
Wieder zurück in Freudenstadt, änderte sich auch unser Leben. Im April sagte Mama, wir hätten den Krieg verloren. Jetzt mussten - ganz schnell - ganz viele Fahnen und Bücher verbrannt werden. Alles, was ein Hakenkreuz trug, musste verschwunden sein, bevor die bösen Männer kommen würden. Und sie kamen. Und sie waren böse.
***
1945 kommen mit den Briten, vergleichsweise, vorbildliche Besatzer nach Deutschland. Vor allem, was den Umgang mit deutschen Frauen betrifft. Die Soldaten der Roten Armee sind anders. Gnadenlose Kriegspropaganda legitimiert ihre Vergewaltigungen. So hieß es bereits in einem sowjetischen Flugblatt von 1942: »Tötet! Tötet! Es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist. Die Lebenden nicht und die Ungeborenen nicht! Folgt der Weisung des Genossen Stalin und zerstampft für immer das faschistische Tier in seiner Höhle. Brecht mit Gewalt den Rassenhochmut der germanischen Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige Beute!« Und das taten die Rotarmisten. Unzählige Frauen werden geschändet, gefoltert und bestialisch getötet.
***
Meine Mutter und ich lebten schon seit ein paar Tagen und Nächten im Wald. Mutter sagte, dass sie sich die Briten, als Eroberer, wünschte. Sie fürchtete die Russen. Es kamen Franzosen. Die Franzosen besetzten die Städte im Westen. Die Städte derer, die vor Jahren Frankreich angegriffen hatten. Die Städte derer, deren Willkürherrschaft sie so lange ertragen mussten. Sie, die Franzosen, die meinen Vater und seine Kollegen ertragen mussten. Unzählige Franzosen, Männer, Frauen und Kinder waren durch Nazis gefoltert und getötet worden.
***
1945, am 16. und 17. April, besetzen französische Truppen Freudenstadt.
***
Karlsruhe war bereits von alliierten Truppen besetzt und Pforzheim bei einem Luftangriff der Alliierten komplett zerstört worden. Nun rückten die Kämpfe näher. Jagdbomber flogen Angriffe gegen Freudenstadt. Artillerie beschießt meine Heimat. Wie Mama und ich, so versteckten sich nun alle Bewohner von Freudenstadt, so gut es ging. Viele waren - wie wir - in die Wälder geflüchtet. Andere warteten zusammengedrängt in Kellern. Zum Beispiel in Wirtschaften, wie der »Burg« in der Loßburger Straße. Wieder andere setzten ihre Hoffnungen auf die Felsenbunker. Hinten, in den Steinbrüchen am Hotel Waldeck und am Hotel Waldlust.
Schon bald bereute meine Mutter, in den Wald geflohen zu sein. Sie hatte sich nämlich erkältet und lag inzwischen mit Fieber in unserer elenden Unterkunft. Im Wald zwischen Freudenstadt und Dornstetten hatten die Frauen - in einer Senke - ein verstecktes Lager errichtet. Aus Ästen, Tannenzweigen und erde-braun verdreckten Bettlaken. Mehrere Frauen, Kinder und Greise teilten sich diesen zeitweisen Wohnort. Es war immer feucht und kalt. Besonders die Nächte waren so furchtbar kalt. Wie herrlich, wenn es am Morgen hell wurde. Die Hoffnung auf ein wenig Wärme. Jetzt lag meine kranke Mutter im Wald und schlief. Schon bald sollte sie froh darüber sein, sich für das Leben im Wald entschieden zu haben.
Hätte Mutter gewusst, was mein Freund Karl und ich machten, hätte sie es uns natürlich verboten. Aber sie war zu schwach. Sie schlief. Dauernd. Gestern Abend lagen Karl und ich am Waldrand und beobachtete wie in Freudenstadt die Granaten der Franzosen wüteten. Die Gewehrgranaten donnerten. Das Granatfeuer war so nah. Die Brandgranaten zündeten. In der Dunkelheit sahen wir, wie immer mehr Häuser brannten. Man konnte sie nicht mehr löschen. Viele Häuser verbrannten. Die Flammen loderten so hoch, dass wir sie gut sehen konnten. Über den Flammen schwebten rote Wolken, in denen Milliarden von Funken tanzten. Eigentlich war es ein schönes Bild. Eine Brandgranate setzte das Dach unserer Kirche in Brand. Dann gab es eine halbstündige Feuerpause. Leise brannten die Häuser ab. Wir kehrten ins Lager zurück. Mutter schlief.
Später erfuhren wir, dass viele Leute von Splittern verletzt wurden. Viele wurden getötet. Viele versuchten Verwandte und Bekannte zu retten. Viele versuchten die Brände zu löschen. Einige versuchten - noch immer - die Verteidigung der Stadt zu organisieren. Vergeblich.
***
Es war Montag, der 17. April 1945, morgens gegen 10 Uhr. Karl und ich radelten, mit unseren klapprigen Fahrrädern über die Wald- und Feldwege. Wir wagten es bis an den Rand der Stadt. Wir sahen die noch immer brennenden Häuser. Unseres brannte nicht. Das von Karls Familie schon. Sein Vater war, wie der meine, im Krieg gefallen. Seine Mutter und die zwei kleinen Schwestern lebten, mit uns und den anderen, im Wald. Und nun waren seine Kaninchen verbrannt. Er weinte. Wir hörten die Abschüsse und Einschläge. Von Maschinenpistolen, Gewehren, Maschinengewehre, Granatwerfern und Panzerfäusten. Wir kannten die verschiedenen Geräusche.
Die Nazis hatten befohlen, die Stadt bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Unsere älteren Schulkameraden waren längst der Infanterie unterstellt worden. Sinnlose Tote, wie ich später erfuhr. Karl und ich wollten nun auch unseren Beitrag leisten. Es kam nicht dazu. Es war kurz nach 10 Uhr, als die Panzer kamen. Und schon gegen 10:30 Uhr war Freudenstadt von den Franzosen besetzt. Es war die vierte marokkanische Division. Weißhäutige Franzosen und schwarze Marokkaner.
Tausende von marokkanischen Gebirgssoldaten zogen, zu Fuß oder mit ihren Maultieren, in die Stadt ein. Wir sahen sie von Weitem. Selbst aus großer Entfernung war ihr Anblick furchterregend. Die dunkelhäutigen Gesichter. Die Turbane. Sie trugen lange Mäntel. Und sie sahen verwahrlost aus. In den folgenden Tagen zogen weitere Hilfstruppen der Franzosen - Algerier, Tunesier und Senegalesen – durch die Stadt. Immer weiter. Von Westen nach Osten. Aus unserem Versteck beobachteten wir den Einmarsch der französischen Truppen.
Die Soldaten stürzten in die Häuser, die noch standen. Sie plündernden Wertsachen. Schmuck, Uhren, Schreibmaschinen, Fahrräder, Motorräder und - seltsamerweise - Fotos. Alles, was sie nicht brauchten, zerschlugen sie. Die geplünderten Häuser zündeten sie an. Ganze Straßenzüge wurden an diesem Tag abgebrannt. Überall brannten Feuer. In der ganzen Innenstadt.
Zuerst hörte man, dass die Soldaten von ihrer Militärführung die Erlaubnis für Plünderungen oder Vergewaltigungen hatten.
Viel später erfuhr ich, dass das nicht stimmte. Offiziell stand auf diese Verbrechen die Todesstrafe. Aber die Disziplinierung der Franzosen, durch ihre Vorgesetzten, fiel erbärmlich aus. Viele der Marokkaner waren nicht zu bremsen. Wir hörten, wie sich einige alte Männer, mit weißen Fahnen, über die Plünderungen und sinnlosen Zerstörungen bei den französischen Offizieren beklagten. Doch die überforderten Militärführer verwiesen auf die Gräuel der SS und Gestapo, in Frankreich. Und tatsächlich bekamen wir Deutschen nun zu spüren, was wir vorher den anderen Völkern angetan hatten.
Die Wut und der Hass der französischen Soldaten auf die Deutschen, führten nun zu regelrechten Gewalt-Exzessen. Doch Hass und Abscheu vor uns Nazis waren nicht die wichtigsten Gründe für die schrecklichen Taten in diesen Tagen. Auch nicht der Alkohol. Man hatte, als man wusste, die Besetzung ist nur noch eine Frage von Tagen, allen Alkohol vernichtet. Ein wichtiger Grund, der die Eroberer zu Verbrechern werden ließ, waren die Rachegelüste. Noch wichtiger aber war die Freude über den Sieg und über die baldige Rückkehr in die Heimat. Und ein weiterer Grund kam hinzu. Die Franzosen fühlten sich jetzt zwar als Herren, im Land des Feindes, aber sie konnten noch nicht nach Hause. Sie waren noch zum Hierbleiben verdammt. Ohnmächtig gegenüber den eigenen Befehlshabern, brauchte ihre Wut ein Ventil. Der Hauptgrund für die kommenden Gräueltaten war die relative Straffreiheit. Ohne wirkliche Schranken wurden Vergewaltigung, Folter und Mord für kurze Zeit normal. Zur Norm.
Der Brandrauch ließ Karl und mich kaum noch atmen. Nur hin und wieder blies der Wind die grauschwarzen Wolken weg, so dass wir das Ungeheuerliche beobachten konnten. Einzelne französische Soldaten, aber auch ganze Gruppen von ihnen, machten sich auf die Suche nach den Deutschen. Sie zogen die Frauen und Mädchen aus den Kellern.
Karl und ich waren erst 13 Jahre alt. Wir hatten so furchtbare Angst. Wir sahen aus der Ferne, wie sie eine nackte Frau auf den Boden legten und ihr weh taten. Wie laut sie um Hilfe schrie.
»Ist das die Schuster-Leni?«, fragte Karl.
Ich wusste es nicht. Der Rauch und die Tränen in meinen Augen, machte es mir unmöglich, klar zu sehen. Sie schrie so laut.
»Lass uns abhauen«, flüsterte Karl, »wir können nichts machen.«
Er hatte Recht. Wir stiegen auf unsere Räder und rasten zurück in den Wald. Wir sahen bei den kommenden Vergewaltigungen nicht zu. Es passierte auf den Straßen. Es widerfuhr so vielen Frauen und Mädchen. Ohne Rücksicht auf Alter oder Aussehen. Oder die flehenden Schreie. Um Erbarmen. Um Gnade.
***
1945 melden sich etwa 600 vergewaltigte Frauen; allein im Kreiskrankenhaus von Freudenstadt. 18 französische Soldaten, die man bei besonders grausamen Vergewaltigungen ertappte, wurden standrechtlich erschossen.
***
Noch Tage und auch noch Wochen später, gab es Vergewaltigungen in Freudenstadt. Die fremden Männer stillten ihre böse Lust an den hilflosen Schwarzwälderinnen. Erst allmählich sorgten menschlichere Offiziere für das Ende dieser Folterungen. Die französischen Soldaten mussten nun planvoller vorgehen. Sie achteten nun darauf, dass ihre Vergehen im Verborgenen blieben und lauerten ihren Opfern meist im Schutz der Dunkelheit auf.
Die vergewaltigten Frauen suchten im Krankenhaus, bei Ärzten und in den Pfarrämtern Hilfe und Trost. In den Annalen der Pfarrämter wurden die Gewalttaten sorgfältig dokumentiert. Man hat die Vergewaltigungen vor allem den Nordafrikanern, den »schwarzen Horden de Gaulles«, unterstellt. Diese Taten gab es fraglos, doch neun Monate später stellte man fest, dass die Babys der Vergewaltiger überwiegend weiß waren.
Große Teile der französischen Truppen zogen nun weiter. Nach Osten. Am Nachmittag des 20. April hatten die Franzosen bereits Magstadt besetzt. Dort quartierten sie sich für die Nacht ein, um am nächsten Morgen weiter nach Sindelfingen zumarschieren. 260 Vergewaltigungen gab es alleine in Magstadt. Von den Konfirmandinnen bis hin zur ältesten Frau. In Deckenpfronn wurden Frauen bis zu achtzehn Mal vergewaltigt. Über 50 Vergewaltigungen gab es in Böblingen. Durch weiße und schwarze Franzosen. Vier Tage nach Freudenstadt, nahmen die Franzosen Stuttgart ein. Die Zustände in der Großstadt waren kaum anders, als bei uns im Schwarzwald.
***
1945, am 21. April, besetzen französische Truppen Stuttgart. Mindestens 1389 Mädchen und Frauen werden vergewaltigt.
***
Noch zwei Wochen lang, lebten wir in dem nassen und kalten Wald. Dann, als es meiner Mutter wieder besser ging, packten wir unsere wenige Habe und luden sie auf mein Fahrrad. Mutter und ich machten uns auf den Weg. Wieder einmal in Richtung Stuttgart. Aus den Zeiten, als wir Lebensmittel nach Stuttgart lieferten, kannte ich den Weg. Rechts war der zerstörte Flughafen von Böblingen und links, die zerstörte Fabrik vom Daimler. Wir waren dennoch guter Dinge. Vor uns und hinter uns, hatten andere Leute den gleichen Weg. Wieder andere kamen uns entgegen. Die meisten hatten mehr Leid gesehen, als erträglich war.
Wir gingen nach Vaihingen. Vaihingen liegt westlich von Stuttgart und grenzt direkt an die zerstörte Stadt an. Dort, in Vaihingen, kannte Mutter einen Maschinenschlosser. Früher, als die Bahn noch fuhr, und auch danach, machte Mutter mit dem Maschinenschlosser Geschäfte. Sie lieferte Lebensmittel aus Freudenstadt. Gegen Geld und Waren zum Tauschen. Oft besuchten wir den Mann. In der Werkstatt des Schlossers arbeitete, seit ich denken konnte, ein französischer Kriegsgefangener. Diesem Franzosen - ich weiß nicht einmal mehr, wie er hieß - verdankten wir unsere Unversehrtheit. Mutter war immer nett zu dem Franzosen und gab auch ihm etwas zu essen. Er mochte sie, weil sie seine Sprache sprach. Als Mutter und ich nun den Maschinenschlosser aufsuchten und um ein Lager baten - für ein paar Nächte - erinnerte sich der Franzose an uns beide. Er sprach mit den französischen Besatzern, die uns deshalb in Ruhe ließen. Ja mehr noch. Meine Mutter bekam sogar eine Arbeit - als Übersetzerin. Mutter war doch Lehrerin für Englisch und Französisch. Wir bekamen als Lohn eine deutlich erhöhte Ration an Lebensmitteln. Diese teilte Mutter mit dem Maschinenschlosser, unter dessen Dach wir nun hausen durften. Den Sommer über wohnten wir unter den nackten Ziegeln. Den ganzen Sommer über plünderten und stahlen die Franzosen. Sie fällten die Bäume und stahlen das Holz. Sie demontierten die Ausstattungen der Fabriken und stahlen die Werkzeuge und Maschinen. Überall. Auch in Bäckereien und Autowerkstätten. Nur nicht bei unserem Maschinenschlosser.
Die Franzosen gaben uns Deutschen nur kleine Lebensmittelrationen. Im Wert von 970 Kalorien pro Tag. Von den vier Besatzungsmächten gaben die Franzosen den Deutschen die geringste Menge an Nahrung. Sie orientierten sich daran, was die Franzosen unter deutscher Herrschaft erhalten hatten.
***
Wir hatten den Krieg verloren. Führer und Vaterland waren besiegt. Ich fühlte mich verraten. Mein Vater war tot. Alle Ideale, an die ich glaubte, waren zunichte. Alles hatte sich in Nichts aufgelöst. Alle Opfer meiner Landsleute waren umsonst gewesen. Ich hätte heulen können. Aber, wie Mutter sagte: »Wir hatten überlebt.«
Ich musste nun jeden Abend mit meiner Mutter die Sprache der Sieger lernen. Ich hasste dieses Französisch so sehr.
Plötzlich kamen amerikanische Soldaten. Viele. Sie vertrieben die französischen Besatzer. Mutter sagte: »Jetzt wird alles besser. Die Amerikaner sind diszipliniert. Und sie hassen uns nicht. Sie sind unsere Rettung. Du wirst sehen. Alles wird gut.«
Besatzer-Liebchen
1945, am 8. Juli, übergeben die französischen Besatzungstruppen die Stadt Stuttgart an die USA. Nun ist Stuttgart ein Teil der US-amerikanischen Besatzungszone.
***
Stuttgart war zerstört. Lebensmittel waren extrem knapp. Als die Amerikaner in Stuttgart - und auch in Vaihingen - einmarschierten, bekamen wir Kinder Schokolade und Kaugummis. Die Erwachsenen bekamen Zigaretten. Die Lebensmittelrationen wurden erhöht. Die Sorge zu verhungern, schien vorerst gebannt. Fast alle waren sich einig: Die US-Soldaten waren echte Befreier. Nicht nur von den Nazis, sondern, vor allem, von den Franzosen.
Aber auch die US-Soldaten waren Männer. Männer, die sich an deutschen Frauen vergingen. Diese Verbrechen passierten, fast immer, im Verborgenen. Die US-Militärdienststellen registrierten allein für das erste Nachkriegsjahr 1.500 Anzeigen von Vergewaltigungen. Meist kam es nach der Anzeige nicht einmal zu einer Gerichtsverhandlung. Die Täter blieben unbekannt.
Nur 613 Amerikaner kamen wegen Vergewaltigung vor Gericht. Und von diesen wurde nur jeder Fünfte verurteilt. 44 US-Soldaten wegen besonders schwerer Vergehen zum Tode verurteilt. Die Akten zu diesen Vergehen, lesen sich wie Protokolle von Inquisitionsprozessen. Sie folterten ihre hilflosen Opfer. Kaum einer dieser Vergewaltiger hasste die Deutschen oder hatte einen Grund, sich zu rächen. Es war die Gelegenheit, die die Täter erschuf. Und das vergleichsweise, geringe Risiko, bestraft zu werden.
Natürlich bemühte sich die US-Militärführung darum, das ganze Thema zu verschleiern. Neue deutsche Richter, die auf ein gutes Auskommen mit den Besatzern angewiesen waren, sorgten für geringe Zahlen von Verurteilungen. Damals kannte jeder die Geschichte einer Frau aus Mannheim. Sie wurde mit vorgehaltener Pistole vergewaltigt. Natürlich wehrte sie sich nicht. Ein Fehler, wie ihr später der Richter erklärte. Ohne Gegenwehr der Frau, kann man, den von ihr geschilderten Vorgang, keineswegs als Straftat ahnden. So musste sie ihre Beschuldigung widerrufen. Das Protokoll hielt fest: »Jetzt, wo man mir die Definition von Vergewaltigung erklärt hat, muss ich einsehen, dass ich nicht vergewaltigt worden bin. Ich habe mich während des Gewaltaktes nicht verteidigt.«
***
Viel häufiger, als zu Vergewaltigungen, kam es jedoch zur »Fraternisierung«. Das heißt zur Verbrüderung oder Anfreundung zwischen US-Soldaten und einheimischen Frauen. Meist hatten diese Liebschaften zwischen amerikanischen Eroberern und deutschen »Fräuleins« handfeste, materielle Gründe. Erst eine Tafel Schokolade, ein paar Zigaretten, dann ein Paar Strümpfe, dann ein paar Dollars. Rasch wurden aus einem hungrigen »Fräulein« ein sattes »Soldaten-Liebchen«. Und daraus wurde nicht selten eine »Trümmer-Hure«. Heute kennt man kaum noch eines, diese Worte. Damals kannte sie jeder.
Stuttgart lag in Trümmern. Es gab keine Wohnungen und keine Arbeit. Häuser und Fabriken waren zerstört. Die Männer waren gefallen oder in Gefangenschaft. Die Frauen mussten sich alleine durchschlagen. In den Ruinen blühte die Prostitution. Für viele Frauen war Prostitution die einzige Möglichkeit, um an Essen zu gelangen. Die Frauen waren schlicht gezwungen, eine »Trümmer-Hure« zu werden. Sex für einen Laib Brot. Oder einen halben. Der Hunger erzwang es. In der zerbombten Stadt breiteten sich Geschlechtskrankheiten aus. Jedes Jahr registrierte man - in der Stuttgarter Hautklinik - im Durchschnitt 600 junge Frauen mit den typischen Symptomen. Man nannte sich HwG-Mädchen. Mädchen mit »häufig wechselndem Geschlechtsverkehr«.
***
1945 beginnen die Amerikaner, ihre Besatzungszone zu stabilisieren. Vor allem in Stuttgart sind Ruhe und Ordnung die primären Ziele. Dazu verhängt die US-Militärregierung unter anderem ein Bordell-Verbot.
***
Die Amerikaner kümmerten sich, um die sogenannte Entnazifizierung. Im Zuge dieser Entnazifizierung mussten die Deutschen 187 politische Fragen auf Fragebögen beantworten. Wer sie auswertete, sah, dass es keine Nazis mehr gab – in Deutschland. Nur noch Unwissende und Mitläufer. Den meisten Deutschen war Politik inzwischen wirklich völlig gleichgültig geworden. Auch meine Mutter kümmerte sich nur um mich und um ihre Arbeit. Sie übersetzte jetzt für die amerikanische Armee und die deutsche Polizei.
Mama arbeitete in Stuttgart im Polizei-Präsidium. Sie stempelte Essensmarken und stellte neue Ausweise aus. Und auch Zonen-Passierscheine. Letzteres tat sie auch für sich selbst und mich. Mit dem Handwagen konnten wir nun, verbotenerweise, Lebensmittel aus dem Schwarzwald nach Stuttgart schmuggeln. Mutter tauschte die Lebensmittel gegen Kleider, Medikamente und Kohle zum Heizen.
Mutter bekam für ihre Arbeit bei der Polizei 215 Reichsmark im Monat. Allerdings kostete ein einziger Laib Brot 200 Reichsmark. 250 Gramm Butter kosteten stolze 350 Reichsmark. Ich aß gerne Butterbrote. Wer keinen Bauern kannte, der hatte weder Brot noch Butter. Mutter kannte viele Bauern. Überall blühte der Schwarzmarkt. Mutter mischte bei diesen Geschäften tüchtig mit. Mutter tauschte auch Passierscheine gegen Lebensmittel oder Kohle. SS- oder NSDAP-Mitgliedschaften, die sich in Luft auflösten, waren die Regel. Nun war auch mein Vater nie in der SS gewesen.
***
1945 wird Stuttgart die Hauptstadt des Landes Württemberg-Baden, das nach Gründung der Bundesrepublik im neuen Bundesland Baden-Württemberg aufgeht. 1945 wird Arnulf Klett zum Oberbürgermeister von Stuttgart gewählt. Er bleibt es bis 1974. Die Stadt wird wiederaufgebaut. Und dabei rigoros modernisiert.
***
1945 und 1946 kamen zehn bis zwölf Millionen Kriegsheimkehrer und Vertriebene aus dem Osten nach Deutschland. Sie strömten in die vier Besatzungszonen. Sie hatten nichts. Aus Ungarn kamen deutsche Flüchtlinge, über Schwäbisch Gmünd in die amerikanische Zone. Dann weiter ins Flüchtlings-Auffang-Lager »Farion«, eine ehemalige Maschinenfabrik in Esslingen-Mettingen. Von hier aus, wurden sie durch die amerikanischen Besatzer verteilt. In extra dafür requirierte Zimmer. So ein Zimmer, in einem größeren Mehrfamilien-Haus in der Stuttgarter Innenstadt, bekamen durch »Zufall« auch meine Mutter und ich. Eigentlich waren es drei Zimmer. Eine richtige Wohnung mit Badezimmer und Toilette. Wer mit uns in diesem Haus wohnte, hatte keinen Hunger. Das waren 1946 die glücklichen Ausnahmen.
Wir, die Kinder aus der Umgebung arbeiteten- wie die meisten Leute damals - im Häuserbau. In der Innenstadt. Wir klopften alten Mörtel oder Putz von Steinen und Ziegeln, damit man daraus neue Wände hochziehen konnte. Geld bekamen wir keines. Aber der Gemeinderat sorgte für eine tägliche Mahlzeit. Der Wiederaufbau lief schleppend. Es fehlte an Werkzeug. Und an Baumaterial.
Mich machte diese Arbeit zäh und kräftig. Ich war erst 14, konnte aber so viel tragen, wie ein erwachsener Mann. Dennoch hasste ich meine eintönige, dreckige und harte Arbeit. Und ich hasste die fremden Erwachsenen, die mich dauernd herumkommandierten.
Jeden Morgen ging ich zu der Baustelle. Stapfte durch die grauen Geröllhalden. Einst schöne Häuser, waren es jetzt nur noch graue Mauerreste. Graue Steine. Überall lag der bleigraue Staub. Eine gleichförmige, betongraue Landschaft. Grau, grau und immer nur grau. Graue, spitze Steine. Graue Schuhe. Vom grauen Staub. Ich wollte kein graues Geröll mehr sehen. Keine geborstenen Fenster in gefallenen Mauern, keine scharfkantigen Steine, keine gesplitterten Ziegel. Ich wollte nicht auf die Baustelle. Ich fürchtete das Geschimpfe. Alte Weiber werden mich antreiben. Mich herumkommandieren. Ich hasste es ihre Befehle zu befolgen. Jeden Tag.
Ich sah ihn in der Ferne. Einen einzelnen Halm einer Löwenzahnpflanze. Saftig und grün. Aus einer graugrünen Blattrosette sprießend. Leben in dieser Wüste des Krieges. Ich suchte nach weiteren Anzeichen von Leben. Nichts. Mein Weg durch die graue Wüste brachte mich näher an die einsame Pflanze. Ich stand vor ihr. Und ich trat darauf. Ja, ich drehte sogar meinen Absatz, um die Pflanze auszumerzen. Später einmal würde keiner mehr über mich bestimmen.
***
Eines Abends kam ich von der staubigen Baustelle nach Hause, da saß Jack an unserem Tisch. Er trug eine Uniform der US-Armee, die ihn als Sergeant auswies. Ein US-Sergeant entsprach einem Unteroffizier oder Stabsunteroffizier der Wehrmacht. Seine Uniformjacke war geöffnet und ich sah sein Unterhemd und seinen üppigen Bauch.
Was wollte der Mann hier? Vor ihm stand ein Glas, zur Hälfte gefüllt mit Bier. Und ein Teller. Auf dem Teller waren Fleisch, Kartoffelbrei und Erbsen. Dasselbe leckere Essen war auch auf dem Teller meiner Mutter. Ihr Bierglas war schon fast leer.
»Das ist Heinrich«, sagte meine Mutter und fuhr fort, »und das ist Jack. Setz dich Junge, ich hole Dir ein Essen.«
Sie stand auf und kam mit einem solch, wunderbaren Teller voller Leckereien wieder.
»Das hat uns Jack mitgebracht«, erklärte sie, »das ist aus ihrer Kantine. Koste es. Es ist wunderbar. Richtiges Fleisch. Und sieh nur, wie viel.«
Sie hatte recht. Seit über einem Jahr hatte ich nichts Vergleichbares gesehen, geschweige denn gegessen. Ich verschlang es. Der Sergeant mit der verlotterten Uniform musterte mich genau.
»Gehst du Schule?«, fragte er in schlechtem Deutsch.
Ich kaute und schüttelte den Kopf.
»He works. Builds houses«, erklärte meine Mutter.
Der große, dicke Mann trank sein Bier leer.
»Hole eins, noch!«, sage er.
Mutter stand auf und zauberte eine weitere Flasche Bier aus der Küche. Und in der anderen Hand hielt sie eine geöffnete Flasche mit Coca Cola. Ich musste riesige Augen gemacht haben. Der Sergeant lachte laut.
»Für dich!«, rief er fröhlich.
Was wollte er hier?
»Jack und ich haben uns schon letzte Woche kennen gelernt, auf der Wache«, sagte Mama.
Ich schaute sie fragend an. Jack lachte wieder sein kehliges Lachen.
Dann sagte er: »Junge, dein Mutter Martha sein Soldaten-Liebchen.«
»Jack!«, rief Mutter, »was soll denn das.«
Doch Jack sprach mit seiner Kasernenhofstimme weiter.
»I love kisses. She loves US-food.«
»Jack!«, rief Mutter erbost, »so halt doch den Mund. Red´ doch nicht so hässlich.«
»Martha, er sein kein Baby mehr.«
»Wir sind Freunde«, beteuerte meine Mutter, »vom Präsidium.«
Jack hatte offenbar schon zuvor genug Bier getrunken.
»Ja genau. Martha has my two friends. Take them out«, kicherte er und deutete auf Mutters Brüste.
»Es ist genug, Jack«, schimpfte Mama mit dem Betrunkenen.
Jack riss sich zusammen.
»Sorry, Heinrich«, murmelte der Riese und stach mit der Gabel von seinem kalten Kartoffelbrei ab. Er schaute auf seinen Teller. Ich schaute meiner Mutter in die Augen.
Sie lächelte und sagte: »Jack ist ein netter Kerl. Er hat heute schon so viel Bier getrunken. Nimm deine Cola und dein Teller. Geh auf dein Zimmer. Alles ist gut. Wir sprechen morgen.«
Ich gehorchte und nahm meine Leckereien mit mir. Erst wollten sie mir nicht so recht munden. Aber bald genoss ich den Luxus.
Am nächsten Abend, als ich heimkam, saß Mutter schon am gedeckten Tisch. Linsensuppe und Brot. Nicht mehr der Glanz vom Vortag. Aber reichlich. Ich fragte noch einmal wegen Jack, aber Mama beteuerte, dass sie ihn mögen würde. Ich solle mir keine Gedanken machen.
Am Dienstag musste ich mir dann doch wieder Gedanken machen. Als ich vom Bau nach Hause kam, saß der riesige Kerl schon wieder an meinem Tisch. Gebratenes Huhn, Röstkartoffeln und Krautsalat. Mein Teller stand schon da. Sein halbes Huhn war bereits abgenagt und auch meine Mutter hatte mich wohl früher erwartet – und angefangen zu essen. Auf dem Tisch standen 6 - nein 7 - leere Bierflaschen. Hatte meine Mutter auch so viel getrunken?
»Hallo Heinrich«, rief meine Mutter fröhlich, als ich meine dreckigen Schuhe im Flur abstellte.
»Hallo Heinrich«, äffte Jack sie mit künstlich, überhöhter Stimme nach.
Jack war gemein zu Mutter.
»Soldaten-Liebchen, Soldaten-Liebchen«, flüsterte er.
So, dass ich es hören musste.
»Psst, Jack«, machte Mutter.
Er knurrte missbilligend. Aber er war kurz still.
Ich ging zu Mutter und wollte sie drücken, als Jack rief: »Kiss her!«
Ich blieb stehen. Böse sah ich den riesigen Kerl an. Ich verabscheute ihn.
»Heinrich, setzt dich und iss...- oder besser…- nimm es wieder in dein Zimmer.«
»Heinrich will nicht küssen. Ich aber«, grölte der offenbar schon wieder Betrunkene, »Martha, küss mich! Mit Zunge!«
Er stand nun auf der anderen Seite von Mutter und beugte sich zu ihr hinab.
»Küss mich!«, sagte er drohend.
Mutter hob ihren Mund und küsste den seinen. Was er dann tat, hatte ich nie zuvor gesehen. Er presste seine Lippen eng an die ihren, öffnete seine Lippen und bohrte seine Zunge in Mutters Mund. Ich sah seinen Speichel. Seine Bartstoppeln. Er schob ihr tatsächlich seine ekelhafte Zunge in den Mund. Und noch schlimmer war, was Mama tat. Nämlich das Gleiche. Sie schob ihre Zunge in seinen Mund. Ich sah dem widerwärtigen Spiel sicher eine halbe Minute lang zu.
Als der Sergeant seine Lippen wieder von meiner Mutter trennte, sagte er schulterzuckend: »Soldaten-Liebchen.«
Ich wusste nicht, was das bedeutete. Aber an der Art, wie er es sagte, erkannte ich, dass es eine Beleidigung sein musste. Mama ertrug es aber.
»Heinrich, geh auf dein Zimmer«, sagte sie.
»He stays!«, kommandierte der Soldat. Dann flüsterte er mit Mutter auf Englisch. Sie wollte nicht, was er wollte. Er wurde lauter. Sie auch. Er zischte drohend. Meine Mutter hatte den Streit wohl verloren.
»Normalerweise küssen sich Erwachsene so nicht, vor anderen. Jack will, dass ich ihn vor deinen Augen küsse. Dass zeigt, was wir für gute Freunde sind. Jetzt nimm dein Teller und geh auf dein Zimmer. Verstanden.«
Kein Wort hatte ich verstanden. Sie küsste ihn wieder. Ihre Zunge leckte an seinen Lippen. Ekelhaft.
»Jetzt geh, Heinrich. Alles ist gut. Lass es Dir schmecken. Und schlaf´ gut.«
Bevor ich die Türe von außen schloss, sah ich sie noch einmal an. Sie streichelte Jacks Gesicht und küsste ihn wieder zärtlich auf den Mund. Ich verstand nicht, was da an meinem Tisch passierte. Ich ließ mir aber das gute Essen schmecken und schlief prima. Ich schlief immer rasch ein. Beim Frühstück gab mir meine Mutter eine neue Regel. Sie verbot mir an Dienstagen und Donnerstagen vor 20 Uhr nach Hause zu kommen. Um 18 Uhr hatte ich auf der Baustelle Feierabend. Was sollte ich bis 20 Uhr tun? Als ich Mama fragte, wo ich die zwei Stunden, von sechs bis acht Uhr abends, verbringen sollte, wusste sie keinen guten Rat.
»Bahnhof, Kirche, Wirtshaus...?«
Sie suchte in Gedanken. Sie fand nichts.
»Jeden Tag mit D, jeden D-Day, kriegst du einen Dollar. Damit kannst du Dir in einer Wirtschaft etwas kaufen. Einen Kuchen. Oder etwas zu Trinken. Eine Limonade vielleicht.«
Zwei Dollar die Woche. Das konnte sich sehen lassen. Und sie gab mir ein Buch. Ein besonders dickes Buch. Viele hundert Seiten. Von Wilhelm Busch. Es waren auch Zeichnungen drin. Ich las es gerne. Es war lustig und klug. Ich las es heimlich auch auf der Baustelle. Ich versteckte mich, damit ich darin lesen konnte. Einmal sprach ich mit den erwachsenen Kollegen auf der Baustelle über den Amerikaner, der uns Essen brachte. Ich fürchtete, sie könnten mich auslachen, weil ich das alles nicht verstand. Aber keiner lachte. Und keiner wollte mir erklären, was ein Soldaten-Liebchen war. Ich verstand noch nicht, was diesen Jack und meine Mutter verband.
Bis heute weiß ich nicht, ob Mama sich jeden D-Day beschlafen lassen musste. Oder ob sie es gerne so wollte. Für Letzteres sprach einiges: Wir waren nicht arm. Wir hatten, auch bevor es Jack gab, jeden Tag genug zu essen. Viel mehr als die Meisten in dieser Zeit. Vielleicht mochte sie ihn wirklich.
An den D-Tagen trieb ich mich, von nun an, in der Stadt herum. Manchmal saß ich mit meiner Limonade im Bahnhof und las in meinem Buch von Wilhelm Busch. Bald kannte ich erste Verse auswendig. Im Bahnhof verscheuchten mich die uniformierten Bahnbeamten. Weil ich keine Fahrkarte hatte. Dann schlenderte ich zur Leonhardskirche. Dort trieb ich mich gerne herum. Dort war viel los. Aber auch an der Kirche war ich nicht willkommen. Ich wusste nicht, weshalb ich die Männer störte, die hier Hütten aufbauten. Wilhelm Busch kannte meine Gefühle: »Ihr seht, dass selbst der bravste Mann, nicht jedermann gefallen kann.«
Trümmer-Huren
1946, ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ist Stuttgart noch immer ein Trümmerfeld. Eine chaotische Ansammlung an Behelfsläden und Behelfswohnungen. Einige pfiffige Männer – überwiegend Wirte - errichten nun auch einfache Behelfslokale und Behelfsbars. Bald blühten der Alkoholausschank und die Prostitution in diesen Hütten zwischen den Ruinen. Stuttgarts Oberbürgermeister, der Stadtrat, die Polizei und selbst der evangelische Stadtdekan, wenden sich mit einer ungewöhnlichen Bitte an die US-Besatzer. Nämlich, das Bordell-Verbot aufzuheben. In den Ruinen und Hütten herrschten nämlich kriminelle Zuhälter.
***
Seit 1946 ging ich wieder zur Schule. In die Schickhardt-Oberschule. Im Süden des Stadtzentrums von Stuttgart. Nur einen Kilometer von unserer Wohnung entfernt. Ich war kein fleißiger und auch kein guter Schüler. Ich hasste Französisch. Ich vernachlässigte das Fach. Und die meisten anderen ebenfalls. Es war so langweilig. Als kleine Kinder lernen wir laufen und sprechen. Dann in der blöden Schule lernen wir das dumpfe Stillsitzen und unseren Mund zu halten.
Unsere Lehrer waren allesamt recht unerfahren in ihrem Beruf. Viele waren alte SPD´ler, die unter den Nazis schikaniert wurden. Leidlich angewidert von Lehrern im Allgemeinen und meinem Französisch-Lehrer im Besonderen, überstand ich trotzdem meine Schulzeit. Ich lernte laut zu lesen und leise zu leiden. Gut war ich eigentlich nur in Englisch. Nun ja, ich übte jeden D-Day mit den amerikanischen Soldaten. Noch immer las ich mein Buch von Wilhelm Busch: Bald kannte ich viele Strophen auswendig. Und meine Vorliebe ging von den lustigen Bildergeschichten über, zu den Briefen, die der kluge Herr Busch geschrieben hatte.
Noch mehr aber, liebte ich ein anderes Buch. Ich hatte es – nass - an der Leonardskirche gefunden und getrocknet. Nun war es ganz wellig und das Papier war mehr bräunlich-gelb, als weiß. Mein Buch lag zu Hause unter meinem Bett. Unter einem losen Parkett-Brett. »Verließ der gequälten Frauen« prangte als Titel auf dem zerfledderten Einband. Schlug man das Werk auf, so fand man fünf Seiten mit Zeichnungen in Schwarz-Weiß. Halbnackte Nonnen folterten nackte Frauen. Ketten, Fesseln und Pranger fixierten die übertrieben üppig, dargestellten Opfer in Posen, die mir, dem Betrachter, ihre intimsten Details offenbarten. Seltsamste Dinge steckten in Öffnungen, die mir völlig unbekannt waren. Zangen, Sägen, brennende Kerzen und Nadeln kamen zum Einsatz. Der Text umfasste gerade einmal 34 Seiten. Die Nonnen erzwangen Geständnisse. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger. Unaussprechliche Worte und Schreie (Aaaaah) garnierten die Schilderungen der einzelnen Verhöre. Es verging kaum ein Abend, an dem ich nicht eine der Bildseiten genoss, bevor ich mein Taschentuch benutzte und befriedigt einschlief.
***
In den Ruinenwüsten der deutschen Städte wuchsen die ersten Wohnungen, Ladengeschäfte und Betriebe. Hier entstand der Mythos, um die bekannten Trümmerfrauen. Auf den grauen Baustellen in den grauen Ruinen sah ich sie schuften. Sie klopften noch immer Steine sauber. Um daraus neue Mauern zu errichten. Überall in Deutschland. Und speziell bei uns im Schwabenland. Schaffen, Schaffen, Häusle-Bauen. Der Schwaben-Mythos.
Im Zentrum von Stuttgart bauten geschäftstüchtige Männer - schnell und unkompliziert - einfache, provisorische Hütten, wie bei einer Kirmes. Diese Baracken entstanden zwischen den zerstörten Häusern. Die ersten Behelfslokale und -bars. Da gab es Wirte, die Bier, Wein und Würstchen an US-Soldaten verkauften. Und damit sich die Amerikaner wohl fühlten, klangen hier die neuen, amerikanischen Plattenspieler. Sie spielten Jazz. Amerikanische Schallplatten.
Und damit sich die Amerikaner noch wohler fühlten, kamen die deutschen »Fräuleins«. Die Soldaten gaben ihnen eine Cola aus. Oder eine Wurst mit Brot.
***
Ab Oktober 1946 wurde es bitterkalt. Später nannte man es den Hungerwinter 1946/47. Es war einer der kältesten Winter in Deutschland seit Jahrzehnten. Tausende Menschen in Deutschland starben an den Folgen von Hunger und Frost. Abertausende suchten ein Dach über dem Kopf. Etwas zu essen. Sie hatten nichts. Steckrübensuppe. Zu dünn zum Überleben. Mehr Augen gucken in den Topf rein, als Fettaugen heraus.
Eine Kartoffel war einen Tag Leben wert. Kohlen vom Schwarzmarkt waren eine warme Nacht. Kohlen und Holz waren knapp. Essen war unbezahlbar. Um Weihnachten kostete ein Kilo-Laib Brot 250 Reichsmark, das Pfund Butter gar 500 Reichsmark.
Auf dem schwarzen Markt - und einen anderen gab es nicht - fehlten auch eineinhalb Jahre nach Kriegsende die Waren. Die amerikanischen Militärpolizisten lernten Deutsch. Sie sorgen für Ruhe in den Geisterstädten. Die US-Militärpolizei wurde unterstützt durch erste, deutsche Polizisten. Diese arbeiteten im Präsidium in Stuttgart. Wo auch meine Mutter noch immer arbeitete.
Offiziell mussten die Polizisten vieles verhindern: Schwarzmarkt, Diebstahl, Prostitution und die Verbrüderung zwischen Deutschen und Amerikanern. Gleichzeitig mussten sie diese Dinge zulassen, sonst wären die meisten Deutschen schlicht erfroren oder verhungert.
Die wenigen Lebensmittel kamen dorthin, wo die Amerikaner mit ihren Dollars waren. Die Wirte, um die Leonhardskirche, botenallerlei, leckere Sachen an. Würste, Kraut, gegrillte Hähnchen, Käsekuchen. Niemand wusste, woher diese Lebensmittel stammten. Aber sie waren da.
Und wo es die reichen Amerikaner gab, da gab es bald auch die »Fräuleins«. Brot, Wurst, Kraut, Cola, Bier, Schokolade und Zigaretten lockten. Immer mehr »Soldaten-Liebchen« waren hier. Inzwischen wusste ich, was der Begriff bedeutete. Was gab es wohl mehr? Trümmer-Frauen oder Trümmer-Huren? Ein Tabuthema. Heute vollkommen vergessen.
Vergessen, wie die Mitgliedschaft in der Partei. Die Nazis waren verschwunden. Nach den Nazis verschwanden noch zwei Dinge, die es im Krieg und im ersten Jahr danach, noch gab: Solidarität und Stolz. Die Solidarität wurde ersetzt durch den Egoismus. Der Stolz wich der Scham.
Es war eine egoistische und beschämende Zeit, die deshalb bis heute tabu ist. Jeder klaute. Jeder! Und fast jeder bettelte. Fast jeder! Viele Frauen wurden zu Huren. Trümmer-Huren. Viele! Vielleicht auch meine Mutter.
Bertolt Brecht wusste, wovon er schon 1928, in seiner Dreigroschenoper, schrieb: »Erst kommt das Fressen, dann die Moral.«
Und die Moral war zum Teufel gegangen. Man tauschte sie gegen ein Stück Brot.
Es war eine Zeit, die Scham erzeugte. Diebe, Betrüger, Bettler und Huren. Alle schämten sich. Ich litt keine Not - und ich schämte mich für nichts. Ich hatte eine Mutter bei der Polizei. Mutter war ganz sicher bestechlich. Und wir hatten Sergeant Jack. Wahrscheinlich schämte sich auch meine Mutter. Für das, was sie in diesen Tagen tat. Sie sprach später nicht gern über diese Tage. Mir war sie immer eine gute Mutter.
Die ersten Freier dieser Trümmer-Hurenwaren natürlich die Alliierten. Die Besatzer, die Befreier, die US-Soldaten. Erst viel später kamen die braven Ehemänner der schwäbischen Trümmerfrauen, die fleißigen Schwaben hinzu. Die waren, zurzeit, noch sehr arm. Reparierten Häuser, Geschäfte, Arztpraxen und Fabriken.
Es war eine Zeit, die kaum für Heldengeschichten taugte. Es waren Geschichten um Elend und Kälte und Armut. Dienstags und donnerstags musste ich mich bis 20 Uhr auf der Straße herumtreiben. Diese kalten D-Day-Abende lockten mich in eine neue Welt, die meine Welt werden sollte. Es war die Kirmes um die Leonhardskirche.
Hier gab es viele warme Plätzchen. In den Hütten und davor. Hier versammelten sich abends die einfachen US-Soldaten, die GIs. Viele glauben der Spitzname leite sich ab, von »Government Issue« (Regierungseigentum; Regierungsangelegenheit). Das ist falsch. GI steht für »Galvanized Iron« (galvanisiertes Eisen). So wurden metallene Armee-Gegenstände gekennzeichnet. So trugen zum Beispiel die metallenen Mülleimer den GI-Stempel.
***
Ich kannte sie gut, diese Mülleimer. Einige standen neben den Öl-Fässern, in denen die Amerikaner abends Holz verbrannten. Fünf solcher Fässer brannten zwischen den Hütten und Trümmern, rund um die Leonhardskirche. Hier wärmten sich die GIs. Hier konnten die Amerikaner, bei lauter Jazz-Musik, bei Essen und Bier, die süßen und willigen »Fräuleins« kennen lernen. Hier plärrte einer der modernen Plattenspieler. Jazz. Ein komisches Gejaule. Ob es den Mädchen wohl gefiel?
Jedenfalls kamen sie hier her, die frierenden und hungrigen, deutschen Mädchen. Hier wurden sie zu Soldaten-Liebchen. Überall in Deutschland die gleichen Bilder: US-Besatzer flirteten mit deutschen Fräuleins. Ob in Berlin am Wannsee oder hier an der Leonhardskirche. Irgendwo in Deutschland gab es die erste deutsch-amerikanische Hochzeit. Ein GI ehelichte sein Liebchen. Meist währten die Liebschaften nicht so lange. Zerbrochene Herzen. Zerbrochene Frauen-Seelen. Ausgebombt, vergewaltigt, ausgehungert und halb erfroren. So waren sie, die Frauen. Und hier suchten sie nach Wärme. Fanden ein paar Dollar. Genug für eine Mahlzeit. Oder für ein paar Kohlebrocken, die die Eltern der Mädchen brauchten, um in ihren Ruinen nicht zu erfrieren. Es war damals wirklich sehr einfach, zur Trümmer-Hure zu werden. Wie viel Prozent der Trümmerfrauen wohl auch Trümmer-Huren waren?
Jeden D-Tag sah ich sie. Diese Frauen, mit ihren klobigen Lederschuhen und ihren Mänteln. Darunter einfache Kleider und wollene Strümpfe. Sie wärmten sich - wie ich - die klammen Hände über den brennenden Fässern. Nur meine Schicht endete um 20 Uhr. Sie mussten - oder durften - hierbleiben bis um 23 Uhr.
Die Feuer der Amerikaner wärmten mich. Hier verbrachte ich, wartend, meine zwei Stunden. Ich bettelte - recht erfolglos. Ich sah zu gesund aus - und zu stark. Ich lauschte der fremden Musik - bewegte mich gegen die Kälte. Zu den fremden, unregelmäßigen Rhythmen. Im November fragte mich einer der Wirte, ob ich seine zwei Mülleimer leeren wollte. Ich sagte zu.
Augenzwinkernd und sympathisch war er, der Wirt. Wir wurden später Freunde. Der Schäfers-Karle und ich. Nun leerte ich jeden D-Day die Mülleimer. Die Soldaten warfen viel weg. Das Papier, in das ihre Sandwiche gepackt waren. Ihre Zeitungen. Die Glasflaschen, die sie leerten. Und ihre Kondome. Die gebrauchten Pariser landeten in meinen Eimern. Alles wurde wiederverwertet. Altpapier, Altglas und Gummis.
Die Pariser habe ich gewaschen, auf Dichtigkeit geprüft, getrocknet und erneut verkauft. Zugegeben, eine etwas ekelhafte Arbeit. Aber weniger schlimm, als die furchtbare Kälte, in der ich sie verrichten musste. Wer kaufte meine gebrauchten Kondome? Praktisch jede der Trümmer-Huren. Meine mangelhaften Qualitätskontrollen hatten sicher einige unerwünschte Konsequenzen.
***
1945-1948 kommen in Westdeutschland 66.730 uneheliche »Besatzungskinder« zur Welt. Viele stammen aus Vergewaltigungen. Mehr aber aus Beziehungen zwischen Besatzungssoldaten und Soldaten-Liebchen. Circa 60% dieser Kinder stammten von US-Soldaten. Circa 10% hatten einen afroamerikanischen Vater. Fast alle diese Kinder kamen zu Pflegeeltern oder in Heime.
***
Endlich kam der März 1947. Endlich wurde es wärmer. Endlich wurden die Abende erträglicher – und unterhaltsamer. Mit 15 Jahren war ich so groß und so stark, wie ein erwachsener Mann. Ich kannte jede der Huren, die hier an der Leonhardskirche anschafften. Sie alle waren Kundinnen für meine billigen, gebrauchten, Kondome. Und ich kannte auch jeden Polizisten. Und jeden US-Militärpolizisten. Und jeder kannte mich. Ich war der bemitleidenswerte Bursche, der hier seine Abende verbringen musste. Ich der war fleißige Bursche, der hier die gebrauchten Kondome wusch. Und ich war einer der wenigen, in dieser rauen Welt, der zu allen Leuten gleichermaßen freundlich war.
***
1947 wird der eisenharte US-Militärgouverneur General McNarney abgelöst. General Clay wir der neue US-Militärgouverneur der US-Besatzungszone und auch der Oberkommandierende aller US-Streitkräfte in Europa. General Clay hilft den hungernden West-Deutschen.
***
Meine Bekannten, die Soldaten aus den USA, erklärten mir die Politik der Vereinigten Staaten. Die USA hatten – zusammen mit Josef Stalin – die Deutschen besiegt. Nun wurde der Verbündete von einst zum Problem. Josef Stalins Weltkommunismus bedrohte offenbar ganz Europa. Der Premierminister der Briten, Winston Churchill hatte es drastisch formuliert. Er sagte: »Wir haben das falsche Schwein geschlachtet.« Um Stalin, den Verbündeten von einst, in seine Schranken zu weisen, kam ein Krieg nicht in Frage. Napoleon und Hitler waren an den russischen Weiten und Wintern gescheitert. Der freie Westen wählte einen subtileren Weg im Kampf gegen den Kommunismus. Man setzte auf den Neid der Bevölkerung im Osten. Die neue Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der USA sollte die Ost-Deutschen neidisch machen. Deshalb wollten die Amerikaner uns West-Deutsche zügig »demokratisieren«. Und dazu mussten wir satt sein. Deshalb gab es, ab sofort Sonderrationen, Speisung von Schulkindern und erste Hilfspakete aus den USA. Dort spendete man für uns. Die Amerikaner spendeten für den besiegten Feind. Im Mai ´47 wählten die Württemberger einen ersten Landtag. Man wählte nicht die Kommunisten. Man wählte die Freunde der USA. Die Freunde von Demokratie, Freiheit und Kapitalismus. Und diese gewählten Freunde der USA brauchten Hilfe. Eine Hilfe, die sie lautstark von den USA forderten. Und dir USA half. ***1947 läuft der Marshall-Plan an: US-Außenminister George C. Marshall gibt Hilfsgelder für die Westzonen. Zum Wiederaufbau ihrer Volkswirtschaften. Unfassbare 17,4 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Der UNO-Spenden-Etat betrug - weltweit - in dreißig Jahren (1945-1975), gerade einmal 7 Milliarden Dollar. Satte West-Deutsche waren den USA wichtig. Hungernde Afrikaner interessieren die USA und die auch die UNO offenbar weniger.
***
Mit dem Marshallplan gab es erstmals Hoffnung, dass die Zeit von Hunger, Schwarzmarkt und Zigarettenwährung enden würde. Ich lerne seit Monaten Englisch und Politik. An zwei Abenden pro Woche. Von meinen Bekannten den GIs. Ich übernahm auch ihre Vorlieben und Träume: einen Vespa-Roller, dann ein Motorrad, dann ein Auto. Der Traum vom 47er-Cadillac.
Ich hörte ihre Schallplatten. Seit 1948 gab es Langspielplatten. Jazz klang für mich inzwischen gut. Gespielt wurden die LPs von einem Koffer-Plattenspieler, wie der junge Wirt, der Schäfers-Karle, einen hatte. An seiner Bude war am meisten los. Hier wechselten die meisten Dollarscheine ihren Besitzer. Beim Schäfers-Karle war es billig. Er bot Wurst, Kraut, Brot und Bier. Er verdiente gut. Die Mauern seines Hauses wuchsen schnell. Es stand direkt an der großen Hauptstätter Straße. Die Hauptstätter Straße war der ehemalige Weg zur Hinrichtungsstätte, der Haupt-Statt. Der Schäfers-Karle war jung und tüchtig. Und erfolgreich. Ein Vorbild.
***
Inzwischen war es August. Ein herrlicher Abend. Warm. Ich war sechzehn. Ich fühlte mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Nun ja, vielleicht keine Bäume. Aber Büsche. Vielleicht? Na gut, Blumen. Aber hier gab es keine Blumen. Ich hätte gerne Blumen ausgerissen und den Strauß einem netten Mädchen geschenkt. Aber hier gab es keine netten Mädchen.
Jeden D-Tag sah ich die bekannten Trümmer-Huren. Die meisten gaben mir ein paar Cent für gewaschene Kondome. Meine linkischen Versuche, die Gummidinger zu verhökern, brachten mir ein wenig Taschengeld. Es war nicht gerade frenetischer Beifall, der mir entgegen-brandete, wenn ich einer der Damen mein ärmliches Sortiment zeigte. Aber allmählich wurde ich besser im Verhandeln.
Allzu gerne hätte ich selbst ein Kondom ausprobiert. Oder wenigstens einmal, eine Frau geküsst.
Ich lehnte an einer hüfthohen Hausmauer, an der seit zwei Jahren niemand baute. Vielleicht waren die Besitzer tot. Oder aufs Land gezogen. Die alte Ingrit kam zu mir und fragte: »Hallo, Heinrich. Schätzchen, wie läuft das Geschäft?«
»Nicht so gut«, klagte ich.
Sie nahm fünf Stück für einen halben Dollar. Sie war sicher schon dreißig. Kurze hellbraune Haare. Dünn. Kein Geld für ein schönes Kleid. Nur ein geblümter Schurz. Keine Strümpfe. Hässliche braune Ledersandalen.
Ich fragte sie: »Und bei Dir? Haste Kunden.«
»Nein, noch bin ich Jungfrau«, lachte sie, »Tages-Jungfrau.«
»Ich auch«, lachte ich gequält, »aber eine echte.«
Sie sah mich von oben bis unten an. Dann lächelte sie mich an.
»Heinrich, mach´ dir keine Gedanken. Du siehst gut aus. Du wirst nicht lange Jungfrau bleiben«, machte sie mir ein Kompliment.
Ich sah sie kritisch an.
»Würdest du mich denn küssen?«, fragte ich sie.
»Huren küssen nicht«, fertigte sie mich ab.
»Und wie viel müsste ich für das andere bezahlen?«, flüsterte ich, »für Sex?«
»Geht nicht. Du bist zu jung«, sagte sie milde lächelnd, »such dir doch ein nettes Mädchen. In der Schule.«
»Die wollen so was doch nicht. Nicht einmal küssen.«
Die Hure Ingrit sah meine sehnsüchtigen Augen. Vielleicht hatte sie Mitleid. Vielleicht wollte sie auch nur etwas Nettes tun.
Sie sagte: »Komm mit Heinrich.«
Und sie nahm mich an der Hand. Sie hatte ganz warme Hände. Sie sah sich um. Wahrscheinlich nach der Polizei oder nach Bernd. Ihrem Zuhälter. Keiner war zu sehen. Ich kannte ihren Zuhälter, Bernd. Er war relativ dauerhaft schlecht gelaunt. Seine Visage war brutal. Ich fürchtete mich auch vor ihm. Sie schlüpfte vor mir in eine der Bretterhütten und zog mich hinter sich her. Sie zog die Tür zu. Was hatte sie vor? Nie wurde abgeschlossen. Bernd, der Zuhälter musste seine Ingrit jederzeit vor Gästen schützen können. Ich war alleine mit einer Hure in einer »der« Hütten. Sonnenstrahlen schossen durch die Ritzen, zu uns in den Raum. Sie lächelte mich wieder an und befahl mir: »Lass deine Hose runter. Und die Unterhose auch. Schnell.«
Ich starrte Ingrit überrascht an. Vermutlich mit offenem Mund.
»Dein Ernst?«, fragte ich ungläubig.
»Schnell!«, sagte sie.
Ich hatte keinerlei Schamgefühle. Sie schien es zu genießen, mich herumzukommandieren. Sie lachte.
»Mach schon. Jetzt die Unterhose. Schnell!«
Eine eigenartige Erregung erfasste mich. Gehorsam ließ ich die Hosen fallen. Mein Pulli hob sich langsam an. Das war mir nun doch peinlich. Unaufhaltsam strömte Blut in meinen Penis, der meinen Pulli anhob. Ingrit lächelte. Sie griff nach der Beule unter meinem Pulli. Sie legte meinen Penis frei. Sie hielt ihn in ihrer warmen Hand. »Ordentlich«, sagte sie, »für sechzehn. Und so fette Eier.«