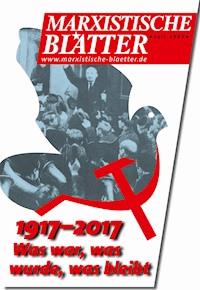
1917-2017 - Was war, was wurde, was bleibt E-Book
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neue Impulse Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Beiträgen von Michail Krjukow, Jelena und Alexander Charlamenko (Russland), Sitaram Yechury (Indien), José Reinaldo Carvalho (Brasilien), Blade Nzimande (Südafrika), Domenico Losurdo (Italien), Jerónimo de Sousa (Portugal), Hans Hautmann (Österreich) und aus der Bundesrepublik: Peter Brandt, Gerrit Brüning, Raimund Ernst, Willi Gerns, Nina Hager, Lothar Schröter
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Marxistische Blätter 3_2017
Kommentar
Eine Antwort auf »Amerikas Faust«
Lothar Geisler
In gemeinsamer Sache
»Wende zum Wachstum« organisieren
Da geht was!
Vorläufiges Ergebnis im ersten Quartal:
Abo-Kampagne »100 Plus!«
Günter Judick ist tot
Aktuelles
Viel Feind und wenig Ehr’
Mit Donald Trump scheitert der Versuch zur Stabilisierung des US-Imperiums
Klaus Wagener
Proleten, Pöbel, Professoren
Micha Brumlik sucht das reaktionäre Subjekt
Holger Wendt
Steuergeld soll private Renditen steigern
Berliner Senat will Schattenhaushalt für Schulen
Uli Scholz
Thema: 1917–2017. Was war, was wurde, was bleibt
Editorial
Gratulation zum Jubiläum der Oktoberrevolution
Michail Krjukow
Welches Russland haben wir eigentlich verloren?
Jelena und Alexander Charlamenko
Die ewig währende Bedeutung der Oktoberrevolution
Sitaram Yechury
Internationalismus und ideologischer Kampf der Bestätigung des revolutionären Wegs
José Reinaldo Carvalho
Der Sozialismus ist die Zukunft – erbauen wir sie jetzt!
Blade Nzimande
China und das Ende der »kolumbianischen Epoche«*
Domenico Losurdo
Der Sozialismus – ein Erfordernis der Gegenwart und der Zukunft
Jerónimo de Sousa
Die Russische Revolution – Ein Überblick
Gerrit Brüning
Die Revolution des Februar (März) 1917 in Russland
Hans Hautmann
Die Oktoberrevolution in der Diskussion
Vor 100 Jahren: Die Russische Revolution
Peter Brandt
Was bleibt? Woran erinnern?
Raimund Ernst
Was lehren 100 Jahre seit dem Oktober 1917?*
Nina Hager
Musste der Sozialismus in Russland scheitern?
Willi Gerns
NATO jagt Roter Oktober
Die Ost-West-Studie der NATO 1978 – das strategische Handlungsdispositiv zum Sieg im Kalten Krieg
Lothar Schröter
Erklärung des Friedensratschlags zum Giftgaseinsatz in Syrien
Völkerrechtswidriger US-Angriff
Positionen
Jüdisches Gemeindeleben in der DDR – Teil 1
Das Verhältnis zwischen der jüdischen Gemeinde, der jüdischen Bevölkerung und dem sich konstituierenden Staatsapparat der SBZ/DDR in den Jahren 1945–1950
Ralf Jungmann
Geschlechterverhältnisse bei Marx und Engels
Eine kritische Auseinandersetzung (Teil 2)
Manfred Scharinger
Geschichte als Tauschobjekt für Regierungsbündnisse?
Ludwig Elm
Der rote Verleger Giangiacomo Feltrinelli
Gerhard Feldbauer
Leserzuschrift
Wer demonstriert da gegen wen?
Andreas Wehr
Erwiderung zu »Wer demonstriert da gegen wen?«
Patrik Köbele
Rezensionen
Forum marxistische Erneuerung und IMSF e.V. (Hrsg.): Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung: 1917–2017 (Raimund Ernst)
Beate Landefeld, Revolution (Gerrit Brüning)
Rolf Hecker, Angelika Limmroth (Hrsg.): Jenny Marx. Die Briefe (Cristina Fischer)
Angelika Limmroth: Jenny Marx. Die Biographie (Cristina Fischer)
Klaus Müller: Geld – Von den Anfängen bis heute(Holger Wendt)
Hermann Klenner: Recht, Rechtsstaat und Gerechtigkeit. Eine Einführung (Anna Kunz)
Dieter Nake: Portugiesischer April. Die Nelkenrevolution in Portugal 1974/75 (Urte Sperling)
Es schrieben diesmal
Impressum
Kommentar
Eine Antwort auf »Amerikas Faust«
Lothar Geisler
»Die BRICS-Staaten sind wie fünf Finger, ausgestreckt kurz und lang, aber zusammengeballt eine machtvolle Faust«, zitierte der chinesische Außenminister Wang Yi im März auf einer internationalen Pressekonferenz seinen Präsidenten Xi Jinping. Dieses Jahr geht das zu BRICS locker zusammengeschlossene Staatenbündnis aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in sein zweites Jahrzehnt. Den diesjährigen Vorsitz hat die VR China. Das Land ist im September Gastgeber des 9. BRICS-Gipfeltreffens.
Die Entwicklung der Zusammenarbeit habe in den vergangenen Jahren Höhen und Tiefen gehabt und jedes Mitglied stehe vor eigenen Herausforderungen, so Wang Yi. Aber wenn die Mitglieder zusammenstehen, werde der BRICS-Mechanismus seinen Glanz nicht verlieren, sondern zukünftig heller erstrahlen.
In Vorbereitung des 9. Gipfeltreffens solle nicht nur gemeinsam eine Bilanz bisheriger Erfahrungen gezogen, sondern konkrete »BRICS-Pläne« geschmiedet werden für Frieden, Entwicklung und Zusammenarbeit auf breiterer Basis. Unter dem Label »BRICS-Plus« sollen Dialog und Partnerschaft mit anderen Schwellen- und Entwicklungsländern des Südens ausgebaut werden. Ob daraus ein stärkerer (antiimperialistischer) Block werden kann, wird sich zeigen. Fest steht, der Freundeskreis von BRICS soll erweitert werden und zu »der einflussreichsten Plattform für die Kooperation des Südens in der Welt werden«. Soweit der Plan.
Er ist unübersehbar auch eine Antwort auf »Amerikas Faust«, auf US-Protektionismus, ungebrochene Weltmachtambitionen, auf Kriege und Wirtschaftskrieg. Insofern: wirklich alles Gute für das zweite Jahrzehnt! Und der Tipp an alle globalisierungskritischen Gipfelstürmer, die marxistischen eingeschlossen: Genauer hinschauen, wer da zu welchen Zwecken und mit wem bei Gipfeln zusammensitzt, egal ob mit 5, mit 5Plus oder mit 7, 8 und 20 Staatenlenkern. Wobei die Frage berechtigt ist: Warum soviel zusätzliches Geld verballern für so viel Hochsicherheitsfirlefanz, bei dem meist wenig rauskommt? Die gleiche soziale Sicherheit für alle (!), unabhängig von Rasse, Klasse, Geschlecht, Glauben oder Nationalität und die Staatenlenker des Westens müssten sich nicht hinter Panzerglas, Stacheldraht und Bodyguards verschanzen.
Zugegeben: BRICS ist nicht der »Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe« (RGW). Der ist lange tot und mit dem Sozialismus in Europa untergegangen. Die Versuchsanordnung: Aufbau von solidarisch-sozialistischen Wirtschaftsbeziehungen in einem vom kapitalistischen Weltmarkt geschützten Raum, wird es nie mehr geben. Die Vision von einer anderen, gerechteren, vor allem aber friedlichen Welt(wirtschafts)ordnung, zu der die Oktoberrevolution vor 100 Jahren den Startschuss gab, bleibt aber lebendig. Und so schwer sie auch zu realisieren ist: sie ist wirklich alternativlos.
In gemeinsamer Sache
»Wende zum Wachstum« organisieren
2017/2018 sind für uns MarxistInnen reich an wichtigen Jubiläen, weit über die »100 Jahre Oktoberevolution« hinaus, die im Zentrum dieses Sonderheftes stehen. Wir haben uns allerhand vorgenommen. Natürlich inhaltliche Beiträge zur »Erbeaneignung«, d.h. Nutzbarmachung für Gegenwart und Zukunft. Vor allem aber auch organisatorische Maßnahmen. Denn die umfassende Stärkung der Marxistischen Blätter ist unsere wichtigste Zukunftsinvestition. Dabei reicht es nicht, den Rückgang zu stoppen. Eine Wende zum Wachstum ist nötig: in der Abo-Entwicklung, beim Buchversand und bei den Spenden, die wir zur Tilgung von Darlehen dringend brauchen. So sieht es die personell verstärkte Gesellschafterversammlung des Neue Impulse Verlages. Und darauf orientiert ihr Ende Januar beschlossener »Rahmenarbeitsplan 2017/18«, der natürlich nur als gemeinsame Kraftanstrengung von Redaktion, Herausgeberkreis und aktiven LeserInnen der Marxistischen Blätter umzusetzen ist.
Da geht was!
Der Kinostart des beeindruckenden Films »Der junge Karl Marx« von Regisseur Raoul Peck war für uns Anlass für den Start einer Werbeoffensive. Unser Verlagsflyer »Wir sind Marx« lag der UZ, den Marxistischen Blättern und dem »Neuen Deutschland« bei. MBl-Leser*innen aus 15 Städten haben zusätzlich 1500 Flyer für die Verteilung vor Kinos bestellt.
Vorläufiges Ergebnis im ersten Quartal:
35% Zuwachs beim Buchversand über unseren neuen Shop; die 12 000 Euro-Marke übersprungen. Auch der Einzelheftverkauf macht Mut. Aktueller Stand: »Gesundheitsmarkt – wie krank ist das denn?« (235 verkaufte Hefte), »Amerikas Faust« (bisher 45). 25 neue Abonnent*inn*en wurden gewonnen (13 befristete Probe-Abos). Ein mutmachender Anfang.
Abo-Kampagne »100 Plus!«
Mit dieser Ausgabe starten wir unsere Abo-Kampagne »100 Plus!« Das anspruchsvolle Ziel ist »2017/18« erstens von jeder MBl-Ausgabe mindestens 100 Exemplare zusätzlich zu verkaufen und am Ende real 100 Abos mehr zu haben, als heute. Zielzahl also: 2000 verkaufte Exemplare pro Ausgabe. Wir bitten um heftige Unterstützung und Nutzung der beigelegten Abo-Karte. Denn niemand wirbt überzeugender, als überzeugte Leser*innen der Marxistischen Blätter.
»Alle blicken nach vorn, und das ist gut so: aber nicht umsonst zählte zu den Göttern der alten Römer auch ein Janus. Janus hatte zwei Gesichter, nicht weil er zwiegesichtig war, wie man häufig hört, nein, er war weise: Das eine Gesicht war der Vergangenheit zugekehrt, das andere der Zukunft.«Ilja Ehrenburg
Günter Judick ist tot
Wir haben einen sachkundigen Historiker, Autor und Referenten, weitsichtigen Genossen und klugen Ratgeber verloren und werden jetzt ohne ihn zeigen müssen, was wir von ihm und seiner Kommunistengeneration gelernt haben.
Redaktion Marxistische BlätterMarx-Engels-StiftungNeue Impulse Verlag
Die Beiträge einer gemeinsamen Geschichtstagung zu Ehren von Günter Judick werden wir veröffentlichen. Genauere Informationen in der UZ oder unter http://www.marx-engels-stiftung.de oder facebook.com/MarxBlaetter.
Aktuelles
Viel Feind und wenig Ehr’
Mit Donald Trump scheitert der Versuch zur Stabilisierung des US-Imperiums
Klaus Wagener
Donald Trump ist schon nach wenigen Wochen in einer, für einen US-Präsidenten ungewöhnlich miserablen Lage. Bis auf die Aufrüstung scheint seinen Projekten wenig Glück beschieden zu sein. Der »Muslim Ban« scheiterte zweimal vor US-Bundesgerichten. Selbst die unumstritten zentrale Propaganda-Kampagne der Republikaner, die Rücknahme des faktisch durchaus nicht zufriedenstellenden Obamacare, konnte der Präsident nicht durch den von seiner eigenen Partei dominierten Kongress bringen. »Trumpcare« hätte allerdings eine weitere Verschlechterung des ohnehin miserablen US-Gesundheitswesens bedeutet. So dass es für seine Gegner argumentativ nicht sonderlich schwer war, ihm eine empfindliche Niederlage beizubringen. Machtpolitisch ist dieser Schachzug der Republikaner, den eigenen Mann komplett im Regen stehen zu lassen, eine Art Kumpanei-Angebot an die Demokraten.
Mit welch harten Bandagen gekämpft wird, zeigte sich schon bei der Demontage von Trumps Sicherheitsberater Michael Flynn. Trump hatte beileibe keine Revolutionsregierung zusammengestellt, sondern klassische Exponenten der »Kommandohöhen« berufen, Spitzenleute aus Geheimdienst und Militär, von Big Money und Big Oil. Mehr Kotau vor der wirklichen Macht geht kaum. Auch Drei-Sterne-General Flynn hatte eine steile Karriere an den Brennpunkten der US-Kriege, Grenada, Haiti, Afghanistan, Irak, und in den Geheimdiensten, National Intelligence, Defense Intelligence Agency (DIA), hinter sich. Flynn war allerdings durch einige unbequem-kritische Äußerungen bspw. gegen Folter und den Drohnenkrieg aufgefallen, und hatte sich bei einem Dinner mit dem Ultrabösewicht Putin vom Sender RT fotografieren lassen. Im extrem russophob aufgeheizten, offiziellen Washington wurde dem Sicherheitsberater schließlich ein banales Telefonat mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak zum Verhängnis. Dass das Telefonat illegal vom Geheimdienst abgehört wurde, ist für dieMainstreampresse natürlich genau so inexistent wie ein Lauschangriff der Dienste auf dieTrump-Zentrale (eine Art Watergate II).
Die Machtrebellion der MIMIC (Military Industrial Media Intelligence Complex)
Dass ein politischer Außenseiter wieTrump gegen die Macht der Bewusstseinsindustrie, gegen den Darling des US-Establishments, »Killary« Clinton, die Protagonistin des radikalisierten »Weiter so!« gewinnen konnte, gilt als irgendwie illegitimer Akt der Insubordination. Trump symbolisiert die tiefe Unzufriedenheit im Land. Seither herrscht eine Art verbissener »Bürgerkrieg« zwischen der gewählten Regierung und dem eigentlich herrschenden Machtapparat, den letzterer schon aus Gründen der machtpolitischen Selbstbehauptung für sich zu entscheiden zu müssen glaubt.
Ex-CIA- und Ex-NSA-Chef Michael Hayden hatte freimütig von einem »Krieg der permanenten Regierung gegen die Administration« gesprochen. Dieses »permanent Government«, dessen Chef er selbst auch jahrelang war, das sind natürlich die Guten. Wir haben ein »friendly permanent Government«, keinen bösen »Deep State«. Und dieses »permanent Government« sei geboten weil, mal im Klartext formuliert, die Laienspielertruppe, die da ins Amt komme, ja keine Ahnung habe von der komplizierten Lage und ihren Handlungsnotwendigkeiten.
Diese, schon von J. Edgar Hoover bekannte Haltung, »mir ist egal, wer unter mir Präsident ist«, vertrat nun auch FBI-Chef James Comey öffentlich vor dem Kongress. Das FBI überwache das Weiße Haus wegen des Verdachts »illegaler Kontakte mit Russland«. Comey versuchte dieTrump-Mannschaft mit dem angeblichen russischen DNC-Hack in Verbindung zu bringen: Es hätte eine Konspiration des Trump-Teams zur fraglichen Zeit mit den Russen gegeben. Das eine ohne Beleg wie das andere, aber in den Medien als Fakt gehandelt. Die entscheidende Botschaft: Der Inlandsgeheimdienst steht kontrollierend über dem eigenen Präsidenten.
Die »illegitime« Wahl von Donald Trump hat den militärisch-industriellen Komplex aus der Deckung gezwungen. Wie sich spätestens in diesem »Bürgerkrieg« zeigt, ist dieser Machtapparat mit »militärisch-industriell« nicht hinreichend beschrieben. Zumindest die medialen und geheimdienstlichen Sektoren sind hinzuzuzählen. Im Englischen: MIMIC, Military Industrial Media Intelligence Complex. Das dürfte eine wichtige Charakterisierung des operativ-steuernden imperialen Machtapparates sein, des »permanent Government«, das seit einem Vierteljahrhundert unbeschränkter Herrschaft, Millionen von Toten zu verantworten und große Teile des Globus in Schutt und Asche gelegt hat.
Dieser MIMIC hat sich keineswegs mit Donald Trump abgefunden. Die verschiedenen Varianten für ein Impeachment werden offen diskutiert. Die unverblümte Attacke von FBI-Chef Comey signalisiert, dass die Messer bereits gewetzt werden. Viele in der Republikanischen Partei, so zeigt die Blockade im Kongress, könnten auch gut mit einem Präsidenten Mike Pence leben.
Der sozioökonomische Verfall
Wie gering die Handlungsspielräume des US-Präsidenten (geworden) sind, zeigt sich am Haushaltsentwurf »2018 Budget Blueprint«. Der einzige relevant expansive Posten ist die Aufstockung des Rüstungs- und Kriegsbudgets um 10 Prozent. Als »Gegenfinanzierung« werden die Ausgaben für Soziales, Landwirtschaft und Umweltschutz zum Teil drastisch zusammengestrichen. Das dürfte bei vielen Trump-Wählern für ein unangenehmes Erwachen sorgen, die von staatlichen Programmen abhängig sind und nun erheblichen Kürzungen entgegensehen.
Die wesentlichen Versprechen von Trumps »America first!«-Kampagne, Wirtschaftsaufschwung, Industriearbeitsplätze (aktuell 12,2 Mio. bei einer Bevölkerung von 324,7 Mio. und 14,6 Mio. realen Arbeitslosen), Abbau des gigantischen Handelsbilanzdefizits (746 Mrd. Dollar/Jahr) und die Billionenschwere Sanierung der maroden Infrastruktur rücken damit in immer weitere Ferne. Im Budget-Entwurf 2018 ist jedenfalls solche Schwerpunktsetzung nicht ansatzweise zu erkennen.
Die in der neoliberalen Gegenreform durchgesetzte Privilegierung individueller Partialinteressen (Das private Nettovermögen ist auf 92,8 Bio. Dollar explodiert. Flow of Funds, 1/2017) hat zur großflächigen Verbreitung von Armut (42,5 Mio.), der Implosion des Mittelstandes, zu einem dramatischen Verfall öffentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge, der Infrastruktur, der Verkehrs-, Gesundheits-, und Bildungseinrichtungen geführt. Die gesamtstaatliche Verschuldung ist unaufhaltsam auf 23 Bio. Dollar geklettert. Die Kriegs- und Krisenpolitik des Friedensnobelpreisträgers Obama hat pro Jahr im Schnitt ein Minus von 1.250 Mrd. Dollar gebracht.
Die BIP-Werte (18,9 Bio. Dollar) reflektieren aufgrund der zweifelhaften Konstruktion dieses »globalen« Indikators mit seinen parasitären und destruktiven Anteilen den inneren Verfall des Imperiums nur bedingt. Betrachtet man die breit gefasste Industrieproduktion, so stieg sie von 1960 bis zur Jahrtausendwende auf etwa das Fünffache. Sie verharrt aber seither auf etwa diesem Niveau. Die Dotcom- und die Immobilienblase sowie die Geldproduktion der FED haben die Werte noch einmal etwas nach oben getrieben. Allerdings mit den folgenden krisenhaften Einbrüchen. Seit dem Ende der Aufkaufprogramme der Federal Reserve ist die stagnierende Seitwärtsbewegung unverkennbar. Aber auch hier deutet sich die bedrückende Wirklichkeit des Rust Belt, des Exports der gutbezahlten Industriearbeitsplätze, der endemischen Verbreitung von Arbeitslosigkeit, Billig-, Teilzeit- und Aushilfsjobs nur ansatzweise an.
Wie schon zu Beginn des Imperialismus zeigen sich gravierende Interessengegensätze auch innerhalb der herrschenden Klasse: Das glänzend profitierende, international agierenden Finanzkapitals der Multis und der Wall Street, vertreten durch das Polit-Establishment und den MIMIC auf der einen Seite und die eher national orientierten Kapitalfraktionen unterstützt durch die breite Masse der Unzufriedenen, vorwiegend der deprivierte Mittelstand auf der anderen Seite. Vor dem Hintergrund der Niederlage der Großen Alternative verschärft sich dieser Konflikt in der Phase der neoliberalen Gegenreform und ihrer Aufkündigung der sozialchauvinistischen Privilegierung des Reformismus. Die Zerschlagung reformistischer Gegenmachtpositionen, die in weiten Teilen eine freiwillige Selbstaufgabe zugunsten eines, nur noch für Kernbelegschaften lukrativen Co-Managements war, hat eine linksreformistische Alternative zum neoliberalen Krisenmodus schon machtpolitisch derartig irreal erscheinen lassen, dass sie noch nicht einmal programmatisch gefasst werden konnte.
Damit haben sich die USA wohl von der Perspektive eines großen Infrastruktur- und Konjunkturprojektes verabschiedet. Wie es das in den 1930er Jahren von der Public Works Administration (PWA) geleitete Infrastrukturprogramm (mehr als 50.000 Projekte), beispielsweise das Tennessee-Valley-Großprojekt, der ökonomischen und infrastrukturellen Erschließung eines Gebietes von der Größe Englands, oder (schon eine Dimension kleiner) Dwight D. EisenhowersInterstate Highway System in den 1950er Jahren darstellte. Die neoliberale Selbstentmündigung zugunsten der Allmacht des »Marktes« und die steuerliche Demontage des »bevormundenden Staates« lassen für derartige Projekte keinen Raum.
Dass anderes möglich ist, zeigt die nachholende Industrialisierung Chinas, die selbst Trumps kühnste Billion-Dollar-Infrastruktur-Phantasie vergleichsweise mickrig erscheinen lässt. Allein das Projekt einer neuen Seidenstraße »One Belt, One Road« (OBOR), von Staatschef Xi Jinping 2013 initiiert, plant nicht weniger als die infrastrukturelle Durchdringung des Eurasischen Kontinents und Ost-Afrikas bis weit nach Europa hinein. Straßen, Eisenbahnlinien, Flughäfen, Häfen, Schifffahrtsrouten, Kanäle, Pipelines u.v.a.m. Es wird die Einbeziehung von bis zu 60 Staaten und ein Volumen bis zu 8 Bio. Dollar diskutiert. Eine der institutionellen Stützen des Projektes ist die Shanghai Corporation Organisation (SCO), die mit dem voraussichtlichen Beitritt von Indien und Pakistan in diesem Jahr die bevölkerungsreichsten Staaten des Globus und wohl auch die größte ökonomische Dynamik repräsentiert. Wie lange sich vor diesem Hintergrund das für das Imperium zentrale Dollar-Privileg aufrechterhalten lässt, ist offen.
Als Ganzes gesehen erscheint daher der US-Imperialismus, in einer historischen Krisensituation in seinen eigenen Widersprüchen gefangen, erstaunlich unfähig zu einer Konsolidierungsbewegung. Stattdessen setzen die herrschenden Kapitalfraktionen weiter auf die finanzkapitalistische Aneignung der globalen Mehrwertproduktion sowie auf seine machtpolitische Durchsetzung durch die globale Präsenz des »Großen Knüppels« als Inkassobüro der letzten Instanz. Donald Trump hat im Gegensatz zu seinen Vorgängern einige der Probleme zumindest adressiert und sich schon dadurch den Zorn des MIMIC zugezogen. Natürlich ist seine Kritik klassengebunden borniert und zeigt wenig realistische Reformansätze. Aber auch Franklin Delano Roosevelt war Patrizier, Mitglied der reichen Oberschicht und hatte gegen den massiven Widerstand der »Geldwechsler« der Wall Street zu kämpfen, die zum Machterhalt bereit waren die USA in den Konkurs zu treiben. Aber das US-Kapital hat keinen zweiten FDR hervorgebracht. Die Geschichte wiederholt sich wieder einmal als Farce.
Aufrüstung, Kriegsfähigkeit,Russland, China, Syrien
Durch den ökonomischen Niedergang des Imperiums und die katastrophalen Resultate seiner 6-Billionen Dollar teuren Interventionspolitik seit »9/11«, sowie die innenpolitische Blockade seiner Führung schon unter Obama haben die zentrifugalen Kräfte an Handlungsspielraum gewonnen. So ist die Initiative in »Greater Middle East« weitgehend auf regionale Mächte, sunnitische bzw. schiitische Staatengruppen, übergegangen. Offen terroristische Gruppierungen wie Daesh bzw. al Qaida sind in der Lage, größere Territorien über längere Zeiträume zu kontrollieren. Selbst der Erzfeind Russland ist in der Lage, eine entscheidende Rolle im Syrienkrieg zu spielen. Ähnliches gilt für China im Südchinesischen Meer.
Das Imperium hat angesichts progressiver Schwäche und schwindender sozialer Integrationskraft seit der Dotcom-Krise mit einem verstärkt globalen Interventionismus und einer strategischen Aufrüstung reagiert. Die ohnehin immensen Rüstungs- und Kriegsbudgets haben sich seither in etwa verdoppelt. Unter Präsident Obama ist eine rund 1 Billion Dollar teure Kompletterneuerung der gesamten atomaren Triade (Bomber, Raketen, Schiffe und U-Boote) auf den Weg gebracht worden. Die US-geführte NATO hat ihr Territorium bis an die Grenzen Russlands vorgeschoben und in der Ukraine einen prowestlichen, teilweise profaschistischen Putsch organisiert. Die imperiale Macht hält den Globus mit rund 800 Militärstützpunkten unter Kontrolle. Ihre globalen Spionagenetzwerke sind darauf aus, alle digital verfügbaren Informationen zu sammeln und zu speichern.
Die nun von Donald Trump projektierte Erhöhung des Rüstungshaushaltes um knapp 10 Prozent dürfte daher vielleicht eines der wenigen seiner Vorhaben sein, die gelingen könnten. Damit wäre der Rüstungshaushalt zwar noch längst nicht auf die Spitzenwerte der Obama-Jahre angestiegen. Er kommt aber, trotz der wieder einmal erreichten Schuldenobergrenze, den Forderungen des Pentagon deutlich entgegen. Kriegsminister James Mattis hat erneut Russland und China als größte Bedrohung der Weltordnung seit dem Zweiten Weltkrieg markiert, auch Nordkorea und Iran sind im Fadenkreuz. Mattis hat die auch von Trump kritisierten, exorbitant teuren Rüstungsprogramme (F35 Fighter) als notwendig gefordert. Die US-Kriegsführung in Syrien muss zwar die Erfolge der russisch gestützten SAA, ebenso wie die türkischen antikurdischen Partialinteressen realisieren, versucht aber mit der Entsendung weiterer eigener Bodentruppen gewissermaßen zu retten was zu retten ist. Diese Ausweitung der US-Kriegführung in Syrien und in Irak (Mosul) wie auch im Drohnenkrieg, zeigt, dass auch dieTrump-Administration sich keinesfalls aus strategischen Gebieten zurückzieht, sondern wie auch von Mattis bestätigt, eine Lösung aus der Position militärischer Stärke sucht, im Klartext gegen jeden Widerstand Krieg zu führen bereit ist. Auf diese Weise kann der (durchaus erkannten) Überdehnung der Kräfte des Imperiums wohl kaum begegnet werden.
Innerimperialistische Positionskämpfe, Protektionismus vs. Freihandel
Mit Beginn der Präsidentschaft Trump hat die Führung der Bundesrepublik und der EU eine erstaunliche Kehrtwende hingelegt. Als habe man in Berlin nur auf einen Watschenmann im Weißen Haus gewartet, sind die deutsch-europäischen Eliten mit einer beleidigenden Rhetorik auf Distanz zu den USA gegangen, die noch vor Monaten als schlimmster Antiamerikanismus gescholten worden wäre.
Wie im Falle von Erdogan, Le Pen und Putin, gilt es auch bei Trump das propagandistische Potential einer Negativfigur im Sinne der Re-Integration auch linker kapitalismus- und globalisierungskritischer Kräfte in das neoliberale Gesamtkonzept zu nutzen. Die neue integrative Großerzählung heißt: Die Mächte der Finsternis, die rassistischen, fremden- wie muslimfeindlichen, homophoben, patriarchalischen Rechtspopulisten bedrohen unsere freiheitliche, liberale, weltoffene, political-, gender-, LGTB- und öko-correcte Gesellschaft. Und unser natürliches Recht andere Länder mittels Kapitalexport und »Freihandel« auszubeuten. Die liberale Gesellschaft, deren Frontfrauen Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Killary Clinton heißen, muss sich natürlich schwer bewaffnen, am besten mit Atomwaffen, weil der unberechenbare Finsterling im Weißen Haus die NATO aufgekündigt hat. Eine an Absurdität nicht zu überbietende Idee, die aber nichtsdestotrotz zu einer neuen Aufrüstungswelle herhalten muss.
Seit Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werden muss, ist der Um- und Aufbau der Bundeswehr zu einer global agierenden Interventionsarmee im vollen Gange. Die Ambitionen sind groß, das Potential weniger. Noch. Um tatsächlich dem Imperium ernsthaft Konkurrenz machen zu können, wäre eine politisch-militärische Integration zumindest der EU unabdingbar. Davon ist man seit dem egoistischen austeritätspolitischen Management der Euro-Krise und dem Austritt der Briten jedoch weiter entfernt denn je. Nichtsdestotrotz laufen die Rüstungsplanungen auf Hochtoren, wie auch die mühsam errungene »Erklärung von Rom« vom 25.3.2017 und die Entschließung des EU-Parlaments vom 16.3.2017 beweist. Hier wird ganz im Wilhelminischen Sinne, eine »entscheidende Rolle in der Welt« und zusätzliche Rüstungsausgaben von 100 Mrd. Euro gefordert. Und wie zuletzt bei Franz-Josef Strauß ist auch wieder die deutsche Bombe in der Debatte.
Allgemeine Krise des Kapitalismus?
Das Imperium, das imperialistische Weltsystem steckt in einer tiefen Krise. Eine Krise, die durch die nun ein Jahrzehnt währende kapitalistische Überakkumulationskrise und die katastrophalen Ergebnisse des imperialen Interventionismus vor allem in »Greater Middle East« ausgelöst wurde, deren Wurzeln aber in der neoliberalen Gegenreform, dem neokonservativen Backlash der Reagan/-Thatcher-Ära und natürlich in der Widersprüchlichkeit des Kapitalismus selbst zu suchen sind. Diese umfassende Krise der Systemparteien, der Systemmedien, der Aufstieg der Regionalmächte, der Rechtspopulisten, der Verfall der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssysteme, der Infrastruktur, der staatlichen Daseinsvorsorge, die systematische Entzivilisierung ist eine tiefe Krise des Washingtoner Consensus, des aktuellen Verwertungsmodus eines entgrenzten Kapitalismus. Es ist eine Krise der großen neoliberalen Legitimationserzählung, die nun beginnt ihr wahres brutal-sozialdarwinistisches Gesicht zu enthüllen.
Geostrategische Vordenker wie Zbigniew Brzezinski oder Ex-Stratfor-Chef George Friedman haben den ganzen Zynismus imperialer Machtausübung offen dargelegt. Für sie ist der Interventionismus eine positiv gedachte Notwendigkeit, die sich aus dem Exzeptionalismus der USA, der Sendungsmission eines global verstandenen Manifest Destiny ergibt. Daran gibt es Zweifel, zunehmend auch in den kapitalistischen Metropolen. Zweifel, die in Zeiten des Internet von der Bewusstseinsindustrie nur schwer unter Kontrolle gebracht werden können. Die Bestrebungen zur Kontrolle des Netzes sind im vollen Gange.
Proleten, Pöbel, Professoren
Micha Brumlik sucht das reaktionäre Subjekt
Holger Wendt
Zumindest einen positiven Effekt hat der Wahlsieg von Donald Trump: Die tintenverarbeitende Industrie kann sich über Beschäftigungsmangel nicht beklagen. Auch Micha Brumlik hat seinen Füllfederhalter gezückt und der staunenden Öffentlichkeit die wahren Schuldigen präsentiert. Nicht nur die Schuldigen an Trump, sondern die an Le Pen, Wilders, AfD, FPÖ et al. gleich mit. Schuld sind, wer hätte das geahnt, die Arbeiter. »Vom Proletariat zum Pöbel: Das neue reaktionäre Subjekt« lautet die Überschrift seines Aufsatzes in den Blättern für deutsche und internationale Politik (1_2017). Lesen kann man dort Sätze wie diesen: »Heute ist zu beobachten, dass die vermeintlich zur Revolution berufene Klasse, eben die Arbeiterklasse, selbst zum Kern jener politischen Kräfte geworden ist, die Marx und Engels im Manifest als ›Reaktionäre‹ bezeichnet hatten.«
Seine Beobachtung nimmt Brumlik zum Anlass, den Marxismus einmal mehr zu erledigen. Das Anwachsen reaktionärer Strömungen innerhalb des Proletariats zerstöre die naiven Hoffnungen, die Marx und seine Nachfolger in diese Klasse gesetzt hätten.
»Somit signalisiert Trumps Sieg das diesmal wirklich unwiderrufliche Ende einer politischen Utopie, die kein Geringerer als Karl Marx vor gut 150 Jahren verkündet hatte.«
Diesmal ist das Ende unwiderruflich. Wirklich unwiderruflich. Wenn nicht sogar wirklich unwiderruflich unwiderruflich.
Um es vorab zu sagen: Micha Brumliks Text ist beeindruckend. Was er vorführt ist phänomenal, atemberaubend, von den Socken reißend. Auf den wenigen Seiten seines Aufsatzes haut das intellektuelle Maschinengewehr einen Chefdenkernamen nach dem andren raus: Marx, Engels, Hobsbawm, Lukács, Mao, Adorno, Marcuse, Eribon, Gorz, Kracauer, Nachtwey, Dugin, Beck, Schelsky, Milanović, Fichte, Heidegger, Hegel. Wäre Namedropping olympische Disziplin, das Gold wäre Brumlik nicht zu nehmen. Leider schlägt Quantität nicht immer in Qualität um, sondern zuweilen in deren Ermangelung. Die benannten Denker werden eben dies: benannt. Eine hinsichtlich der Problemstellung gewinnbringende Darstellung oder auch nur näherungsweise angemessene Skizzierung ihrer jeweiligen theoretischen Ansätze ist Brumliks Sorge nicht. Die Positionen, die er den angeführten Marxisten unterschiebt, entsprechen weniger deren tatsächlichen Auffassungen als den Vorurteilen, die der deutsche Halbbildungsbürger bezüglich dieser Auffassungen pflegt. Über Karl Marx lernen wir, er war Utopist, der sich die Verwirklichung seiner Utopie von einem als revolutionär missverstandenen Proletariat erträumte. Unterfüttert wird dies mit zwei Zitaten aus dem Kommunistischen Manifest – jener Schrift, die, weit davon entfernt eine Utopie zu formulieren, die Abkehr des Bundes der Kommunisten vom utopischen Sozialismus markierte. Zitiert wird die Schlussfolgerung, die das revolutionäre Potenzial der Arbeiterklasse konstatiert. Nicht zitiert wird die Begründung dieser Folgerung. Nicht zitiert werden Stellen, in denen Marx und Engels die Verwirklichung des revolutionären Potenzials der Arbeiterklasse nicht als den Arbeitern angeborene Eigenschaft, sondern als politische Aufgabe beschreiben. Nicht erwähnenswert ist Brumlik der Gedanke der »Organisation der Proletarier zur Klasse«, die im Marxismus zentrale Unterscheidung von Klasse an sich und Klasse für sich. Schon gar nicht angeführt werden die Stellen, an denen das Manifest auf die Gefahr reaktionärer Entwicklungen innerhalb des Proletariats hinweist. Nachvollziehbar: wer Marx und Engels mit dem Verweis auf die Existenz solcher Entwicklungen als wirklichkeitsfremde Utopisten abstempelt, der ist gut beraten, ihre diesbezüglichen Aussagen zu beschweigen. Dahinter steckt Methode: Alles, was Zweifel an Brumliks simpel gezeichneter Karikatur marxistischer Auffassungen wecken könnte, fällt dezent unter den Tisch.
Für Marx, wie für Engels, wie für Lenin, wie für Lukács, wie für so ziemlich jeden anderen marxistischen Theoretiker von Rang, war das Proletariat eine progressive, eine revolutionäre Klasse, wenn und insofern es seinen objektiven Interessen gemäß handelte. Um diese Interessen zu erkennen, um ihnen gemäß handeln zu können, bedarf es entsprechender Organisationen. Ohne Klassenorganisationen, die wissenschaftliche Erkenntnis in zielgerichtete materielle Gewalt übersetzen, sinkt das Proletariat ab zur bloß leidenden Klasse, verelendet materiell wie geistig, wird wehrloses Ausbeutungsobjekt, Spielball feindlicher Interessen, mehr oder weniger williges Kanonenfutter der konkurrierenden Fraktionen der Bourgeoisie. Diese im Marxismus tausendfach formulierte Position stört Brumliks opportune Erzählung von der Naivität der Marxisten und ihrer diesmal wirklich unwiderruflich gescheiterten Utopie. Folglich bleibt sie unerwähnt.
Mut zur Lücke beweist Professor Brumlik nicht allein im Bereich der Philologie. Seine politischen Betrachtungen sind gleichfalls, sagen wir: exklusiv. Partielle Erfolge der Trump-Kampagne unter männlichen weißen Arbeitern und Arbeitslosen des zunehmend deindustrialisierten Rust Belt hebt er hervor. Das Phänomen Bernie Sanders und die soziale Herkunft seiner Unterstützer sind ihm der Rede nicht wert. Erst recht nicht diskutiert wird die Frage, was sich die arbeitende Bevölkerung von einer weiteren Clinton-Administration hätte erhoffen sollen. Von einer Kandidatin, die nicht einmal den Anschein zu erwecken versuchte, von ihr sei eine weniger kapitalfreundliche, weniger arbeiterfeindliche, weniger bellizistische Politik zu erwarten als von ihren Vorgängern. Der Zusammenhang zwischen den reaktionären Protagonisten des bis dato hegemonialen Neoliberalismus und jenen noch reaktionäreren Figuren, die sich als Alternative zu ihnen inszenieren, bleibt ausgeblendet. Gar auf die Einsicht zu hoffen, dass letztere nicht Gegenteil der ersteren sind, sondern Gegenstück, hieße, den Optimismus über die Schwelle der Narretei zu treiben.
Kernstück der Brumlikschen Erzählung ist die Identifizierung der sogenannten Globalisierung als treibende Kraft der proletarischen Regression: »Offensichtlich führt die von Marx und Engels beschriebene Globalisierung eben gerade nicht zur Aufklärung der ohnehin schrumpfenden Arbeiterklasse, sondern zu deren reaktionärer Regression. Marx und Engels konnten nicht ahnen, dass ihre eigenen profunden Einsichten in jenen Prozess, den wir heute als Globalisierung bezeichnen, das Ende ihrer politischen Utopie besiegeln würden.«
Ein pingeliger Leser könnte Professor Brumlik auf den Unterschied zwischen der Marxschen Analyse der Herausbildung des Weltmarktes und dem neoliberalen Kampfbegriff ›Globalisierung‹ aufmerksam machen. Auch könnte er auf einer Klarstellung der Verwendung des Begriffs Arbeiterklasse insistieren beziehungsweise auf den empirischen Nachweis ihres Schrumpfens. All dies wäre gar zu kleinlich; die Fundiertheit von Brumliks Zentralthese ist unwichtig, worauf es ankommt ist ihre Nutzanwendung im Geiste der Totalitarismusdoktrin. In kühnem Bogen wird die Ablehnung des im Zuge marktradikaler Freihandelspolitik durchgeführten sozialen Kahlschlags und des Deregulierung getauften Großangriffs auf soziale und demokratische Errungenschaften in eins gesetzt mit nationalistischem Mief, mit der Sehnsucht nach Obrigkeitsstaatlichkeit, mit Faschismus.
»Wie aber sehen die Antworten auf diesen Untergang der Arbeiterklasse aus? Das Fatale daran: Heute werden sich die Reaktionen der Rechten und vieler (Traditions-)Linker immer ähnlicher. Ihre Antworten entsprechen strukturell in nicht wenigen Fällen jenen Wirtschaftsprogrammen, mit denen faschistische Länder vor etwa achtzig Jahren die sozialen Krisen ihrer Länder beheben wollten.«
Konkrete Belege für das, was da »viele« »in nicht wenigen Fällen« »immer ähnlicher« treiben, hat Herr Brumlik beizufügen vergessen. Der Hinweis, derart nichtssagende Kaugummiformulierungen in wissenschaftlichen Arbeiten würden gemeinhin als Anzeichen gelten, ein Autor könne seine Behauptungen weder valide belegen noch aussagekräftig quantifizieren, verfehlt dennoch den Punkt. Wozu belegen? Rot gleich braun ist Staatsdoktrin. Eine solche bedarf keiner systematischen Quellenanalyse, sie bedarf machtgestützter ideologischer Apparate.
Die Punkte, mit denen Professor Brumlik seine These vom Proletariat als »Kern« der reaktionären Kräfte unterfüttert, sind im besten Falle das, was man im Englischen »anecdotal evidence« nennt. Er springt von Land zu Land, streut hier und da eine Beobachtung ein, die, großzügig interpretiert, zu seinen Behauptungen passen könnte. Histörchen statt empirischer Forschung. Das windigste Indiz, das in die gewünschte Richtung deutet, wird aufgeblasen bis es quietscht, Gegeninstanzen übergeht man souverän. Eine bewährte Methode: Kreationisten widerlegen auf diese Weise die Evolutionstheorie, Homöopathen die Pharmakologie und deutsche Professoren den Marxismus.
Wie das funktioniert? Zum Beispiel so: Weil Micha Brumlik in Trumps Milliardärskabinett partout keinen Arbeiter zu finden vermag, bemüht er Steve Bannon. Der ist, so erfahren wir, »Sohn einer katholischen, depossedierten Arbeiterfamilie«. Was wir nicht erfahren ist die Tatsache, dass sich diese Arbeiterfamilie, im Gegensatz zu ihrem faschistoiden Sprößling, demokratisch und pro-gewerkschaftlich verortet. Gleichfalls wird zu erwähnen vergessen, dass der proletarische Bannon sein Vermögen als Goldman-Sachs-Banker verdiente und sich später als schwerreicher Medienmogul etablierte. Bezieht man die Brumlik entglittenen Tatsachen in die Betrachtung ein, dreht sich seine fesche Story vom reaktionären Proletariersohn um. Reaktionär war nicht der Proletarier Bannon, reaktionär ist der Bourgeois.
Faktenchecks sind groß in Mode, checken wir also ein paar Fakten:
Gibt es reaktionär gesinnte Arbeiter, in den USA und anderswo? Die gibt es.
Taugt diese Tatsache als Beleg für »das diesmal wirklich unwiderrufliche Ende« der von Marx in die Welt gesetzten »Utopie«? Dies würde voraussetzen, der Marxismus hätte diese Möglichkeit jemals bestritten.
Haben die Proletarier in den USA mehrheitlich Trump gewählt? Das haben sie nicht. Trump ist von 26,4% der Wahlberechtigten gewählt worden, Clinton von 26,5%. Der größte Teil des US-Proletariats stand beiden Kandidaten skeptisch gegenüber, wollte (oder durfte) keine Stimme abgeben. Die selbst für US-Verhältnisse beachtliche Wahlabstinenz schwächte vor allem die Demokraten. Während Donald Trump in etwa gleich viele Wähler mobilisieren konnte wie seine Vorgänger John McCain und Mitt Romney, büßte die Demokratische Partei gegenüber der ersten Wahl Obamas nahezu 10 Millionen Stimmen ein – und fiel von 69.500.000 auf 59.700.000 Wähler. Insbesondere Menschen aus den unteren Einkommensklassen wandten sich ab: Wähler mit Jahreseinkommen von unter 30.000 $ hatten 2012 noch zu 63% Obama, 2016 nur zu 53% Clinton gewählt.
Sind es vorwiegend die US-amerikanischen Industriestädte, in denen Trump seinen Anhang rekrutiert? Sie sind es nicht, in nahezu allen Großstädten siegten die Demokraten mit deutlichem Abstand. Seine Massenbasis findet Trump in ländlich und kleinstädtisch geprägten Regionen, insbesondere im fundamentalchristlichen Bible Belt. Hier findet man in der Tat ein reaktionäres Subjekt: Den christlichen Mainstream. 60% der Protestanten wählten republikanisch, bei den Evangelikalen lag der Wert bei 81%.
Sind die unteren Einkommensklassen unter den Trump-Wählern überproportional vertreten? Das sind sie nicht. Am Tag nach der Wahl veröffentlichte dieSüddeutsche Zeitung folgende Zahlen über den Zusammenhang von Einkommensklasse und Wahlentscheidung:
Jahreseinkommen Demokraten Republikaner
< 30.000 $ 53% 41%
30.000– 49.999 $ 51% 42%
50.000– 99.999 $ 46% 50%
100.000–199.999 $ 47% 48%
> 200.000 $ 48% 49%
Einkommenshöhe und pro-republikanische Stimmabgabe sind eindeutig positiv miteinander korreliert, in den Einkommensklassen über 50.000 $ hatte Trump die Mehrheit. Dass die Bevorzugung des demokratischen Lagers seitens der unteren Bevölkerungsschichten nicht mehr so stark ausgeprägt ist wie noch 2008 oder 2012, lässt sich mit den Erfahrungen aus zwei Legislaturperioden demokratischer Präsidentschaft und mit einer rationalen Einschätzung der Kandidatin Clinton gut erklären.
Fazit des Faktenchecks: Herrn Micha Brumliks diesmal wirklich unwiderrufliche Erledigung des Marxismus kollidiert mit den Tatsachen. Das macht aber nichts. Der politische Gebrauchswert seines Textes steckt ohnehin in der Conclusio: »So aber scheint die Einsicht unabweisbar, dass der auf einer kapitalistischen Wirtschaft beruhende (europäische) demokratische Sozialstaat das Beste ist, was die von Marx über Lenin bis Lukács zum revolutionären Subjekt erkorene Arbeiterschaft welthistorisch erreichen konnte und vielleicht überhaupt erreichen kann. Die Antwort einer aufgeklärten, liberalen, aber eben auch desillusionierten Linken kann daher nur darin bestehen, die Kritik am Kapitalismus aufrechtzuerhalten, freilich um dieEinsicht bereichert, ›dass kein Kapitalismus eben auch keine Antwort ist‹.«
Vielleicht wäre kein Kapitalismus ja ein ganz brauchbarer Lösungsansatz für Petitessen wie Arbeitslosigkeit, massenhafte soziale Deklassierung, Wirtschaftskrisen, Standortnationalismus, eskalierende Lohndrückerei, entgrenzte Arbeitshetze, Hunger, Flüchtlingselend, Menschenhandel, ökologische Katastrophen oder die endlose Kette von Kriegen. Ein ordentlicher deutscher Professor, dies freilich sei eingeräumt, braucht die Proklamation seiner unabweisbaren Einsichten bezüglich des welthistorisch Erreichbaren nicht mit Gedanken an derartige Detailprobleme zu belasten.
Immerhin, soviel Liberalismus vermag Herr Brumlik aufzubringen, kritisieren dürfen wir ihn, den Kapitalismus. Solange jedenfalls, wie sich die Kritik damit bescheidet, eine etwas hübschere Ausgestaltung des europäischen Sozialstaates vorzuschlagen, der unabweisbar besten aller möglichen Welten.
Die auf der Ausbeutung von Lohnarbeit beruhende Gesellschaftsordnung grundsätzlich in Frage zu stellen, das hingegen ist schlecht. Allzu genau wissen zu wollen, was der internationale Vormarsch reaktionärster Kräfte mit kapitalistischer Wirtschaft zu tun hat und was mit den Interessen der Bourgeoisie, gar zu behaupten, kein Kapitalismus sei unabdingbare Voraussetzung für die endgültige Überwindung der faschistischen Bedrohung, ist völlig inakzeptabel. Schließlich besteht die Gefahr, eine noch aufgeklärtere und noch stärker desillusionierte Linke könnte auf den Gedanken verfallen, den proletarischen Pöbel mit jenen Marxschen Einsichten aufzuwiegeln, die der liberale Herr Professor Brumlik eben noch so schön diesmal wirklich unwiderruflich erledigt hatte – und ihn mitsamt seinen Illusionen in die demokratisch-europäische Sozialstaatlichkeit rechts liegen zu lassen.
Steuergeld soll private Renditen steigern
Berliner Senat will Schattenhaushalt für Schulen
Uli Scholz
Der Schulbau und die Schulsanierung hätten in Berlin »alles andere aus dem Haushalt gedrückt«, würde man die notwendigen Ausgaben aus öffentlichen Mitteln bestreiten wollen, sagte Berlins Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) im Februar vor Gewerkschaftern.
Bis 2024 fehlen allein aufgrund steigender Schülerzahlen 60 bis 80 neue Schulen, was bei der Durchschnittsfrist von acht Jahren zwischen Planung und Übergabe eine dringliche Notlage ist. Um ein zwei- bis dreimal größeres Finanzierungsvolumen geht es bei der Sanierung. Die dafür vorgesehenen Landesmittel sind in den beiden vergangenen Jahren nur zu sieben bzw. zu 15 Prozent ausgegeben worden, allein schon die Bestandaufnahme der Schäden hatte wegen Personalmangels mehrere Jahre gedauert. In Berlin verrichten statt einer Viertelmillion (1992) nun nur noch 110.000 Beamte und Angestellte die Aufgaben des öffentlichen Dienstes. Für die bauliche Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der öffentlichen Gebäude sind im Wesentlichen die zwölf Bezirke zuständig, denen allerdings die fürs Personal zuständigen Landesregierungen die Stellen weggekürzt haben.
Die Parteien des im vergangenen Herbst gewählten Senats hatten vor der Wahl Vorschläge zum Bau und zur Sanierung von Schulen gemacht. SPD, Bündnisgrüne und ebenso die Linkspartei wollen dabei mehr privates Kapital als Investitionen in Schulen leiten. Die Linkspolitiker Harald Wolf (2002 bis 2011 Senator in Berlin) und Steffen Zillich (Aufsichtsratsmitglied beim Berliner Liegenschaftsfonds) schlugen im Juni 2016 eine »Hebelung« öffentlicher Ausgaben vor und spielten damit auf die in der Privatökonomie übliche Steigerung der Eigenkapitalrendite durch zinsgünstige Verschuldung (»Hebelung«) an. Gemeint ist aber etwas ganz anderes, nämlich die Übertragung von Immobilien wie Schulen und Kitas in landeseigene Gesellschaften. Diese würden Zinskosten und Tilgung der Bau- und Sanierungskredite dadurch bestreiten, dass sie die Immobilien an den Senat zurückvermieten. Das wollen die Linkspolitiker mit einer Vorauszahlung an diese Gesellschaften verbinden. Die »Hebelung« bestünde darin, dass die Summe der eingeworbenen Kredite die des anfänglichen Geldgeschenks im Laufe der Jahre um ein Mehrfaches übertreffen würde. So steht es denn auch – verklausuliert – im Koalitionsvertrag: Schulbau und Sanierung sollen durch privatrechtliche Kredite finanziert werden, deren Kapital im Vergleich zu Staatsanleihen erheblich höher verzinst werden würde. Als Begründung dient die Versicherung, so die Schuldenbremse umgehen zu können, da die Kosten als Mietzahlungen des Senats an eine oder mehrere Infrastrukturgesellschaften wie in einem Schattenhaushalt verschwinden würden. Davon unabhängig wird die Bundesregierung aufgrund der diesjährigen Grundgesetzänderung, ergänzt durch 13 weitere Gesetzesänderungen, den Kommunen ab 2017 Steuergeld zur Verfügung stellen, mit dem bei der Schulsanierung auch solche Projekte gefördert werden können, bei denen sich der Staat »über den Lebenszyklus des Vorhabens eines Privaten im Rahmen einer vertraglichen Zusammenarbeit bedient« und für Investitionen eine »Vorabfinanzierung« zahlt.[1] Mit diesen Umschreibungen für PPP bzw. ÖPP (public-private-partnership/öffentlich-private Partnerschaft) vermeiden CDU/CSU und SPD diesen anstößigen Begriff, weil praktisch alle deutschen Rechnungshöfe bislang nachgewiesen haben, dass PPP rentabel für Konzerne, aber ruinös für die staatliche Seite ist. Dabei werden über Jahrzehnte laufende Bau- und Unterhaltungsverträge mit Konzernen abgeschlossen, die aus der Differenz zwischen den zu Anfang festgelegten Preisen und den später durch Produktivkraftfortschritt und Tarifflucht sinkenden Kosten Extraprofite erzielen. »Erhebliche finanzielle Mehrbelastung« (Sachsen-Anhalt) und »stark gestiegene(n) Kosten« (Landkreis Offenbach) beklagen die Rechnungshöfe. Dazu kommen Probleme, wenn die Privaten ihre vertraglichen Leistungen unzureichend erbringen. So liegen derzeit Streitigkeiten um Millionensummen zwischen dem österreichischen Baukonzern Strabag und der Stadt Mühlheim vor Gericht, die bis 2012 drei Schulen in einem PPP-Modell sanieren ließ.[2]
Das Grundgesetzänderungspaket sieht außerdem Kooperationen des Bundes mit kommunalen und Länderinfrastrukturgesellschaften vor. Das Gesetzgebungsverfahren war von einer »beispiellosen Intransparenz« geprägt (Laura Valentukeviciute von »Gemeingut in Bürgerinnenhand«) und dieMainstreammedien fixierten sich auf die Infrastrukturgesellschaft Verkehr. Dabei ist die Verzahnung der Bundesgesetze mit den kommunal verantworteten Schulbauten bereits im Berliner Koalitionsvertrag angelegt, der zwar PPP ablehnt, aber auf »alternative Finanzierungsmöglichkeiten« beim Bau und der Sanierung von Schulen pocht, also auf einen Schattenhaushalt mit privater Finanzierung. Das Argument, auf andere Art könnten in der Bundeshauptstadt überhaupt keine Schulen mehr gebaut werden, trug Regina Kittler als bildungspolitische Sprecherin der Berliner Linkspartei im Dezember 2016 auch den Landesdelegierten der Bildungsgewerkschaft GEW vor. Die GEW Berlin lehnte die Übertragung der Schulimmobilien in Infrastrukturgesellschaften trotzdem ab, weil so wesentliche Entscheidungen Teil des Geschäftsgeheimnisses würden und damit politisch und zivilgesellschaftlich kaum beeinflussbar wären. Die Gewerkschafter bewerten die Pläne als Einstieg in die Privatisierung der Schulen. Es erscheint ihnen wenig sinnvoll, die Diskussion auf die »Schuldenbremse« zu beschränken Die Vorschriften des Europäischen Fiskalpaktes gelten natürlich nicht nur in Südeuropa. Sie besagen, dass auch die in Berlin geplanten Infrastrukturgesellschaften mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit privaten Geschäftspartnern zu erzielen und außerdem über weitgehende unternehmerische Entscheidungsfreiheit zu verfügen hätten, damit ihre Kreditaufnahme nicht als Teil des Staatshaushalts bewertet wird. Mit explizitem Bezug auf Haushaltstricks bei der Berliner Verkehrsgesellschaft hat das zuständige Statistikamt der EU diese Vorschriften 2016 extra noch einmal bekräftigt. Versprechen von Transparenz und demokratischer Kontrolle seitens der Berliner Koalitionsparteien sind allesamt unglaubwürdig, weil der Europäische Fiskalpakt gerade diese Kriterien für nichtstaatliche Unternehmen ausschließt.
Erfahrungen mit einer landeseigenen Infrastrukturgesellschaft gibt es beim »Sondervermögen Schulbau Hamburg«, das seit 2010 die Hamburger Schulen baut, saniert, unterhält und an den Senat zurückvermietet. Da diese Rückvermietung nach einer massiven Überbewertung der Schulimmobilien seit 2012 »objektscharf« geschieht, sind viele Schulen gemäß den Vorgaben des damals eingeführten »Musterflächenprogramms« gezwungen, einen Überhang rechnerisch ungenutzter Räume abzubauen. Nach Berechnungen der Hamburger GEW sind bis 2016 schon 300.000 Quadratmeter aus der schulischen Nutzung herausgefallen und wurden – zumindest in profitablen Lagen – zum Wohnungsbau genutzt. Im Ergebnis ist auf der einen Seite zwar die Schulbaudauer verkürzt, auf der anderen Seite aber ein starker Privatisierungsdruck auf die Schulen erzeugt worden.
Für derartige öffentlich-öffentliche Partnerschaften (ÖÖP), als PPPs kleine Schwester, werben auch Birgit Keller, Benjamin-Immanuel Hoff und Alexander Fischer, Minister in Thüringen bzw. Staatssekretär in Berlin.[3] Sie sehen ÖÖP »als Hebel zur Mobilisierung zusätzlicher Finanzmittel am Kreditmarkt«, wollen in Auswertung der Hamburger Erfahrungen ihre »neokeynesianische Strategie« aber nicht mit dem Versprechen verbinden, öffentliche Ausgaben billiger zu erledigen. Im Unterschied zu Hamburg hätte sich eine Infrastrukturgesellschaft auf den Bau und die Sanierung von Schulgebäuden zu beschränken und würde nicht auch noch an der Unterhaltung verdienen. Diese weniger militante Strategie widerspricht aber den Absichten der Berliner Senatsparteien, die landeseigene Unternehmen laut Koalitionsvertrag betriebswirtschaftlich »an vergleichbaren Unternehmen messen« wollen, also Privatunternehmen. Der bündnisgrüne Koalitionspartner hat angekündigt, die Betriebskosten der Berliner Schulen analog zu Hamburg »spitz« abrechnen zu wollen. Die widersprüchlichen Absichten werden nun hinter verschlossenen Türen verhandelt, man plane »Berliner Strukturen, um das Ganze finanzieren zu können, im Rahmen der Schuldenbremse«, so die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) im Februar 2017.
Wie eine fortschrittliche Investitionspolitik durchzusetzen wäre, bleibt in der Argumentation von Keller, Hoff und Fischer auch deswegen offen, weil sie ihre »Erkenntnis« nicht begründen, »dass der über Jahre aufgebaute milliardenschwere Investitionsstau an den Berliner Schulen nicht mittels einer konventionellen Haushaltsfinanzierung abgebaut werden kann«.[4] So bleibt unerklärlich, dass aktuell ein jährlicher Milliardenüberschuss im Berliner Landeshaushalt zum Neubau von elfSchulen in alleiniger Staatsregie genutzt werden soll, wie im Januar vorgestellte Senatspläne besagen. Es geht also auch, ohne das Finanzkapital zwischenzuschalten. Die Bewertung der Linkspolitiker, ÖÖP sei als Alternative zu PPP das kleinste Übel, ist einerseits nicht nachvollziehbar, fügt sich andererseits aber argumentativ in die Planungen auf Bundes- und Landesebene ein. Bei denen geht es auch darum, im Rahmen einer in Stein gemeißelten Ablehnung konventioneller Haushaltspolitik auch linke Kritiker in die staatsmonopolistische Rechtsetzung (»Sachzwang«) mit einzubeziehen.
Die Argumente der Gewerkschaften sind bisher nicht durchgedrungen, obwohl sie die Wirtschaftlichkeit ihrer Alternativen – mehr Personal, mehr staatliche Investitionen – in den vergangenen Jahren durch Berechnungen belegt haben. Mehreren Studien zufolge sind öffentliche Investitionen im Vergleich zu privaten mit einem wesentlich höheren Multiplikatoreffekt verbunden, sodass jeder Euro, den der Staat investiert, zu einem Wachstum des Volkseinkommens um 1,30 € bis 1,80 € führt.[5] Im Zusammenhang mit der Missachtung dieser makroökonomischen Erkenntnisse steht die Stagnation der Baubranche. Hier erzeugen bundesweit 300.000 sozialversicherungspflichtig Arbeitende weniger denselben Umsatz wie im Jahr 2000. Mehr als ein Drittel der Stellen sind entfallen. Da in der von Kleinbetrieben geprägten Branche kaum Produktivitätsentwicklung stattgefunden hat, lässt der Stellenabbau auf verschärfte Ausbeutung schließen, v.a. auf eine massenhafte Tarifflucht, die ein radikaler Ausstieg des Staats aus der Sanierung und dem Bau neuer Schulen mit ermöglicht hat. Statt 45 Prozent (1995) gaben Länder und Kommunen 2015 nur noch 20 Prozent ihrer baulichen Investitionen für die Schulen aus. Die Zahl der Lehrlinge am Bau deckt seit 2014 angesichts wenig attraktiver Arbeitsbedingungen nicht mehr den ohnehin verringerten Bedarf, demgegenüber übertraf die Zahl der ausländischen Bauarbeiter 2015 erstmals seit 2003 wieder die 100.000. Im Ergebnis fehlt nicht nur für die staatliche Planung, sondern auch die Durchführung der unabweisbaren Investitionen das nötige Personal, und zwar mit großen regionalen Unterschieden und vor allem dort, wo die Schulgebäude ohnehin schon in beklagenswertestem Zustand sind, wie eine Studie der staatlichen Förderbank KfW belegt.[6] Betroffen sind vor allem Armutsregionen, zu denen große Teile Berlins zählen. Hier konkurrieren die Bezirksverwaltungen miteinander nicht nur um Absolventen der (bau-)ökonomischen Studiengänge der Universitäten, sondern sogar um Firmen, die bereit sind, ihre Bau- und Sanierungsaufträge überhaupt noch entgegenzunehmen. Aus einem Bereich beschränkter Monopolprofite, dem (noch) durch demokratische Teilhabe geprägten öffentlichen Bauen, hat sich privates Kapital wie ein »scheues Reh« weitgehend zurückgezogen.
Die absurde Dysfunktionalität des öffentlichen Bauens – v.a. im Schulbereich – ist allerdings mit dem Potential verbunden, die andauernd krisenhafte Entwicklung des Finanzkapitals ein wenig abzuschwächen, und fügt sich daher nahtlos in die allgemeine Krise des Kapitalismus ein. Der Begriff »Akkumulation durch Enteignung«[7] hat hier hohen Erklärungswert, da die stattfindende Auszehrung der Infrastruktur letztlich zum totalen Wertverlust der Schulimmobilien führt, was bei einer Abschreibungsdauer von 60 Jahren für massiv gebaute Schulen (30 Jahre im Leichtbau)[8] vielerorts bereits eingetreten sein mag. Die dieser Enteignung folgende private Kapitalakkumulation bedarf nun neuer Formen der Zusammenarbeit von Staat und Finanzkapital, eben der Infrastrukturgesellschaften bei Bund, Ländern und Kommunen. Die privatisierungskritische SPD-Politikerin Gerlinde Schermer in der Jungen Welt: »Die Bauämter in den Kommunen sind durch die Sparen-bis-es-quietscht-Politik völlig ausgedünnt. Demnächst stellt man ihnen Geld in Aussicht, das aber möglichst rasch abgerufen werden muss. Weil die Kompetenzen fehlen, behilft man sich mit den Privaten, gründet privatisierbare Schulbau-GmbHs.«[9] Mit jährlich weniger als 50 Millionen Euro ist der Berliner Anteil an den Sanierungsmitteln des Bundes ohnehin nur als Hebel für den Einstieg des Privatkapitals geeignet, da der jährliche Mindestbedarf mehr als fünfzehnmal größer ist.
Im umrissenen Gesamtzusammenhang – die fehlende Eignung der alten »Flurschulen« für moderne Pädagogik blieb als bereits eingetretener moralischer Verschleiß unberücksichtigt– sollten die von den DGB-Gewerkschaften vertretenen Alternativen nun endlich durchgesetzt werden: Abschaffung der Steuerprivilegien für sehr hohe Vermögen und Einkommen, einheitliche Besteuerung sämtlicher Einkommensarten, Ausnahme öffentlicher Infrastrukturinvestitionen von der »Schuldenbremse« und Stärkung der »personellen und institutionellen Kapazitäten der Kommunen« sowie des regionalen Handwerks.[10]
[1] Kommunalinvestitionsförderungsgesetz §13, Entwurfsfassung.
[2]http://www.waz.de/staedte/muelheim/stadt-muelheim-hat-massive-probleme-mit-oepp-partner-strabag-id209611877.html.
[3] Rosa-Luxemburg-Stiftung 2016: »Zukunftsinvestitionen – Plädoyer für eine aktive Infrastrukturpolitik und nachhaltige Finanzwirtschaft«.
[4] Ebd., S. 16.
[5] Gustav Horn, Sebastian Gechert, Katja Rietzler, Kai Daniel Schmid: Streitfall Fiskalpolitik – eine empirische Auswertung zur Höhe des Multiplikators, IMK Report Nr. 92, April 2014.
[6] »Am Beispiel des Indikators der Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II wird deutlich, dass die Investitionen in Schulen tendenziell dort höher ausfallen, wo der Anteil besonders förderbedürftiger Kinder kleiner ausfällt, während in Bundesländern mit einem hohen Anteil an »Hartz-IV-Familien« die Investitionen in die Bildungseinrichtungen eher niedrig sind« in: »Kommunaler Investitionsrückstand bei Schulgebäuden erschwert Bildungserfolge«, KfW Research 24.9.2016.
[7] Gretchen Binus, Beate Landefeld, Andreas Wehr 2014: »Staatsmonopolistischer Kapitalismus«, S. 21.
[8] Anlage 10 zu §116 KF-VO.
[9] Junge Welt, 14.3.2017.
[10] Expertenkommission »Stärkung von Investitionen in Deutschland« 2015: Minderheitsvotum von DGB-Gewerkschaften, S. 13ff.
Thema: 1917–2017. Was war, was wurde, was bleibt
Editorial
Sicher, der hundertste Jahrestag der russischen Doppelrevolution vom Februar und Oktober 1917 wirft die Frage nach deren geschichtlicher Bedeutung auf und danach, inwieweit dieses historische Ereignis von Bedeutung ist für die sozialen und politischen Auseinandersetzungen der Gegenwart.[1] Und selbstverständlich für die Suche nach erfolgversprechenden Wegen zu einem überlebensfähigen Sozialismus, wie die international sehr lebhaften Strategiedebatten und auch die Diskurse über »Post-Kapitalismus« zeigen.
Der hundertste Geburtstag der russischen Revolution ist aber auch ein Grund zum Feiern.[2] Zumindest für uns und viele andere Kommunist*inn*en/Sozialist*inn*en auf allen Kontinenten. Siege soll man feiern. Denn nicht nur aus Niederlagen ist zu lernen. »Reclaiming our victories« schrieb das südafrikanische Theorieorgan »African Communist« jüngst auf seiner Titelseite, was bedeutet, die eigenen Siege verteidigen, für sich beanspruchen, nutzbar machen. Das fällt uns deutschen Linken vor dem Hintergrund unserer spezifischen Geschichte möglicherweise schwerer als anderen. Ein Nebenaspekt, warum wir in diesem Sonderheft anderen den Vortritt gelassen haben.
Den ersten »internationalistischen« Block des Schwerpunktes bilden Beiträge von Kommunisten aus Russland, Indien, Brasilien, Südafrika und Portugal, mit jeweils eigenen Akzenten über Bedeutung der Oktoberrevolution und Lehren aus ihr. Über China, das Ende der kolumbianischen Epoche und das – durchaus von der Oktoberrevolution inspirierte – Ringen um eine andere Weltordnung schreibt Domenico Losurdo.
In einem zweiten Block steht – insbesondere für unsere jüngeren Leser*innen – die Revolution als historisches Ereignis im Mittelpunkt. Unser jüngster Redaktionszugang Gerrit Brüning gibt einen kurzen Überblick über das Jahrhundertereignis Oktoberrevolution. Und ein alter Freund der Marxistischen Blätter, der österreichische Historiker und Kommunist Hans Hautmann, skizziert die Februarrevolution und ihre Entwicklung.
Der dritte Block »Oktoberrevolution in der Diskussion« beginnt mit einem anregenden Vortrag des sozialdemokratischen Historikers Peter Brandt, den er uns freundlicherweise zur Veröffentlichung freigegeben hat. Nina Hager formuliert Lehren aus den 100 Jahren seit Oktober 1917 und Willi Gerns beantwortet Fragen, ob der Sozialismus in Russland scheitern musste. Hochspannend ist auch der Beitrag des Militärhistorikers Lothar Schröter, dem wir die Überschrift »NATO jagt Roter Oktober« gegeben haben. In seinem Zentrum steht die erst seit kurzem zugängliche NATO-Studie »Über die langfristigen Tendenzen in den Ost-West-Beziehungen« vom Mai 1978, die u.a. eine bemerkenswert realistische Analyse des inneren Zustandes der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder beinhaltete. Mit diesen Beiträgen ist das Thema für uns noch bei weitem nicht erschöpft. Weitere Beiträge folgen mit Sicherheit in den kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift.
[1] Für besonders interessierte Leser*innen haben wir alle »Jubiläumsartikel« der Marxistischen Blätter (und andere Materialien zur Oktoberrevolution) auf einem USB-Stick veröffentlicht. (Siehe Beileger des Verlages)
[2] Die Festveranstaltung des DKP-Parteivorstandes findet am 21. Oktober im ›Babylon‹ in Berlin statt.
Gratulation zum Jubiläum der Oktoberrevolution
Michail Krjukow
In wenigen Monaten jährt sich die





























