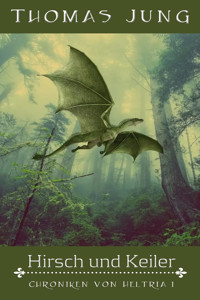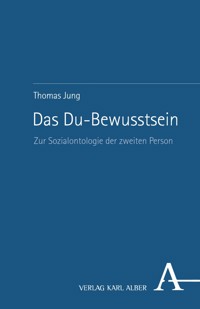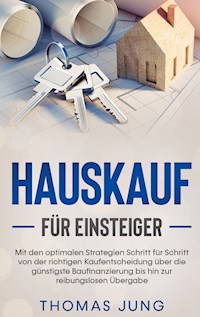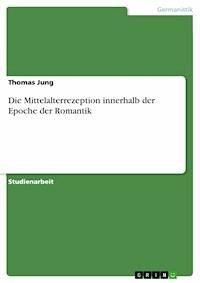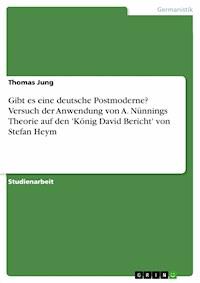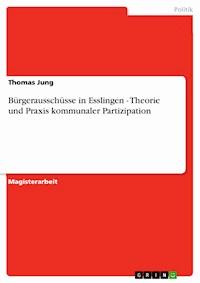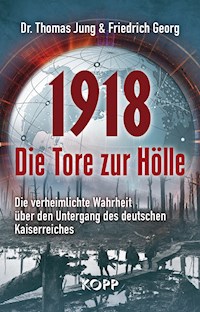
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Erste Weltkrieg und die deutsche Niederlage:
Was damals wirklich geschah»Der Krieg war nur die Vorbereitung, die Vernichtung des deutschen Volkes fängt jetzt erst an!«Georges Benjamin Clemenceau, französischer Ministerpräsident
Im Jahr 2019 liegt ein Jahrhundert der Propaganda, der Lügen und der Gehirnwäsche hinter uns. Die Botschaft, die die moderne Geschichtsschreibung zum Ersten Weltkrieg bis heute verkündet, lautet: Deutschland war schuld am Ausbruch des Ersten Weltkrieges und stand im Herbst 1918 vor der totalen Niederlage.
Dr. Thomas Jung und Friedrich Georg belegen jedoch genau das Gegenteil: Der »Große Krieg« war kein politischer, sondern ein kommerzieller, inszenierter Krieg mit dem Ziel, Deutschland als führende und moderne Wissenschafts- und Wirtschaftsmacht zu zerstören. Fakt ist: Frankreich und England waren bis zum letzten Penny bei US-Banken und Investoren verschuldet. Im Falle eines deutschen Sieges oder eines Ausgleichsfriedens drohte ihnen der Bankrott. Die USA waren also nur deshalb in den Weltkrieg eingetreten, um ihre milliardenschweren Investitionen in England und Frankreich zu retten.
Diese und viele andere Tatsachen, die in diesem Buch aufgedeckt werden, sind in der internationalen Geschichtsschreibung so gut wie nicht zu finden.
Lesen Sie jetzt, was Ihnen bislang verheimlicht wurde:
- Was sich hinter dem geheimnisvollen »Plan 1919« der Alliierten verbarg.
- Warum US-Truppentransportschiffe ausgerechnet deutsche »Schutzengel« hatten.
- Wie Marxisten und Alliierte massenhaft die Fahnenflucht deutscher Soldaten planten und organisierten.
- Was wirklich hinter der »Dolchstoß-Legende« steckt.
- Warum US-Präsident Wilsons »14-Punkte-Friedensplan« der größte Betrug der Weltgeschichte war.
- Weshalb die deutsche Regierung ihre Flotte so bereitwillig an den Feind auslieferte.
- Weshalb Deutschlands Eliten den Ausgleichsfrieden mit den Alliierten so leichtfertig verspielten.
- Warum Reichspräsident Friedrich Ebert die »vollständigen Geheimprotokolle der Obersten Heeresleitung« an die USA »verschenkte«.
- Weshalb der »unvollendete« Erste Weltkrieg einen Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland notwendig machte.
Was die Autoren außerdem zum Vorschein bringen, macht politisch korrekte Mainstream-Historiker fassungslos. Doch all das darf bis heute in keinem Schulbuch stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
1. Auflage April 2019 Copyright © 2019 bei Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Nicole Lechner ISBN E-Book 978-3-86445-671-8 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-0 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
EINLEITUNG: Vier Jahre und vier Monate
EINLEITUNG
Vier Jahre und vier Monate
Abb. 1 Die »große Schlacht im Westen«, März 1918, in den gestürmten englischen Linien zwischen Bapaume und Arras. Ein Transport von 4000 englischen Gefangenen in einer Sammelstelle vor Arras.
Immer wieder scheint der Monat November für Deutschland von schicksalsschwerer Bedeutung zu sein.
Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, am 9. November 1938 kam es zu den Pogromen der Kristallnacht, und am gleichen Tag scheiterte 1923 der Hitler-Putsch in München.
Am 11. November 1918 geschah im französischen Wald von Compiègne ein nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt bis heute bestimmendes Ereignis. Hier ist seine bis heute verheimlichte Vorgeschichte.
Noch im Sommer 1918 sah nichts nach einem schnellen Ende des bereits 4 Jahre wütenden Materialkrieges aus, der später mit Recht als die »Urkatastrophe Europas« bezeichnet wurde.
Viereinhalb Jahre lang hatte sich das Deutsche Kaiserreich erbittert gewehrt, bevor es – für seine Kriegsgegner völlig überraschend – binnen weniger Wochen im Herbst 1918 den Kampf aufgab.
Seit 2014 ist mit dem Wiedererwachen des Interesses am Ersten Weltkrieg geradezu »Revolutionäres« über die wahren am Kriegsausbruch Schuldigen geschrieben worden.
Die sich bis heute auf unser Leben auswirkenden Umstände des Kriegsausgangs scheinen dagegen nach wie vor von einem Mantel des Schweigens umhüllt zu sein. Dies ist kein Zufall!
Wie von der internationalen Elite geplant, war der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands mit Kriegsausbruch ab 1. August 1914 zu einem abrupten Ende gekommen.
Die Kaiserzeit nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 war eine Blütezeit der deutschen Nation. Bismarck hatte das »Zweite Reich« mit Blut und Eisen geschmiedet. Allerorts sprossen nach der Reichsgründung prächtige Bauten hervor, das Bürgertum blühte auf, das Land zeigte sich selbstbewusst, glanzvoll, patriotisch und fortschrittlich. Mit dem Regierungsantritt des jungen Monarchen Wilhelm II. beschleunigte sich die Entwicklung noch.
Die Wirtschaft des Deutschen Kaiserreichs hatte zuvor fast alle damaligen Zukunftstechnologien zulasten der traditionellen europäischen Wirtschaftsmächte in Beschlag genommen. Allein Bayer, BASF und Hoechst hielten zusammen mehr Chemie- und Pharmapatente als der Rest der Welt. Auf den globalen Seehandelswegen, die Amerikaner und Engländer für sich sicher gepachtet zu haben glaubten, erschienen immer häufiger die Dampfschiffe unter Fahne der Hamburger Reederei HAPAG. Auch die zukunftsträchtigen Erdölfelder des Mittleren Ostens drohten in deutsche Hände zu fallen.
Tatsächlich erlebte das Kaiserreich Wilhelms II. zwischen 1890 und 1914 eine wirtschaftliche Blüte, die erst in den 1950er- und 1960er-Jahren übertroffen wurde. Man nannte sie noch Generationen später ehrfürchtig die »gute alte Zeit«.
Neid und Missgunst führten deshalb das Regiment in den geheimen Zirkeln Europas und der USA – schon Jahrzehnte vor Kriegsbeginn. So findet sich in der einflussreichen Londoner Elitepostille Saturday Review vom 11. September 1897 folgende Aussage:
Staaten haben jahrelang um eine Stadt oder ein Thronfolgerecht Krieg geführt, und da sollten wir nicht Krieg führen, wenn ein jährlicher Handel von 5 Milliarden auf dem Spiel steht?
Lord Balfour, der ehemalige englische Premierminister, erklärte gegenüber dem US-Diplomaten White im Jahr 1910:
Wir sind wahrscheinlich töricht, dass wir keinen Grund finden, um Deutschland den Krieg zu erklären, ehe es zu viele Schiffe baut und uns den Handel wegnimmt.
Im August 1914 war es dann so weit! Ziel der »Entente«, wie sich die vereinigten Gegner des Kaiserreichs nannten, war, dass Deutschlands Zeiten als führende, moderne und blühende Wissenschafts- und Wirtschaftsmacht endlich vorüber sein sollten.
Am Ende des Krieges wollte man das florierende Land in der Mitte Europas in eine ländliche Einöde verwandelt sehen – ähnlich den späteren Plänen des US-Finanzministers Henry Morgenthau aus dem Jahre 1944.
Die Financial News vom 30. Oktober 1915 drückte dies unmissverständlich aus:
Die Welt würde gesunden, wenn am Ende des Krieges ein Deutscher ein so seltenes Ding geworden wäre wie eine Schlange in Irland oder ein wilder Tiger in England.
Dabei kam den Alliierten ein Umstand zu Hilfe: Wenngleich Deutschland nach allen ökonomischen Parametern der große Sieger des wirtschaftlichen Wettlaufs bis 1914 war, hatte man dort die Militärrüstung lange zugunsten der Hochseeflotte vernachlässigt.
Immerhin hatten die Engländer 1910 ein Viertel aller staatlichen Ausgaben in die Marinerüstung gesteckt – also dreimal so viel, wie das sparsame deutsche Kaiserreich für seine Kriegsmarine ausgab. Die Aufwendungen für die Royal Navy hatten die Staatsfinanzen Großbritanniens zerrüttet. Erst 1912, als es angesichts zunehmender internationaler Spannungen klar wurde, dass Deutschland das Wettrüsten gegen Großbritannien zur See nicht gewinnen konnte, schalteten seine Planer auf Landrüstung um. Dies erfolgte viel zu spät und oft auf der Grundlage veralteter Militärtechnologie.
Das Rüstungsbudget Deutschlands war selbst 1913 weit geringer als das jedes einzelnen der späteren Kriegsgegner! Frankreich hatte sogar die 1905 aufgegebene 3-jährige Dienstzeit wieder eingeführt.
Aus dem erhofften schnellen 6-wöchigen Blitzsieg der Koalition, die Deutschland im Zweifrontenkrieg umklammert hielt, wurde dennoch nichts.
Stattdessen kam es zu einem unentschiedenen Stellungskrieg mit Materialschlachten. Man hatte aufseiten der Entente Deutschlands Behauptungswillen völlig unterschätzt. Panik machte sich zunehmend in Kreisen der internationalen alliierten Finanziers breit.
Was man erreichte, war, dass die »globalisierte Welt von 1913« mit ihrem freien Handel, ihrem kulturellen Austausch und ihren friedlichen Veränderungen sinnlos zertrümmert und vergeudet wurde.
Alle deutschen Angebote zwecks eines Ausgleichsfriedens wurden von den verantwortlichen Entente-Politikern umgehend abgelehnt. Sie konnten nicht anders, denn um die Blüte ihrer Jugend für die wirtschaftlichen Interessen weniger auf die Schlachtfelder treiben zu können, hatten sich Frankreichs und Englands Politiker bis zum letzten Penny bei amerikanischen Banken und Investoren verschulden müssen. Ihnen drohte im Falle eines deutschen Sieges oder eines Ausgleichsfriedens der Bankrott. Die USA waren deshalb 1917 in den Weltkrieg aufseiten der Gegner Deutschlands eingetreten, um ihre Investitionen zu retten.
Beinahe wären die Amerikaner zu spät gekommen, denn zwischen Winter 1917 und Juli 1918 hatten die Entente-Mächte zunehmend den Zermürbungskrieg verloren. Dennoch gelang es dem kaiserlichen Heer trotz seiner militärischen Überlegenheit nicht mehr, die alliierten Armeen an der Westfront ebenso zu besiegen, wie es vorher den Sieg über Serbien, Rumänien und Russland errungen hatte.
Dabei war es aber so knapp, dass man 1918 nach den Worten des führenden französischen Generals Philippe Pétain die Entfernung, die Deutschland vom endgültigen Sieg trennte, in Schritten habe messen können. Auch Verrat spielte eine Rolle wie bei der deutschen Reims-Marne-Offensive vom Juli 1918.
Schließlich brachten zwei erfolgreiche Gegenoffensiven am 18. Juli und 8. August 1918 einen strategischen Umschwung zugunsten der Alliierten; von da an ging es nur noch rückwärts für das deutsche Heer.
Diese Entwicklung wurde dadurch erleichtert, dass das bis dahin siegreiche Deutsche Reich ab Sommer 1918 nicht nur an zunehmenden Defiziten beim Material- und Personalnachschub litt, sondern auch durch Parteienstreit und Defätismus bis hinauf in höchste Kreise des Adels und der bürgerlichen Eliten gelähmt schien.
Besonders der in der Heimat durch Not, Hunger, bolschewistische Propaganda und Geld der Entente schnell um sich greifende revolutionäre Geist war ein Zeichen der nahenden Krise. Das Etappengebiet füllte sich mit deutschen Deserteuren, ohne dass die Behörden richtig durchgriffen.
Dabei hätte das Kaiserreich 1918/19 immer noch einen letzten Trumpf ausspielen können: Schon oft in der Geschichte hatte moderne Kriegstechnik über Sieg und Niederlage entschieden.
Trotz administrativer Behinderung und Rohstoffmangel gelang es deutschen Erfindern und Industriellen, am Ende des Ersten Weltkriegs neuartige Waffentechnik herauszubringen, der die alliierten Gegner nur wenig entgegenzusetzen hatten.
Die neuen Waffen kamen allerdings nur noch ansatzweise oder gar nicht mehr zum Einsatz, aber auch so standen die Alliierten im Oktober 1918 vor einer neuen Krise.
Zum Erstaunen der Alliierten, die trotz ihrer seit August erzielten großen Geländegewinne völlig erschöpft waren, ersuchte dann eine neu gebildete deutsche Regierung am 4. Oktober 1918 den US-Präsidenten Wilson um Waffenstillstand.
Ließ man sich in Berlin dabei vom betrügerischen US-Versprechen eines »Ausgleichsfriedens ohne Sieger und Besiegte« täuschen, oder steckte mehr dahinter?
Am 11. November 1918 war alles vorbei: Neue Politiker und die dahinterstehenden Kräfte hatten nicht nur den Kaiser verjagt und die Staatsform gewechselt, sondern Deutschland auf Gnade und Verderb an die Alliierten ausgeliefert.
Bismarcks »Zweites Reich« existierte nur noch in der Erinnerung. Linke Revolutionäre und Soldatenräte beherrschten die Straßen Berlins.
Heute behaupten viele, dass dies alles zwangsläufig so habe kommen müssen, was ein Segen für die Welt gewesen sei.
KAPITEL 1: Der unerwartete Sieg
KAPITEL 1
Der unerwartete Sieg
Abb. 2 Die Unterzeichnung des bedingungslosen Waffenstillstands vom 11. November 1918 im berühmten Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne. Stehend halblinks: Matthias Erzberger, Reichstagsabgeordneter des Zentrums; stehend rechts: General Ferdinand Foch, Oberbefehlshaber der Alliierten.
»Wir werden die Deutschen nie vernichtend schlagen!«
»We shall never trash the Boche!«, rief Lord Alfred Milner am 31. Juli 1918 entsetzt vor führenden britischen Persönlichkeiten aus.
Wie kaum ein anderer hatte der Lord mit einer kleinen, aber äußerst einflussreichen Gruppe jahrelang dafür gesorgt, dass ein Vernichtungskrieg der von ihnen zusammengezimmerten Koalition gegen das Milner verhasste Deutschland vom Zaun gebrochen wurde. Jetzt schien man vor dem Scherbenhaufen aller vorherigen Bemühungen zu stehen.
Tatsächlich war der Erste Weltkrieg kein politischer, sondern ein kommerzieller und industrieller Krieg, wie der damalige US-Präsident Wilson in der Nachkriegszeit zugab.
Als im Sommer 1914 die Lichter in Europa ausgingen, hatte die Gruppe um Milner wie viele andere gehofft, dass nur ein kurzer Krieg die Folge sein würde. Auch die Drahtzieher ahnten nicht, dass sie ein Inferno lostraten, das Charles de Gaulle später mit dem Dreißigjährigen Krieg gleichsetzte.
Bis Sommer 1918 war der Krieg für die Alliierten trotz ihrer scheinbar unerschöpflichen Nachschubquellen und Finanzmittel nicht zufriedenstellend gelaufen.
Diesseits wie jenseits des Rheins machte sich Kriegsmüdigkeit breit. Es ging darum, welche Machtgruppierung am längsten durchhalten und damit den Krieg entscheiden könne. Einen damals jederzeit möglichen vorzeitigen Friedensschluss mit Interessenausgleich verhinderten alliierte Bankiers. Für sie wäre ein Ausgleichsfrieden einem Bankrott gleichgekommen. Lieber setzte man auf Risiko.
Tatsache war, wie der große deutsche Reeder Albert Ballin noch im September 1916 äußerte, dass das deutsche Volk sich den größten Teil seiner Schulden selbst schulde, während England an Amerika eine enorme Schuldenlast abzutragen haben werde. Dies galt auch für Italien und Frankreich.
Bei einem Ausgleichsfrieden hätte jeder für seine Kriegsschulden geradestehen müssen. Man ließ also weitermachen – wie Vabanquespieler.
Warum die Deutschen willenlos alle Waffenstillstandsforderungen der Alliierten annahmen
Eine Inschrift auf einem Stein auf der Lichtung von Compiègne besagt:
Hier zerbrach am 11. November 1918 der verbrecherische Stolz des Deutschen Reiches, besiegt durch die freien Völker, die es sich zu unterjochen anmaßte.
Am 9. November 1918 war die deutsche Waffenstillstandsdelegation unter Matthias Erzberger gegen 7 Uhr morgens im Zug auf der Waldlichtung von Rethondes beim französischen Compiègne angekommen.
Das noch weit im Feindesland stehende Deutschland bat aufgrund alliierter Versprechen um Waffenstillstand, nicht zuletzt im Angesicht einer aufkeimenden Revolution in der Heimat.
Ursprünglich sollte General Erich von Gündell Vorstand der deutschen Waffenstillstandskommission werden. Dazu eignete er sich aufgrund seiner perfekten Beherrschung der französischen Sprache, seines Auftretens und seiner Übung im Umgang mit französischen Offizieren. Erzberger riss jedoch den Vorsitz der Waffenstillstandskommission an sich. Unter Zustimmung des Prinzen Max von Baden strich er auf der Liste den Namen General von Gündells aus und setzte seinen eigenen an dessen Stelle. Erzberger empfahl, in Compiègne möglichst schuldbewusst aufzutreten, unterwürfig alles zu unterschreiben, um Verzeihung zu betteln und an die Moral der Gegner zu appellieren.
Der alliierte Kriegsrat in Paris hatte so strenge Waffenstillstandsbedingungen aufs Papier gebracht, dass es ihm selber grauste. Doch bekam er von der Erzberger-Delegation alles mühelos bewilligt.
Der Waffenstillstand beinhaltete 34 Artikel.
Die Deutschen gelobten, Belgien, Frankreich und die seit 1871 ins Reich aufgenommene Provinz Elsass-Lothringen binnen 14 Tagen zu räumen.
Das Deutsche Reich sollte schutzlos werden. Abzugeben waren unter anderem 5000 Kanonen, 1700 Flugzeuge und 150000 Eisenbahnwaggons.
Deutsche Schiffe durften weiterhin gekapert werden.
Die sofortige Auslieferung sämtlicher U-Boote und fast aller Großkampfschiffe hatte zu erfolgen.
Die alliierten Kriegsgefangenen waren ohne Gegenseitigkeit zurückzugeben.
Wie später im Irak unter Saddam Hussein – nach dem verlorenen Kuweit-Krieg 1990 – mussten Kontrollkommissionen der Alliierten ins Land gelassen werden.
Die Hungerblockade blieb bestehen.
Es wurde in Compiègne vieles vorweggenommen, was im Allgemeinen in einem Friedensvertrag geregelt wird.
Die alliierten Oberbefehlshaber Ferdinand Foch und Douglas Haig wunderten sich, dass die deutsche Delegation diese eigentlich unannehmbaren Bedingungen widerstandslos hinnahm. Unterlagen zeigten dann auch, dass die Kriegsgegner im Falle eines Widerspruchs der deutschen Delegation durchaus bereit gewesen wären, Deutschland in wichtigen Fragen wie etwa der Beibehaltung der Flotte entgegenzukommen. Ein solcher Widerspruch kam nicht. War also Deutschlands Lage im Herbst 1918 wirklich so schlecht, dass man sich dem Gegner auf Gedeih und Verderb ausliefern musste, oder verspielten Deutschlands Eliten aus den unterschiedlichsten Motiven heraus einen sonst wahrscheinlichen Ausgleichsfrieden mit den Alliierten?
Heute wird von der angloamerikanisch zentrierten Geschichtsschreibung behauptet, dass Deutschland im November 1918 noch Glück gehabt habe, dass die Alliierten den Krieg beendeten.
Neben einer erdrückenden Übermacht an Menschen und Material hätten die taktische Kompetenz und die überlegene Technik der Alliierten dafür gesorgt, dass die Lage für die absolut zerschmetterte deutsche Armee immer hoffnungsloser wurde.
Um dieses Bild objektiv beurteilen zu können, werden wir die Lage Deutschlands im Sommer 1918 untersuchen, bevor das Waffenstillstandsersuchen an die Alliierten abging.
Wie es aussieht, wird die Welt seit 1918 belogen!
KAPITEL 2: War Deutschland ab Sommer 1918 am Ende?
KAPITEL 2
War Deutschland ab Sommer 1918 am Ende?
Abb. 3 »Unternehmen Michael«. Die Operation begann Ende März 1918. Obwohl die deutschen Truppen bis etwa 64 Kilometer ins Feindesland vorgerückt waren, beendete Ludendorff die Operation am 5. April mit der Begründung, man habe keinen entscheidenden Sieg errungen.
Am 12. September 1916 hatten die Mittelmächte – Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und die Türkei – den Alliierten ein großzügiges Friedensangebot unterbreitet.
Dort war die Rede von der Katastrophe des Krieges, welche die Menschheit um ihre wertvollsten Errungenschaften bringe:
Sie droht den geistigen und materiellen Fortschritt, deren Stolz Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts bildete, in Trümmer zu legen.
Die Mittelmächte seien nicht darauf aus, ihre Gegner zu zerschmettern oder zu vernichten. Vom Wunsch beseelt, weiteres Blutvergießen zu verhüten, schlugen die vier verbündeten Mächte vor, alsbald in Friedensverhandlungen einzutreten und den Kämpfen ein Ende zu machen.
In einer Note vom 10. Januar 1917 reagierten die Regierungen der Alliierten (Entente), indem sie das Friedensangebot ablehnten. Sie verwahrten sich sogar feierlich dagegen, dass die Mittelmächte, bei angeblicher Alleinschuld am Krieg, überhaupt gleichberechtigt an Friedensverhandlungen teilnehmen dürften.
Kurz, man verlangte die totale Kapitulation des Gegners. Allein schon das Wort »Friede« sei frevelhaft.
Auch im Jahre 1917 hatte eine reelle Chance auf zumindest einen Waffenstillstand bestanden, als Papst Benedikt XV. am 1. August 1917 alle kriegführenden Parteien zu Verhandlungen, zu Verzicht auf Reparationen und zur Rückgabe der besetzten Gebiete sowie der von den Entente-Mächten eroberten Kolonien aufrief. Über alle strittigen Territorialfragen wie zwischen Deutschland und Frankreich um Elsass-Lothringen sollte ein internationales Schiedsgericht urteilen. Kaiser Wilhelm II. begrüßte ausdrücklich den Friedensappell des Papstes, plädierte für Rüstungsbegrenzung und für die Einführung eines Schiedsverfahrens bei internationalen Streitigkeiten. Die Alliierten lehnten sofort die Initiative des Vatikans ab. Besonders schroff trat dabei US-Präsident Wilson hervor.
Im März 1918 war das deutsche Heer in Frankreich zur Großoffensive übergegangen. Man nannte dies hoffnungsvoll »Kaiserschlacht« oder auch »Operation Michael«.
Zum ersten Male seit der Marne-Schlacht 1914 konnte Deutschland im Westen mit Kräften auftreten, die denen der Gegner gewachsen waren. Die deutsche Oberste Heeresleitung (OHL) wollte versuchen, eine Entscheidung im Westen zu erzwingen, bevor die von Monat zu Monat im Vergleich immer stärker eintreffende amerikanische Unterstützung die lähmenden Nebenwirkungen des Jahres 1917 in den Reihen der Entente ausgeglichen hätten.
Die strategische Lage hatte sich deutlich zugunsten der Deutschen gebessert. Im Osten waren Russland und Rumänien aus dem Krieg ausgeschieden, Italien hatte Ende 1917 eine vernichtende Niederlage erlitten. Allerdings kam aus der Heimat das Wetterleuchten eines nahenden Sturmes seit Januar 1918 immer näher.
Der Erfolg des deutschen Großangriffs war überraschend gewaltig.
So begann die Offensive am 21. März 1918 auf der 50 Kilometer breiten Front Arras–Cambrai–St. Quentin. Schon am 30. März war der Stoß 60 Kilometer tief eingedrungen, unermessliche Beute wurde gewonnen, mehr als 90000 Gefangene wurden gemacht.
Die auf Amiens zurückgeworfene 5. englische Armee hörte schon am 26. März auf zu bestehen, die 3. englische Armee hatte außerordentlich schwer gelitten. »Es war die größte Niederlage, die wir in der Geschichte erlitten hatten«, sagte der englische General Haig. General Pétain, der französische Oberbefehlshaber, meinte, die Deutschen könnten in spätestens 5 Tagen in Paris sein. Dort entstand eine schwere Panik, die infolge der am 23. März beginnenden Beschießung der Stadt durch drei deutsche Ferngeschütze auf eine Entfernung von 130 Kilometern noch beträchtlich erhöht wurde. Etwa 500000 Einwohner der Hauptstadt »stürzten sich Ende März und Anfang April in die Züge«. Die Bank von Frankreich brachte ihre Bestände im Inneren des Landes in Sicherheit. Die Räumung von Paris und die Verlegung der Regierung nach Tours wurden vorbereitet.
Abb. 4 Die Schlacht von Amiens am 8. August 1918, »der Schwarze Tag des deutschen Heeres«. Die 3-tägige Schlacht gilt heute als Wendepunkt an der Westfront.
Es kam zu ernsten Streitigkeiten zwischen französischen Militärs und Politikern wegen der Unfähigkeit der Armee, dieser unheimlichen Bedrohung ein Ende zu bereiten. Marschall Foch erklärte nach dem Krieg, die damalige Krise sei die gefährlichste im Weltkrieg gewesen; der Endsieg habe für die Deutschen in Reichweite gelegen.
Die siegreichen Deutschen standen dicht vor Amiens. Die Eroberung dieser Stadt hätte einen starken Keil zwischen die englische und die französische Armee getrieben, die schon durch eine Lücke von 15 Kilometern getrennt waren. Gelang diese Trennung vollständig, so musste der linke französische Flügel befürchten, gänzlich aufgerollt zu werden, während die schwer erschütterten englischen Truppen auf die Kanalhäfen zurückgeworfen worden wären. Die Franzosen liefen dabei Gefahr, wie General Pétain später äußerte, zur Kapitulation im freien Felde gezwungen zu werden. Er schrieb:
Man konnte die Entfernung, welche die Deutschen vom endgültigen Siege trennte, in Schritten messen. Es war die kleine Entfernung von der deutschen Front bis Amiens.
Die deutschen Truppen kamen bis zur Ortschaft Albert im Département Somme, und dann ging es nicht mehr weiter.
Die Luftaufklärung hatte gemeldet, zwischen Albert und Amiens seien keine Feinde. 30 Kilometer Entfernung wären noch zu überwinden gewesen. Keiner wusste, was den Vormarsch verhinderte.
Tatsächlich hatten sich deutsche Truppen im englischen Etappengebiet damit beschäftigt, zu plündern und den Wein in den Kellern zu trinken. Hinzu kam, dass viele deutsche Soldaten nach mehreren Tagen des Vormarsches und der schlechten Verpflegung von der sogenannten »Spanischen Grippe« befallen wurden und sich zuerst erholen mussten.
Obwohl die 18. deutsche Armee den Durchbruch erzielt hatte, blieb man am 27./28. März 1918 liegen.
Die Türme der Kathedrale von Amiens waren bereits zu sehen; die Engländer verbrannten schon ihre Munitionsvorräte in der entscheidenden Stadt. Das Fehlen von zwei bis drei deutschen Kavalleriedivisionen, die in den Rücken des geschlagenen Feindes nur noch hätten vormarschieren müssen, wo alliierte Artillerie ohne Infanterieschutz in Lastkraftwagen herbeieilte, erwies sich als mitentscheidend.
Abb. 5 Weinplünderung: Deutsche Soldaten plündern einen erbeuteten Proviantzug mit französischem Rotwein. Auch Kampftruppen konnten der Versuchung nicht widerstehen, wie die Aufnahme zeigt.
Deutsche Lkw-Kolonnen, von denen die Sturmtruppen-Fußsoldaten durch die weit offene Frontlücke hätten transportiert werden können, standen in Bereitschaft. Sie blieben jedoch in den entscheidenden Tagen ohne Treibstoff hinten in den Depots liegen, und auch der schweren deutschen Artillerie fehlte auf einmal Munition. Nur Zufälle?
»Der 27. März 1918«, schrieb der 1. Generalstabsoffizier Karl von Prager an Kronprinz Rupprecht, »war der Wendepunkt der großen Offensive.« Ohne große Feindberührung stopften die schon besiegten Engländer das riesige Loch in der Front.
Als sich die Deutschen einige Tage danach wieder zum Vormarsch entschieden, wurden sie von französischen Truppen gestoppt, die unter großen Verlusten ohne eigene Artillerie direkt aus der Eisenbahn an die Front geworfen worden waren.
Nach diesen vergeblichen Versuchen, die Angriffe am 30. März und 4. April 1918 wiederaufleben zu lassen, stellte die deutsche Oberste Heeresleitung das »Unternehmen Michael« ein.
Abb. 6 Nachschubversagen: Im entscheidenden Moment der Offensive mussten die bereitstehenden deutschen Lkw mangels Treibstoff in den Depots bleiben. Der Transport beruhte nur noch auf Pferden, während die Alliierten im Eiltempo mit eigenen Lkw-Kolonnen die Frontlücke bei Amiens schließen konnten.
Der zweite große deutsche Angriff gegen die Engländer, genannt »Georgette«, startete am 9. April 1918. Nach nur 9 Tagen Vorbereitung gelang es den Deutschen, die Engländer mit einem Blitzangriff in Richtung des alles entscheidenden alliierten Nachschubknotens Hazebrouck in so große Bedrängnis zu bringen, dass General Haig am 11. April das »Halten bis zum letzten Mann« befehlen musste.
Abb. 7 Ein schwerer deutscher 21-cm-Mörser muss mangels mechanischer Zugmittel mühsam mit Menschenkraft nach vorn bewegt werden
Der »Plan Z«, die Räumung Frankreichs, wurde mit größter Dringlichkeit geplant, wobei die Engländer damit rechneten, alles Material zurücklassen zu müssen, um wenigstens die Soldaten und Zivilpersonen nach England retten zu können.
Für einen anhaltenden Erfolg waren die deutschen Kräfte allerdings zu schwach. Als sich Unternehmen »Georgette« dann immer mehr zur Materialschlacht entwickelte, ließ Ludendorff die Offensive abbrechen.
Aber noch am 27. April 1918 erörterten die britischen Generale, dass es bald notwendig sein könnte, auf die Kanalhäfen zurückzufallen, um das englische Expeditionskorps nach Großbritannien zu evakuieren.
General Ludendorff, von diesem ernsthaften Gedankenspiel unterrichtet, sandte ein Telegramm an die deutsche Hochseeflotte und verlangte, man solle Pläne machen, um einem Versuch der Briten, ihre Truppen aus Frankreich über den Kanal zu evakuieren, entgegenzutreten.
Am 27. Mai und 19. Juni 1918 griffen die Deutschen dann die Franzosen überraschend und wuchtig an. Zum zweiten Mal im Weltkrieg wurde bei Château-Thierry und Dormans die Marne erreicht. Nur noch 77 Kilometer trennten die deutschen Soldaten von der französischen Hauptstadt! 123000 Gefangene, mehr als 600 Geschütze und unzählige Geräte fielen in deutsche Hände; der eroberte Landstrich war einer der fruchtbarsten Frankreichs.
Ab Château-Thierry hatten die deutschen Truppen, wie französische Berichte ausführen, eine Zeit lang überhaupt keinen Feind mehr vor sich. Ludendorff nutzte die sich bietende Gelegenheit aber nicht aus.
Die schlimme Lage löste eine schwere Depression bei der Entente aus. Mitte Juni kam es zu einer neuen Krise bei den Alliierten, da immer mehr Beweise für nachlassenden Kampfwillen unter den französischen und britischen Soldaten zutage traten. Dass auch die deutschen Soldaten seit dem Frühjahr immer stärkere Moralprobleme entwickelten, war den alliierten Generalen teilweise bekannt. Schon beim Unternehmen »Georgette« war es auf deutscher Seite zu Befehlsverweigerungen gekommen, die Gräben zu verlassen.
Am 31. Mai erteilte General Henry Wilson den Befehl, alles für die Evakuierung des BEF (British Expeditionary Force) vom Kontinent vorzubereiten. Am 1. Juni bereitete sich die englische Botschaft in Paris auf ihre Verlegung nach England vor.
Völlig überraschend rettete da die Rede des deutschen Außenamts-Staatssekretärs Richard von Kühlmann vor dem Reichstag am 24. Juni die alliierte Stimmung. Von Kühlmann verkündete, dass der Krieg allein mit militärischen Mitteln nicht mehr gewonnen werden könne. Der alliierte Oberbefehlshaber Foch beschloss daraufhin eine Offensive innerhalb von 2 Monaten. Von Kühlmann musste zurücktreten, aber der Schaden war bereits angerichtet.
Ein letzter deutscher Versuch, am 15. Juli 1918 bei Reims eine Großoffensive zu starten, schlug nach mäßigen Anfangserfolgen fehl – trotz sorgfältiger Vorbereitung und Geheimhaltung. Durch hochstehenden Verrat, Dekodierungserfolge und Aussagen Gefangener waren die Franzosen wohl vorbereitet gewesen. Die Initiative ging von nun an auf die Entente über.
Während die Deutschen noch überlegten, ob sie erneute Angriffe planen oder lieber zur Defensive übergehen sollten, griffen die Franzosen am 17. Juli 1918 aus dem Wald von Villers-Cotterêts mit Renault-Panzern an und erzielten einen beträchtlichen Erfolg. Foch mobilisierte dafür 26 Divisionen, unterstützt durch 400 Tanks und 1100 Flugzeuge.
Abb. 8 Georg Bruchmüller, genannt »Durchbruchmüller«. Beim »Unternehmen Michael« zog er 6500 Geschütze und 3500 Grabenmörser zusammen und ließ in nur 5 Stunden 1,6 Millionen Granaten abschießen.
Obgleich den Deutschen rechtzeitige Vorinformationen über den geplanten französischen Angriff vorlagen, wurden diese nicht an die vorderen Linien weitergegeben. Deutsche Soldaten wurden so auf den Getreidefeldern bei der Erntehilfe für französische Bauern und ihre eigenen Vorräte völlig vernichtet.
Die Franzosen vermochten ihre Attacke überwiegend nur noch mit Kolonialtruppen durchzuführen, da die eigenen Personalverluste vorher so hoch gewesen waren. Auch hier neigte sich der »Menschenvorrat« dem Ende zu!
Von da an kam es zu einer immer größeren Nervosität bei der deutschen Führung, und man zog sich am 20. Juli 1918 ohne großen Verlust über die Marne zurück.
Auch die Alliierten zeigten sich darüber enttäuscht, dass es seit der Offensive von Villers-Cotterêts keine größeren Fortschritte gegeben hatte.
Die deutsche Oberste Heeresleitung plante dann auch neue Angriffe, und die schwere deutsche Artillerie des genialen Artillerieführers Georg Bruchmüller rollte bereits in Richtung des neuen Angriffsziels in Flandern.
Als Ausweg aus der Krise hatten sich die Engländer aber zu einer großen Offensive entschlossen. Wegen massiver eigener Personalverluste in den Frühjahrsschlachten 1918 setzten sie alle Erwartungen auf die Kanadier und Australier. Ein Einsatz der Franzosen und Amerikaner galt den Strategen Seiner Majestät als zu riskant. Entscheidendes erhoffte man sich durch den Massenangriff von Tanks.
Doch trotz des französischen Erfolgs vom 17. Juli herrschte im englischen Kriegskabinett am 25. Juli tiefer Pessimismus vor: Deutschland verfüge trotz seines Fehlschlags vor Reims immer noch über genügend substanzielle Reserven. Ein weiterer erfolgreicher deutscher Angriff gegen die Engländer würde zur endgültigen Aufgabe der Kanalhäfen in Frankreich und Belgien führen.
Trotz erneuten Vorwissens des deutschen Oberkommandos traten die Engländer dann am 8. August 1918 mit einem Großangriff gegen die kaum befestigten deutschen Linien an und erzielten große Erfolge. Die Warnung war nicht an die Front weitergegeben worden.
Zwischen Albert und Montdidier griffen 32 Divisionen mit 430 Tanks, 3000 Geschützen und 1900 Flugzeugen an. Innerhalb weniger Stunden gelang es, die deutschen Linien auf 20 Kilometer Breite zu durchbrechen. Ein Durchbruch in die Tiefe gelang aber nicht!
Dabei hätte man die englische Offensive durchaus verhindern können: So unterbrach eine hervorragende Division Württemberger die Vorbereitungen des 3. englischen Korps für die kommende Offensive, verstärkte ihre Positionen und war für den Angriff am 8. August bereit. Demzufolge konnte das 3. englische Korps nicht mit anderen Korps der 4. Armee am 8. August Schritt halten. Man ließ so die linke Flanke zwangsweise offen für deutsches Flankenfeuer, was beim Großangriff hohe Verluste unter den Entente-Truppen verursachte.
Am 8. August 1918 zeigten aber bereits Teile der deutschen Truppen bei der Schlacht von Amiens einen Mangel an Kampfgeist.
So berichtete General Ludendorff, dass damals eine Elite-Fahrrad-Brigade, die an die Front vorrückte, von sich zurückziehenden Kameraden als »Streikbrecher« beschimpft wurde. Ganze Einheiten gaben sich ohne einen einzigen Schuss schon gefangen, als der Feind noch 800 Meter entfernt war.
Auch die Engländer stimmten dann überein, dass die deutsche Armee am 8. August nicht mehr die furchterregende Kampfmaschine war, die sie nur Wochen vorher noch dargestellt hatte. Die deutschen Verluste am 8. August: 16 Divisionen aufgerieben, davon gerieten 53000 (!) Mann in Gefangenschaft.
Auch General Oskar von Hutier, der erfolgreiche »Durchbruchsgeneral«, berichtete am 10. August 1918, dass vorrückende Reserven auch an anderen Stellen als »Streikbrecher« beschimpft worden seien.
Ähnliche Berichte gingen beim Chef des deutschen Alpenkorps ein, dessen Truppen als »Dummbayern« – und wieder – als »Streikbrecher« »begrüßt« wurden.
Selbst die zwei österreichischen Divisionen, die zur Verstärkung nach Frankreich beordert worden waren, wurden beim Anmarsch von deutschen Reserveeinheiten als »Kriegsverlängerer« beschimpft.
Stand eine organisierte Aktion dahinter? Wir wissen es nicht.
Von Hutier berichtete auch über merkwürdige Befehle und häufig wechselnde Anordnungen, die ihm von der OHL übermittelt wurden. Die Schuld an der Niederlage vor Amiens gab er der OHL! Stimmte hier bei Teilen der OHL bereits etwas nicht?
Allerdings war schon am 10. August 1918 – nach lediglich 2 Tagen – klar, dass die englische Offensive erneut ihren Dampf verloren hatte. Die Deutschen hatten sich von ihrem Anfangsschock erholt und kämpften trotz schwerer und schwerster Verluste oft bis zum letzten Mann. Die »Streikenden« waren offensichtlich bereits zu den Engländern übergelaufen!
Abb. 9 Im Kampfgelände um Fismes. Ein typisches Bild aus den Verfolgungskämpfen. Feuerndes deutsches 7,7-cm-Geschütz im bisher verschont gebliebenen Gelände.
Die deutschen Generale stimmten dann auch darin überein, dass sich die Moral ihrer Fronttruppen wieder erholt hatte.
Die alliierten Tanks erlitten bei Amiens entsetzliche Verluste gegen die deutschen Panzerabwehrgeschütze. So waren am 9. August noch 145 Tanks einsatzbereit, am 11. August gerade noch 38. Am Ende blieben 6 (!) übrig! Alliierten Panzerbesatzungen musste »Urlaub« versprochen werden, damit sie überhaupt wieder in ihre »eisernen Särge« stiegen.
Die Entente hatte zwar den Offensivgeist der Deutschen gebrochen, aber keine großen operativen Gewinne erzielt. Tatsächlich hatte der taktische Erfolg des 8. August 1918, der später als »Schwarzer Tag« des deutschen Heeres in die Geschichte eingehen sollte, nur die Spitze des deutschen Geländegewinnes während der »Michael«-Offensive vom Frühjahr 1918 zurückerobert.
Der psychologische Schaden bei der deutschen Führung war dennoch beträchtlich und fraß sich schnell wie ein Krebsgeschwür weiter.
Am 14. August 1918 fand dann ein Treffen im Großen Hauptquartier im belgischen Spa statt, das vom Kaiser selbst geleitet wurde. Wie Admiral Paul von Hintze, der fähige neue deutsche Außenminister, mitteilte, war er von General Hindenburg darüber instruiert worden, dass weitere Angriffe nicht möglich seien und dass Deutschland nun versuchen werde, die Entente durch eine Defensivstrategie abzunutzen.
Die Generale zeigten sich davon überzeugt, dass die deutsche Armee weiterhin auf französischem Boden bleiben würde. So war es dann auch bis Kriegsende.
Selbst höchste alliierte Offiziere wie General William Robertson glaubten trotz aller Erfolge um Amiens nicht länger an die Möglichkeit eines größeren Durchbruchs durch die Westfront, der zur Zerstörung der deutschen Armee geführt hätte.
Die Lage des Deutschen Kaiserreichs war nach 4-jährigem Massengemetzel gegen eine Welt von Feinden im Sommer 1918 sicherlich nicht brillant, aber auch nicht so hoffnungslos, wie es heute gern dargestellt wird. Als Beispiel moderner Geschichtswissenschaft kann hier die »Hunderttageoffensive« gelten. Nach dem »Schwarzen Tag von Amiens« hat sie bis November 1918 angeblich zur völligen Zerstörung der deutschen Armee geführt.
Die Wahrheit über die »siegreiche Hunderttageoffensive« der Entente
Heute bezeichnet man im modernen Sprachgebrauch die »Hunderttageoffensive« als die letzte Phase des Ersten Weltkriegs an der Westfront.
Nach dem »Schwarzen Tag des Deutschen Heeres« am 8. August 1918 unternahmen die Alliierten bis zum 11. November 1918 eine Reihe von Angriffen gegen deutsche Soldaten. Diese Angriffsserie war an sich keine geschlossene Operation, sondern eine rasche Folge einzelner alliierter Geländegewinne, die am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstand von Compiègne endeten. Wichtig ist, dass die Deutschen dabei Gelände räumten, das sie bereits seit 1914 besetzt hielten.
Nach Aufgabe der Stellungen »Siegfried«, »Hermann«, »Hunding« und »Brunhilde« fanden die letzten Kämpfe vom 11. November 1918 im offenen Gelände vor der Antwerpen–Maas-Stellung statt, die zur Verteidigung als letzte Bastion vor dem Rhein in aller Eile ausgebaut worden war.
Allerdings waren die Kämpfe so erbittert, dass die Sieger während ihrer Hunderttageoffensive bis zuletzt weit mehr Verluste erlitten als ihre Gegner. Diese Einbußen an Toten und Verwundeten erinnerten an die schlimme Zeit in der Anfangsphase des Krieges im Jahre 1914.
Die Engländer verloren so im Zeitraum vom 8. August (Amiens) bis zum 11. November (Waffenstillstand) über 400000 Soldaten; dabei sind die französischen und US-amerikanischen Toten noch nicht inbegriffen. Dies war weit mehr, als die Engländer während der »Existenzkrise« ihrer Armee im März und April 1918 einbüßten.
Sah die Geschichtsschreibung seit Jahrzehnten die »Hunderttageoffensive« als eine einzige alliierte Erfolgsgeschichte, sind Militärhistoriker in dieser Frage neuerdings differenzierter Meinung.
Es geht dabei um das Konzept der »Abwehrschlachten«, das die deutsche Armee ab August 1918 im Westen anwandte. Damit wollte man Zeit gewinnen, um nach einem Ausharren bis Winter 1918/19 wieder in eine stärkere Position zu kommen, von der aus man begrenzt offensive Operationen starten könnte.
Die dahinter stehende Idee bestand darin, die Alliierten durch eine Reihe von aufeinanderfolgenden zeitraubenden, fürchterlichen Verteidigungsschlachten so zu schwächen, dass ihre Kampffähigkeit gelähmt würde.