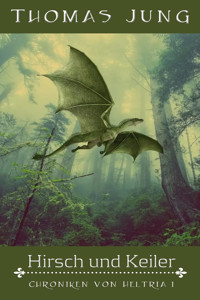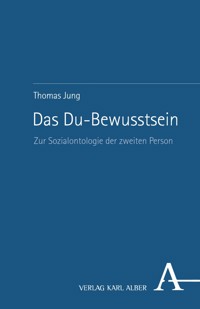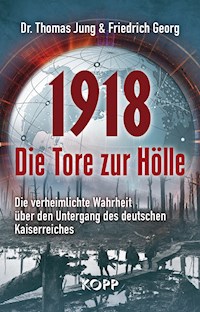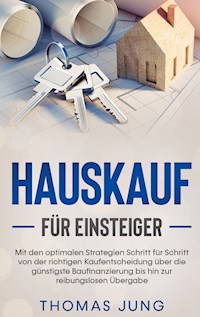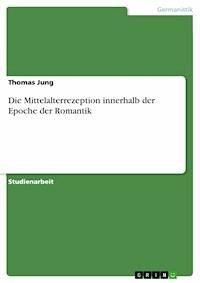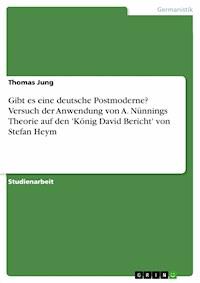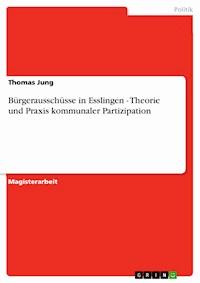Präsentismus im Handlungsfeld von Personalführung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement E-Book
Thomas Jung
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind oder sich krank fühlen. Ein komplexes Phänomen, das seit einigen Jahren verstärkt unter dem Begriff "Präsentismus" diskutiert wird. Doch welche Bedeutung hat dieses Phänomen für Personalführung und das Betriebliche Gesundheitsmanagement? Ist Präsentismus ein Phänomen, welches aus betrieblicher Sicht zu verhindern, in Kauf zu nehmen oder gar zu begrüßen ist? Thomas Jung greift diese Fragen auf und rückt das Phänomen Präsentismus in den Kontext des Personal- und Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Dabei nimmt er eine interdisziplinäre Analyse des Phänomens vor und zeigt auf, dass Präsentismus weit mehr ist, als "nur" krank zur Arbeit zu gehen. Neben praktischen Fallbeispielen wird ein anwendungsbezogener Orientierungsrahmen für den betrieblichen Umgang mit Präsentismus geschaffen, der sowohl Hintergründe und Zusammenhänge des noch jungen Forschungsfeldes veranschaulicht als auch konkrete Handlungsmöglichkeiten und -strategien aufzeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Thomas Jung
Präsentismus im Handlungsfeld von Personalführung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement
Thomas Jung
Präsentismus im Handlungsfeld von Personalführung undBetrieblichem Gesundheitsmanagement
Tectum Verlag
Thomas Jung
Präsentismus imHandlungsfeld von Personalführung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement
©Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden2017Zugl. Diss. Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr Hamburg 2016
ISBN: 978-3-8288-6693-5(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3910-6 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: foxaon1987
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de
BibliografischeInformationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sindim Internet überhttp://dnb.ddb.de abrufbar.
Meinen Eltern,
die mir den Wert der Bildung vermittelt haben
Die vorliegende Arbeit wurde unter dem Titel „Das Phänomen Präsentismus im Handlungsfeld von Personalführung und Betrieblichem Gesundheitsmanagement. Hintergründe, Zusammenhänge und praktische Relevanz einer neuen Herausforderung für Unternehmen?“ an der Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr Hamburg als Dissertation eingereicht.
Alle Personenbezüge in dieser Arbeit beziehen sich jeweils auf die feminine und maskuline Form. Um die Lesbarkeit der Arbeit zu erhöhen, wird in den weiteren Ausführungen aber zumeist nur auf ein Geschlecht Bezug genommen.
Danksagung
Wenige Dinge im Leben sind so einmalig, wie die Zeit und der Augenblick!
Deshalb möchte ich am Ende eines langen Prozesses die Gelegenheit nutzen, um mich bei all jenen Menschen herzlich zu bedanken, die mir die Erstellung dieser Arbeit erst ermöglicht haben, indem sie mir ihre Zeit geschenkt und mich auf meinem Weg unterstützt und begleitet haben.
An erster Stelle möchte ich meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Peter Nieder für die fachliche Betreuung, konstruktive Kritik sowie sein Vertrauen und seine Zeit danken, die er mir auch über seine Emeritierung hinaus geschenkt hat. Ebenso bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Michel E. Domsch, der ohne zu zögern das Zweitgutachten für meine Arbeit übernommen hat.
Großer Dank gilt außerdem allen Teilnehmern und Unterstützern der Unternehmensbefragung, ohne deren Interesse, Engagement und Daten die Arbeit in der vorliegenden Form nicht zustande gekommen wäre. Darüber hinaus möchte ich mich bei allen Gesprächs- und Interviewpartnern für ihr entgegengebrachtes Vertrauen, ihre Offenheit und nicht zuletzt ihre Zeit bedanken, die sie sich trotz der gefüllten Terminkalender für die ausführlichen Gespräche mit mir genommen haben. Im Besonderen gilt dieser Dank Herrn Dr. Koch, Herrn Dr. Rohrbeck sowie Herrn Dr. Tscharnezki. Des Weiteren danke ich Frau Dr. Metje für die wertvollen methodischen Hinweise und Frau Draack für die gute organisatorische Unterstützung bei der Durchführung der Befragung.
Ein großes persönliches Dankeschön gilt überdies meiner Schwester Christina für ihr unermüdliches Korrekturlesen und ihre konstruktiven Hinweise sowie meiner Freundin Denise für ihre Geduld und Zuversicht.
Abschließend möchte ich mich bei Amy und allen anderen herzlich bedanken, die mich auf vielfältige Weise nicht nur fachlich und sachlich, sondern vor allem auch mental bei der Realisierung meines Vorhabens unterstützt und mir Kraft gegeben haben. Ganz besonders gilt dies für meine Familie. DANKE!
Thomas Jung
Münster, im Februar 2016
Vorwort
Für alle Menschen besteht ein Tag aus 24 Stunden. Für die meisten Menschen setzt sich ein Tag aus Arbeits- und Freizeit zusammen. Viele Menschen entscheiden sich täglich:
Gehe ich heute zur Arbeit oder gehe ich nicht?
Für die Mehrzahl der Menschen ist das eine Entscheidung wie für das Zähneputzen. Grundsätzlich können dabei zwei Phänomene entstehen: Absentismus oder Präsentismus.
Präsentismus beschreibt die Entscheidung der Mitarbeiter zur Arbeit zu gehen, obwohl sie krank sind oder sich krank fühlen. Das Phänomen rückt seit ca. 10 Jahren stärker in den Blick des Personalmanagements. Gleichzeitig ist festzustellen, dass das Konzept des „Betrieblichen Gesundheitsmanagements“ eine immer größere Verbreitung findet.
Absentismus ist die Entscheidung eines Mitarbeiters, dem Arbeitsplatz fern zu bleiben, auch wenn es dafür keine medizinische Notwendigkeit gibt. Er beschreibt die motivationsbedingte Abwesenheit.
Thomas Jung will mit seiner Arbeit sowohl einen Beitrag zur weiteren Fundierung und Differenzierung des Phänomens Präsentismus leisten als auch einen praxis- und anwendungsbezogenen Orientierungsrahmen für den betrieblichen Umgang mit Präsentismus schaffen, welcher Hintergründe und Zusammenhänge erläutert, aber auch Handlungsmöglichkeiten und -strategien aufzeigt.
Obwohl das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Präsentismus in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, steht seine Erforschung noch am Anfang und erfolgte bislang aus einer medizinisch-psychologisch geprägten Perspektive heraus. Folglich wurden vor allem Aspekte wie Risikofaktoren, Verbreitung, Ursachen und Folgen in zahlreichen Studien untersucht oder Instrumente zur Messung von Präsentismus entwickelt. Ebenso liegen (auch für Deutschland) erste unternehmensbezogene Untersuchungen vor, die sowohl die Häufigkeit als auch die wirtschaftlichen Konsequenzen für das jeweilige Unternehmen analysieren.
Blickt man jedoch aus der Perspektive des Personalmanagements auf das Phänomen Präsentismus, so liegt hierzu bislang keine wissenschaftliche Arbeit vor, die eine unternehmensübergreifende und praxisorientierte Analyse des Phänomens Präsentismus vornimmt oder ein integriertes Konzept zum betriebliche Umgang mit Präsentismus vorstellt.
Thomas Jung schließt diese Lücke und beantwortet die folgenden drei Fragen:
1.Welche wissenschaftliche Bedeutung hat das Phänomen Präsentismus für das Personal- und Betriebliche Gesundheitsmanagement?
2.Welche betriebliche Relevanz hat das Phänomen Präsentismus für das Personal- und Gesundheitsmanagement in deutschen Unternehmen?
3.Wie soll ein integriertes Konzept zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus aus Sicht der Personalführung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements gestaltet sein?
Die Antwort besteht in einem sehr umfassenden Grundlagenteil, in dem auf Arbeit und Gesundheit, Arbeitsunfähigkeit, Fehlzeiten und Betriebliches Gesundheitsmanagement eingegangen wird. Im Mittelpunkt steht eine empirische Studie in der Form einer schriftlichen Befragung, die detailliert beschrieben wird.
Drei Praxisbeispiele werden ausführlich dargestellt und ein Betriebliches Präsentismus-Management entwickelt.
Aus den aufgezeigten Forschungsdefiziten zu Präsentismus werden folgende Fragen definiert, die durch die empirische Studie beantwortet werden sollen:
1.Welche Bedeutung hat Präsentismus für Unternehmen in Deutschland?
2.Welches Präsentismus-Verständnis liegt in diesem Unternehmen vor?
3.Wie schätzen die Unternehmen den mit Präsentismus verbundenen Handlungsbedarf ein?
4.Welche Ansätze verfolgen diese Unternehmen im Umgang mit Präsentismus sowie kranken und leistungsgeminderten Mitarbeitern im Arbeitskontext?
5.Welche konkreten Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Präsentismus lassen sich daraus (auch für andere Arbeitgeber) ableiten?
Bezogen auf die Studie lässt sich festhalten, dass es trotz methodischer Einschränkungen hinsichtlich der Stichprobe und Repräsentativität der Ergebnisse gelingt, die Fragen zu beantworten. Insbesondere bieten die Ergebnisse, neben Erkenntnissen zum Umgang mit Präsentismus, einen unternehmens- und branchenübergreifenden Überblick über dessen Bedeutung, Verständnis und Herausforderungen für das Personal- und betriebliche Gesundheitsmanagement.
Damit ist es Thomas Jung zum einen gelungen, einen Beitrag zur Klärung der wissenschaftlichen Bedeutung des komplexen und interdisziplinären Phänomens Präsentismus für das Personal- und Betriebliche Gesundheitsmanagement zu leisten. Zum anderen konnte erstmalig in Deutschland eine unternehmens- und branchenübergreifende Untersuchung zur betrieblichen Relevanz, zum vorliegenden Begriffsverständnis sowie zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus vorgenommen und aus den Erkenntnissen ein systematisches Konzept für ein Betriebliches Präsentismus-Management abgeleitet werden.
Prof. Dr. Peter Nieder
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1Einleitung
1.1Zielsetzung
1.2Vorgehensweise
2Grundlagen und Hintergründe zu Präsentismus
2.1Grundlagen des Phänomens Präsentismus
2.1.1Der Begriff Präsentismus und seine Entwicklung
2.1.2Definitionen und Grundverständnisse von Präsentismus
2.1.2.1Gesundheits- und verhaltensorientierte Definitionen
2.1.2.2Produktivitäts- und defizitorientierte Definitionen
2.1.2.3Definitionen im erweiterten Sinne von Präsentismus
2.1.2.4Zusammenfassende Betrachtung der Definitionen und Grundverständnisse von Präsentismus
2.1.3Präsentismus in Abgrenzung zu anderen Konzepten des Personalmanagements
2.1.3.1Absentismus, innere Kündigung und Präsentismus
2.1.3.2Workaholismus und Burnout
2.1.4Präsentismus-Definitionen im Sinne dieser Arbeit
2.2Arbeit und Gesundheit
2.2.1Arbeit und Arbeitswelt
2.2.2Gesundheit und Wohlbefinden
2.2.3Krankheit und Arbeitsunfähigkeit
2.2.4Differenzierung zwischen Gesundheit und Krankheit
2.2.5Konzept der Arbeits(bewältigungs)fähigkeit
2.2.6Konzept der Salutogenese
2.3Arbeitsunfähigkeiten und Fehlzeiten
2.3.1Grundlagen zur Erhebung und Berechnung von Fehlzeiten
2.3.2Fehlzeitenentwicklung im Überblick
2.3.3Arbeitsunfähigkeiten nach Krankheitsarten
2.3.4Bedeutung von psychischen Erkrankungen
2.3.5Bedeutung von Alter und demografischer Entwicklung
2.3.6Gesundheitsverhalten und Fehlzeiten
2.4Gesundheit als Handlungsfeld des Personalmanagements
2.4.1Kennzahlen und Routinedaten
2.4.2Rechtliche und normative Regelungen und Rahmen
2.4.2.1Rechtliche Grundlagen des BGM
2.4.2.2Normen, Standards und Sebstverpflichtungen
2.4.2.3Betriebliche Gesundheitspolitik
2.4.2.4Präsentismus aus arbeitsrechtlicher Sicht
2.4.3Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) – Grundlagen und zentrale Handlungsfelder
2.4.3.1Definitionen und Ziele von BGM
2.4.3.2Handlungsbereiche
2.4.3.3Gestaltungsgrundsätze
2.4.3.4Mindeststandards und Kernprozesse
2.4.3.5Integrierte BGM-Modelle
2.4.3.6Wirksamkeit und betriebswirtschaftlicher Nutzen
2.4.3.7Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
2.4.3.8Betriebliches Fehlzeitenmanagement (BFM)
2.4.3.9Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
2.4.4Gesunde Personalführung
2.5Folgerungen für das Personalmanagement – Zwischenfazit I
3Forschungsfeld Präsentismus
3.1Das Konzept Präsentismus
3.2Möglichkeiten der Erfassung von Präsentismus
3.2.1Erfassung der Präsentismus-Häufigkeit
3.2.2Erfassung präsentismusbedingter Produktivitätsverluste und Kosten
3.2.3Erfassung der Präsentismus-Neigung
3.3Häufigkeit von Präsentismus
3.3.1Präsentismus in Deutschland
3.3.2Präsentismus als Verhalten
3.4Präsentismus als Produktivitätsverlust
3.4.1Produktivitätsverluste im Überblick
3.4.2Produktivitätsverluste nach Krankheitsbildern
3.4.3Kritische Einordnung der Ermittlung präsentismusbedingter Produktivitätsverluste
3.5Präsentismus als Kostenfaktor
3.5.1Betriebswirtschaftliche Kosten durch Präsentismus
3.5.2Volkswirtschaftliche Kosten durch Präsentismus
3.5.3Limitierende Faktoren der Kostenberechnung von Präsentismus
3.6Mögliche Gründe für Präsentismus
3.6.1Personenbezogene Einflussfaktoren
3.6.1.1Soziodemografische Merkmale
3.6.1.2Gesundheitszustand
3.6.1.3Persönlichkeit
3.6.1.4Arbeitsverhalten
3.6.1.5Werte, Einstellungen und Motive
3.6.2Arbeitsbezogene Einflussfaktoren
3.6.2.1Arbeitsplatzunsicherheit
3.6.2.2Beruf und Charakteristik der Tätigkeit
3.6.2.3Arbeitsorganisation
3.6.2.4Unternehmens-, Fehlzeiten- und Führungskultur
3.6.2.5Rahmenbedingungen
3.6.3Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren
3.7Präsentismus und seine Folgen für die Gesundheit
3.7.1Pathogenetische Auswirkungen
3.7.2Salutogenetische Auswirkungen
3.8Interventionsansätze
3.9Zwischenfazit II – „Alter Wein in neuen Schläuchen?“
4Präsentismus als Herausforderung für das Personalmanagement? Eine Studie zu Bedeutung und Umgang von Präsentismus in deutschen Unternehmen
4.1Konzeption und Methodik der Studie / Untersuchung
4.1.1Zielsetzung und Fragestellungen
4.1.2Studiendesign
4.1.3Stichprobe
4.1.4Datenerhebung
4.1.5Datenauswertung
4.1.6Methodische Einschränkungen
4.2Durchführung der Befragung
4.2.1Durchführung
4.2.2Erhebungsinstrument
4.2.3Rücklauf und Akzeptanz
4.3Deskriptive Analyse und Ergebnisse
4.3.1Merkmale der Befragungsteilnehmer
4.3.2Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
4.3.3Präsentismus-Verständnis
4.3.4Umgang mit Präsentismus
4.4Zusammenfassung und Ausblick
5Präsentismus-Management im Kontext von BGM und Personalführung
5.1Praxisbeispiele zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus
5.1.1Präventionscoaching und Mitarbeiter-Arbeitsplatz-Matching – am Beispiel der MAN Truck & Bus AG Salzgitter
5.1.1.1Die Ausgangssituation
5.1.1.2Ein Gefährdungs- und Belastungsatlas für das Werk
5.1.1.3Mitarbeiter-Arbeitsplatz-Matching – Ein Verfahren zur leidensadäquaten Arbeitsplatzbesetzung
5.1.1.4Verhaltensprävention im Werk
5.1.1.5Verhaltensoptimierung durch Präventionscoaching und Gesundheitsschicht
5.1.1.6Schlussfolgerungen für den Umgang mit kranken und leistungsgeminderten Mitarbeitern
5.1.2Gesundheitsmanagement unter der Maxime: „Vernetztes Handeln und Kooperation“ – am Beispiel der Salzgitter AG
5.1.2.1Die Ausgangssituation
5.1.2.2Konzeptionelle Ausrichtung
5.1.2.3Vernetztes Handeln und Kooperation
5.1.2.4Psychosoziale und -mentale Unterstützung mit niederschwelligem Zugang
5.1.2.5Kooperationsprojekt zur Betreuung Beschäftigter mit psychischen Erkrankungen
5.1.2.6Angebote zur muskulo-skelettalen Gesundheit
5.1.2.7Arbeitsplatzbezogene Medizinische Trainings-Therapie als interne Präventions-Maßnahme
5.1.2.8Ambulante Schmerztherapie für chronisch Erkrankte
5.1.2.9Schlussfolgerungen für den Umgang mit kranken und leistungsgeminderten Mitarbeitern
5.1.3Präsentismusmanagement auf 3 Ebenen – am Beispiel der Unilever Deutschland Holding
5.1.3.1Die Ausgangssituation
5.1.3.2Präsentismus-Befragung zur BGM-Ausrichtung
5.1.3.3(Neu-)Ausrichtung des BGM auf drei Interventionsebenen
5.1.3.4Umgang mit kranken und leistungsgeminderten Mitarbeitern
5.1.3.5Schlussfolgerungen für ein ganzheitliches BGM
5.2Betriebliches Präsentismus-Management (BPM) – ein konzeptioneller Ansatz im Kontext von BGM und Personalführung
5.2.1Anforderungen an ein BPM
5.2.2Integration des BPM in das betriebliche Fehlzeiten- und Gesundheitsmanagement
5.2.3 Präsentismus-Analysen im Rahmen des BPM
5.2.3.1Präsentismus-Impuls-Analyse (für Führungskräfte)
5.2.3.2Betrieblich-sytematische Präsentismus-Analyse
5.2.4Maßnahmenplanung
5.2.5Implementierung und Realisierung
5.2.6Kritische Einordnung des BPM-Konzeptes
6Resümee und Ausblick
7Literaturverzeichnis
8Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abs.Absatz
AFArbeitsfähigkeit
aMTTarbeitsplatzbezogene Medizinische Trainingstherapie
ANArbeitnehmer
APArbeitsplatz
ArbSchGArbeitsschutzgesetz
ArbStättVArbeitsstättenverordnung
ArbVArbeitsvertrag
ArbZGArbeitszeitgesetz
ARCAmbulantes Reha Centrum
ASAArbeitssituationsanalyse
ASiGArbeitssicherheitsgesetz
AUArbeitsunfähigkeit
AU-FälleArbeitsunfähigkeitsfälle
AU-TageArbeitsunfähigkeitstage
A&G-MSArbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem
BABetriebsarzt
BÄDBetriebsärztlicher Dienst
BAGBundesarbeitsgerichts
BAuABundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BDSGBundesdatenschutzgesetz
BEMBetriebliche Eingliederungsmanagement
BetrVGBetriebsverfassungsgesetz
BFMBetriebliches Fehlzeitenmanagement
BGBerufsgenossenschaft
BGFBetriebliche Gesundheitsförderung
BGMBetriebliches Gesundheitsmanagement
BGPBetriebliche Gesundheitspolitik
BIPBruttoinlandsprodukt
BKKBetriebskrankenkasse
BPMBetriebliches Präsentismusmanagement
BtrVGBetriebsverfassungsgesetz
BUrlGBundesurlaubsgesetz
BVBetriebsvereinbarung
BMASBundessozialministerium für Arbeit und Soziales
BMGBundesministerium für Gesundheit
CMPChronic nonspecific musculoskeletal pain
DGBDeutscher Gewerkschaftsbund
DGFPDeutsche Gesellschaft für Personalführung
DGUVDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DINDeutsches Institut für Normung
DRVDeutsche Rentenversicherung
EAP„Employee Assistance Program“
EFLEvaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit
Etc.Et cetera
GDAGemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie
GewOGewerbeordnung
GGGrundgesetz
GNPGemeinsame nationale Präventionsstrategie
GUVGesetzliche Unfallversicherung
FASiFachkraft für Arbeitssicherheit
HoLHealth-oriented Leadership
ICD-10International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. (10th Revision)
IGAInitiative Gesundheit und Arbeit
IBindividual boundarylessness
MuSchGMutterschutzgesetz
MAMitarbeiter
MABMitarbeiterbefragungen
MAMMitarbeiter-Arbeitsplatz-Matching
MHMedizinischen Hochschule
NAKNationale Arbeitsschutzkonferenz
NPKPräventionskonferenz
OEOrganisationsentwicklung
OROdds Ratio
PEPersonalentwicklung
PFPersonalführung
PIAPräsentismus-Impuls-Analyse
PrävGPräventionsgesetz
ROIReturn on Investment
RRRelative Risk
SGB IXSozialgesetzbuch; Neuntes Buch
StBAStatistisches Bundesamte
TUTechnische Universität
TVTarifvertrag
Vgl.Vergleiche
WAIWork Ability Index
WHOWorld Health Organization
WIdOWissenschaftliches Institut der AOK
Zit. n.Zitiert nach
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.2:Vorgehensweise in der Arbeit (schematische Darstellung)
Abbildung 2.1.2.4:Definitions- und Bewertungsrahmen von Präsentismus
Abbildung 2.1.3.2:Standardizedsolution (maximumlikelihoodestimates)ofthethree-wavemodelofpresenteeism,N258 (nach:Demeroutietal.)
Abbildung 2.1.4:IntegrierteDarstellungvonPräsentismus
Abbildung 2.2.4:Gesundheits-Krankheits-KontinuumderArbeitsfähigkeit (nachOppolzer)
Abbildung 2.2.5.a:Arbeits-, Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit (nach Treier)
Abbildung 2.2.5.b:Haus der Arbeitsfähigkeit (nach Ilmarinen/Tempel et al.)
Abbildung 2.2.6:Kernelemente des Salutogenese-Modells von Antonovsky (nach Hurrelmann & Richter)
Abbildung 2.3.1:Gruppen von Fehlzeiten (modifiziert nach Nieder)
Abbildung 2.3.2.a:Krankenstandsentwicklung in Deutschland (BMG)
Abbildung 2.3.2.b:Entwicklung Krankenstand und Arbeitslosigkeit (1980 bis 2013)
Abbildung 2.3.2.c:Anteile der AU-Fälle unterschiedlicher Dauer an den AU-Tagen und Fällen 2014 insgesamt (nach DAK-Gesundheit)
Abbildung 2.3.3:AU-Tage nach Diagnosegruppen und Geschlecht (BAuA)
Abbildung 2.3.4:AU-Tage und-Fälle pro 100 Versichertenjahre aufgrund psychischer Erkrankungen (DAK-Gesundheit)
Abbildung 2.3.5.a:Arbeitsunfähigkeit nach Altersgruppen 2013 (BMAS)
Abbildung 2.3.5.b:Bevölkerungspyramiden für die Jahre 2015 und 2035 (StBA)
Abbildung 2.4.1:Elemente einer Betrieblichen Gesundheitsberichterstattung (modifiziert nach Brandenburg & Nieder)
Abbildung 2.4.3.1: Zielhierarchie des integrierten Gesundheitsmanagements (nach: DGFP)
Abbildung 2.4.3.4: Lernzyklus: Kernprozesse des BGM (modifiziert nach Walter)
Abbildung 2.4.3.5.a: Gesamtzusammenhang des integrierten Managementkonzepts (nach Bleicher)
Abbildung 2.4.3.5.b:DGFP-Modell eines integrierten Gesundheitsmanagements (nach DGFP)
Abbildung 2.4.3.5.c:Prozessebenen des integrierten BGM (nach DGFP)
Abbildung 2.4.3.7.a: Konzept der Betrieblichen Gesundheitsförderung (nach Nieder & Michalk)
Abbildung 2.4.3.8.a:Zielgruppen unter den Mitarbeitern (nach Nieder)
Abbildung 2.4.3.8.b:Maßnahmen zur Erhöhung der Anwesenheit (nach Brandenburg & Nieder)
Abbildung 2.4.3.9: Prozess des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
Abbildung 2.4.4: DerHoL-Ansatz. Haus der gesundheitsförderlichen Führung (nach Franke 2012)
Abbildung 3.1.a:Präsentismus-Modell (nach Aronsson & Gustafsson)
Abbildung 3.1.b:Dynamisches Präsentismus-Absentismus-Modell (nach Johns)
Abbildung 3.1.c: Schematisches Präsentismus-Entscheidungsmodell (nach Gerich)
Abbildung 3.2: Ansätze der Erfassung von Präsentismus
Abbildung. 3.3.1:Häufigkeit von Absentismus & Präsentismus (nach BIBB/BAuA)
Abbildung 3.3.2:Verschiedene Aspekte des Präsentismus-Verhaltens
Abbildung 3.4.1.a:Produktivitätsverluste durch Präsentismus und Absentismus (nach Iverson & Lynch)
Abbildung 3.4.2.a:Produktivitätsverluste durch Präsentismus und Fehlzeiten pro Mitarbeiter und Jahr (in Prozent) (nach Goetzel et al.)
Abbildung 3.4.2.b: Chronische Erkrankungen: Häufigkeit, Fehlzeiten und Produktivitätsverluste (nach Baase)
Abbildung 3.5.2.a: Anteil der Einzelerkrankungen am Produktivitätsverlust durch Präsentismus (KPMG Econtech)
Abbildung. 3.5.2.b:Makroökonomischer Effekte von Präsentismus auf die australische Wirtschaft (in Milliarden AUS-Dollar) (nach Econtech)
Abbildung 3.5.3:Limitierende Faktoren bei der Gesamtkostenberechnung von Präsentismus
Abbildung 3.6:Kategorien zentraler Ursachen und Verstärkungsfaktoren von Präsentismus
Abbildung 3.6.1.2:Vergleich verschiedener Symptome bei Präsentisten und Nicht-Präsentisten (in Prozent und bezogen auf die letzten 12 Monate) (nach Aronsson et al.)
Abbildung 3.6.1.5:Ausschlaggebende Gründe für Präsentismus im letzten Jahr (Mehrfachnennungen in Prozent) (nach Zok)
Abbildung 3.7:Gesundheitliche Belastungen bei Präsentisten/Nicht-Präsentisten (in Prozent) (nach Zok)
Abbildung 4.3.1.a: Branche/Wirtschaftsgruppe der Befragten
Abbildung 4.3.1.b: Anteil der überwiegend körperlich tätigen Beschäftigten
Abbildung 4.3.1.c:Position (Hauptfunktion) der Befragten im Unternehmen
Abbildung 4.3.2.a:Steuerung/Zuständigkeit BGM
Abbildung 4.3.2.b:Gegenwärtige und geplante Handlungsfelder BGM/BGF
Abbildung 4.3.2.c:Erhebung gesundheitsbezogener Daten
Abbildung 4.3.2.d: Einschätzung Handlungsbedarfe des Unternehmens
Abbildung 4.3.2.e:Kenntnis und betriebliche Berücksichtigung der DIN SPEC 91020 (BGM)
Abbildung 4.3.3.a:Bestehendes Präsentismus-Verständnis
Abbildung 4.3.3.b:Bewertung des Phänomens Präsentismus
Abbildung 4.3.3.c:Berücksichtigung des Phänomens Präsentismus
Abbildung 4.3.3.d:Bewertung der Herausforderungen und Probleme mit Präsentismus-Bezug
Abbildung 4.3.4.a:Verbindliche Anweisung zum Umgang mit Präsentismus
Tabelle 4.3.4.a:Offene Angaben zu Regelungen, Handlungsanweisungen und Maßnahmen
Abbildung 4.3.4.b:Ermittlung gesundheitsbedingter Produktivitätsverluste am Arbeitsplatz
Abbildung 4.3.4.c:Angebote zur Verbesserung/Förderung der Arbeitsfähigkeit
Abbildung 4.3.4.d: Externe Kooperationen im Umgang mit Präsentismus
Abbildung 4.3.4.e:Bewertung externer Kooperationspartner bei der Integration/Betreuung kranker und leistungsgeminderter Mitarbeiter
Abbildung 5.1.1.3: Matching Arbeitsplatzprofile & Mitarbeiterprofil (nach Rohrbeck & Kunze)
Abbildung 5.1.1.4:Verhaltensprävention. Ablauf Werk Salzgitter (nach Rohrbeck & Kunze)
Abbildung 5.1.2.5:Kooperationsprojekt zur Betreuung von Beschäftigten mit psychischen Erkrankungen (nach Koch et al.)
Abbildung 5.1.2.6: Angebote bei Muskel-Skelett-Erkrankungen (nach Koch et al.)
Abbildung 5.1.2.8:Ambulante Schmerzgruppe (nach Koch et al.)
Abbildung 5.2.2:Implementierung des Präsentismus-Managements in das BGM
Abbildung 5.2.3.1:Situatives Präsentismus-Raster
Abbildung 5.2.4:Interventionsplan des Betrieblichen Präsentismus-Managements
Abbildung 2.2.1.1.a: Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren in West und Ost (1950–2012; Geißler)
Abbildung 2.2.1.1.b: Erwerbstätige nach ihrer Stellung im Beruf (1882–2011; Geißler)
Abbildung 2.2.1.2.a:Erwerbstätige Bevölkerung nach Erwerbsstatus (Eichhorst & Tobsch; Datenquelle: SOEP)
Abbildung 2.2.1.2.b:Anteil und Entwicklung atypischer Beschäftigung (Eichhorst & Tobsch; Datenquelle: SOEP)
Abbildung 2.2.4.a:Dichotomes Konzept von Gesundheit und Krankheit (nach Franke)
Abbildung 2.2.4.b:Bipolares Konzept von Gesundheit und Krankheit (nach Franke)
Abbildung 2.2.4.c:Unabhängigkeitsmodell von Gesundheit und Krankheit (nach Franke)
Abbildung 2.2.4.d:Zweidimensionales Modell von Befund und Befinden (nach Franke)
Abbildung 2.2.5.1:Förderungsmodell der Arbeitsfähigkeit (nach Tempel)
Abbildung 2.2.5.2.a:WAI-Fragebogen
Abbildung 2.2.5.2.b:WAI-Fragebogen (Seite 2)
Abbildung 2.2.5.2.c:WAI-Fragebogen (Seite 3)
Abbildung 2.3.2.d: Krankenstandsentwicklung nach Kassenarten (BMG)
Abbildung 2.3.2.e:AU-Tage der beschäftigten Mitglieder nach Wirtschaftsgruppen – Alter und Geschlecht standardisiert/unstandardisiert im Vergleich (Berichtsjahr 2013; BKK Dachverband)
Abbildung 2.3.3.a:Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach den vier häufigsten Diagnosegruppen 2010 – 2013 (BMAS)
Abbildung 2.3.5. c:Bevölkerungsberechnung für das Jahr 2015 (StBA)
Abbildung 2.3.5. d:Bevölkerungsberechnung für das Jahr 2035 (StBA)
Abbildung 2.3.5.e:Natürliche Bevölkerungsbewegung und Wanderungssaldo (StBA)
Abbildung 2.4.3.5.d:Modell eines integrierten BGM (nach Rimbach)
Abbildung 3.1.d:The model of illness flexibility (nach Johansson & Lundberg)
Abbildung 3.1.e:Integratives Modell des Krankheitsverhaltens am Arbeitsplatz (nach Hägerbäumer)
Abbildung 3.2.2:Stanford-Formel zur Gesundheitskostenrechnung (nach Schulte-Meßtorff & Wehr)
Abbildung 3.4.1.b:Beeinträchtigungen der Arbeit durch Gesundheitsprobleme nach WPAI (aus den Teilstichproben der Befragten mit gesundheitlichen Problemen, in Anzahl & Prozent; nach Bödeker & Hüsing)
Abbildung 4.1.2:Die Grundidee der Leverage-Salience-Theorie (nach Proner)
Abbildung 4.2.1.a:Anschreiben Unternehmensbefragung (Seite 1)
Abbildung 4.2.1.b:Anschreiben Unternehmensbefragung (Seite 2)
Abbildung 4.2.2.a:Fragebogen Kurzbefragung (Deckblatt & Bearbeitungshinweise)
Abbildung 4.2.2.b:Fragebogen Kurzbefragung (Seite 3)
Abbildung 4.2.2.c:Fragebogen Kurzbefragung (Seite 4)
Abbildung 4.2.2.d:Fragebogen Kurzbefragung (Seite 5)
Abbildung 4.2.2.e:Fragebogen Kurzbefragung (Seite 6)
Abbildung 4.2.2.f:Fragebogen Kurzbefragung (Seite 7)
Abbildung 4.2.2.g: Fragebogen Kurzbefragung (Seite 8)
Abbildung 4.3.1.d:Anzahl der Beschäftigten
Abbildung 4.3.2.1:Bestehen eines Systematischen BGM
Abbildung 4.3.4.f:Führungskräfte-Schulungen Krankheit am Arbeitsplatz (Frage 16)
Abbildung 5.1.1.c:BGM: Ergebnis der Diagnose einer ausgewählten Abteilung (MAN Truck & BUS AG)
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2.1.2.1:Verhaltens- und gesundheitsorientierte Präsentismus-Definitionen
Tabelle 2.1.2.2:Produktivität- und defizitorientierte Präsentismus-Definitionen
Tabelle 2.1.2.3:Erweiterte Präsentismus-Definitionen
Tabelle 2.1.3.1.2: Bestimmungsfaktoren von Präsentismus und Absentismus (nach Preisendörfer)
Tabelle 2.2.1:Grundformen der Arbeit (nach Rudow nach Luczak 1998)
Tabelle 2.2.5:Die 7 WAI-Dimensionen
Tabelle 2.4.4: Abgrenzung transaktionaler und transformationaler Mitarbeiterführung (nach Stock-Homburg)
Tabelle 3.2.1.a:Präsentismus-Skala (nach Hägerbäumer)
Tabelle 3.2.1.b:Präsentismus-Skala (nach Ulich & Nido)
Tabelle 3.2.2:Messinstrumente zur Erfassung von Präsentismus(gekürzte Darstellung; nach Steinke & Badura)
Tabelle 3.2.2:Fragebogen zur Erfassung der Präsentismusneigung (nach Emmermacher)
Tabelle 3.3.1:Häufigkeit von Präsentismus in Deutschland
Tabelle 3.5.1:Gesundheitsausgaben und Produktivitätsverluste nach Erkrankungen - pro Mitarbeiter und Jahr (nach Steinke & Badura)
Tabelle 3.6.1.2: Häufigkeitsverteilung von Gründen für Präsentismus und Absentismus nach Beschwerdeart und Vergleich mit den AU-Fällen (nach Wieland & Hammes)
Tabelle 4.1.4:Befragungstechniken im technisch-methodischen Vergleich (nach Häder)
Tabelle 4.3.4.b:Offene Angaben zu weiteren präsentismusbezogenen Maßnahmen
Tabelle 4.3.4.c:Zusammenfassung empfohlener präsentismusbezogener Maßnahmen
Tabelle 5.2.1:Klassifikation von Präventionsmaßnahmen (nach Leppin)
Tabelle 5.2.4:Interventionsmatrix Präsentismus
Tabelle 2.2.2:Maximen für eine konsensfähige Definition von Gesundheit und Krankheit
Tabelle 2.2.6:Überblick wesentlicher Generalisierter Widerstandsressourcen (nach Franke)
Tabelle 2.3.2:Krankenstandsentwicklung nach Kassenarten (BMG)
Tabelle 2.3.3.:Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach den vier häufigsten Diagnosegruppen 2010 – 2013 (BMAS)
Tabelle 2.4.3.5: Drei Ebenen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (nach Oppolzer)
Tabelle 2.4.3.7:BGM Maßnahmenportfolio mit Beispielen (nach DGFP)
Tabelle 3.4.2.a:Übersicht der Prävalenzen verschiedener Krankheitsbilder (Goetzel et al.)
Tabelle 3.4.2.b:Produktivitätsverluste der zehn wichtigsten Krankheitsbilder (Goetzel et al.)
Tabelle 4.1.2:Grundaussagen der Leverage-Salience-Theorie (nach Menold)
Tabelle 4.2.a:Ansätze zur Optimierung schriftlich-postalischer Befragungen (nach Dilman)
Tabelle 4.2.b: TDM: Anweisungen DILLMANNs (nach Hippler)
Tabelle 4.3.2.1:Erhebung/Analyse sonstiger gesundheitsbezogene Daten
Tabelle 4.3.2.2.a:Vergleichsauswertung Frage 7 bei Unternehmen mit und ohne ABF-Analyse
Tabelle 4.3.2.2.b:Vergleichsauswertung Frage 8 bei Unternehmen mit und ohne ABF-Analyse
Tabelle 4.3.2.2.c:Vergleichsauswertung Frage 18 bei Unternehmen mit und ohne ABF-Analyse
Tabelle 4.3.2.3:Teilauswertung Frage 7 bei Unternehmen mitPräsentismus-Analyse
Tabelle 4.3.2.4:Einschätzung Handlungsbedarfe (tabellarisch)
Tabelle 4.3.3.a:Gegenüberstellung Verständnis und Bewertung von Präsentismus
Tabelle 4.3.3.b:Herausforderungen präsentismusbezogener Sachverhalte (Frage 14)
Tabelle 4.3.4.d:Bewertungexterner Kooperationen im Umgang mit Präsentismus
Tabelle 4.3.4.e: Offene Angaben zu Regelungen, Handlungsanweisungen oder standardisierten Maßnahmen im Umgang mit erkrankten und nur eingeschränkt arbeitsfähigen Mitarbeitern am Arbeitsplatz (Frage 15)
Tabelle 4.3.4.f:Offene Angaben bezüglich weiterer Maßnahmenzur Unterstützung kranker und leistungsgeminderter Mitarbeiter (Frage 19)
Tabelle 4.3.4.g:Als wirksam bewertete Maßnahmen im Umgang mit krankenund leistungsgeminderten Mitarbeitern
Tabelle 5.1.1.a:Übersicht Arbeitsplatz- und Mitarbeiterprofile (nach MAN Truck & BUS AG)
Tabelle 5.1.1.b: Auszug Werksatlas (nach MAN Truck & BUS AG)
1Einleitung
„Viele Mitarbeiter gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind oder sich krank fühlen!“
Zu diesem Ergebnis gelangten zahlreiche deutsche Studien in den letzten Jahren und konstatierten in relativer Übereinstimmung, dass mehr als jeder zweite Mitarbeiter dieses Verhalten mindestens einmal im Jahr zeigte – viele von ihnen sogar mehrfach1. Eine große Zahl unterschiedlichster Studien suggeriert darüber hinaus, dass die Produktivitätsverluste durch anwesende, aber in ihrer Produktivität beeinträchtigte Mitarbeiter die Verluste durch Fehlzeiten weit übersteigen2. Für dieses Phänomen wird sowohl im wissenschaftlichen als auch gesellschaftlichen Diskurs die Bezeichnung ‚Präsentismus‘ verwendet. Und obwohl angenommen werden darf, dass dieses Phänomen ebenso alt ist wie die Erwerbsarbeit selbst, so ist erst seit einigen Jahren zu beobachten, dass Präsentismus stärker in den Blick von Wissenschaft, Gesellschaft und Unternehmen rückt.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass der Faktor ‚Gesundheit in der Arbeit‘ als gegenwärtig wichtiger denn je wahrgenommen wird3. Immer mehr Unternehmen ergreifen Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF). Und auch politisch gewinnt das Handlungsfeld der betrieblichen Gesundheit zunehmend an Bedeutung, wie sich jüngst an der Verabschiedung des Präventionsgesetzes durch den deutschen Bundestag und die damit einhergehende Initiierung einer gemeinsamen nationalen Präventionsstrategie zeigte. Dabei ist unschwer zu erkennen, dass die steigende Bedeutung der betrieblichen Gesundheit in engem Zusammenhang mit den gravierenden Veränderungen der soziodemografischen Strukturen in unserem Land sowie den aktuellen Trends und Entwicklungen in der Arbeitswelt (Globalisierung, Flexibilisierung, Digitalisierung, Individualisierung, steigender Wettbewerbsdruck etc.) steht – wobei die „Rolle des Humankapitals als (kritischer) Erfolgsfaktor immer deutlicher“4 wird.
Blickt man hierzu auf das Fehlzeitengeschehen in Deutschland, so ist der Krankenstand über die zurückliegenden Dekaden insgesamt stark gesunken. Während dieser nach Berechnung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) im Jahr 1980 noch bei 5,67 Prozent lag, sank er bis zum Jahr 2007 auf 3,22 Prozent und bewegt sich seit inzwischen mehr als einem Jahrzehnt auf dem relativ niedrigen Niveau von unter vier Prozent (3,68 Prozent im Jahresdurchschnitt 2014)5, wenngleich manche Krankenkassen seit einigen Jahren wieder leicht steigende Krankenstände konstatieren6.
Da sich Arbeitslosenquote und Krankenstand in der Tendenz leicht gegenläufig entwickeln und der Krankenstand speziell in wirtschaftlichen Krisenzeiten sinkt7, scheint (zumindest) ein Teil des langfristigen Rückgangs der Krankenstände auf die hohe Arbeitslosigkeit zu Beginn sowie die Wirtschaftskrise (mit Kurzarbeit) zum Ende der 2000er Jahre zurückzuführen zu sein und scheint auch zur Erklärung der (im Zuge der wirtschaftlichen Belebung der letzten Jahre) wieder leicht steigenden Krankenstände einiger Krankenkassen beizutragen. Stellt man dem moderaten Anstieg der Fehlzeiten jedoch die außerordentlich gute Wirtschafts- und Beschäftigungslage (mit einer Arbeitslosenquote von deutlich unter sieben Prozent)8 gegenüber, so erklärt dieses Muster allerdings kaum noch die anhaltend niedrigen Krankenstände.
Darüber hinaus zeichnet sich eine deutliche Kausalverschiebung innerhalb des Fehlzeitengeschehens ab, wonach insbesondere psychisch bedingte Erkrankungen seit Ende der 1990er Jahre signifikant an Bedeutung hinzugewonnen haben9. Weitgehend unklar ist allerdings, in welchem Maße jeweils höhere Belastungen der Arbeitswelt, ein verändertes Diagnoseverhalten der Ärzte oder auch die stärkere Sensibilisierung und Bereitschaft der Betroffenen ihre psychischen Erkrankungen anzuerkennen den Anstieg der Fehlzeiten bedingen10.
Betrachtet man die Entwicklungen der niedrigen Krankenstände, des Präsentismus-Verhaltens sowie der Kausalverschiebungen innerhalb des Fehlzeitengeschehens gemeinsam und aus der Perspektive des Personalmanagements, so wird deutlich, dass das Phänomen Fehlzeiten und seine Zusammenhänge dringender denn je einer genaueren Analyse bedarf – obwohl (oder gerade weil) die Krankenstände auf einem historisch niedrigen Niveau liegen.
Dabei ergibt sich eine Vielzahl grundsätzlicher und betrieblicher Fragen, wie die nach dem Zusammenhang zwischen Fehlzeiten und Präsentismus, die nach den Ursachen für anhaltend niedrige Krankenstände, die nach der allgemeinen und betrieblichen Bedeutung des relativ „neuen“ Phänomens Präsentismus oder natürlich die nach den Folgerungen und Konsequenzen, welche es im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Veränderungen der Arbeitswelt für das Personalmanagement daraus abzuleiten gilt.
Während dabei zumindest die grundsätzlichen Zusammenhänge zum Phänomen Fehlzeiten wissenschaftlich gut erforscht sind11 und die Herausforderung für das Personalmanagement primär in der betrieblichen Analyse und der konkreten Anwendung des bestehenden Wissens zu suchen ist, steht die Forschung zu Präsentismus erst am Anfang, sodass bislang nur wenig anwendungsbezogene Erkenntnisse zum betrieblichen Umgang mit dem Präsentismus vorliegen und auch der theoretisch-konzeptionelle Rahmen noch großen Forschungsbedarf aufweist.
Die vorliegende Arbeit soll daher diesem spannenden Themenkomplex gewidmet werden und das Phänomen Präsentismus aus Sicht des Personalmanagements und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements näher beleuchten.
Dabei entspricht es der Intention des Autors, mit dieser Arbeit sowohl einen wissenschaftlichen Beitrag zur weiteren Fundierung und Differenzierung des Phänomens Präsentismus zu leisten, als auch einen praxis- und anwendungsbezogenen Orientierungsrahmen für den betrieblichen Umgang mit Präsentismus zu schaffen, welcher Hintergründe und Zusammenhänge erläutert, aber auch Handlungsmöglichkeiten und -strategien aufzeigt.
1.1Zielsetzung
Obwohl das wissenschaftliche Interesse am Phänomen Präsentismus in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, steht seine Erforschung noch am Anfang und erfolgte bislang insbesondere aus einer medizinisch-psychologisch oder aber ökonomisch geprägten Perspektive heraus. Folglich wurden vor allem Aspekte wie Risikofaktoren, Verbreitung, Ursachen und Folgen in zahlreichen Studien (teils detailliert) untersucht oder Instrumente zur Messung von Präsentismus entwickelt (siehe Kapitel 3). Ebenso liegen (auch für Deutschland) erste unternehmensbezogene Untersuchungen vor, die sowohl die Häufigkeit als auch die wirtschaftlichen Konsequenzen für das jeweilige Unternehmen analysieren.
Blickt man jedoch aus der Perspektive des Personalmanagements auf das Phänomen Präsentismus, so liegt hierzu bislang keine wissenschaftliche Arbeit vor, die eine unternehmensübergreifende und praxisorientierte Analyse des Phänomens Präsentismus vornimmt oder ein integriertes Konzept zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus vorstellt.
Ziel der vorliegenden Arbeit soll es daher sein, diese Lücke zu schließen und die folgenden drei Fragestellungen zu beantworten:
1.Welche wissenschaftliche Bedeutung hat das Phänomen Präsentismus für das Personal- und Betriebliche Gesundheitsmanagement?
2.Welche betriebliche Relevanz hat das Phänomen Präsentismus für das Personal- und Gesundheitsmanagement in deutschen Unternehmen?
3.Wie sollte ein integriertes Konzept zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus aus Sicht der Personalführung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements gestaltet sein?
Somit folgt diese Arbeit im Wesentlichen zwei Pfaden, die in einem integrierten Konzept zusammengeführt werden sollen. Mit dem ersten Pfad soll der theoretisch-konzeptionelle Rahmen zu Präsentismus möglichst umfassend ermittelt und in den Kontext des Personalmanagements gerückt werden. Hierbei kommt es dem Autor neben der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes besonders darauf an, die interdisziplinären Zusammenhänge (beispielsweise zum Arbeitsrecht oder den Sozial- und Gesundheitswissenschaften) herauszuarbeiten, um einen Beitrag zu einem ganzheitlicheren Präsentismus-Verständnis zu leisten.
Der zweite Pfad bildet den praxis- und anwendungsorientierten Kern dieser Arbeit. Hierbei sollen vor allem Erkenntnisse über Begriffsverständnis und Relevanz, aber auch konkrete Ansätze zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus ermittelt werden, die ebenfalls einem ganzheitlicherem (und praxisbezogenerem) Präsentismus-Verständnis dienen und final in das integrierte Konzept einfließen sollen.
Das abschließende Ziel bildet das integrierte Konzept zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus. Dieses soll zum einen die Integration eines Präsentismus-Managements in das Konzept das BGM aufzeigen und zum anderen konkrete Handlungsansätze bieten, die dem hohen Stellenwert der Personalführung beim Umgang mit Präsentismus Rechnung tragen. In diesem Fall geht es neben der wissenschaftlichen Erweiterung des Präsentismus-Konzeptes primär um ein praxistaugliches Konzept für die betriebliche Personalarbeit (im Sinne eines Leitfadens für die Implementierung eines Präsentismus-Managements).
1.2Vorgehensweise
Nachdem der Bezugsrahmen für die Arbeit hergeleitet und die forschungsleitenden Fragen definiert sind, soll nachfolgend die weitere Vorgehensweise der Untersuchung systematisch erläutert werden (siehe Abbildung 1.2).
Die ersten beiden Schritte (Grundlagen und Stand der Forschung) richten sich dabei auf die Beantwortung der ersten Forschungsfrage und die wissenschaftliche Bedeutung des Phänomens Präsentismus für Personalmanagement und BGM.
Aufgrund der komplexen und interdisziplinären Verflechtung des Phänomens und seiner Einflussbereiche ist es im Rahmen der Grundlagenbetrachtung (Kapitel 2) erforderlich, dieses nicht isoliert, sondern in seinen unmittelbaren und mittelbaren Handlungsbereichen zu untersuchen, um eine annäherungsweise Darstellung seiner vielschichtigen Zusammenhänge zu ermöglichen – was jedoch einen umfangreicheren Rahmen (als in vergleichbaren Arbeiten üblich ist) zur Folge hat. Hierbei gilt es insbesondere die Bereiche Arbeit und Gesundheit (siehe Kapitel 2.2), Arbeitsunfähigkeit und Fehlzeiten (siehe Kapitel 2.3) und (im übertragenen Sinne) das Handlungsfeld der Mitarbeitergesundheit im Rahmen des Personalmanagements (siehe Kapitel 2.4) näher zu beleuchten.
Darauf aufbauend erfolgt im Rahmen der nächsten beiden Schritte die Untersuchung des Forschungsgegenstandes im Feld. Durch eine explorative Feldstudie sollen dabei zunächst die betriebliche Relevanz, das in der Praxis vorherrschende Begriffsverständnis sowie der betriebliche Umgang mit Präsentismus untersucht werden (Kapitel 4). Über drei ausgewählte Unternehmensbeispiele werden außerdem Strategien und Lösungsansätze zum betrieblichen Umgang mit Präsentismus aufgezeigt (Kapitel 5.1). Im Rahmen eines anwendungsorientierten Konzeptes für ein integriertes Präsentismus-Management erfolgt schließlich eine Zusammenführung der theoretisch und praktisch gewonnenen Erkenntnisse (Kapitel 5.2):
Abbildung 1.2:Vorgehensweise in der Arbeit (schematische Darstellung)
Grundlagen & Hintergründe (Kapitel 2):
Inhaltlich richtet sich der erste Blick unmittelbar auf das Phänomen Präsentismus, um die definitorische und konzeptionelle Grundlage für den weiteren Verlauf dieser Arbeit zu schaffen. Dabei sollen einerseits die verschiedenen Definitionsansätze, Grundverständnisse und Forschungsstränge hergeleitet und zum anderen Abgrenzungen zu anderen Konzepten des Personalmanagements (Absentismus, Innere Kündigung, Workaholismus und Burnout) vorgenommen werden. In Kapitel 2.1.2.4 erfolgt darüber hinaus eine zusammenfassende Betrachtung der heterogenen Definitionen und Grundverständnisse und in Kapitel 2.1.4 wird abschließend ein eigenes Definitionsverständnis von Präsentismus (im engeren und weiteren Sinne) hergeleitet, welches zugleich die Arbeitsdefinition für den weiteren Gang der Untersuchung bildet.
Entsprechend der ersten Fragestellung besteht ein Kernziel der Arbeit darin, die wissenschaftliche Bedeutung des Phänomens Präsentismus für die Handlungsfelder des Personalmanagements und des BGM zu eruieren (siehe Kapitel 1.1). Hierzu sollen durch das Kapitel „Grundlagen“ zentrale Begriffe geklärt, Abgrenzungen vorgenommen und wichtige interdisziplinäre Zusammenhänge aufgezeigt beziehungsweise hergeleitet werden.
Das zweite Grundlagenkapitel zu Arbeit und Gesundheit erläutert zentrale Hintergründe und theoretische Konzepte bezüglich Arbeit und Gesundheit. Neben einer interdisziplinären Betrachtung von Gesundheit sollen unter anderem wichtige Unterscheidungen wie die zwischen Krankheit und Arbeitsunfähigkeit oder Gesundheit und Krankheit vorgenommen sowie die zentralen Konzepte der Salutogenese sowie der Arbeitsbewältigungsfähigkeit hergeleitet werden. Im Hinblick auf Präsentismus ist dabei speziell dessen Zuordnung und auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Kapitel 2.2.4) von konzeptioneller Bedeutung.
Aufgrund der inhaltlich-konzeptionellen Nähe des Phänomens Präsentismus zu den Aspekten der Arbeitsunfähigkeit (AU) und Fehlzeiten befasst sich das nächste Teilkapitel mit deren Zusammenhängen und Hintergründen sowie zentralen Entwicklungen und Trends wie dem demografischen Wandel, der steigenden Bedeutung der psychischen Gesundheit sowie dem individuellen Gesundheitsverhalten.
Darüber hinaus gilt es einen schließenden Blick auf die Gesundheit als zentrales Handlungsfeld für das Personalmanagement zu richten. Neben Kennzahlen und Routinedaten soll hierbei der rechtliche und normative Bezugsrahmen hergeleitet werden und in Kapitel 2.4.2.4 eine arbeitsrechtliche Bewertung von Präsentismus vorgenommen werden. Außerdem sollen Grundlagen und (im Hinblick auf Präsentismus) zentrale Handlungsfelder des BGM diskutiert sowie die wichtige Rolle der Vorgesetzten für das Gesundheits- und Präsentismusverhalten ihrer Mitarbeiter aufgezeigt werden.
Forschungsstand Präsentismus (Kapitel 3):
Während in Kapitel 2.1 bereits der definitorische und begriffliche Rahmen zu Präsentismus hergeleitet wurde, soll auf der Grundlage des aktuellen Forschungsstandes in Kapitel 3 darüber hinaus eine theoretisch-konzeptionelle Betrachtung vorgenommen werden.
Im Fokus der Untersuchung sollen dabei der konzeptionelle Rahmen von Präsentismus, Ursachen und Determinanten, mögliche Erfassungsmethoden sowie die Häufigkeit, Produktivitätsverluste und Kosten, aber auch gesundheitliche Folgen und Interventionsmöglichkeiten stehen.
Explorative Studie (Kapitel 4):
Bereits die Herleitung des theoretischen Rahmens zu Präsentismus zeigt auf, welcher ausgeprägten Heterogenität und Inkonsistenz die gegenwärtigen Definitionen und Begriffsverständnisse zu Präsentismus unterliegen (siehe Kapitel 2.1) und sich mutmaßlich auch in der betrieblichen Praxis widerspiegeln. Insofern erscheint es grundsätzlich zielführend zu sein, Grundlagenforschung im Hinblick auf das in den Unternehmen vorherrschende Präsentismus-Verständnis zu betreiben, um langfristig einen inhaltlichen Referenzrahmen für etwaige Interventionsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen zu schaffen. Ein kleiner Beitrag soll hierzu im Rahmen einer explorativen branchenübergreifenden Unternehmensbefragung geleistet werden (Kapitel 4). Hierdurch sollen zum einen Erkenntnisse über das in der betrieblichen Praxis vorliegende Präsentismus-Verständnis sowie zum anderen über Handlungs- und Interventionsbedarfe sowie bereits ergriffene Maßnahmen gewonnen werden.
Präsentismus-Management (Kapitel 5):
Dem praxis- und anwendungsorientierten Anspruch dieser Arbeit folgend, sollen abschließend Möglichkeiten eines gezielten Präsentismus-Managements aufgezeigt werden. Und wenngleich die individuellen Besonderheiten der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter kein Patentrezept zum Umgang mit Präsentismus zulassen, soll durch ausgewählte Unternehmensbeispiele (Kapitel 5.1) sowie der Herleitung eines integrierten Konzeptes zum Umgang mit Präsentismus (Kapitel 5.2) zumindest ein erster Orientierungsrahmen für den betrieblichen Umgang mit Präsentismus geschaffen werden, der die theoretisch-konzeptionellen Erkenntnisse der vorherigen Schritte reflektiert.
1Vgl. z. B.: (DAK-Gesundheit, 2014); (Schnee & Vogt, 2013); (Oldenburg, 2012); (Wieland & Hammes, 2010); (DGB-Index Gute Arbeit, 2009); . (Schmidt & Schröder, 2010); (Preisendörfer, 2010); (Zok, 2008a)
2Vgl. z. B.: (Baase, 2007, S. 52); (Goetzel, et al., 2004); (Bödeker & Hüsing, 2008); (Fissler & Krause, 2010)
3Vgl. (Rudow, 2011, S. 5f.)
4(Scholz, 2014, S. V)
5Vgl. (BMG, 2015a, S. 20)
6Vgl. z. B. (Meyer, Böttcher, & Glushanok, 2015, S. 346f.); (Techniker Krankenkasse, 2015, S. 98); (Knieps & Pfaff, 2014, S. 36f)
7Vgl. (Brandenburg & Nieder, 2009, S. 26); (Oppolzer, 2010, S. 187f.)
8Vgl. (Statistisches Bundesamt, 2015a)
9Vgl. (Marschall, Nolting, Hildebrandt, & Sydow, 2015, S. 19ff.); (Meyer, Böttcher, & Glushanok, 2015, S. 368ff.); (BKK Bundesverband, 2012, S. 41f.)
10Vgl. (Marschall, Nolting, & Hildebrand, 2013, S. 54ff.); (Lohmann-Haislah, 2012); (Badura, 2010, S. 10f.)
11Vertiefend hierzu siehe: (Brandenburg & Nieder, 2009); (Marr, 1996)
2Grundlagen und Hintergründe zu Präsentismus
Das Phänomen Präsentismus umfasst mehr als „nur“ krank zur Arbeit zu gehen, wenn man es ganzheitlich und vor dem Hintergrund seiner interdisziplinären Zusammenhänge definiert. Um diese jedoch verständlich darstellen zu können, bedarf es zunächst einiger Begriffsklärungen, Abgrenzungen und theoretischer Herleitungen, die den inhaltlichen Rahmen dieses Kapitels bilden und in perspektivischer Anlehnung an das Personalmanagements erfolgen sollen.
Beginnend mit dem Forschungsgegenstand dieser Arbeit wird in Kapitel 2.1 eine definitorische Eingrenzung und begriffliche Herleitung des Phänomens Präsentismus vorgenommen. Diese solle zum einen die Komplexität und Heterogenität des Themas verdeutlichen, aber zugleich eine klare inhaltliche Abgrenzung zu anderen Konzepten des Personalmanagements sowie eine umfassende Erläuterung der verschiedenen Forschungsstränge und Grundverständnisse ermöglichen und durch eine eigene Präsentismus-Definition zusammengeführt werden.
In Kapitel 2.2 werden zentrale Hintergründe und theoretische Konzepte zum Themenkomplex Arbeit und Gesundheit hergeleitet. Neben Differenzierungen und Erläuterungen der Aspekte Arbeit und Arbeitswelt sowie Gesundheit und Krankheit werden dabei unter anderem die zentralen Konzepte der Salutogenese sowie der Arbeitsbewältigungsfähigkeit diskutiert.
Der nächste Themenblock befasst sich mit Arbeitsunfähigkeiten und Fehlzeiten (siehe Kapitel 2.3). Dabei sollen Grundlagen und Berechnungsverfahren dargestellt sowie aktuelle Trends und Entwicklungen thematisiert und Schwerpunktthemen wie psychische Erkrankungen, demografische Veränderungen sowie das Gesundheits- und Fehlzeitenverhalten von Mitarbeitern analysiert werden.
Kapitel 2.4 bringt darüber hinaus die elementare Bedeutung des Handlungsfeldes der Gesundheit für das Personalmanagement zum Ausdruck. Neben der Thematisierung gesundheitsrelevanter Kennzahlen und Routinedaten werden sowohl rechtliche als auch normative Regelungen und Rahmen für das Handlungsfeld der Gesundheit im Unternehmen dargestellt und in Kapitel 2.4.2.4 eine arbeitsrechtliche Bewertung von Präsentismus vorgenommen. Dabei soll der abschließende Blick der Grundlagenbetrachtung auf die zentralen Themen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie die gesunde Personalführung gerichtet werden.
2.1Grundlagen des Phänomens Präsentismus
Versucht man sich dem Phänomen Präsentismus inhaltlich zu nähern, so wird sehr schnell deutlich, dass es sich um ein sehr komplexes und sowohl in der öffentlichen als auch wissenschaftlichen Diskussion äußerst heterogen definiertes und interpretiertes (mitunter sogar instrumentalisiertes) Phänomen handelt.
Bevor jedoch der Forschungsstand zu Präsentismus (in Kapitel 3) dargestellt wird, soll im Rahmen der nachfolgenden Teilkapitel zunächst eine begriffliche Herleitung und definitorische Eingrenzung des Phänomens vorgenommen werden (siehe Kapitel 2.1.1/2). Wie diese Kapitel dabei bereits zeigen werden, haben sich zu Präsentismus verschiedene Grundverständnisse und Forschungsstränge herausgebildet die in Kapitel 2.1.2.4 zusammengefasst und erläutert werden sollen.
Weil es bislang aber nicht gelungen ist, eine einheitliche und allgemeingültige Definition von Präsentismus zu erarbeiten, wird im Hinblick auf ein klares Verständnis des Phänomens außerdem eine inhaltliche Abgrenzung zu anderen Konzepten des Personalmanagements vorgenommen, welche größere Schnittmengen zum Phänomen Präsentismus aufweisen (siehe Kapitel 2.1.3), um in Kapitel 2.1.4 (über die Entwicklung einer eigenen Präsentismus-Definition) schließlich die definitorische Grundlage für den weiteren Verlauf dieser Arbeit zu schaffen.
2.1.1Der Begriff Präsentismus und seine Entwicklung
Unter dem deutschen Begriff ‚Präsentismus‘ und seinen verschiedenen englischsprachigen Bezeichnungen werden sowohl in der nationalen wie internationalen Betrachtung eine Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte und Zusammenhänge dargestellt und diskutiert (siehe auch Kapitel 2.1.2).
Abgeleitet aus dem englischen Wort ‚present‘ (anwesend) und angelehnt an den Terminus ‚absenteeism‘ (Abwesenheit oder Fehlzeiten) entstand der Begriff ‚presenteeism‘ (Präsentismus) zunächst in Nordamerika. Die erstmalige Verwendung des Begriffs ‚presentee‘ wird dabei dem Autor Mark Twain und seinem im Jahr 1892 erschienenen Buch „The American Claimant“ zugeschrieben12 – („there was an absentee who ought to be a presentee“13). Vereinzelte Verwendungen des Begriffs „presenteeism“ lassen sich daneben auch in Fachzeitschriften der 1930er und 40er Jahre belegen14.
Im arbeitswissenschaftlichen Kontext wird die erstmalige Verwendung des Begriffs ‚presenteeism‘ dem US-amerikanischen Arbeitswissenschaftler Auren Uris zugeschrieben15, der die Bezeichnung zugleich als Titel für seinen im Jahr 1955 publizierten Artikel „How to build Presenteeism“ verwendete16. Im selben Jahr erschien der von Canfield und Soash verfasste Aufsatz „Presenteeism – A constructive View“17. Inhaltlich sind beide Publikationen vor dem Hintergrund hoher Fehlzeiten in Unternehmen zu sehen – denen über die Erhöhung der Anwesenheit begegnet werden sollte („changing absenteeism to presenteeism“18). Beide Arbeiten folgten dabei einem insgesamt positiven Grundverständnis von Präsentismus und setzten Präsentismus mit der Anwesenheit von Mitarbeitern am Arbeitsplatz gleich.19 Bedeutsamen Einzug in die Literatur erfuhr der Begriff in jener Zeit hingegen nicht.
Im Jahr 1970 griff David Smith den Begriff in seiner Publikation „Absenteeism and presenteeism in industry“ erneut auf und bemerkte einleitend, dass der Term ‚presenteeism‘ bis zu diesem Zeitpunkt in keinem Dictionary zu finden sei20. Dabei entsprach Smiths Begriffsverständnis noch weitgehend dem der Publikationen der 1950er Jahre, wenngleich der Titulierung seines Aufsatzes bereits die Intention zum Ausdruck bringt, den Begriff Präsentismus parallel zu „absenteeism“ zu implementieren und den inhaltlichen Fokus stärker auf die Anwesenheit zu lenken21.
Im Zuge weitreichender Restrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen vieler Unternehmen in den 1980er und 1990er Jahren wurde der Begriff Präsentismus – insbesondere im britischen Raum – auch für die Beschreibung unverhältnismäßig langer Arbeits- beziehungsweise Präsenzzeiten („Face Time“) genutzt22 und bereits vereinzelt auf das Arbeiten von Beschäftigten unter Stress oder trotz Krankheit erweitert23. Einhergehend mit dieser Erweiterung erfolgte zudem eine negative Konnotierung des Begriffs, indem Aspekte wie die Angst vor beruflichen Nachteilen oder dysfunktionale Folgeerscheinungen (etwa unproduktiv genutzte Arbeitszeit) mit Präsentismus assoziiert wurden. 1996 definierte der britische Wirtschaftswissenschaftler Cooper Präsentismus als „being at work when you should be at home either because you are ill or because you are working such long hours that you are no longer effective”24 und schrieb dem Begriff damit sowohl eine verhaltens- und gesundheits- als auch produktivitätsorientierte Komponente zu. In einer Studie zu unverhältnismäßig langen Anwesenheitszeiten wählte Simpson diesbezüglich sogar die Bezeichnung „competitive presenteeism“ und beschrieb damit die Instrumentalisierung von Anwesenheitszeiten zum gegenseitigen Wettbewerb in Unternehmen25 – („compete over who stays longest in the office“26).
Eine nachhaltige Etablierung des Begriffs ‚Präsentismus‘ in die wissenschaftliche sowie ökonomische Diskussion lässt sich ab Ende der 1990er Jahre verzeichnen, als insbesondere in Nordamerika und Skandinavien zahlreiche Publikationen zum Thema erschienen. So gaben etwa Burton und Conti dem Präsentismus-Diskurs im Jahr 1999 einen maßgeblichen Impuls, als sie mit „The real measure of productivity“ eine Untersuchung publizierten, in der sie – bezogen auf Mitarbeiter der US-Amerikanischen Großbank ‚Bank One‘ – Produktivitätsverluste und Kosten analysierten, die durch anwesende, aber in ihrer Leistung eingeschränkte Mitarbeiter am Arbeitsplatz hervorgerufen werden27. Einen weiteren zentralen Beitrag zur wissenschaftlichen Etablierung des Begriffs Präsentismus leisteten Koopmann et al., als sie im Jahr 2002 mit der „Stanford Presenteeism Scale“ ein Messinstrument vorstellten, durch welches Präsentismus (im Sinne von individuellen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und Produktivität durch gesundheitliche Probleme) explizit gemessen werden konnte28. Vor allem in den USA entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren ein primär produktivitäts- und kostenorientiertes Forschungsinteresse an Präsentismus29 (siehe auch Kapitel 2.1.2).
Außerhalb von Nordamerika wird das Phänomen Präsentismus seit Ende der 1990er Jahre insbesondere in Skandinavien intensiv erforscht. Entgegen dem Begriffsverständnis, welches jenseits des Atlantiks dominiert, entwickelte sich in Europa indes ein weniger produktivitäts- und kostenorientiertes als vielmehr verhaltens- und gesundheitsorientiertes Forschungsinteresse an Präsentismus30. Prägende Impulse für den Diskurs setzten dabei insbesondere Aronsson, Gusafsson und Dallner mit ihrer vielzitierten Querschnittsstudie „Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism“31. Zum Teil wird dem Phänomen – in Europa – dabei auch eine Bedeutung beigemessen, die deutlich über ein produktivitäts- und/oder verhaltensorientiertes Verständnis von Präsentismus hinaus geht und Präsentismus eine „eigenständige Bedrohung der Gesundheit“32 zuspricht – etwa durch Verschleppung, Chronifizierung und damit Verschlechterung des Krankheitsbildes (siehe Kapitel 3.7.1)33.
In Deutschland nahm der Begriff Präsentismus erst Mitte der 2000er Jahre nachhaltig Einzug in den wissenschaftlichen Diskurs. Besonderen Einfluss hatte dabei der im Jahr 2005 ins Deutsche übersetzte Aufsatz von Paul Hemp „Krank am Arbeitsplatz“ (engl. Originaltitel: „Presenteeism: At Work – But Out of It“), in welchem er neben der Darstellung des Phänomens auf die immensen Kosten verweist, die der amerikanischen Studien zufolge durch Präsentismus entstehen34. Dennoch entwickelte sich – analog zu Skandinavien – aber auch in Deutschland ein überwiegend verhaltens- und gesundheitsorientiertes Forschungsinteresse und Begriffsverständnis von Präsentismus35, in dessen Kontext inzwischen eine Vielzahl Studien durchgeführt wurden36 (siehe Kapitel 3.3.1). Eigene Befragungsergebnisse zum Verständnis von Präsentismus in deutschen Unternehmen und Behörden zeigen allerdings auch, dass der Begriff zwar weitgehend bekannt ist, weiterhin aber sehr heterogen definiert und interpretiert wird (siehe Kapitel 4.3.3).
Dennoch lässt sich für den deutschsprachigen Diskurs resümierend festhalten, dass der Begriff „Präsentismus“ trotz verschiedener Definitionen und Grundverständnisse (siehe Kapitel 2.1.2) zumindest sprachlich einheitlich gebraucht wird.
Für den englischsprachigen Diskurs lässt sich diese begriffliche Uniformität hingegen nicht konstatieren. Neben der Bezeichnung ‚presenteeism‘ wird analog auch der Begriff „sickness presenteeism“ von zahlreichen Autoren verwendet37. Ferner existieren eine Vielzahl begrifflicher Abwandlungen und alternierender Termini wie „impaired presenteeism“38, „inappropriate non-use of sick leave/ working through illness“39, „sickness presence“40 „sickness attendance“41, „competitive presenteeism“42, „pregnant presenteeism“43, „decreased presenteeism“44, „non-sickness presenteeism“45 oder „non-work presenteeism“46, womit in vielen Fällen Teilaspekte oder Spezifizierungen des Phänomens pointiert werden sollen.
2.1.2Definitionen und Grundverständnisse von Präsentismus
Die Herleitung und Begriffsbestimmung von Präsentismus hat bereits aufgezeigt, dass es sich um ein sehr vielschichtiges und interdisziplinär diskutiertes Phänomen handelt, dem verschiedenste Definitionen zugrunde liegen. In der Literatur haben sich dabei – weitgehend unabhängig voneinander – zwei zentrale Forschungsstränge beziehungsweise Grundverständnisse herausgebildet (siehe unten) auf die sich der wesentliche Teil der bisherigen Forschungsaktivitäten konzentriert. Dennoch ist es bislang weder gelungen den Begriff Präsentismus allgemeingültig zu definieren noch theoretisch-konzeptionell klar zu umreißen47 (siehe auch Kapitel 3.1).
So definiert Hemp Präsentismus zum Beispiel als „Produktivitätsverluste auf Grund tatsächlicher Gesundheitsprobleme“48, Simpson betrachtet das Phänomen im Sinne einer unverhältnismäßig langen Präsenz am Arbeitsplatz49 und nach Ulich wird Präsentismus als der „Sachverhalt beschrieben, dass Mitarbeitende zwar anwesend, aber infolge einer gesundheitlichen oder anderweitigen Beeinträchtigung nicht voll leistungsfähig sind“50. Nach Brandenburg & Nieder sowie Hansen & Andersen handelt es sich dabei allgemein um das „Verhalten von Mitarbeitern, trotz Krankheit zur Arbeit zu kommen“51/„turning up at work despite ill-health”52 und Jungreuthmayer definiert Präsentismus als gefühlten „Drang, der Arbeitspflicht nachzukommen, auch […] unter eingeschränkter Leistungsfähigkeit und Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit […]“53.
Um das breite Definitions-Spektrum von Präsentismus dennoch strukturiert aufzeigen zu können, sollen in den nachfolgenden Teilkapiteln verschiedene Definitionsansätze näher betrachtet werden. In Anlehnung an die beiden zentralen Grundverständnisse (welche selbst in Kapitel 2.1.2.4 zusammenfassend diskutiert werden) erfolgt die Übersicht der Definitionen getrennt nach gesundheits- und verhaltensorientierten Definitionen (Kapitel 2.1.2.1), nach produktivitäts- und defizitorientierten Definitionen (Kapitel 2.1.2.2) sowie im erweiterten Sinne von Präsentismus (Kapitel 2.1.2.3).
Die Herleitung und Diskussion des eigenen Definitionsverständnisses – dieser Arbeit – wird darüber hinaus in Kapitel 2.1.4 vorgenommen.
2.1.2.1Gesundheits- und verhaltensorientierte Definitionen
Wie Tabelle 2.1.2.1 zeigt, weisen insbesondere die gesundheits- und verhaltensorientierten Definitionen von Präsentismus eine ausgeprägte Heterogenität auf:
Begriff
Definition / Beschreibung
Autor
A
Präsentismus
“Phänomen, dass “Kranke” zur Arbeit gehen” 54
Zok
B
Sickness attendance
“going to work in spite of illness” 55
Johansson
& Lundberg
C
Sickness presence
“situations where the ability to work is impaired due to disease, but yet the person goes to work” 56
Vingård et al.
D
Präsentismus
„Verhalten – krank zur Arbeit zu gehen, obgleich eine Krankmeldung gerechtfertigt und auch möglich wäre“57
Kramer et al.
E
Sickness presenteeism
“situation in which an employee goes to work despite perceiving herself to be sufficiently ill to have legitimately called sick” 58
Hansen
& Andersen
F
Präsentismus
„Verhalten, sich bei einer Erkrankung nicht krankzumelden sondern arbeiten zu gehen“ 59
Schmidt
& Schröder
G
Sickness presenteeism
“people, although sick, bring themselves to work and record no absences”60
Kivimäki et al.
H
Pregnant presenteeism
“describe pregnant employees who resist taking sick leave” 61
Gatrell
I
Sickness presenteeism
“people, despite complaints and ill health that should prompt rest and absence from work, still turning up at their jobs” 62
Aronsson et al.
J
Sickness presenteeism
„when an employee goes to work despite feeling so ill that he or she judges that sick leave would have been proper” 63
Bergström et al.
K
Präsentismus
“Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz gesundheitlicher oder anderweitiger Beeinträchtigungen, die eine Abwesenheit legitimiert hätte“ 64
Ulich & Nido
L
Präsentismus
„Präsenz am Arbeitsplatz trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Beschwerden, inklusive der damit verbundenen negativen Folgen für die Produktivität im Arbeitsprozess“ 65
Emmermacher
M
Präsentismus
„gefühlter Drang, der Arbeitspflicht nachzukommen, auch wenn dies unter eingeschränkter Leistungsfähigkeit und bei Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit geschieht“ 66
Jungreuthmayer
Tabelle 2.1.2.1:Verhaltens- und gesundheitsorientierte Präsentismus-Definitionen
Betrachtet man die ersten beiden Definitionen (A und B), so wird Präsentismus aus einer allgemeinen verhaltensbezogenen Perspektive heraus als der Sachverhalt beschrieben, dass Beschäftigte ‚krank zur Arbeit gehen‘, ohne dabei Folgen zu benennen oder Aussagen über mögliche Gründe oder Motive zu treffen – also Begriffsbildung mit Ursachenforschung zu vermengen67. Zugleich dient dieses Definitionsmuster sehr oft als eine Art „Kurzprofil“ von Präsentismus und bildet im Kern den Ausgangspunkt der nachfolgenden Definitionen.
Vingård et al. (C) definieren Präsentismus sehr ähnlich als ‚Situationen des Arbeitens trotz krankheitsbedingter Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit‘. Im Unterschied zur vorherigen Definitionsgruppe sind die Folgen aber bereits Teil der Definition. Dabei beziehen sie sich nicht auf den Überbegriff ‚Krankheit‘, sondern auf tatsächlich vorhandene Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit, sodass etwa chronische Erkrankungen nicht in jedem Falle eingeschlossen werden.
In Rahmen des dritten Definitionsmusters (D und E) wird über das suggerierte ‚Erreichen der Arbeitsunfähigkeitsschwelle, bei dem eine Krankmeldung gerechtfertigt wäre‘ außerdem eine indirekte Objektivierung des Krankheitsaspektes vorgenommen. Dieser Arbeitsunfähigkeitsbezug spiegelt sich auch in den Definitionen der nächsten Gruppe (F bis H) wieder, in der Präsentismus im Sinne des ‚Unterlassens einer Krankmeldung beziehungsweise des Verzichts auf Genesung, zugunsten der Arbeit‘ definiert wird. Ohne dass Motive oder Folgen definitorisch einbezogen werden, macht diese Begriffswahl ferner deutlich, dass es sich bei Präsentismus um ein ‚entscheidungsbasiertes Verhalten‘ des Betroffenen handelt.
Die Auswahl I bis J bezieht sich einerseits auf das verhaltens- und gesundheitsorientierte Grundschema von Präsentismus als ‚Arbeiten trotz Erkrankung oder gesundheitlicher Beschwerden‘, nimmt durch den expliziten Zusatz ‚obwohl es ratsam oder empfehlenswert wäre, sich krank zu melden‘ zugleich aber auch eine ausdrücklich negative Konnotierung dieses Verhaltens vor.
Ulich & Nido (Definition K) stellen wie viele andere in ihrer Definition einen direkten Arbeitsplatzbezug her, lösen sich aber ausdrücklich vom Begriff Krankheit und beziehen sich (ähnlich wie Vingård et al.) nur auf ‚tatsächlich vorhandene gesundheitliche oder anderweitige Beeinträchtigungen, die eine Abwesenheit legitimieren‘. Erläuternd betonen sie, dass eine Erkrankung am Arbeitsplatz (etwa bei chronisch Kranken) „nicht notwendigerweise eine tägliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit zur Folge haben“ müsse68.
Mit Definitionsbeispiel L wählt Emmermacher eine gesundheitsorientierte Präsentismus-Definition mit Arbeitsplatzbezug, die zugleich ‚negative Folgen für die Produktivität im Arbeitsprozess‘ ausdrücklich einschließt. Damit schlägt er die Brücke zum Faktor Produktivität, ohne jedoch den Aspekt der ‚gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Beschwerden‘ näher zu spezifizieren.
Auch Jungreuthmayer (Definition M) bezieht die Präsentismus-Folgen unmittelbar in ihre Definition ein. Dabei skizziert sie das Phänomen nicht als Verhalten, sondern in Form eines Zustands, der auch losgelöst von der Präsenz am Arbeitsplatz bestehen kann. Dieser ‚Zustand des gefühlten Dranges der Arbeitsplicht nachzukommen‘ kann sowohl mit ‚Leistungseinschränkungen‘ einhergehen, als auch eine ‚eigenständige Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit‘ zur Folge haben. Zugleich löst sich diese Definition räumlich vom Arbeitsort, um auch die modernen Möglichkeiten der Arbeitserfüllung via Internet, Handy oder Smartphone (im Sinne einer digital-geistigen Präsenz) einzubinden69.
2.1.2.2Produktivitäts- und defizitorientierte Definitionen
Über die gesundheits- und Verhaltensorientierten Definitionsansätze hinaus, bietet Tabelle 2.1.2.2 eine Übersicht verschiedener produktivitäts- und defizitorientierter Präsentismus-Definitionen:
Begriff
Definition / Beschreibung
Autor
N
Presenteeism
“the percentage of time impaired while on the job (eg, decreased productivity and below-normal work quality)”70
Boles et al.
O
decreased presenteeism
„when employees are physically present at their jobs, they may experience decreased productivity and below-normal work quality” 71
Koopman
et al.
P
Präsentismus
„wenn Beschäftigte zur Arbeit kommen, aber durch Krankheit oder Beschwerden nicht voll einsatzfähig sind”72
Iverson
& Krause
Q
Presenteeism
“decreased on-the-job performance due to the presence of health problems”73
Schultz
& Edington
R
Impaired presenteeism
“when workers are physically present but function at less than full productivity because of illness or other health conditions” 74
Turpin et al.
S
Sickness presenteeism
“employees are working less productively due to health or medical problems” 75
Caverley
et al.
T
Presenteeism
„the productivity loss that occurs when workers are on the job but not fully functioning“ 76
Burton
& Conti
U
Presenteeism
“on-the-job productivity loss attributed to poor health and other personal issues” 77
Merrill et al.
Tabelle2.1.2.2:Produktivität-unddefizitorientiertePräsentismus-Definitionen
Bereits auf den ersten Blick weisen diese Definitionen (im Vergleich zu den Gesundheits- und Verhaltensorientierten Ansätzen) eine deutlich größere Homogenität auf. Entsprechend der selektiven Einstufung in Produktivitäts- und defizitorientierte Definitionen ist allen Ansätzen gemein, dass Präsentismus primär über die daraus resultierenden Konsequenzen definiert wird.
Wesentliche Definitionsunterschiede ergeben sich letztlich nur aus den Fragen, inwieweit ein Kausalbezug zwischen dem Gesundheitszustand und den Produktivitätsverlusten hergestellt wird und welcher Art die Konsequenzen sind.
Angelehnt an Tabelle 2.1.2.2 lässt sich Präsentismus somit zusammenfassend als Leistungsbeeinträchtigungen und/oder Produktivitätsverlust im Arbeitsprozess durch gesundheitliche Beeinträchtigungen eines Mitarbeiters definieren.
2.1.2.3Definitionen im erweiterten Sinne von Präsentismus
Über die zuvor betrachteten Definitionsansätze hinaus kann präsentistisches Verhalten in bestimmten Fällen auch dort beobachtet werden, wo keine konkrete Erkrankung oder gesundheitliche Beeinträchtigung eines Mitarbeiters vorliegt (siehe Tabelle 2.1.2.3):
Begriff
Definition / Beschreibung
Autor
V
presenteeism
“the tendency to stay at work beyond the time needed for effective performance on the job” 78
Simpson
W
Non-work presenteeism
“refers to the behaviour of employees who engage in personal activities instead of work-related activities whilst at work” 79
Wan et al.
X
Non-sickness presenteeism
“come to work while physically fine but suffer from conditions like personal financial difficulties, perceived workplace pressure, legal and family problems, and performing at below capacity […]; spend time at work on personal matters thereby losing available work hours” 80
Quazi
Tabelle2.1.2.3:ErweitertePräsentismus-Definitionen
Unabhängig von der Gesundheit eines Mitarbeiters betrachtet Simpson (Definition V) Präsentismus aus einer effizienzorientierten Perspektive heraus. Wie bereits dargestellt (siehe Kapitel 2.1.1), wird Präsentismus in diesem Zusammenhang als die ‚unverhältnismäßig lange Präsenz am Arbeitsplatz‘ oder auch ‚Face Time‘ definiert und somit als Zeit- und Effizienzverlust im Arbeitsprozess verstanden.
Wan et al. lösen sich in ihrer Definition (W) ebenfalls gänzlich vom Gesundheitsbezug und beschreiben unter „non-work presenteeism“ das kontraproduktive Verhalten von Mitarbeitern am Arbeitsplatz, die persönlichen Betätigungen nachgehen, anstatt ihre Arbeitsaufgabe zu verrichten.
Unter dem Begriff „non-sickness presenteeism“ verschmelzen bei Quazi die beiden vorherigen Definitionsverständnisse und werden inhaltlich erneut weiter gefasst. In Abgrenzung zu „sickness presenteeism“ schließt „non-sickness presenteeism“ (physische) Gesundheitsprobleme explizit aus, während sämtliche in der Person des Beschäftigten und dessen Umfeld liegenden Beeinträchtigungen und Produktivitäts- sowie Zeitverluste (die nicht unmittelbar auf eine Erkrankung zurückzuführen sind) in das erweiterte Definitionsverständnis einbezogen werden.
2.1.2.4Zusammenfassende Betrachtung der Definitionen und Grundverständnisse von Präsentismus
Die aufgeführten Definitionen machen deutlich, welche Breite und Heterogenität das inhaltliche Spektrum aufweist, das mit dem Phänomen Präsentismus verbunden wird. Ebenso uneinheitlich bis kontrovers gestaltet sich die Frage der grundsätzlichen Bewertung dieses Phänomens. Handelt es sich dabei um ein Problem, das es zu lösen bzw. zu verhindern gilt, um ein normales Phänomen, das es in Kauf zu nehmen gilt oder um etwas, das grundsätzlich begrüßt werden sollte?
Abbildung 2.1.2.4:Definitions- und Bewertungsrahmen von Präsentismus
Mit Abbildung 2.1.2.4 wird diesbezüglich versucht, die beschriebene Vielfalt der bestehenden Definitions- und Bewertungsmöglichkeiten von Präsentismus zusammenfassend darzustellen. Sie greift Aspekte auf, die in den einzelnen Betrachtungen des Phänomens Berücksichtigung finden und unterstreicht zugleich das theoretisch-konzeptionelle Grundproblem einer fehlenden allgemeingültigen Definition von Präsentismus. Je nach Kontext, Intention sowie einem eher selektiven oder erweiterten Blickwinkel auf das Phänomen und seine Elemente ergeben sich folglich abweichende Definitionen und Bewertungen desselben Begriffs. Darüber hinaus wird in vielen Definitionen der Aspekt des Verhaltens (zum Beispiel: Krank zur Arbeit gehen) mit dem der Konsequenzen (wie Produktivitätsverluste)81 zusammengefasst (beispielsweise Definitionen O bis U), sodass die Schnittmengen dessen, was die jeweiligen Autoren mit Präsentismus verbinden extrem variieren.
Abbildung 2.2.4:Gesundheits-Krankheits-KontinuumderArbeitsfähigkeit (nachOppolzer)269
Die großgeschriebenen Buchstaben (Punkte „A“ und „D“) bilden die Extremwerte des Kontinuums und stehen für einen objektiven und subjektiven „Zustand völliger Gesundheit und Beschwerdelosigkeit („A“) beziehungsweise „Zustand schwerer, manifester Krankheit“ („D“) in Übereinstimmung mit objektiv-medizinischen Befunden und einhergehend einer auch subjektiv empfundenen gravierenden Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit.270 Der „Punkt B charakterisiert das Auftreten einer Befindensstörung oder eines Unwohlseins, wobei das Individuum sich in seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit gestört fühlt. Punkt C markiert den Schritt […] professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und den Arzt aufzusuchen, weil die Leistungsfähigkeit herabgesetzt und die Gesundheit »angeschlagen« ist, sodass es zur Krankschreibung kommen kann“271. In Bezug auf die mittleren Punkte („B“ und „C“) gilt es aber zu berücksichtigen, dass ihre Lage auf dem Kontinuum rein hypothetisch gewählt ist. Sie sind daher immer auf den konkreten Einzelfall bezogen und werden über eine Vielzahl von Faktoren, wie Merkmale der Person oder Charakteristika des Befunds (speziell bei Chronifizierung) bestimmt272.
Aus den vier Punkten des Kontinuums leiten sich drei Stufen der Arbeitsfähigkeit ab. Die erste Stufe („a“) „umfasst zweifellos Gesunde, die aufgrund objektiver und subjektiver Kriterien als »gesund« zu betrachten und in ihrer Leistungsfähigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt sind“273. Sofern diese Personen „krankheitsbedingt“ ihrer Arbeit fernbleiben, handelt es sich um „illegitime Kranke“ (Absentisten) und um Missbrauch der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Die zweite Stufe („b“) „erstreckt sich auf die Grauzone relativer Krankheit bzw. bedingter Gesundheit, die ein breites Spektrum von Befindlichkeiten sowie Krankheitsvor- und Frühstadien einschließlich Erschöpfungszuständen oder chronischen Krankheitsbeschwerden umfassen kann“274. Oppolzer spricht in diesem Zusammenhang von „bedingt legitimen Kranken“, deren gesundheitliche Beeinträchtigungen „zwar einen faktischen Anlass“, aber keinen zwingenden Grund für eine Abwesenheit darstellen275. Die dritte Stufe („c“) bezieht sich auf „behandlungsbedürftig Kranke“, die „schwerwiegendere, manifeste Erkrankungen aufweisen und unter massiven Leistungsminderungen leiden“276. Hierbei handelt es sich um „legitime Kranke“, die eine Abwesenheit zur Regeneration und Wiederherstellung ihrer Leistungs- und Arbeitsfähigkeit benötigen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen277.
Steinke & Badura beziehen sich ebenfalls auf das Kontinuum von Oppolzer und betonen, dass die Unterscheidung zwischen den Stufen „b“ und „c“ wesentlich für das Verständnis der beiden Präsentismus-Stränge (siehe Kapitel 2.1.2) ist278. Folgt man dem ersten (verhaltensorientierten) Präsentismus-Strang, so befindet man sich auf der Stufe „c“ des Kontinuums, während der zweite (produktivitätsorientierte) Präsentismus-Strang die beiden Stufen „b“ und „c“ berücksichtigt279.
Richtet man den Blick wieder auf die Differenzierung und Modelle von Gesundheit und Krankheit, so wird am Arbeitsfähigkeitskontinuum (exemplarisch) der Nachteil bipolarer Konzepte deutlich, nämlich dass sie „Gesundheit und Krankheit als eine gemeinsame Menge [abhängiger Faktoren] auffassen“280, sodass ein mehr an Krankheit automatisch ein weniger an Gesundheit zur Folge hat281. Diesen Nachteil versuchen orthogonale Konzepte auszuschließen, indem Gesundheit und Krankheit als unabhängige (koexistierende) Faktoren dargestellt werden282 (siehe Anlage/Abbildung 2.2.4.c/d). Sie eignen sich daher gut, um zum Beispiel Übereinstimmungen und Abweichungen von objektiven und subjektiven Parametern (wie Befund und Befinden) sichtbar zu machen283.
Auf den Präsentismus-Diskurs übertragen finden von diesen hauptsächlich bipolare Konzepte und Modelle (wie das von Oppolzer oder das der Salutogenese) Berücksichtigung, um zum Beispiel das Präsentismus-Verhalten oder die Arbeitsfähigkeit (siehe Kapitel 2.2.5) einzustufen beziehungsweise Entstehungsprozesse von Präsentismus zu skizzieren. Daneben spielen aber auch dichotome Überlegungen regelmäßigt eine Rolle, wenn es beispielsweise um das Arbeiten trotz Krankheit gegen ärztlichen Rat oder unter Medikation geht.
Auf orthogonale Gesundheits-Modelle wurde der Präsentismus-Diskurs284 – trotz mehrdimensionaler Messinstrumente (siehe Kapitel 3.2) – bislang nicht übertragen. Jedoch erscheint es aus Sicht einer Identifizierung und Kategorisierung von Präsentismus durchaus sinnvoll, den Gedanken eines orthogonalen Präsentismus-Modells aufzugreifen, um die beiden Definitionsstränge integriert erfassen und abbilden zu können. So würde es etwa möglich, Präsentismus-Verhalten einerseits sowie gesundheitliche Beeinträchtigungen, Beschwerden oder Produktivitätsverluste anderseits gemeinsam abzubilden, zu rastern und schließlich Interventionsbedarfe oder potenzielle Gefährdungen zu eruieren. In Kapitel 5.2 soll diese Überlegung daher einbezogen werden.
2.2.5Konzept der Arbeits(bewältigungs)fähigkeit
Arbeitsfähigkeit (auch als ‚Arbeitsbewältigungsfähigkeit‘ oder ‚work ability‘ bezeichnet) ist nach Ilmarinen „die Grundlage, um arbeiten zu können und zu wollen“285. Dabei ist unter Arbeitsfähigkeit (AF) nicht die „Umpolung“ von Arbeitsunfähigkeit zu verstehen286, sondern die Umschreibung, „inwieweit ein Arbeitnehmer in der Lage ist, seine Arbeit angesichts der Arbeitsanforderungen, Gesundheit und mentalen Ressourcen zu erledigen“287. Sie wird damit „nicht abstrakt und allgemein als Fähigkeit zur Arbeit verstanden, sondern als Fähigkeit zu bestimmten Aufgaben in bestimmten Situationen“288. Ilmarinen spricht diesbezüglich auch von einer „Balance zwischen dem was von uns verlangt wird (Arbeitsanforderung), und dem, was wir leisten können (individuelles Potenzial)“289.
AF steht damit im engen Zusammenhang mit den Begriffen der „Leistungsfähigkeit‘ und „Beschäftigungsfähigkeit“, wobei die wesentliche Unterscheidung der Begriffe über den Bezugsrahmen geschieht (siehe Abbildung 2.2.5.a):
Abbildung 2.2.5.a:Arbeits-, Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit (nach Treier)290
Während sich die AF auf „konkrete Arbeitsanforderungen“ bezieht, ist die ‚Leistungsfähigkeit‘ ein von der Arbeit losgelöstes Konstrukt, das sich auf „relativ stabile Personenmerkmale wie Intelligenz, Persönlichkeit oder Gesundheit“ bezieht und etwa an „Normalverteilungen“ oder „gesellschaftlich verankerten Erwartungen“ orientiert. Die ‚Beschäftigungsfähigkeit‘ (auch Employability genannt) ist wiederum eng mit der AF verbunden und auf die „Erfordernisse des Arbeitsmarkts“ bezogen291. Sie stellt die „andauernde Arbeitsfähigkeit“ dar, die sich in dynamischen und sich verändernden Arbeitsmärkten, also in verschiedenen „Person-Situation-Konstellationen“, beweist292.
Das Konzept der AF veranschaulicht Ilmarinen mit dem – arbeitswissenschaftlich viel beachteten – „Haus der Arbeitsfähigkeit“ (siehe Abbildung 2.2.5.b). Dieses Modell verfügt über ein „solides sozial- und arbeitswissenschaftliches Fundament [ ] das in der Praxis mittlerweile vielfache Überprüfung, Bestätigung und Weiterentwicklung erfahren hat“293. Es „liefert ein plausibles Bild der betrieblichen Wirklichkeit“ und ermöglicht „die Schritte auf dem Weg zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Mitarbeiter-Potenziale“ zu beschreiben294.
Abbildung 2.2.5.b:Haus der Arbeitsfähigkeit (nach Ilmarinen/Tempel et al.)295
Das Haus der Arbeitsfähigkeit umfasst vier Stockwerke, welche sinngemäß die Arbeitsfähigkeit (das Dach) tragen. Das unterste Stockwerk bildet die „physische und psychische Gesundheit“ und „Leistungsfähigkeit“ und damit das Fundament, also die Voraussetzung für die AF. Treten in diesem Bereich Veränderungen auf, so wirken sich diese unmittelbar auf die AF aus und können diese bedrohen.296 Das zweite Stockwerk umfasst die Kompetenzen und Qualifikationen eines Menschen. Hierzu zählen Fähigkeiten und Fertigkeiten ebenso wie Wissen, fachliche Qualifikationen oder Schlüsselkompetenzen sowie die wichtige Kompetenz sich durch „lebenslanges Weiterlernen“ an die jeweiligen Begebenheiten und Arbeitsanforderungen anpassen zu können297. Neben Kompetenz geht es auf dieser Etage somit auch um die Bereiche Bildung und Fortbildung298.
Im dritten Stockwerk „werden die Rahmenbedingungen für einen gesunden Betrieb platziert, die durch Werte und Einstellungen als auch Motivation als wichtige Bedingungen für die Arbeitsfähigkeit geprägt sind“299. Hierzu zählen Aspekte wie das Betriebsklima, die Unternehmens- und dort gepflegte Kommunikationskultur oder auch verankerte Menschenbilder sowie gelebte Führungs- und Fehlerkulturen300. Für eine gute AF ist es „wichtig, dass die eigenen Einstellungen und Motivationen im Einklang mit der eigenen Arbeit sind“301.
Der vierte Stock umfasst den zentralen Bereich der Arbeit. Diese Ebene wiegt entsprechend ihrer Komplexität und Relevanz am schwersten und übt sinnbildlich den größten Druck auf die anderen Ebenen aus302. Es geht zum einen um die Arbeitsaufgabe und die damit verbundenen Anforderungen sowie Erwartung an den Mitarbeiter. Zum anderen geht es um das Umfeld der Arbeit (einschließlich der Kollegen und Vorgesetzten), um die Struktur und Organisation (in der sie verrichtet wird) sowie um die Arbeitsumgebung (etwa im Hinblick auf Lärm, Lichtverhältnisse, Mobiliar oder technische Ausstattung)