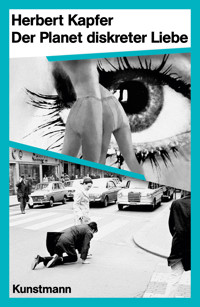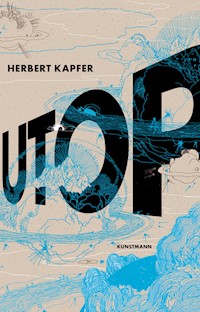19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1919. Deutschland unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Aufstände. Räterepubliken. Freikorpskämpfe. Versailler Vertrag. Dolchstoß, politischer Mord, Revanche und Nazismus: Hätte Geschichte anders verlaufen können? Soldaten, Rückkehrer, Revolutionäre, Minister, Freikorpskämpfer, Gymnasiasten, Matrosen, Monarchisten, Vertriebene, Verliebte, ein Vagabund, eine Zeitungsverkäuferin: In ihren Geschichten präsentieren sich die tausendfachen Probleme einer Zeit, die von den Explosionen des Krieges erschüttert und von der katastrophalen Niederlage geprägt ist, von Hunger, Massenelend und Kriegsgewinnlern, von fanatischem Nationalismus und sozialrevolutionären Ideen, von militärischer Gewalt und Fantasien freier Liebe. In 1919 fließen Hunderte von Splittern, Szenen und Handlungsverläufen aus zeitgenössischen Romanen, Berichten und Aufsätzen zusammen. Ein Erzählstrom in 123 Kapiteln, der aus den Ideen und Kämpfen der Zeit schöpft, aus trivialen, völkischen, utopischen, dadaistischen, reaktionären, politischen, literarischen und fotografischen Quellen. Ein Spiel mit historischen Möglichkeiten und literarischen Figuren, imaginierten Geschichten und realen Ereignissen, kollektivem Wahn und individuellen Wirklichkeiten. Eine Fiktion, die extreme Positionen vorführt und die Widersprüche der Weimarer Republik zuspitzt, die von Kaiser Wilhelms Glück und Ende erzählt, von der Bruderschaft der Vagabunden und dem Untergang einer Flotte, von den Träumen der Kunst und der Rückkehr deutscher U-Boote. Ein kühnes, überraschendes, ungeheuerliches Werk wider Geschichtsvergessenheit, Fatalismus und blinden Gehorsam. Ein wegweisendes Buch über ein Weltende, das eine Zukunft war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
1919. Deutschland unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Aufstände. Räterepubliken. Freikorpskämpfe. Versailler Vertrag. Politischer Mord, Revanche und Nazismus: Hätte Geschichte anders verlaufen können?
Soldaten, Rückkehrer, Revolutionäre, Minister, Freikorpskämpfer, Gymnasiasten, Matrosen, Monarchisten, Vertriebene, Verliebte, Vagabunden, eine Zeitungsverkäuferin: In ihren Geschichten präsentieren sich die tausendfachen Probleme einer Zeit, die von den Explosionen des Krieges erschüttert und von der katastrophalen Niederlage geprägt ist, von Hunger, Massenelend und Kriegsgewinnlern, von fanatischem Nationalismus und sozialrevolutionären Ideen, von militärischer Gewalt und Fantasien freier Liebe.
In 1919 fließen Hunderte von Splittern, Szenen und Handlungsverläufen aus zeitgenössischen Romanen, Berichten und Aufsätzen zusammen. Ein Erzählstrom in 128 Kapiteln, der aus den Ideen und Kämpfen der Zeit schöpft, aus trivialen, völkischen, utopischen, dadaistischen, reaktionären, politischen, literarischen und fotografischen Quellen. Ein Spiel mit historischen Möglichkeiten und literarischen Figuren, imaginierten Geschichten und realen Ereignissen, kollektivem Wahn und individuellen Wirklichkeiten. Eine Fiktion, die extreme Positionen vorführt und die Widersprüche der Weimarer Republik zuspitzt, die von Kaiser Wilhelms Glück und Ende erzählt, von der Bruderschaft der Vagabunden und dem Untergang einer Flotte, von den Träumen der Kunst und der Rückkehr deutscher U-Boote.
Ein kühnes, überraschendes, ungeheuerliches Werk wider Geschichtsvergessenheit, Fatalismus und blinden Gehorsam. Ein wegweisendes Buch über ein Weltende, das eine Zukunft war.
Über den Autor
Herbert Kapfer, 1954 in Ingolstadt geboren, ist Autor und Publizist. Von 1996 bis 2017 leitete er die Abteilung Hörspiel und Medienkunst im BR. 2017 erschienen die Bücher „Verborgene Chronik 1915–1918“ (mit Lisbeth Exner) und die Essaysammlung „sounds like hörspiel“.
Herbert Kapfer
1919
Fiktion
Verlag Antje Kunstmann
Fiktion
aus zerschnittenen und zusammengesetzten Texten jener Zeit
von Stephan Berghoff, Karl Matthias Buschbecker, Theophil Christen,
Hermann Cordes, Joseph Delmont, Frateco, Gregor Gog,
Oskar Maria Graf, Agnes Harder, Georg Hermann,
Rudolf Herzog, Sophie Hoechstetter, Max Hoelz,
Richard Huelsenbeck, Nathanael Jünger, Arthur Kahane,
Emil Ludwig, Erich Mühsam, Gustav Noske,
Ludwig von Reuter, Hans Roselieb,
Ernst von Salomon, Werner Scheff,
Eduard Stadtler, Ernst Toller
mit einer Schwundversion des nie aufgeführten Lustspiels
10 Tage Rätefinanzminister
von Karl Polenske
einem Privattelegramm und Skandalberichten zum Stummfilm
Kaiser Wilhelms Glück und Ende
von Willy Achsel, Ferdinand Bonn und Alfred Funke
Aufnahmen von C. W. Burrows, O. Gramkow,
Adam Hofmann, Theodor Jürgensen, Hans Mehlert
und der unbekannten Fotografin
Kommentaren von Hugo Ball für Die Freie Zeitung
Abfertigungen aus dem Kleinen Briefkasten
in Franz Pfemferts Wochenschrift Die Aktion
Glossen aus dem Panoptikum des Bücherwurms
und einigen Zeilen von Heiner Müller aus späterer Zeit
I.
So sei hier eine Geschichte aus dem Jahre 1897 so wiedergegeben
wie sie damals von einem Zeugen aufgezeichnet worden ist. Dies ist der Originalbericht:
»Zu der seinerzeitigen Meldung, daß Kaiser Wilhelm II. auf einer Nordlandsfahrt eine Verletzung des Auges erlitt, und der späteren Meldung, daß Leutnant von Hahnke, als er, auf dem Zweirade an Bord spazieren fahrend, in das Meer gefallen war, nachstehende Details.
Kaiser Wilhelm hatte den Leutnant von Hahnke radfahren gesehen. Als der Kaiser den Offizier, der vom Rade sprang und sofort grüßte, bemerkte, rief er ihm zu: ›Melden Sie sich sofort beim Kommandanten zum Hausarrest.‹ Darauf entfernte sich der Kaiser, auf die Kommandobrücke zuschreitend. Leutnant von Hahnke schritt hinter dem Kaiser, um dem Befehl nachzukommen und sich beim Kommandanten zu melden. Der Kaiser, welcher bemerkte, daß der Offizier hinter ihm schritt, kehrte sich um und rief: ›Warum gehen Sie hinter mir? Sie sind unwürdig, dahin zu treten, wo mein Fuß schreitet.‹ Der Leutnant wurde durch diese Worte ungemein erregt: das Blut schoß ihm in die Wangen, und er rief: ›Eure Majestät, mein Adel ist so alt wie der Ihre, und ich muß mich nicht von Eurer Majestät beleidigen lassen.‹ – Kaiser Wilhelm, der bereits einige Stufen zur Kommandobrücke emporgestiegen war, schrie ihn laut an: ›Unwürdiger Bengel, ich reiße dir die Epauletten herab und lasse deinen Degen zerbrechen.‹ – Kaum hatte Kaiser Wilhelm diese Worte Hahnke zugedonnert, konnte letzterer seiner Erregung nicht mehr Herr werden und rief: ›Was, ich bin ein unwürdiger Bengel?‹ Er sprang auf den Kaiser zu, stürzte sich auf ihn, erfaßte ihn mit einer Hand beim Genick und versetzte ihm mit der zweiten Hand einen Schlag ins Gesicht, direkt in das Auge, so daß das Blut sofort hervorstürzte. Der aufs höchste erregte Offizier wurde bald darauf durch herbeistürmende Seeleute vom Kaiser getrennt und abgeführt. Der Kaiser forderte hierauf den Schiffskommandanten auf, sofort ein Militärgericht einzuberufen, aber dem Kommandanten gelang es, die Angelegenheit in die Länge zu ziehen. In der Nacht öffnete sich plötzlich die Kabine, in welcher Leutnant von Hahnke inhaftiert war, und von diesem Augenblicke – verschwand von Hahnke überhaupt. Man glaubte auf dem Schiff, daß von Hahnke Gelegenheit gegeben worden war, durch .. Selbstmord dem Militärgericht zuvorzukommen, welches gewiß auf Todesstrafe erkannt hätte und welches nicht hätte verschwiegen werden können. Allen an Bord Befindlichen ist strengste Geheimhaltung dieses Vorfalls anbefohlen worden …«
1897. Der Bericht sagt nichts darüber, ob Wilhelm II. sich für seinen Sieg über von Hahnke einen Extraorden verliehen hat.
II.
Gott als Verfasser
Bekanntlich gilt der liebe Gott als der persönliche Autor des Alten Testaments. Diese Hypothese kann vor der Textkritik wohl kaum standhalten. Es ist, zu seiner Allweisheit, Allgegenwart und Allgüte auch Alltalent vorausgesetzt, unmöglich, daß der liebe Gott so ungleichmäßig arbeitet und solche Verschiedenheiten der Handschrift, ja solche Niveauschwankungen der Begabung aufweist. Es ist unmöglich, daß ein und derselbe Autor zugleich der Frauenkenner, der Eva und Delila decouvriert, und der Nichtsalsjurist sein soll, der Levitikus und Deuteronomium formuliert hat.
Der liebe Gott gilt aber nicht bloß als der anonyme Verfasser, sondern ist auch der eigentliche Held des Alten Testaments. So daß dieses Buch sozusagen als Autobiographie, als Selbstbekenntnis und Selbstdarstellung anzusehen ist; als Ich-Roman in der dritten Person geschrieben. Tatsächlich geht die Figur durch, spielt die größte Rolle und verschwindet nie vom Schauplatz. Trotzdem ist es eigentlich kein aktiver Held, sondern mehr ein zuschauender, beobachtender, der immer über der Situation steht, es vorzieht, unsichtbar zu bleiben und der nur ab und zu von oben her in die Handlung einzugreifen scheint. Es geht ihm wie jedem Autor, er hat die Welt verfaßt, aber dann hat sie sich selbständig gemacht, wie das Werk jedes Dichters, und lebt auf eigenen Füßen weiter: der Autor sieht kopfschüttelnd zu, versteht sein eigenes Werk nicht mehr und nur, wenn’s ihm gar zu bunt wird, erinnert er sich, daß er ja nicht bloß der Verfasser, sondern auch die Hauptperson ist und greift mit einem heiligen Donnerwetter über Sodom und Gomorrha mit einer Sintflut oder einem Weltkrieg ein.
Einwandfreies, ausgesuchtes Menschenmaterial
Im August 1916 kreuzte Kapitänleutnant Mader mit seinem U-Boot im Mittelländischen Meere. U. 10 war kein Kampfboot, sondern eine schwimmende Werkstätte.
Am 9. August, morgens gegen 5 Uhr, bei unsichtigem, diesigem Wetter schlüpfte U. 10 unter dem Minenkranz des Golfs von Genua durch, wo an der riffigen Küste zwischen Spotorno und Bergeggi, in der Tiefe von zehn Metern ein flacher Felsen lag, an dem vor einiger Zeit durch die zwei geschicktesten Taucher der U-Bootflottille, Schröder und Maxstadt, eine Verankerungsvorrichtung für U-Boote nach monatelanger schwerer Arbeit fertiggestellt worden war. Die Boote wurden dort festgemacht und repariert, soweit dies unter den gegebenen Umständen möglich war. Kapitänleutnant Mader stand am Steuer und sichtete mit dem Unterwasserperiskop, dem ein Scheinwerfer den Weg auf fünfzig Meter vorleuchtete. Der Ankerfelsen kam in Sicht und sachte legte sich U. 10 auf dem glatten Felsen fest. Die Maschine stoppte. Die Mannschaften machten sich an ihr Frühstück und verteilten sich rings auf ihren Plätzen. Mader stellte Periskop und Steuer fest, gab dem jungen Leutnant Gerber einige Befehle, als er plötzlich stockte und taumelte. Auch einige Matrosen rollten nach achtern aus. Mader sprang zum Steuerapparat. Im gleichen Augenblick legte sich U. 10 ganz backbord und ging kielhoch, so daß alle losen Gegenstände herumkollerten, dann trieb das Boot ab. Es hatte sich von seiner Verankerung losgerissen.
Plötzlich wurde das Boot hin und her geschleudert. Wer sich nicht festzuhalten vermochte, schlug der Länge nach hin. Alle glaubten, eine Mine wäre an das U-Boot herangetrieben und explodiert. Mader hielt sich am Steuerapparat fest. Der Scheinwerfer warf trotz Umschaltens kein Licht. »Kurzschluß oder kaputt« schrie der den Apparat bedienende Maschinist. Die Magnetnadel drehte sich im Kreise. Mader blickte auf seine Uhr. Sie stand still. Der Zeitmesser über dem Pumpgehäuse ging auch nicht mehr. Leutnant Gerber zog seine Uhr, – sie war ebenfalls stehengeblieben. »Seebeben«, sagte kurz Kapitänleutnant Mader und gab Befehl, die Maschinen anzulassen. Der Tiefenmesser zeigte 18 Meter. Das Boot trieb an, schwankte aber immer noch ein wenig. Die Magnetnadel im Kompaß begann sich wieder wie rasend im Kreise zu drehen. An ein Dirigieren des Bootes war nicht zu denken. Plötzlich spürte man, wie das Boot steuerbord an dem Felsen entlangstrich. Es gab ein klirrendes Geräusch, das bald wieder verstummte. Mader gab Befehl, die Wasserventile zu öffnen. Langsam hob sich das Boot. Aufmerksam beobachtete der Kapitänleutnant den Periskopspiegel. Alles schwarz. Die Tiefenmesser zeigten nur mehr zwei Meter Tiefe an. Langsam hob sich das Boot weiter. Nach kurzem Schwanken lag es still.
Hätte die Insel- oder Landwache das Boot entdeckt, so würde man schon zu feuern begonnen haben. Auch das Radio-Horchperiskop gibt nur ein plätscherndes leises Wellengeräusch wieder. Als nach weiteren fünf Minuten alles ruhig bleibt, gibt Mader den Befehl, die Einsteigluke zu öffnen. Die dazu kommandierten Matrosen klettern in den Tubus. Leise und langsam öffnet sich der Deckel des Turmes. »Die Welt ist untergegangen. Alles ist schwarz und eiskalt!« Schreckensbleich kommen die beiden Leute die Steigleiter herunter. Mader klettert selbst nach oben. Es ist stockdunkel. Das Decklicht brennt, doch durchdringt es nicht die Finsternis. »Den kleinen Handscheinwerfer herauf!«
Neben Mader steht ein Matrose mit dem kleinen Handscheinwerfer. Der Lichtkegel fällt über den schwarzen Wasserspiegel und beleuchtet weit hinten feuchte, glitzernde Felswände. Mader dirigiert den Lichtkegel nach oben. Auch dort, vielleicht in vierzig Meter Höhe funkelt eine große Felsenkuppe. Sie waren durch einen Unterwasserkanal in eine Riesenfelsenhöhle getrieben.
Der grelle große Lichtkegel zeigte die Riesenausdehnungen des Höhlensees. Weit über fünfhundert Meter zog er sich der Länge nach hin, während die Breite mindestens dreihundert Meter maß. Die Tieflotung ergab fünfzig Meter und darüber. Mader, gefolgt von zwei Leuten mit Stricken, Werkzeugen und Taschenlampen, sprang auf ein Felsplateau, eine Fläche von dreißig bis fünfunddreißig Meter Breite. Seitlich davon drang Mader mit seinen Leuten in einen riesigen Dom ein. Mächtige Tropfsteingebilde hingen von der Decke herab oder standen am Boden. Stalaktiten- und Stalagmitengebilde bizarrster Form. Säulen, hunderttausende von Jahren alt. Alabasterweiß. Kleine Stalagmiten kauerten wie Gnome und tückische Zwerge am Boden. Und jetzt, o Wunder! Ein klarer, zwei Meter breiter Bach stürzt über eine Silberwand in einen kleinen See hinab. Blinde Molche, rosig gefärbt, schwimmen träge in dem eisig kalten Wasser.
Die Mannschaften harren am Plateau und betrachten forschend ihren Kommandanten. »Wir sind durch ein Elementarereignis in ein vielleicht zwei bis drei Jahrhunderttausende altes Wunder der Mutter Natur geraten. Die Strömung hat uns hier hineingetrieben. Wir müssen jetzt versuchen, zurückzufinden!«
Aller Augen haften an Maders Mund. Von den Wänden des Domes hallen die letzten Worte lauter wider, als sie gesprochen wurden. Auch das mutigste Herz schlägt schneller.
»Können wir auf dem Unterseewege unseren Ausweg nicht finden, so müssen wir versuchen, durch den Berg hindurch zu kommen. Wenn uns diese Wege verschlossen sind, – dann müssen wir uns in das Schicksal ergeben. Noch ist es nicht so weit. Verpflegung ist für sechs Wochen und noch länger vorhanden, wenn wir die Vorräte einteilen. Betriebsstoff für Licht haben wir genug, um auf Wochen die Akkumulatorenbatterien zu laden. – Und jetzt, alle Mann an Bord!«
Langsam schiebt sich U. 10 durch die nachtdunklen Wassermassen. Mader ruft Ulitz mit überlauter Stimme plötzlich ein Kommando zu. Steuerbord! Back! Back! Schrill gehen die Klingelsignale. Ein Knirschen und Reiben wird von Backbord außen hörbar. Der Scheinwerferkegel ist länger geworden, das Wasser durchsichtiger. Das Licht kommt von oben. Das ist der Tag.
Im Marineministerium wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Endlich hatte Mader es durchgesetzt, selbst gehört zu werden. Mader stand vor dem Marineminister und Obersten Chef der Flotte. Der Plan des Kapitänleutnants war gigantisch. Ein Konteradmiral mit einem großen technischen Stab begleitete U. 10 und U. 79 zum Golf von Genua.
Der Konteradmiral kam aus dem Staunen nicht heraus. Mader hatte eine Lichtleitung in dem großen Dom und den anschließenden Räumen legen lassen. Die Kabel wurden an die Dynamos im U. 10 angeschlossen. Neun große Höhlen lagen in einer halbkreis förmigen Strecke von zwölf Kilometern Länge. Auf dem Plateau hatte Mader eine kleine Reparaturwerkstätte eingerichtet. Die Höhlen hatten Namen oder Zahlen erhalten. In Nummer 4 fiel ein großer Wasserfall zwanzig Meter in die Tiefe. Durch die Höhlen 5, 6 und 7 ging ein reißender Bach von sieben bis zehn Meter Breite. Trinkbares, eisiges, keimfreies Quellwasser. In Höhle 8 gab es drei heiße Springquellen, die dicke, heiße Wasserstrahlen bis zu neun Metern hochschleuderten.
Im Dom 1, der Madersee genannt, waren weit über zwanzig Exzellobogenlampen an der Decke angebracht. Das Licht spiegelte sich im Madersee und beleuchtete zehn U-Boote, die teils zur Reparatur, teils zur Aufnahme von Munition und Ladung eingefahren waren. In Dom 2 hatte sich wenig verändert. Die wunderbaren Tropfsteingebilde sollten erhalten bleiben. Dom 3 hatte sich in eine große Maschinenhalle verwandelt. Drehbänke, Fräsmaschinen, Schneide-, Bolzen-, Nieten- und Stiftenmaschinen standen in regelmäßigen Reihen. Dom 4 war auch eine Schlosser- und Schmiedewerkstatt. Holzbearbeitungsmaschinen, wie Gatter-, Kreis- und Bandsägen, Fräs-, Hobel- und Falzmaschinen standen in Dom 5, während am großen Wasserfall die Turbinenanlage angebracht war, die sämtlichen Maschinen in der Felsenhöhlenstadt als Antriebskraft diente. Dom 6 war in zwei Teile geteilt. Hier waren die Speisesäle und der allgemeine Aufenthaltsraum errichtet. Eine Abteilung diente als Magazin und Lagerraum. Abteil 2 enthielt die große elektrische Küche. Nummer 7 umfaßte die Schlafräume für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Im Mannschaftsschlafraum standen Holzbetten in Reih und Glied. Die Riesenhalle besaß im Mannschaftslogis zwei Reihen zu 45 Doppelbetten, wie in den Schiffskabinen, also Raum für 180 Mann. Außerdem waren 100 Hängematten an den Felswänden entlang aufgespannt. Dom 8 diente als Badeanstalt mit Wannen-, Schwimm-, sowie Dampf- und Heißluftbädern. Im rückwärtigen Teile war ein Lazarett mit zwanzig Betten hergerichtet worden. Die letzte und allergrößte Höhle, die ungefähr 650 Meter lang und gegen 400 Meter breit war, diente als Sportplatz. Für Fußballspiele waren zwei regelrechte Tore vorhanden.
Die einlaufenden U-Boote brachten von den versenkten Schiffen alle möglichen Dinge mit. Die Mannschaften arbeiteten täglich zehn Stunden. Zweimal wöchentlich konzertierte eine Kapelle, die sich aus zwölf Mann der Besatzung gebildet hatte. Ein Maurerklavier, oder, wie der schnoddrige Berliner Koch, der Stübbecke, sagte, eine Quetschkommode, gab den zwei Gigerln der Besatzung, Lehmann I und Hansen, Gelegenheit, ihre neuesten Schieber zu tanzen. Der Schrittenbacher Max, ein Feinmechaniker ersten Ranges aus Feldafing in Bayern, hatte einen Gesangverein gegründet und in Stimmung gebracht. Dieser Max plattelte, wenn Stübbecke ihm den Heitauer Doppelschlag auf der Ziehharmonika vorspielte.
Mader stand nackt in seiner Badekoje und ließ die kalte Dusche über seinen Kopf brausen. In der Nebenkoje plätscherte Ulitz. »Möchte gerne einmal wissen, wie die liebe Sonne aussieht. Wir werden noch eine Haut über die Pupille bekommen, – wie die Molche.« Mader mußte über den ewigen Brummhumor des kleinen Ulitz lachen. Er wurde aber gleich wieder nachdenklich. Draußen ging das blutige Ringen weiter. Die Menschen zerfleischten sich, und ein Ende war nicht abzusehen. Wie schwierig war es doch gewesen, hier tief unter der Erde all dies erstehen zu lassen. Die Kunst der Marineingenieure hatte hier ein Wunderwerk vollendet. Wie schwer war das Finden der richtigen Leute gewesen. Jeder Einzelne mußte ein Vollkommener in seinem Fache sein. Die Leute hatten sich für die Zeit des Krieges zu verpflichten. Es wurde keinem gesagt, wohin es ging. Jeder erfuhr nur, daß er nach einer Werkstätte käme, die versteckt im Lande des Feindes läge, und daß es keinen Urlaub gäbe. Jedem Manne wurde zwei Tage Bedenkzeit gelassen. Erklärte er sich dann einverstanden, so wurden ihm zwei Wochen Urlaub bewilligt und strengste Verschwiegenheit aufgetragen. Da nur ganz einwandfreies, ausgesuchtes Menschenmaterial in Frage kam, so war ein Verrat kaum zu erwarten. Den Angehörigen ward eine Adresse im Marineministerium aufgegeben. Dorthin mußte alle Post gesendet werden, und von dieser Stelle ging sie erst wieder auf Umwegen zur Stadt unter dem Meere.
In der ganzen Welt wurde von einer geheimen U-Boot-Basis im Mittelmeer gesprochen. Ganze Geschwader der Gegner suchten die Küsten immer und immer wieder ab. Nichts! Nichts! Niemand in Italien hatte eine Ahnung, daß sich im eigenen Lande eine unterirdische deutsche Werkstätte befinde, die Granaten und Torpedos herstellte. Kein Mensch vermutete, daß ein kleiner Typ feindlicher U-Boote sich unter heimischer Erde im Bau befand und daß eine kleine Schar von Menschen in treuester Pflichterfüllung seit Jahren nicht mehr die Sonne sah und fern von ihren Liebsten weilte, die nicht wußten, wo sich Vater, Sohn, Bruder, Gatte oder Bräutigam aufhielten.
Millionenheere können nicht an einem Tag erledigt werden
In Aachen hielt Kaiser Wilhelm im Sitzungssaale der Stadtverordneten folgende Ansprache:
»Im Westen habe ich das halbverwüstete Frankreich besichtigt. Da gewinnt man erst den richtigen Eindruck von dem Grausigen, von dem unser Vaterland verschont geblieben. Wer etwa kleinmütig werden sollte, der möge einmal einige Tage an die Front gehen und sich die Verwüstungen ansehen. Dann wird er nicht mehr klagen und mit seinem Los zufrieden sein. Die Offensive geht gut vorwärts; 600 000 Engländer sind bereits außer Gefecht gesetzt, 1600 Geschütze erbeutet. Die Franzosen müssen überall einspringen. Hart werden die Gegner mitgenommen; sie haben’s auch nicht besser verdient. Die Sache im Westen wird gemacht; aber wir müssen Geduld üben. Millionenheere können nicht an einem Tag erledigt werden. Wir werden unser Ziel erreichen. Schwere Arbeit ist zu leisten; aber dafür haben wir ja auch tüchtige Schmiede. Den Osten haben wir geöffnet. In der Krim geht es auch vorwärts. Aus der Ukraine sind die ersten Lebensmittelzüge in Berlin eingetroffen. Dadurch wird unsere Lebensmittelversorgung gebessert. In Sebastopol haben wir eine starke, reich beladene Handelsflotte erbeutet; dort werden wir uns den Verkehr auf dem Schwarzen Meer wieder ermöglichen. Also es steht gut.«
Begriff der Propaganda
Das Wort selbst stammt aus der altkirchlichen Institution Collegium de propaganda fide und wurde als Gerundium in den Sprachgebrauch übernommen. Der Verbreitung des Glaubens diente dieses Collegium und dem Worte der Heiligen Schrift. Heute ist es nicht mehr die Kirche, sondern der Staat, der es für wichtig hält, Prinzipien durch eine organisierte Verbreitung zur Geltung zu bringen. Und nicht Gottes und der Völker, sondern abkommandierter Skribenten Stimme ist es, die den Begriff der Propaganda in Verruf gebracht hat. Moral oder Unmoral der Propaganda hängen von den moralischen oder unmoralischen Absichten des Staates ab.
Ganz klar sah die Reichsleitung von Anfang an ein, daß sie vor der Alternative stand: entweder alles zu gewinnen, um, im Rausche des materiellen Erfolges vergöttert, über die Schuldfrage hinwegzukommen, oder, nach einer Niederlage in ihrem Betruge durchschaut, unterzugehen. Deshalb von Anfang an die Behauptung, Deutschland führe einen Verteidigungskrieg. An einen Mittelweg kann und konnte diese Regierung nicht denken. Deshalb auch ist ein Verständigungsfrieden nicht möglich. Er würde gewisse Freiheiten bringen, die für das alte System verhängnisvoll wären. Wenn die hermetisch verschlossenen Landesgrenzen wieder geöffnet, der Belagerungszustand mit all seinen Unfreiheiten aufgehoben wären; wenn die Zensur und die Bedrohung mit Schutzhaft wegfielen: die brutal und mit allen Mitteln unterdrückte Wahrheit würde sich elementar einen Weg zum Lichte schaffen. Kein Friede ist möglich, der nicht einen vollständigen Sieg der Moral oder der Unmoral mit sich bringt.
Nun endete der Krieg mit einer zerschmetternden Niederlage
die der rücksichtslose U-Bootkrieg nicht hatte aufhalten können. Manchem Seemann mag es danach verlangt haben, mit seinem Schiff beim letzten Schlag nach dem Gegner in den Fluten unterzugehen. Für eine solche heroische Geste, die am Ausgang des Krieges nichts mehr ändern konnte, war die Mannschaft nicht zu haben. Antimilitaristische Agitation in beträchtlichem Umfange war schon im Jahre 1917 auf den Großkampfschiffen betrieben worden. Zwei Mann büßten für den Plan einer Erhebung mit dem Leben, andere mit schweren Zuchthausstrafen. Den Schiffsbesatzungen wurde der öde Dienst etwas erleichtert und das Essen verbessert. Auf den Geist der Truppe verstand man aber nicht richtig einzuwirken. Nach beendetem Dienst ging der Offizier in seine Räume, der Unteroffizier in sein Abteil, in drangvoller Enge saßen die durch vierjährigen Dienst mißmutig gemachten Leute ohne Aufsicht beieinander. Die Agitation war leicht und fand einen günstigen Nährboden. Für eine verlorene Sache zu sterben, in dem Augenblick, wo die Entlassung zur Familie bevorstand, waren die vielen verheirateten Leute nicht gewillt. Als am 28. Oktober die Flotte in See gehen sollte, rissen Heizer die Feuer heraus und verhinderten dadurch die Ausfahrt. Eine größere Anzahl der Meuterer wurde verhaftet. In Kiel fand am 1. November eine große Versammlung von Marinesoldaten statt, in der die Freilassung der Inhaftierten gefordert wurde. Deputationen wurden von den Kommandanten abgewiesen. Eine zweite Versammlung am Sonnabend den 2. November wurde durch Truppenaufgebot verhindert. Jedoch kamen schon Gehorsamsverweigerungen vor. Mannschaften versammelten sich auf dem Exerzierplatz; es wurde lebhaft diskutiert, wobei sich Mitglieder der unabhängigen Sozialdemokratie beteiligten. Verabredet wurde eine neue Versammlung für Sonntag nachmittag 5½ V Uhr auf dem Exerzierplatze. Durch Handzettel wurde dazu eingeladen. Nachmittags 2 Uhr ließ das Stadtkommando Alarm schlagen; Patrouillen forderten alle Soldaten auf, sich sofort zu ihren Truppenteilen zu begeben. Der Befehl wurde nicht befolgt. In der Versammlung wurde zur Befreiung der Gefangenen aufgefordert. Ein großer Demonstrationszug setzte sich in Bewegung. Patrouillen und einzelne Offiziere wurden entwaffnet. Schließlich feuerte eine starke Patrouille auf die Meuterer. Es gab eine Anzahl Tote und Verwundete.
Sie brauchten keinen Fahnenjunker mehr
Der Novemberhimmel, von Wolken überfetzt, grau, melancholisch und trübe, brachte dem kein Lustgefühl, der hoffte, draußen im Freien könnte es besser sein.
Waldemar näherte sich wieder der Stadt. Die Menschen hatten ein paar flackrige Tage lang geglaubt, ihre Rufe nach Amerika würden mit Engelsstimmen beantwortet. Ein gepeinigtes und halb verzweifeltes Volk schien plötzlich den Verstand verloren zu haben. Es bekannte sich zu Idealen, deren Träger es gestern noch verlacht hatte, und hoffte, wenn es sich nun mit seiner wunden und zerquälten Seele den Pazifisten entgegenwarf, wäre ein Fest wie einst in biblischen Zeiten bei der Heimkehr des Sohnes.
So fühlte Waldemar Ring. Er ging durch die Straßen von Danzig. Es war nun nichts mehr mit den Husaren. Sie brauchten keine Fahnenjunker mehr. Waldemar merkte an der Leere in seinem Innern, wie sehr er sich eingerichtet hatte auf den Krieg. Er war so bereit gewesen, seine achtzehn Jahre hinzugeben, weil es nicht anders ging, weil man seinem Vaterlande angehörte.
Gewiß, die Bücher, von jungen Deutschen aus schönen Alpentälern oder Städten der Schweiz heraus gegen den Krieg geschrieben, würden große Kulturdokumente bleiben. Waldemar besaß ein starkes Selbstgefühl und der Krieg war ihm nie anders als ein Ungeheuer erschienen. Doch zu einer Sicherheitsreise in die Schweiz mußte man aus traditionslosen Gegenden stammen.
Es war völlig sinnlos für ihn, noch in Danzig zu bleiben. Es galt, sich anderswie einzurichten. Ein Studium natürlich. Aber was denn, wie denn? Wie können die Weisheiten noch wahr sein, die man vor diesem Zusammenbruch für richtig hielt? Waldemar erfuhr, abends um neun Uhr würde wahrscheinlich ein Zug nach Berlin gehen. Den wollte er benutzen. Das Vaterland hatte sich seines Stolzes begeben, die Mutter heiratete einen neuen Mann. Ganz frei, ganz allein ging man nun seines Weges.
Der Zug war angstvoll überfüllt. In den Korridoren kauerten ermüdete Soldaten auf hochgeschwollenen Gepäckstücken. Manche trugen die rote Kokarde an der Mütze, anderen waren die Achselstücke abgerissen. Aber auch die Revolutionäre besaßen kein Feuer. Stumpf und dumpf, mit geschlossenen Augen und offenen Mündern lehnten die meisten da, erschöpft von langer Fahrt oder von dem Entsetzlichen, dem sie entronnen.
Waldemar zwängte sich durch die Korridore. Es waren auch viele Flüchtlinge im Zuge. Die Wagen hatten schlechte Beleuchtung, eine trübselige Kälte breitete sich aus, Gerüche aller Art beklemmten den Atem. Waldemar fand endlich am Durchgang zu einem andern Wagen noch ein Stückchen leere Wand, an die er sich lehnen konnte. In trauriger Finsternis lag draußen das westpreußische Land. Der Zug hatte wohl ein- bis zweimal gehalten, und es entstand ein Geschrei um Plätze, die es nicht mehr gab. Die Soldaten fuhren dann für einen Augenblick aus ihrem Schlaf und sanken erleichtert zurück, als kein Weckruf kam und kein Feuergeknatter. Ein Herr zwängte sich durch den Harmonikaweg des Zuges, stieß Waldemar unsanft mit einem Koffer an und bat dann um Entschuldigung. Der Herr hatte blanke, dunkle Augen und sprach Thüringisch. Ob er erfahren könne, wie die nächste Station hieße? Weit und breit sei kein Schaffner zu finden. Doch der Fremde, der schon seit Königsberg mitführe, könne es im Zuge nicht mehr aushalten. Lieber bleibe er im elendesten Gasthaus eines bis jetzt noch unbekannten Ortes. Ob der junge Herr so gut sein möge, ihm sein Gepäck hinaus zu reichen, sobald der Zug mal wieder hielte? Der Zug hielt nach einer Weile. Der Herr schlüpfte an einem schnarchenden Soldaten vorbei zur Türe hinaus und Waldemar reichte ihm das Gepäck. Er sah flüchtig, daß auf den Koffern und Taschen eine Krone war, und er bemerkte auch, die gelbliche Pelzdecke, die er als letztes Stück beförderte, hatte ein sehr schönes, lichtblaues Futter. Waldemar hörte noch ein Weilchen den Singsang der Räder, dann schlief er stehend ein.
Dann stand Waldemar vor einem Schaffner, der den Gang versperrte. Neben diesem wuchtigen Mann befand sich eine junge Dame. Ihre seltsam großen Augen waren bernsteinfarben und blickten über die Dinge hinweg, während sie mit einer dunkeln, eintönigen Stimme sagte: »Die Koffer sind mit einer Krone und v. E. gezeichnet, die Pelzdecke ist mit hellblauem Tuch gefüttert.« Es ging wohl nicht an, daß Waldemar sein ihn bestürzendes Wissen zurückhielt. Der Dieb war erst an der vorigen Station ausgestiegen. Die junge Dame wandte in einer fast trägen Bewegung ihr Gesicht Waldemar zu. Er fühlte sich unter ihrem Blick erröten, überstürzte sich in bedauernden Worten, wurde aber von dem Schaffner unterbrochen, der eine Beschreibung der gestohlenen Sachen in sein Notizbuch machte. Wie die Damen hießen? Frau und Fräulein von Envers. Woher sie kämen? Von einem Landgut bei Riga. Gut, der Schaffner würde von der nächsten Station telegraphieren, daß man die Koffer, wenn sie ermittelt, an den Anhalter Bahnhof, Berlin sende.
Aus dem Halbabteil, vor dem Waldemar noch unschlüssig neben der jungen Dame stand, kam eine etwas ängstliche Stimme: »Ellen, es ist kalt. Gib mir doch die Decke.«
Da zog Waldemar Ring seinen Überzieher aus. Es war eine kurze, hübsche, pelzgefütterte Jacke und sein ganzer Stolz. Doch er entledigte sich dieses Beweises seiner Eleganz beglückt. Denn die junge Dame war überaus apart, und er konnte zeigen, daß es ihm nicht an Ritterlichkeit gebrach. Er blieb vor der Türe des Abteils stehen und überlegte, was nun weiter seine Pflichten gegen die Damen waren, an deren Beraubung er sich mitschuldig fühlte. Da kam Fräulein v. Envers und bat Waldemar, einzutreten.
Das Abteil war schwach beleuchtet – in der Ecke schlief sitzend eine Dame, die weißes Haar hatte, und das Gesicht in ein Kissen versteckt. Waldemars Überzieher lag auf den Knien der alten Dame. Die junge Dame an seiner Seite schlief ein. Sie bog sich ein wenig von ihm weg, nach einer Stütze für den Kopf, legte ihre Hände sonderbar still und langgestreckt in den Schoß und schloß die Augen. Er betrachtete die Hände. Sie waren schmal, sehr weiß und vollkommen ringlos. Von den Händen ging der Blick zu der Schlafenden. Sie hatte sehr dunkles Haar mit einem sehr reingezeichneten Stirnansatz. Es fiel in einer schlichten Welle über die Schläfen. Der Mund, schmal und mit sehr roten Lippen, hob sich in starker Abgrenzung aus dem blassen Gesicht. Der junge Mensch fühlte sich lebhaft erregt und wartete angestrengt auf ihr Erwachen, bis er selbst schlief.
Es mochte viele Stunden später sein, als ihm Worte ans Ohr klangen. »Du warst noch nicht in Großpapas Wohnung am Augustaufer, Ellen. Aber wir gehen nicht gleich zu ihm. Was würde er erschrecken, wenn wir so ohne Gepäck ankommen. Wir steigen im Kaiserhof ab –«
»Ohne Gepäck, Mama?«
»Wir fahren erst in Läden, ich habe etwas deutsches Geld, es ist eingenäht.«
Eine Pause entstand. Waldemar besann sich, ob er nun aufstehen sollte. Da klang die angstvolle Stimme wieder: »Wir müssen uns ein paar farbige Dinge kaufen. Wir dürfen nicht vor Großpapa hintreten, schwarz wie Raben von einem Schlachtfeld.«
»Aber liebe Mama – wir können ihm doch nicht etwas vortäuschen –«
»Doch – doch. Ich kann nicht so vor meinem alten Vater stehen und ihm sagen: Meinen Mann und Ellens Vater, den haben die Bolschewisten mit einer Axt in Stücke gehauen, und mich hielten vier von den Teufeln fest, und ich mußte zusehen –«
Die arme Frau bekam von ihren Worten einen Weinkrampf – der klang noch schrecklicher, als die Worte. Waldemar verließ das Abteil. Ihn schauderte. War das eine Irre? Aber dann fiel ihm ein, solche fürchterlichen Dinge hatte man ja so oft in den Zeitungen gelesen – gefühllos fast, stumpf, wie die Menschen in den vier Kriegsjahren geworden waren, weil kein Hirn und kein Herz imstande war, auch nur den tausendsten Teil all des Fürchterlichen, was geschah, sich ganz begreiflich zu machen. Er drängte sich durch die Korridore. Es ging dem Morgen zu. Waldemar stieß auf eine Gruppe von bärtigen Landwehrmännern, die gerade ihre Stullen auspackten. Er bot Zigaretten und Geld an und erhandelte ein paar Brote. Die befreite er von schmutzigem Zeitungspapier, in das sie gewickelt waren und riß Notizblätter aus seinem Taschenbuch ab, welche die Teller vorstellen sollten. Frau v. Envers hatte sich beruhigt. Sie sah Waldemar durch eine Stielbrille flüchtig an und sagte: »Mein Herr, ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie uns an der nächsten Station etwas Kaffee besorgen würden.«
Waldemar stand an der Wagentür – öffnete das Fenster und fand, die Kälte, die eindrang, war immerhin besser als die verbrauchte Luft des Wagens. Das Land lag noch im Dämmern. Plötzlich fühlte Waldemar einen leichten Aufstrom, eine Frische in sich – und wußte sofort, was es sei: Fräulein v. Envers war zu ihm herausgekommen. Dunkel und schlank, fast ebenso groß wie er, stand sie neben ihm.
»Sie müssen Ihre Frau Mutter nicht in ein Hotel bringen, sondern gleich zu dem Großvater,« sagte er und errötete, denn er verriet sein Zuhören. Die sonderbare Entgegnung kam: »Haben Sie sich nicht auch die Befreiung anders gedacht? Der Anfang war nicht schön. Aber vielleicht wird es in Berlin anders sein. Wir warten doch alle so –«
Er sah in das blasse Gesicht des jungen Mädchens, fühlte sich von rätselhafter Anziehung erregt, und blieb doch gehemmt, sich zu äußern. Sie standen minutenlang stumm nebeneinander, den Blick voneinander gerichtet, hinaus auf die dämmernde Ebene, über der ein trauriger Himmel stand, dessen Gestirne erloschen. Da fuhr der Zug in einen Bahnhof ein und Waldemar gedachte des Wunsches nach Kaffee, sagte hastig, er wolle mal nachsehen und sprang aus dem Wagen. Es war eine Station, von der eine andre Linie abzweigte, und die Bewirtung befand sich auf einem Bahnsteig, der erst durch eine Unterführung zu erreichen war.
Als Waldemar wieder durch den Tunnel rannte, rollte sein Zug über ihm hinweg. Er hatte gerade noch den Anblick des letzten Wagens und sah seine roten Lichter in den Morgennebel hineinfahren. Waldemar blickte dem Zuge nach, als sei er ein entschwindendes Phantom. Dann, um doch etwas zu tun, trank er wenig von dem schrecklichen Kaffee und schleuderte Glas und Inhalt achtlos über den Bahnsteig hinweg. Sechs Stunden später ging ein andrer Zug und kam am frühen Nachmittag in Berlin an.
Unsinn! Die Truppe steht zu mir
»Unter seinen Führern und Generalen wird das Heer in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurückmarschieren, nicht aber unter dem Befehl Eurer Majestät.«
»Schwarz auf weiß will ich die Meldung aller kommandierenden Generale haben, daß das Heer nicht mehr hinter seinem Obersten Kriegsherrn steht. Hat es mir nicht den Fahneneid geschworen?!«
»Der ist in solcher Lage eine Fiktion.«
Niemand kann das alte Preußen mehr retten
Waldemar nahm eine Droschke und fuhr nach dem Kaiserhof. Er sagte sich vor, daß er alles Recht besäße, den Damen, die durch seine Mithilfe ihr Gepäck verloren hatten, seinen Beistand anzubieten. Im Kaiserhof war ein alter, höflicher Portier. Ja gewiß, die Damen waren heute morgen vorgefahren. Jedoch wäre jedes Zimmer besetzt, der letzte Winkel, die unmöglichste Kammer. Wohin die Damen sich gewendet, könne er leider nicht sagen. Der alte Mann bekam ein Trinkgeld, wußte auch ein Hotel zu nennen, das dem Augustaufer gegenüber, ganz nahe am Kanal lag.
Waldemar hatte ein wenig ausgeschlafen, sich gewaschen, umgekleidet, schön frisiert, er schritt in den kleinen Speisesaal hinunter. Er überblickte den Raum. Es saßen viele Marineherren mit ihren Damen da. Dann überflog er den Anzeigenteil der Zeitungen, um endlich bei der Ankündigung eines Vortrags zu haften. Doktor August Wilhelm Ring: Siedlungspläne. Für Siedlungspläne hatte Waldemar nicht das geringste Interesse. Aber August Wilhelm Ring? Natürlich, das mußte Papas jüngster Bruder sein.
Der Saal, in dem der Vortrag sein sollte, lag ganz nahe, an der Lützowstraße. Es war eine Kleinigkeit, hinüber zu gehen. Waldemars Unerschrockenheit bahnte sich einen Weg bis in die Nähe des Redners, obwohl der Vortrag schon im Gange war. Oh, dachte Waldemar, gefesselt von einer schönen Stimme, mein Onkel sieht ja sehr anständig aus. Und er hat ein Kreuzbändchen, also war er im Feld. Und Waldemar begab sich in der tändelnden Sicherheit seiner achtzehn Jahre am Schluß der Sache in das sogenannte Künstlerzimmer. Dort hatte der Onkel noch eine Weile mit Fremden zu reden.
Sie schritten am Kanal entlang und Waldemar fiel ein, daß da der alte Herr wohnen müsse, zu dem Ellen v. Envers gegangen. Er sah nach den Fensterscheiben hinauf, aber überall war es schon dunkel. Morgen mußte er Ellen v. Envers suchen.
Der ältere Ring schien seinen Gefährten vergessen zu haben. »Niemand kann das alte Preußen mehr retten,« sagte er dann. »Denn es hat seine Mission beendet. Millionen von Menschen werden es im Erinnern behalten, wie Heldenlieder und einen frommen Glauben.«
»Soll man es beklagen?« fragte Waldemar. Aber er möchte gerne noch wissen, ob es denn mit uns so schlecht stünde, daß man fürchte, alles wäre in einer Auflösung begriffen – und es würde eine Epoche kommen, die alle bisherigen Gliederungen verschöbe. Er stünde im Augenblick vor einer Berufswahl. Und nach diesem unglücklichen Krieg wisse man nicht, wo beginnen. »War das königliche Preußen nicht schon lange dahin? Ist das Kaiserreich nicht ein Aufputz von Großtuerei und irgendwo sehr unwahr. Denn wie könnte es sonst so aus der Liebe des Volkes gestürzt sein –«
»Ach, das Volk,« antwortete Ring und ließ seine Worte in der Luft hängen.
Keine Disziplin mehr
Die beiden Leutnants sind noch sehr jung. Der eine fuchtelt, leise sprechend, dem anderen mit der Hand vor dem Gesicht herum. Aber diese Hand hat nur den Daumen und die beiden anderen Finger daneben. Der kleine und der vierte Finger sind so sauber und so glatt, wie mit einem Rasiermesser abgeschnitten.
»Also wie es vorjehn soll, raus aus’n Wald, da schmeißt sich doch der eine Kerl, so ein dickes Schwein … ein Familienvater von mindestens achtunddreißig, statt dessen im Dickicht hinter einen Baum, und is nich von der Stelle zu bringen. Und der Russe funkt so mit seinen beiden Maschinengewehren, einfach wie ‘n Fächer, janz niedrig über ’n Boden hin. Also, es war jradezu ein Anblick für Jötter: wie nun das dicke Schwein da, wie ein Kahn, den sie an den Pfahl jebunden haben, und der nu in der Strömung hin und her schwankt, mit den Jarben so mitgeht. Ich zieh’ meinen Dienstrevolver und halt ’n über ihn. Aber in dem Augenblick kommt eine neue Garbe. Und der Mann, der sich schon halb aufgerichtet hat, schmeißt sich wieder hin. ›Auf, du Hund‹, schreie ich und will abdrücken. Ehe ich also noch den Finger krumm machen kann, geht der Kerl hoch wie so ’ne Spannerraupe, und dann streckt er sich. Ich wundere mich noch, mein Revolver liegt auf seinem Rücken. Aber mit den zwei Fingern hier dran. Beide Schüsse also erstmal durch den dicken Baum. Ihm der eine mitten in die Stirn und hinten an der Wirbelsäule wieder raus. Und mir haut’s meine zwei Finger hier weg.«
Ein Matrose steigt am Savignyplatz ein und setzt sich still in die Ecke. Er hat keine Fahrkarte. Aber das macht nichts mehr. Die beiden jungen Leutnants sehen zu ihm hinüber. Er grüßt nicht, sieht über sie fort. In Charlottenburg klettert er wieder heraus mit Bewegungen, als ob das Abteil ein Mastkorb wäre.
»Also ich sage dir«, meint der Dreifingrige: »Diese Schweineflotte hält keine Disziplin mehr. Das kann den schönsten Kladderadatsch noch jeben.«
In einem fernen Rückblick war vielleicht diese Stunde einmal schön
Es lag so etwas Sonderbares, Tragendes, Unruhiges in der Atmosphäre. Der Alexanderplatz war von erregten Menschen bestanden. Waldemar hörte immer wieder den Ruf: der Kaiser. Kam der Kaiser? Was ging vor? Wie, der Kaiser sollte gezwungen werden, abzudanken? Waldemar begriff nichts. Es hatte sich in ihm festgeankert, daß er Ellen v. Envers suchen müsse. Jemand sagte ihm, das Augustaufer begänne in der Nähe der Von der Heydt-Brücke. Ein Auto fuhr ihn die Leipziger Straße hinunter. Es stoppte am Potsdamer Platz, eingekeilt in schreiende, verwahrloste Soldaten. Eine Menschenflut war da, wie sie Waldemar noch nie gesehen hatte. Ihm schauderte vor allen diesen ärmlichen, schlechtgekleideten, mühseligen und erregten Hungergestalten. Und in einem heftigen Gefühl dachte er wieder: wenn Fräulein v. Envers unter diesen Menschen sein mußte!
Berlin lag in dem fieberhaften Aufruhr einer ungeheuerlichsten Erwartung. Man hatte dem Kaiser noch zwei Stunden Frist gegeben zu seinem Verzicht. War es noch eine Höflichkeit, daß man ihm gestattete, selbst die fünfhundertjährige Geschichte seines Hauses zu beenden? Wie beispiellos mußten diese Stunden für ihn sein! Und wenn er alles wäre, was ihm Feinde und Widersacher tausendmal vorgeworfen: ein schlechter Schauspieler, ein Schuldbeladener und ein Feigling: wie mußte ihn selbst dann diese Stunde treffen. So dachte August Wilhelm Ring. Er stand auf der Straße, las Extrablätter, eingekeilt in eine tobende Menge, unter Portier- und Waschfrauen, unter rüden Jungens, die sich amüsierten, und er vernahm die Stimmen kleiner Ladenmädchen, die ihren Esprit an »Aujustens« Spitzenwäsche verschwendeten. O ja doch, alle großen Revolutionäre mußten sich schlechter Gesellschaft bedienen, ihr Ziel zu erreichen. Wer gegen die Korruption der Ehe schreibt, findet feurige Anhänger in hysterischen Jungfrauen. Wer gegen Gewissenszwang der Kirche redet, bekommt all die Mißratenen zu Freunden, die den Gottesbegriff als einen Mumpitz erkennen. Und wer heute ging, ein Kaiserreich zu stürzen – der fand Mithelfer, die sich von einem Freistaat die Zügellosigkeit versprechen. In einem fernen Rückblick war vielleicht diese Stunde einmal schön. Im Freskenstil der Geschichte sah man vielleicht diesen 9. November als den Beginn einer großen Erneuerung.
August Wilhelm Ring bahnte sich den Weg in eine stillere Straße, stieg mehrere Treppen eines Hauses hinauf und wurde in eine alte, weitläufige Wohnung eingelassen. In einem großen, hellen Gelehrtenzimmer, dessen Wände fast nur aus Büchern bestanden, saß ein schöner, weißhaariger Herr.
»Oh, Sie kommen August.« Welche Höflichkeit, dachte Ring, dem Mann brennen Fragen auf den Lippen, aber zuerst denkt er dran, daß mir eine Zigarette brennen muß.
»Bis vier Uhr – eine Stunde noch – hat der Kaiser Zeit, seinen Entschluß zu fassen. Ich möchte diese Stunde mit Ihnen verleben, wenn Sie erlauben, Herr Geheimrat.«
Die Hände des alten Mannes begannen zu zittern. Er fuhr sich hilflos über die Augen.
»Wo ist der Kaiser?«
»Im großen Hauptquartier.«
»So. Und ist er nicht auf dem Weg nach Berlin? Friedrich Wilhelm der Vierte war in Berlin bei der Revolution. Er ist von seinem Schloßhof hinunter gestiegen und hat vor den Leichen der Aufrührer salutiert. Ein bitterer Weg für einen König. Warum ist heute der König nicht da?«
August Wilhelm Ring antwortete: »Er ist bei seinen Generalen.« Der alte Herr fragte in der Hartnäckigkeit seiner Greisenjahre: »Warum ist der Kaiser nicht in Berlin? Warum ist er nicht auf seinem Platz?« Und er hob seine Stimme: »Warum ist er nicht da, und steht auf dem Schloßbalkon, wo er am 1. August gestanden hat? Und sagt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders? Dreißig Jahre habe ich mich von Gottes Gnaden auf meinem Platz gefühlt, und diesen Platz verlasse ich nicht als ein Lebendiger.«
Der alte Herr sah leer in die Luft. Die alte Wirtschafterin stürzte ins Zimmer. Ihre hagere Gestalt schien in dem doch so dürftigen Kleid zu schlottern: »Herr Geheimrat –«
Hinter der Wirtschafterin erschien eine junge Dame, schlank, groß, in dunkeln Kleidern – mit einem sehr weißen Gesicht, aus dem ein roter Mund und bernsteinfarbene Augen sonderbar leuchteten.
»Wo kommst du her, Kind – wo sind deine Eltern?« Wieder hörte August Wilhelm Ring in sonderbarer Betroffenheit diese Stimme, die wie aus einer tiefen Ferne klang.
»Mama und ich mußten fliehen. Um dich nicht zu erschrecken, wollte Mama in ein Hotel.«
August Wilhelm Ring versuchte, die Türe zu erreichen und unbemerkt sich zu entfernen. Da rief ihn der alte Mann: »Ich kann nicht zu meiner Tochter – lieber August Wilhelm, würden Sie nicht in das Hotel gehen und meine Tochter holen?«
August Wilhelm war mit der fremden Dame auf der Straße. Die Dämmerung lag über Berlin. Schreiende Menschenhaufen zogen die Potsdamer Straße hinunter. Weit und breit sah man kein Gefährt. Diese Menschenknäuel ließen sich nicht durchrasen. Man stand Brust an Brust mit feindselig oder frech Blickenden – man kam ihnen nahe, als wollte man sie küssen, man wurde wie ein Quirl gedreht und sah andern in die müden, heischenden oder flackrigen Gesichter. Auf dem Potsdamer Platz johlten Soldaten. Sie trugen denselben grauen Rock, in dem die Todgeweihten des August einst auszogen. Jetzt barg der Rock Gesindel oder verzweifelt Enttäuschte, Straßenläufer, Aufwiegler, Zerbrochene. Die Entscheidung des Kaisers mußte noch nicht da sein, fühlte Ring. Er drängte hinunter nach der Bellevuestraße. Sie war ein wenig leerer – und der Weg der Siegesallee gestattete wieder ein leidliches Gehen. Vom Brandenburger Tor her hörte man das Knacken der Maschinengewehre.
»Es ist Revolution,« sagte sie. »Das große Wecken, das große Erwachen, Weltreveille. Sie bangen um einen einzelnen Menschen – um Wilhelm. Und es ist doch Menschheitsfrühling.«
Pathos. Altes Pathos. Neu von jungen Lippen, dachte August Wilhelm Ring. Und begriff plötzlich, das war nicht Phrase bei seiner Begleiterin. Mit ihren Augen, die in der Farbe des Bernsteins, der im Meeresgrund liegt, über alle Dinge so blicklos forschten, konnte sie wohl einen Menschenfrühling erträumen. In Hunderte von Gesichtern hatte er heute schon geblickt. Gab es einmal den Glauben, die germanische Rasse sei schön?
Sie waren in der Nähe des Brandenburger Tores. Gebrüll, Lärm, Schüsse hallten von den Linden herüber. »Ich würde Sie nicht bemühen,« sagte Fräulein v. Envers, »wenn es möglich wäre, mit meiner Mutter die kommende Nacht hier Unter den Linden zu verbringen. Wir sind Flüchtlinge. Unser Landhaus, unser Park bei Riga brennt vielleicht noch. Mein Vater ist ermordet worden, trotzdem er so fest an die Menschenrechte glaubte. Er begriff nur nicht, daß die Tiere, die das heilige Wort brüllten, Geld damit meinten – «
Verwirrt blickte August Wilhelm Ring in das blasse Gesicht mit dem roten Mund. Was für ein Singsang, fühlte er. Unser Haus brennt, mein Vater ist ermordet, die heiligen Menschenrechte – oh, nun begriff er plötzlich, warum alles, was dieses Mädchen sagte, so aus weiter Ferne klang. Sie hatte es gesehen, zuschauend mitgelebt, aber es war noch nicht zu ihrem Herzen gedrungen.
Durch die Linden rasten Lastautos, mit Maschinengewehren besetzt. Zum Schloß – zum Schloß. Durch das Brandenburger Tor rasten Autos mit treulosen Soldaten, die auf die Volksgenossen schossen. Wo waren Seiner Majestät Offiziere? Noch an den Grenzen? Wo war der Bürger von Berlin? Ein Flackerrot stieg in August Wilhelms kühnes Gesicht. Und wo bin ich? Ich tue das nächste – ich beschütze ein junges Mädchen. Vorher stand ich müßig in den Gassen. Vorher war ich bei Hindenburgs Fahnen und dann mit dem lahmen Arm ein Kriegsberichterstatter! Wir konnten nicht schreiben, was wir wollten. Sonst hätten wir geschrieben: Gebt euren letzten Pfennig, damit ihr noch euer Haus behaltet. Gebt dem Volk den Traum der Freiheit, sonst gibt es euch den Terror. Man mußte schreiben: Wir siegen auch im Rückzug.
Ein Matrose versperrte Fräulein v. Envers den Weg. Das wüste Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. Man mußte stehen bleiben, die Menschenmauer gab keine Möglichkeit, sie zu durchdringen. Der Matrose hatte ein feistes Gesicht und bläuliche Backen. »Du willst wohl Wilhelm beistehen,« sagte er durchaus nicht spöttisch, nur wie feststellend zu Ring. »Da biste zu weit weg, der türmt. Der tigert.«
»Er türmt nicht,« antwortete Ring.
Der Matrose lächelte. »Wirste sehen, daß er türmt. Du – du Freilein – ist der dein Schatz? Haste dich schon versprochen für den hübschen Abend –«
Ein Rätselhaftes geschah. Fräulein v. Envers sah den Matrosen an. Sie hob den Kopf, streckte das sonderbar geformte Kinn ein wenig vor und blickte dem Matrosen in die Augen. Er verfärbte sich. Wich zurück – Und wie in einer Spukgeschichte schien sich die Menschenmauer zu öffnen und doch nicht zu öffnen – sie nahm den Matrosen auf. Er war nicht mehr da.
Also, nu gibt’s erst Mal zur Abwechslung son bißchen Revolution
zum Schluß wird der arme Hund wieder in die Gefängnisse wandern und an die Mauer gestellt werden, genau wie in der Kommune einundsiebzig. Denn das haben die andern immer noch besser gekonnt. Aber wat jeht des mich an?! Ich bin Arzt. Ich verbinde de Weißen wie de Roten. Ich kenne keine Parteien, nur Patienten!!
Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser
Waldemar erwachte sehr spät. Er hatte viel und heftig geträumt. Der Kellner stand da. Er war von großer Jugend und sah wie ein Konfirmand aus. So feierlich in dem schwarzen Anzug, dem Vorhemdchen und dem wässerigen Scheitel. Seine Augen glitzerten, seine Hände fuhren in die Luft, seine Stimme war von Aufregung erfüllt. »Es ist Revolution! Der Kaiser hat abjedankt. Der Kronprinz ooch. Überall hängen schon die roten Fahnen heraus. Und ich habe gleich Ausjang. Es ist Revolution.«
Revolution! Von dem Wort ging eine Bezauberung aus. Waldemar stürzte den gräßlichen, bitteren Kaffee hinunter, zerkaute ein wenig muldrig schmeckendes graues Brot und war voll Eile. Und der junge Mensch lief die Siegesallee hinunter, lief dem Knacken der Maschinengewehre nach, frei von Nervosität und Furcht. Er wollte die kommenden Dinge sehen. Das Volk war auf den Platz gezogen, wo Bismarck, Moltke und der eiserne Hindenburg von der Geschichte des letzten halben Jahrhunderts erzählten. Kam die Menge hierher, diese Geschichte auszulöschen? Das Schießen wurde heftiger. Ab und zu wichen mit lautem Kreischen Frauengruppen zurück. Aber die Lücken, die sie ließen, schlossen sich rasch wieder. Unter dem Knattern von Maschinengewehren, die den Platz überstrichen, drängten sich die Menschen dem Reichstagsgebäude zu. Waldemar kam nahe genug heran, um einzelne Sätze zu hören, die ein Redner stoßweise in die Menge warf.
»Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, hat der Kaiser gesagt, der als siegreicher Held hier nach dem furchtbaren Krieg durch das Brandenburger Tor einziehen wollte. Und Matrosen sind es gewesen, die von Hamburg aus die Befreiung, die Revolution über Deutschland trugen.« Ein neues Knattern und Krachen von Schüssen ließ die Stimme des Redners zerflattern.