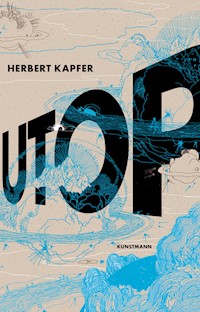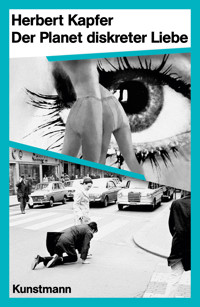
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München 1975: Bea und Kai sind um die 20, leben in der Kommune kollektiv 7 und arbeiten am Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse. Kai, Arbeiterkind, Schulabbrecher und Ausreißer, begeistert sich für den Dichter Rolf Dieter Brinkmann und für Charles Fouriers Utopie einer Gesellschaft der Leidenschaften und des Glücks. Bea, die aus »gutem Hause« stammt, engagiert sich in einer radikalen Frauengruppe und ist eine glühende Anhängerin der Künstlerin VALIE EXPORT und des Öko-Feminismus, wie ihn Françoise d'Eaubonne in ihrem Klassiker »Feminismus oder Tod« beschreibt: Das patriarchale System kann nur durch eine ökofeministische »Mutation« gestürzt werden. Aber wie lässt sich dieser Machtwechsel im Jetzt realisieren? Vor einer gemeinsamen künstlerischen Protestaktion erproben Bea und Kai hinter verschlossenen Türen die Umkehrung der patriarchalen Verhältnisse: Sie beginnen eine sado-masochistische Beziehung, in der ER der Diener und Glücksbringer und SIE die Herrin und Königin ist. Für Bea und Kai ist das ein gelebtes Modell, ein erster Akt, um die »Mutation« in der Welt zu realisieren. Doch lässt sich daraus eine »planetarische Bewegung gegen die Phallokratie« organisieren, wenn das Experiment in den eigenen vier Wänden bleibt? Herbert Kapfer erzählt in diesem sexual-politischen Kammerspiel in 7 Akten von einer brisanten Beziehung am Anfang einer neuen Zeit, von der Macht der Gesten und den Gesten der Macht, von Erniedrigung und Überhöhung und 810 Leidenschaften, von einer lustvollen Verbindung von Theorie und Praxis, die das Potential hat, die herrschenden Verhältnisse auf den Kopf zu stellen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herbert Kapfer
Der Planetdiskreter Liebe
Roman
Verlag Antje Kunstmann
Wet Leggewidmet für Ur Mum
Das Glück besteht darin, viele Leidenschaften zu empfinden und sie alle befriedigen zu können. Wir haben wenig Leidenschaften und können höchstens ein Viertel von ihnen befriedigen. Deshalb ist unsere Erde im Augenblick einer der unglücklichsten Himmelskörper des Universums.
Charles Fourier
Die im Buch zitierten und zusammengefassten Abschriften persönlicher Aufzeichnungen wurden mir von Niki Zorzor zur Einsicht überlassen. Sie selbst verfügt über die Originale. Die Verwendung dieser Selbstzeugnisse erfolgte mit Genehmigung der Besitzerin. Frau Zorzors Anmerkungen zu den Schriftstücken sind mit dem Kürzel N.Z. versehen. Sie konnten zwischen ihr und mir, von einigen Fällen abgesehen, einvernehmlich abgestimmt werden. Niki Zorzor bin ich zu Dank verpflichtet.
(Lob, Lob! N.Z.)
Schaufenster
Sanremo
5. April 1972
Bea war in der Oberstufe, als sie zum ersten Mal auf radikale Feministinnen traf. Ein Jahr vor ihrem Abitur verbrachte sie mit ihrem Vater die Osterferien in Ligurien. Am fünften April zweiundsiebzig wurden sie in Sanremo zufällig Zeugen einer Protestaktion. Der Tag sollte ihr unvergesslich bleiben. Sie trug den kurzen, leuchtend grünen Rock und den blauen Pulli, zwei Sachen, die sie als Kombination gefällig drapiert vielleicht eine Stunde zuvor im Schaufenster einer kleinen Boutique in einer Seitenstraße entdeckt und anprobiert hatte. »Steht dir gut. Wie angegossen.«
Bea war vor dem Spiegel gestanden, kritisch das eigene Erscheinungsbild musternd. Tatsächlich hatte es nichts auszusetzen gegeben. Auch die etwas abgenutzten, matt glänzenden schwarzen Lederstiefel passten dazu. Sie schafften einen lebendigen Kontrast zu den neuen modischen Teilen, die ihr im Nu vertraut vorkamen. Das angemessen verhaltene väterliche Kompliment war von ihr ohne eine Regung zur Kenntnis genommen worden. In einem unbeobachteten Moment hatte sie danach, einem plötzlich aufgekommenen Bedürfnis nach körperlicher Lockerung entsprechend, ihre Mimik mit einer Abfolge sekundenschnell wechselnder Grimassen strapaziert und dabei ihre Gesichtsmuskeln entspannt. Im Stillen freute sie sich über die anerkennenden Worte wie übrigens auch darüber, dass Paps, großzügig wie er am liebsten sein wollte, umstandslos – das war vorauszusehen gewesen – sein Portemonnaie gezückt und ein Bündel Lire-Scheine über den Ladentisch geschoben hatte.
»Grazie mille!«
Draußen wehte ein leichter, kühler Wind. Sie schlenderten ein wenig herum. Unter Palmen, vor dem Spielcasino beobachteten sie dreißig, vierzig Leute, die mit geballter Faust und umgehängten Schildern demonstrierten. Beas Vater wollte sich im Gegensatz zu ihr sofort abwenden. Sie aber blieb stehen und ließ das Szenario der überschaubaren Zusammenrottung auf sich wirken. Sie wollte wenigstens in Erfahrung bringen, worum es ging, und war auch selbst bei mehreren Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg oder das Abtreibungsgesetz mitgelaufen. Er, seiner neugierigen und insistierenden Tochter wie fast immer nachgebend, sofern sie nicht launisch oder hochmütig auftrat, bot ihr an, in einem nahen Café maximal eine halbe Stunde auf sie zu warten. Einmal mehr ein Beweis, wenn sie ihn nett behandeln und gleichzeitig auf Abstand halten konnte, war er ganz gut zu steuern. Lächelnd überreichte sie ihm die grell bedruckte Plastiktüte mit den in der Kabine ausgetauschten alten Kleidungsstücken – Jeansrock und dunkelroter Weste – und versprach bald nachzukommen. Er quittierte die Übergabe noch mit einem gefälligen Zwinkern.
Leider verlor Bea die Zeit aus dem Blick, da sie vor dem Casino mit einigen der protestierenden Frauen ins Gespräch kam. Sie waren ausnahmslos älter als sie, erwachsen, Studentinnen, Intellektuelle, manche im Alter ihrer Mutter. Dem wilden italienisch-französisch-englischen Kauderwelsch entnahm Bea immerhin, dass sich die Demonstration gegen die Eröffnung eines »Congresso internazionale sulle devianze sessuali« über sogenannte abweichende sexuelle Verhaltensformen richtete.
Am längsten redete eine Frau auf sie ein, die eine graue Felljacke und Jeans trug. Die dozierende Italienerin musste den Kopf in den Nacken schieben, um zu ihrer aufmerksamen, häufig nickenden Zuhörerin hoch sehen zu können. Bea konnte nicht alles verstehen, weil die quirlige Demonstrantin mit dem halblangen dunklen Haar und der großen Sonnenbrille ihre Sätze sprudelnd und heftig gestikulierend vorbrachte. Es ging um Repressionen des italienischen Staates und der katholischen Kirche. Bea, die allmählich dem Wortschwall zumindest passagenweise grob folgen konnte, gelang es nicht, sich dem Elan dieser couragierten Person zu entziehen. Sie hieß Mariasilvia Spolato, war Professorin für Mathematik, eine prominente, auch berüchtigte Feministin und die Begründerin der Fronte di Liberazione omosessuale. Mehrmals ließ sie den Begriff Fuori! fallen, den Namen einer Zeitschrift, für die sie Artikel schrieb.
Mariasilvia – Bea sollte sie einfach beim Vornamen nennen – erzählte der wissbegierigen Schülerin vom ersten Frauenkampftag in Italien, bei dem sie einen Monat zuvor in Rom auf der Piazza Campo dei Fiori demonstriert hatte. Kurz danach, so Mariasilvia, erschien ein Foto von ihr mit einem Plakat für die »liberazione omosessuale« auf dem Titelblatt des Wochenmagazins Panorama. Das Bildungsministerium leitete ein Disziplinarverfahren gegen sie ein, wegen unwürdigen Verhaltens in der Öffentlichkeit. Sie unterrichtete an einem staatlichen Institut in Rom. Ihr drohe die Entlassung. Alles sei noch in der Schwebe. Das überall nachgedruckte Bild habe landesweit Empörung ausgelöst. Sie sei die erste Frau in Italien, die sich zu ihrer Homosexualität bekenne. Bea zeigte sich unverstellt teilnahmsvoll und solidarisch. Sie reagierte auf Marisilvias Bemerkung über die harte ministerielle Reaktion mit kräftigem Kopfschütteln, wusste aber nichts zu sagen. Eine leichte Verlegenheit versuchte sie zu überspielen. Sie hatte erst wenige Begegnungen mit Lesbierinnen gehabt und sich selbst dabei als ziemlich unsicher und scheu erlebt.
Dass beim Frauenkampftag sogar die amerikanische Schauspielerin und Aktivistin Jane Fonda als Rednerin aufgetreten war, wie Mariasilvia stolz erwähnte, imponierte ihr. Umso skandalöser war es, dass die Polizei die Massenversammlung in Rom gewaltsam unter dem Einsatz von Schlagstöcken aufgelöst hatte. Mehrere Frauen seien verletzt von helfenden Demonstrantinnen vom Platz geführt worden.
Bea schaute sich um. Auch vor dem Casino waren Polizisten postiert. Es sah aber nicht so aus, als ob sie eingreifen wollten. Sie wirkten eher gelangweilt, manche auch amüsiert. Wenn überhaupt, so beobachteten die Ordnungskräfte einige junge Männer, die mit ihren langen gelockten oder gekräuselten Haaren als Protestierende und Außenseiter durch das normative Raster fielen. Ein Demonstrant trug ein handgemaltes Plakat mit der Aufschrift: »Psichiatri, ficcatevi i vostri elettrodi nei vostri cervelli« – eindeutig und klar genug, dass sich Bea die Parole ohne Übersetzungshilfe erschließen konnte: Psychiater, steckt eure Elektroden in eure Gehirne.
Sie empfand sich, vermutlich wahrgenommen als eine aufgeweckte Gymnasiastin aus Deutschland, wohlgelitten in dem kleinen Kreis eifrig parlierender Frauen, der sich inzwischen um Mariasilvia gebildet hatte. Bea registrierte aber, ohne sich etwas anmerken zu lassen, dass offensichtlich ihre eigene Erscheinung den Uniformierten besonders ins Auge stach. Vor allem zwei jüngere Polizisten links in ihrem Blickfeld – Bürschchen, die sich übertrieben oder bemüht lässig gaben, Ragazzi in steifer Kluft, wie sie zunächst belustigt dachte – starrten sie penetrant und vollkommen ungeniert an. Sie waren ihr besonders zuwider, weil sie bei ihr die Vorstellung auslösten, zwei unterdrückte Kreaturen würden einander schlüpfrige oder niederträchtige Bemerkungen über das gemeinsame Objekt ihrer ungehörigen Beobachtung zuraunen. Denn ihr Aussehen, das einer aparten, jungen Touristin – so Beas Selbsteinschätzung und Vermutung – schien sie zu reizen oder womöglich an die graziösen, Begierde erregenden Models einschlägiger Hochglanzmagazine zu erinnern, in denen pubertierende Knaben und verklemmte Senioren befangen blätterten, wenn sie beim Friseur auf den Schnitt warteten. Bea, die sich in diesen Fantasien beinahe verlor und plötzlich zur eigenen Bestürzung ausgezogen, nackt und gedemütigt fühlte, folgte abrupt einer Intuition oder wusste sich nicht anders zu helfen, als den unverschämten Blicken der pflichtvergessenen Uniformierten eisern standzuhalten und die beiden Ertappten so lange zu fixieren, bis diese sich scheinbar unbeeindruckt und eigenen Antrieb vortäuschend von ihr abwandten.
Zerstückelung
Köln
3. Dezember 1973
Kai erkannte ihn auf der Stelle, wagte aber nicht ihn anzusprechen. Es war eine kalte Nacht Anfang Dezember. Schnee lag in Köln. Die neonbeleuchteten Straßen waren matschig. Der Laster, mit dem er von Frankfurt bis hierher getrampt war, hatte ihn irgendwo an der Aachener Straße abgesetzt. Brinkmann, so wie er da stand, in einem hellen Staubmantel, den Kragen hochgeschlagen, wirkte unnahbar. Er war mit einem Gerät beschäftigt, einem Tonbandgerät und Zetteln, die er aus einer Tasche kramte, las und wieder einsteckte, zugange mit einem Mikrofon, das er offensichtlich testete, und einigen Aufnahmen, die er kurz anspielte. Die Situation, die Vorgehensweise Brinkmanns war mysteriös, Kai selbst nicht in der Lage, ganz genau zu erfassen, was hier in einem Abstand von etwa zwei Metern vor sich ging. Ob Brinkmann überhaupt Notiz von ihm nahm zu diesem Zeitpunkt und wie diese Zufallsbegegnung im Detail ablief, würde er Stunden später kaum rekonstruieren können, so überrumpelt fühlte er sich von der Erscheinung, aber auch übermüdet und noch nicht in dieser Stadt angekommen, in der er noch nie gewesen war. Im Gedächtnis blieben ihm eine Reihe von Wörtern, die Brinkmann von Band spielte oder einsprach oder die er als Hörer hinzu fantasierte oder falsch verstand oder später richtig erinnerte: kleine matschige Flocken, durch dunkle Schatten, Zeitverknappung, Unsinn der Gegenwart, Unsinn der Vergangenheit, vollgefüllte deutliche Begriffe, Zeitentzug, das Ende aller Dinge, trockene Lippen, Atemgeräusche, Wellpappe, Körperempfindung, Bewusstsein, Lebensgeräusche, Menschenlarven, verbranntes Zelluloid, ein unbekanntes Licht, erstorbene Fantasie, Wichtelmännchen, in Schlachtordnung, Gefühl der Kleinheit, Dreckshaufen, Hundeblicke, Dogmatik, bloßes Denken, schmieriger Alltag, verfluchte Gegenwart, verfluchte Realität, Staaten und Kriegsheere, technische Geräte, Schrecken und Angstschweiß, analerotische Signale überall, überall Grimassen, Fahndungsbücher, Backsteinkanten. Auch Autowracks kamen vor, an die Wand geklebte Stücke, blutige Striemen, in welchem Zusammenhang auch immer, Schwarzer Afghan. Hier war die zugenagelte Bretterwand, dort fiel das Wort Versteinerungen oder Bauchnabel, immer wieder Felle, Körper mit dem Gefühl von Nässe und Kälte, immer wieder schmierige Typen, immer wieder schmierige Straßen, Hungerszenen. Es wimmelte von Abfällen, toten Blättern, jeder Menge Mufftypen. Mehrfach wurde eine Texaco-Tankstelle erwähnt. Menschenmasken, doofe Nüsse und abgetakelte Häuser waren da, von einem Verlieren in der Menge war die Rede, von Aufmerksamkeit immer an das Momentane.
Für Sekunden drangen Fetzen von Songs und Improvisationen aus dem Lautsprecher des Rekorders, von Velvet Underground, Sam & Dave, Rolling Stones, Soft Machine, Traffic und möglicherweise Dizzie Gillespie. Sowie andere, dem Zuhörer unbekannte Musikstücke. Partylärm, übersteuerte wilde Klänge. Einzelne Wörter wurden flüsternd ins Mikro gesprochen, Glotzgesichter, vergorene Gefühle. Dann ganze Sätze, von denen Kai später aber nur mehr einen gehört zu haben glaubte: Die auffallenden Unterschiede verschwinden, die Erde wird überall gleich. Eine weitere Satzhälfte immerhin meinte er in Erinnerung behalten zu haben, über den übrig gebliebenen und in der Luft umherfliegenden Verstand eines Menschen, der bald in seiner Vorstellungskraft zerflatterte. Manches war absolut unverständlich, etwa wenn von Fragmenten, die an den Leichnamen hingen, geredet wurde und, wie zu hören war, andren Materialien. Auch einzelne Laute wie Brrrr oder Bäh Bäh Bäh waren zu vernehmen, dann wieder gesprochene Wörter vom Band oder der ins Mikro sprechenden Stimme, über vertrocknete Platanenblätter, die einsamsten und abgelegensten Gegenden der Stadt, erloschene Buchstaben, kleine Schwirrvögel, irgendeine Widerwärtigkeit, graues Fleisch, gelbsandige Wege. Manche Wörter klangen rau, hart, angewidert, andere zugewandt, zärtlich, weich, traurig: Sex, Schnitte, Titten, tote Flüsse, Kinderknarren, Chillums. Einzelne Vornamen wurden genannt, Maleen, Robert, Henning, in Verbindung gebracht mit Schlangenleder, Verhören, schwarzen Beeren, Wortjauche und Rocky Mountains Musik Dreck.
Erst fröstelnd, dann zitternd vor Kälte hörte Kai zu. Seine Füße waren eiskalt, die Nase lief ununterbrochen. Er verlor sich im uferlosen Fluss der Wörter und ihrer Bedeutungen. Es gab Augenblicke der Stille. Er traute sich nicht, sie zu durchbrechen. Dann hantierte Brinkmann wieder mit seinem Mikro, seinem Gerät und seinen Zetteln, spulte das Band vor und zurück, und machte kurze Aufnahmen. Endlich wandte er sich ihm zu: »Na und, na und.«
»Entschuldigung«, stammelte Kai, »ich kenne mich nicht aus hier, aber Sie sind – da war ein Artikel in der Zeitung, den ich ausgeschnitten habe, mit einem Foto. Sie sind Brinkmann, Rolf Dieter Brinkmann oder nicht?«
»Brinkmann, Brinkmann, wer ist schon Brinkmann«, sagte Brinkmann, »na und, na und, na schön. Wer bist du? Wie heißt du? Wo kommst du her? Sag, wer du bist. Wer bist du, na sag schon.«
Er fühlte sich von den knappen, klaren, in gleichbleibendem Klang wiederholt gestellten Fragen hart bedrängt, und brachte, so in die Defensive gekommen, nur mühselig einige Sätze hervor.
Er hatte nicht den Eindruck, dass Brinkmann seinem Gerede folgte. »Was für ein Aufzug, wie ihr euch ausstaffiert, Parka, lange Haare. Öde Typen, genauso öde wie die Popmufftypen, die jetzt überall rumhängen. Bleibt mir bloß mit eurer verschimmelten Ideologie vom Leib, Jungs, mit euren dämlichen Wörtern, mit euren endlosen Bandwurmsätzen in den verfluchten Seminaren.«
Er sei kein Student, erwiderte Kai. Er sei ausgerissen, abgehauen, vor sechs Wochen. Er habe die Schule hingeschmissen, ein Jahr vor dem Abi. Jetzt würde er herumtrampen und so. Mit dieser Antwort schien Brinkmann einigermaßen zufrieden zu sein. »Kannst du mal nehmen.« Er hielt ihm den Bandrekorder hin. Es war keine Frage, es klang eher nach einer Anweisung, wie sie Assistenten gegeben werden. Er nahm das Gerät, das in einer schwarzen Ledertasche an einem Riemen baumelte. Brinkmann holte einen kleinen Schreibblock aus der linken Innentasche seines Staubmantels und einen Stift. Er kritzelte zwei oder drei Wörter auf ein Blatt, steckte den Block wieder ein, und sagte, nachdem er mit einer Handbewegung das Tonbandgerät zurückverlangt und wieder umgehängt hatte, ins Mikro: »Das Wirkliche war nun da, nur durch Zeit und Zufälle verdunkelt. Die Erdstöße, die Tiefflieger, die Granatsplitter. Mangel an Gegenwart, die wilde Lust, Zustand der Gleichgültigkeit, Gefühle abgestumpft, aufgerissener Asphalt, die leere Wirklichkeit, nichts als die leere Wirklichkeit, die kahle Wirklichkeit, Schrecken und Grauen vor der Zukunft, keine Zukunft mehr, zurückgebliebene Aschenhaufen. Schuldgefühle, Ordnung, fleißig sein, alles wieder gut machen. Dumpfheit der Empfindung, menschliche Larven, Zerstörung und Zerstückelung des Körpers. Die tägliche Gewohnheit« – Brinkmann hielt inne und blickte suchend noch oben – »durch die tägliche Gewohnheit vergisst man, vergisst man am Ende, dass man einen Körper hat. Dass man einen Körper hat, der allen Gesetzen der Zerstörung unterworfen ist. Einen Körper hat, der allen Gesetzen der Zerstörung in der Körperwelt unterworfen ist, als« – Brinkmann lachte auf – »als ein Stück Holz, das wir zersägen oder zerschneiden, also dass sich der Körper nach eben den Gesetzen bewegt wie jede andere von Menschen zusammengesetzte körperliche Maschine.«
»Das Wichtigste im Leben spielt sich 85 Zentimeter über dem Boden ab«, flüsterte er, das Mikro nah an den Lippen. Er fasse sich an seinen Schwanz, seinen Sack. Hier unter diesen Winterbäumen rollten so viele Gedanken und Empfindungen unaufhörlich durch seinen Kopf. Misstrauisch mache ihn die ungeheure Verketzerung von Onanie bei den linken Theorieheinis. Immer würden sie sagen, das sei doch Onanie. Woher bloß diese Wut über eine sexuelle Betätigung komme. Überall gebe es Schwierigkeiten mit Frauen und mit Sexualität. Alles sei zugestopft von dieser alltäglichen Realität, jede Empfindung, jedes gute Gefühl, jede Lust durch den Druck von außen beinahe erloschen. Der Staat hetze Männer und Frauen gegeneinander auf. Elende Berufsarbeiten! Es gehe nur noch um Arbeit und Fleiß, ein Arbeitslager sei Westdeutschland. Diese ganze miese schimmernde Gesellschaft, in der er wie ein Gespenst täglich herumwandere, diese Gestalten, die leeren Phantomen nachjagten, alle Glieder zitterten mit konvulsivischer Bewegung, die Muskeln des Gesichts verzerrten sich in schreckliche Mienen – »und immer diese Raserei nach dem Geld! Jeder hat das Papier vom Staat in der Tasche!«, schimpfte Brinkmann jetzt und schaltete auf Stopp. Dann spulte er das Band zurück, hörte sich einige Sekunden an und drückte nach zwei oder drei Wörtern wieder die Aufnahmetaste. Er löschte eine Sequenz der Aufnahme, ersetzte oder unterbrach alte Wörter für neue, die er jetzt ins Mikro sprach.
Kai ging neben dem ununterbrochen Sprechenden, manchmal Schimpfenden oder Schreienden her, schaute, hörte zu, fasziniert, beklemmt von der hohen Emotionalität des von ihm bewunderten Dichters in der kalten Winternacht. Brinkmann nahm von ihm weiter keine Notiz, duldete aber den jungen Begleiter. Das Mikro nah an den Lippen flüsterte er: »Ich trete aus dem Haus, aus der Haustür.« Das letzte Wort hing in der Luft, der Satz war noch nicht abgeschlossen. Er machte eine Pause, in der nur seine Schritte zu hören waren, um dann stehen zu bleiben und mit lauter Stimme fortzufahren, »und trete zuerst mal in Hundescheiße, zuerst trete ich mal in Hundescheiße. Verdammte Scheiße hier«, tobte Brinkmann. Aber da war kein Haus, keine Türe und keine Hundescheiße. »Der gegenwärtige Zustand, bis auf den gegenwärtigen Augenblick! Wenn ich mir klarmache, dass ich zuerst, wenn ich aus dem Haus trete, aufpasse, nicht in einen frischen Hundekot zu treten, na und, na und, bäh, bäh bäh!«
Er hatte sich erregt, empört, hineingesteigert in diesen Augenblick, einen Augenblick, der zwar ein anderer war, als der von ihm als »gegenwärtig« behauptete, aber vorbei, vorbei, und wie gesagt, da war keine Hundescheiße, es war nur eine imaginierte, behauptete Hundescheiße gewesen, und überhaupt nur eine Aufnahme, nicht die Realität, nur die Aufnahmerealität, nur ein Teil der Realität. Was für ein Zustand, der gegenwärtige! Schnell und zornig ging Brinkmann weiter. Das umgehängte Gerät schaukelte am Riemen. Brinkmanns Körper erfasste eine plötzliche Bewegung, er wollte die Straßenseite wechseln oder sein rechter Fuß war von der Bordsteinkante gerutscht.
»Achtung!« Ein grauer Ford Mustang, aufgetaucht aus dem Nichts, bretterte donnernd, haarscharf an dem kurz wankenden Körper Brinkmanns vorbei. Kai, der dicht bei ihm stand, wollte ihn im Reflex am Mantelärmel fassen und zurückhalten. Da spürte oder halluzinierte er schon den Fahrtwind entschwundener Gefahr im eigenen Gesicht, und der ohrenbetäubend schmetternd-dumpfe Lärm des Motors klang nur mehr in seinem Kopf nach. »Total übersteuert!«, schrie Brinkmann. Es war nicht klar, ob er die Gefährdung empfunden, die Situation überhaupt als bedrohlich wahrgenommen, die Warnung gehört hatte. »Aber ein tolles Gerät, nimmt sehr gut auf, das Uher 4100 Report-V«, sagte er nur und kratzte mit seinen Fingernägeln am Mikrofonkopf. Manche Momente seien, obwohl eine Maschine alles aufnehmen würde, echter als die sogenannte Realität. Stille, die nur von einzelnen Geräuschen oder von mehreren Geräuschen gleichzeitig unterbrochen würde, das sei die Wirklichkeit – Brinkmann lachte kurz auf –, wenn es überhaupt so etwas wie Wirklichkeit gäbe, geräuschlos gewordene Bänder. Es sei komisch, überall gäbe es Ereignisse die nicht stattfänden. Ein schwerer Lastwagen fuhr vorbei und schleuderte den Matsch auf den Gehweg. »Hier haben sie Salz gestreut, aber alles ist schon wieder zugefroren. Winter. Winter mit Autogeräuschen«, sagte Brinkmann, »und Winter mit Fickgeräuschen. Wenn ich nachts durch die Straßen gehe und diese erleuchteten Fenster sehe, sehe ich nicht, dass darin jemand lebt, vielleicht erschlaffte, müde Körper, da drinnen, in den viereckigen Schachteln. Hässlich hier in Köln zu leben neunzehnhundertdreiundsiebzig, in Deutschland, Westdeutschland. Diese Scheißrealität!« Er ist sich seines Bewusstseins bewusst, dachte sein Zuhörer, und er nimmt nur sich selbst wichtig, um den gegenwärtigen Augenblick zu verstehen. Matsch der Gefühle und Matsch der Gedanken: Alles ist ein einziger Wörtermatsch, und überall ist keine Zeit mehr vorhanden, für nichts mehr. Wenn ich Brinkmann reden höre, erinnere ich mich an mich selbst, auch wenn er gar nicht zu mir, gar nicht mit mir spricht, weil sein Gefühl mir so verständlich ist, das dahinter steckt. Er lebt ohne Musik, geht überhaupt nicht mehr ins Kino. Er kann den Tag draußen nicht mehr ertragen, bleibt in seinem kleinen Zimmer. Ich kann dieses Bedrücktsein verstehen, dieses muffige Zeug, wie er sagt. Er spricht über seine sieben Gedichtbände, seine Hörspiele, und dass er davon nicht leben kann. Achtundsechzig habe er angefangen Kurzfilme zu machen, dann Fotos ab siebzig. Ich schreibe meine Bücher, sagt er, und packe sie dann weg. Ich bin kein Hausierer, sagt er. Ich bin doch nicht blöd. Er redet von Städten, die nur noch rauchende Müllkippen sind. Verdammt nochmal, warum verwüstet ihr denn alles, schreit er. Wörter hinausbrüllen, das ist gut. Er redet über die Hässlichkeit der Wörter, zum Beispiel das Wort Wohnsitz. Man könnte doch nicht immer sitzen. Man sitzt doch nicht immer. Er sei immer mit einem kleinen Notizbuch unterwegs, notiere sich Eindrücke, immer überall. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem Gefängnis lebe, sagt er, und dieses Gefängnis ist der Staat. Das sei die kalte Bratpfanne der Gegenwart. Eine enorme Hässlichkeit überall, dazu diese bleichen Neonlichter, die schäbigen Plätze mit ihren verwischten Gestalten, die miesen Reklamewände, die stinkenden Abfälle, sie trieben ihn aus der alten, verrotteten Welt, in der an manchen Orten kein Mensch mehr ein freies Wort zu flüstern wage. Alles sei ausgezehrt von den Massenmedien. Die Massenmedien legten ihre Larven in den Körpern ab. Heraus kämen Kopien, überall Kopien. Jeder kopiere irgendetwas. Und überall Grimassen! Kotzige Visagen. Überall kuckten Polizisten aus den Leuten heraus. Du hast das Gefühl, hier ist überall Krieg. Vorschriften, Vorschriften, Polizisten. Am Staat seien so viele Empfindungen und Gefühle verreckt. In diesem Staat stehe jeder gegen jeden. Unterdrückung Tag für Tag: gäbe es nur ein Projekt, dieses Ungeheuer zu vertilgen, sähe er nur eine Möglichkeit, sich aus dem Taumel und dem Gefühl der Widrigkeiten zu befreien. Mit Literatur habe er aufgehört. Er scheiße darauf, sich um Gelder zu bewerben. Geld und Polizei, wo sei da der Unterschied. Dinge, Dinge, überall Dinge, Millionen mit der Empfindung nicht zusammenhängende Dinge!
»Dass dich tausend Gegenstände umgeben in einer Scheißrealität, in der man nicht einmal das Eigentum seines Lebens besitzt, wo man nur noch arbeiten kann. Malochen in Reih und Glied mit anderen fiesen Gestalten. Alle Empfindungen und Gedanken, alle Wörter halb erstickt und abgerissen. Die gespenstische Gegenwart. Keine Farben mehr, keine Gerüche mehr, wenig schöne Gefühle beim Durchqueren der mickrigen Stadt, und wenn ich hoch blicke, sehe ich nur drei, vier Sternenlichter«, sagte Brinkmann und drückte die Stopptaste. Für einen Augenblick herrschte Stille. Schweigend schleppte sich Kai neben Brinkmann her. Er konnte kaum mit ihm Schritt halten, fiel manchmal auch einige Meter zurück. Er war nahe daran, sich bei dem Autor, dessen Roman Keiner weiß mehr ihn beim Schreiben unterschwellig beeinflusste, zu erkundigen, wie er und Ralf-Rainer Rygulla an die Beat- und Underground-Texte für ihre Superanthologie Acid herangekommen seien. Wie er es überhaupt anstelle, Bücher, und dazu dermaßen gigantische, herauszugeben. Und wofür er die Aufnahmen dieser Nacht verwenden würde. Doch eine plötzliche Befangenheit hinderte Kai, die Fragen zu formulieren, ausgelöst durch aufzuckende Gedächtnisfetzen zur Beschaffung seines persönlichen Exemplars von Keiner weiß mehr. Er bewegte sich traumähnlich durch eine halbdunkle, grauweiße, urbane Landschaft, mit heimlicher Schuld beladen, in engstem Abstand zu dem berühmten Verfasser jenes Romans, der von ihm als Fünfzehn- oder Sechzehnjährigem spontan stibitzt worden war – nicht der Nachdruck, sondern selbstverständlich die gebundene Erstausgabe. Der Schutzumschlag hatte ihn gelockt und dazu verführt, das dreihundert Seiten dicke Buch in einem Laden, im Stapel noch nicht einsortierter Neuerscheinungen obenauf liegend, an sich zu reißen und, ohne es auch nur einmal flüchtig durchblättert zu haben, heiß- und kaltblütig zugleich hinter dem Gürtel seiner Hose verschwinden zu lassen. Der mit einem farbigen Gruppenfoto überzogene Umschlag zeigte auf seiner Frontseite einen Ausschnitt mit den Körpern dreier sich bewegender Personen. Die Köpfe fehlten, wie es das Format vorsah. Blickfang war ein Frauenkörper in grün gestreifter Bluse und dunkelblauem Minirock zwischen zwei männlichen Körpern. Die unterhalb der Schultern und oberhalb der Knöchel angeschnittene Frauenfigur bewegte sich auf Tuchfühlung mit der rechts von ihr abgebildeten männlichen Gestalt in Jeans und kurzem schwarzen Ledermantel – vielleicht, wie ein Betrachter assoziieren mochte, in einer Momentaufnahme beim Tanzen oder einer Party oder beim Sex.
Einzelne Passagen des Romans waren dem motivisch befeuerten Gelegenheitsdieb besonders bildhaft in Erinnerung geblieben. Eine verknüpfte sich mit den kopflosen Körpern auf dem Umschlag: Der Romanheld beobachtete vom Balkon aus in Autos sitzende Frauen, deren Oberkörper er wie abgeschnitten wahrnahm. Er verfolgte die Beine, schaute auf freiliegende Knie und Strümpfe. Eine andere Erinnerung an die Lektüre führte in einen muffigen, dunklen Keller unter einem Buchladen zu den dort arbeitenden Lehrlingen, die alle irgendwie immer Bücher mitgehen ließen. An der Seite Brinkmanns durch die nasskalte, fremde Wintergegend stapfend, fiel ihm jene in bestem Juristendeutsch abgefasste Beilage ein, die sein eigenes, geklautes Keiner weiß mehr-Exemplar enthielt, ein Kärtchen, das bei der ersten Besichtigung der Beute daheim aus dem begehrten Druckerzeugnis herausgefallen und auf dem Fußboden gelandet war. Die Karte – nicht so subversiv verspielt gemacht wie das Leporello mit pornografischen Fotos und Zeichnungen in Fritz Teufels und Rainer Langhans Buch Klau mich mit dem satirisch-rechtlichen Hinweis, wonach die von der Kommune I eingelegten Bildchen vor dem Verkauf entfernt werden könnten, sie war eine Reliquie, die Kai den Freundinnen und Freunden häufig mit Besitzerstolz zeigte. Das grafisch anspruchslose, bürokratische Kärtchen, das der Pop-Art-mäßig gestalteten Erstausgabe des Brinkmann-Romans beilag, gab vor, jedem Käufer das Versprechen abzunehmen:
Ich erkläre, daß ich das 18. Lebensjahr vollendet habe und den Roman Keiner weiß mehr ausschließlich für meinen privaten Gebrauch erwerbe. Ich werde das Buch Jugendlichen nicht zugänglich machen, es weder privat noch gewerblich ausleihen.
Anschrift … Unterschrift … Datum …
Diesen ungewöhnlichen Zettel mit seinem Spruch für Spießer und Paragrafenreiter fand Kai sehr lustig, vor allem, weil er selber sich davon nicht im Geringsten angesprochen fühlen musste: Er war weder ein Käufer des Buchs noch ein volljähriger Leser des Romans gewesen.
Ein extrem schräger Bücherklau, der ihm in diesem Augenblick in den Sinn kam, wurde auf den letzten Seiten von Keiner weiß mehr beschrieben, unternommen vom Protagonisten des Romans und dessen Freund Rainer. Kai empfand beim Lesen Mitgefühl für die Buchhändlerin, die von den beiden Typen gnadenlos getriezt und düpiert wurde, nachdem sie besorgt oder warnend darauf aufmerksam gemacht hatte, dass der Laden von Detektiven überwacht werden würde. Wie er jetzt in dieser Winternacht neben dem bewunderten Autor des Werks dahinging, angestrengt auf der Suche seinerseits einen Gesprächsstoff einzubringen, wurde ihm rasch klar, dass der Einfall, sich quasi komplizenhaft – sozusagen von Dieb zu Dieb – mit Brinkmann auszutauschen, den Autor mit dem Romanhelden gleichsetzen würde und schon deshalb schnellstens verworfen und vergessen werden sollte. Kai spürte einen Anflug von Verzweiflung, eine rollenmäßig vorgegebene Ungleichheit, die mancher Fan erfährt, der manisch die Nähe zu seinem Idol sucht.
Gerne hätte er ein Gespräch mit Brinkmann auf Augenhöhe geführt, von Schriftsteller zu Schriftsteller. Ihm fiel das Gedicht Augenblicke ein, das er selbst vor ungefähr zwei Jahren geschrieben hatte, und in dem dreimal die Zeile »Das ist also jetzt der gegenwärtige Augenblick« vorkam. Oft dachte er an die Zeile, die sich, von der Poesie losgelöst, selbst in Erinnerung brachte und in jedes beliebige Geschehen einmischte, wann auch immer: das ist also jetzt der gegenwärtige Augenblick, ja, ja! Aber ein Gespräch auf Augenhöhe, in diesem Augenblick, es war nicht möglich, von vornherein nicht möglich gewesen. Denn Kai hatte außer einigen Texten in kleinen Zeitschriften nichts veröffentlicht, und viele, auch Augenblicke, waren ungedruckt. Wer war er schon für Brinkmann, was konnte er mehr für ihn sein als ein Niemand, im besten Fall ein Fan. Keiner weiß mehr, einer weiß weniger, dachte er, beinahe grimmig, beinahe verbittert über diesen Einfall. Er könnte sich nie erklären, warum er in diesem Augenblick lebte, hörte er Brinkmann neben sich unvermittelt sagen. Die Sprache würde ihm beim Denken im Wege stehen, und doch könnte er wieder ohne Sprache nicht denken, oder so ähnlich. Begriffe, sehr dunkel und verworren. »Diese Mufftypen, sie wollen etwas über ein Dichterleben wissen«, sprach die Stimme ins Mikro, »ich soll Auskunft geben, worüber denn? Was wollen sie denn hören, Ansichten, Meinungen? Gottverdammte Wörter! Nichts als gottverdammte Wörter, alles geordnet und geregelt. Verbrauchte, tote Wörter. Selbst Wilhelm Reich redet von einer Körpersprache, also wieder Sprache, wieder Wörter! Menschen, durch Wörter festgehalten beim Ficken.« Kai war bei dem zackigen Reizwort, das er selber nicht in den Mund nahm, plötzlich wieder hellwach geworden. Schon bei der Lektüre des Romans Keiner weiß mehr irritierten ihn die chauvimäßigen, aggressiven Sprüche und Wörter des Romanhelden und seiner Freunde, wenn von Titten, Scheißfotzen, nassen Dosen, Nuttenfleisch, Klitorisfrauen und Vaginafrauen die Rede war oder darüber sinniert wurde, ob einem Mädchen auf der Straße oder der eigenen Frau die gelben Lackstiefel besser stünden. Er erinnerte abfälliges Gerede über kleine Mädchen in regennassen Gummistiefeln. Hänseleien von Klassenkameraden: »Weiberschmecker!« Treffen an Nachmittagen mit Freundinnen und Freunden aus dem Gymnasium, bei denen sie, einander unter Gelächter aus den frisch geklauten Büchern Sexfront und Josefine Mutzenbacher vorlasen. Den kahlköpfigen Direktor, von dem er als Rädelsführer der Schülerbewegung bezeichnet worden war. Einige zehn, zwölf Jahre ältere Rebellen, die er bei Demos kennenlernte, wie sie über Kommunen und Reichs Die sexuelle Revolution diskutierten. Und Mike, der ihm in den ersten Nächten, nachdem er ausgerissen war, Unterschlupf gewährte, in einer winzigen, mit Bücherkartons vollgestopften Einzimmerwohnung, im Schlafsack auf einem schmalen Streifen des Linoleumbodens. In keinem Gespräch ließ der Philosophiestudent, der auf die dreißig zuging, Hegel unerwähnt, und fast jedes Mal kam er auf Charles Fourier zu sprechen. Sprudelnd vor Eifer breitete Mike, der mit einer Dissertation über die Theorie der vier Bewegungen des lange verspotteten Dialektikers und Frühfeministen nur schleppend vorankam, dessen Ideen der universellen Harmonie aus. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hatte Fourier das Gesetz der Attraktion, die leidenschaftliche Anziehungskraft, als Quelle des sozialen Glücks entdeckt: Jedes Begehren war von der Schöpfung gewollt und dazu da, erfüllt zu werden. Alle Passionen sollten, in Gruppen kombiniert, Serien bilden, wie die Natur, das Universum, die Planeten. Mike überschlug sich fast in Superlativen für diese Liebes- und Sexualutopie. Ein großzügiges Leben in Liebesgemeinschaften, in prunkvollen Gebäuden, Phalansterien, voller Luxus und Vergnügungen, mit geregelten Orgien und kurzweiliger Arbeit eigener Wahl. Kein Patriarchat, keine Monogamie, schwärmte Mike, keine Unterdrückung der Frau, dafür öffentliche, freie Liebe. Jede Lust war gut. Ersehnten manche, mit einer Türkiskette traktiert zu werden, genossen andere die Vorstellung, solches Verlangen taktvoll oder schlagkräftig zu befriedigen. Die Leidenschaften ergänzten einander. Selbst eine Neigung, der weltweit vierzig Menschen anhingen, bereicherte die Vielfalt der Harmonie, ginge es doch um das Glück jeder einzelnen Person.
(Fourier, der Kapitalismuskritiker und Erfinder des Begriffs Feminismus, wird häufig als großer Menschenfreund bezeichnet. Dies trifft nicht uneingeschränkt zu. In seinen Schriften attackierte er »die Juden«, denen er pauschal Ausbeutung, Wucher und betrügerischen Handel unterstellte. N.Z.)