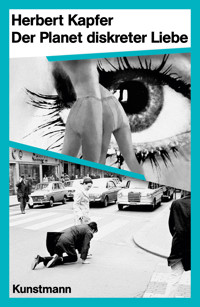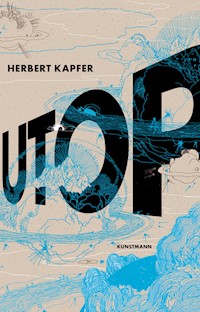
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Utopisches dringt in dargestellte Wirklichkeiten, zerdehnt und sprengt geschichtliche Rahmen. In UTOP verweben sich in drei Teilen – Siedler, Jünger und Geister – Erzählungen, Episoden und Szenarien von Arbeiterrevolten, Vorkriegs-Bohème und Geschlechterkampf, Sekten- und Siedlungsgründungen, Bodenreform und sozialrevolutionären Experimenten, von der Züchtung primitiver Arbeitsgeschöpfe, gigantischen Raumflottengefechten und der innigen Begegnung eines terrestrischen Raketenoffiziers mit einer friedliebenden Marsitin. Auf einem Utopistenkongress mit den großen Geistern aller Völker und Epochen, ergreifen u.a. Hannah Arendt, Ernst Bloch, Donatella Di Cesare, Charles Fourier, Thomas More, Simone Weil und die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung das Wort. Und im Haus der Intelligenz entbrennt ein Streit über die biologische Unsterblichkeit. UTOP ist ein Roman mit Zeitluken in die Gegenwart, dessen Handlung von zahlreichen Stimmen überliefert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
UTOP - Glücksversprechen, Menschheitsträume und Systeme prallen in diesem Roman aufeinander, und wie in einem surrealen Film erscheinen Parallel- und Gegenwelten, Neuland-Expeditionen, Handlungsstränge deutscher Zukunftsromane des letzten Jahrhunderts, so wirr und widersprüchlich wie konkret und visionär.
Utopisches dringt in dargestellte Wirklichkeiten, zerdehnt und sprengt geschichtliche Rahmen. In UTOP verweben sich in drei Teilen – Siedler, Jünger und Geister – Erzählungen, Episoden und Szenarien von Arbeiterrevolten, Vorkriegs-Bohème und Geschlechterkampf, Sekten- und Siedlungsgründungen, Bodenreform und sozialrevolutionären Experimenten, von der Züchtung primitiver Arbeitsgeschöpfe, gigantischen Raumflottengefechten und der innigen Begegnung eines terrestrischen Raketenoffiziers mit einer friedliebenden Marsitin.
Auf einem Utopistenkongress mit den großen Geistern aller Völker und Epochen, ergreifen u.a. Hannah Arendt, Ernst Bloch, Donatella Di Cesare, Charles Fourier, Thomas More, Simone Weil und die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung das Wort. Und im Haus der Intelligenz entbrennt ein Streit über die biologische Unsterblichkeit.
UTOP ist ein Roman mit Zeitluken in die Gegenwart, dessen Handlung von zahlreichen Stimmen überliefert wird.
Über den Autor
Herbert Kapfer, 1954 in Ingolstadt geboren, ist Autor und Publizist. Von 1996 bis 2017 leitete er die Abteilung Hörspiel und Medienkunst im BR. 2017 erschienen die Bücher Verborgene Chronik 1915–1918 (mit Lisbeth Exner) und sounds like hörspiel. Er wurde mit dem Tukan-Preis ausgezeichnet für 1919. Fiktion (2019).
Herbert Kapfer
UTOP
Roman
Verlag Antje Kunstmann
I.Siedler
Man muss das Unmögliche so lange anschauen
bis es eine leichte Angelegenheit ist. Das Wunder ist eine Frage des Trainings.
Das Zeitbuch von Poseidonis
Ataxikitli strich mit beinahe zärtlicher Gebärde über das prachtvolle Werk, das ein einzelner Mensch kaum zu heben vermochte und das mit den Sinnbildern der gefiederten Schlange, des heiligen Dreizacks, der Wellenlinie, der offenen und der geschlossenen Muschel, der sieben Vögel, des Lebensbaumes und so weiter geschmückt, die Geschichte des Landes von Urzeiten an enthielt, doch nicht immer in zusammenhängender Form, sondern aus unzähligen, oft bruchweisen Abschriften alter Steintafeln zusammengesetzt, denen, ebenso zierlich ausgeführt, viele halbvergessene Überlieferungen, nur noch im Volksmund weiterlebend, alte Sprüchlein, merkwürdige Vorhersagungen und allerlei Aufzeichnungen über die Taten längst verstorbener Helden beigefügt waren. Jedes Blatt dieses kostbaren Zeitbuches war eine dünne Ledertafel, in die mit scharfem Stift die gewundenen Schriftzeichen eingeritzt worden waren.
Die Anfangsworte, ja oft ganze Zeilen, waren reich bemalt, und zwar entsprach die Farbe immer genau dem Inhalt: Geistiges, den Glauben und die alte Weisheit betreffend, war in Grün gehalten, Seelisches blau, Heldentaten rot, wärmendes Wissen lichtviolett und düstere Vorhersagungen in dunkelviolettem Ton, so daß man schon an der Farbe die Art des Inhalts zu erkennen vermochte. Seine einzige Tochter Isolanthis hatte mehr als drei Jahre an diesem Buch gearbeitet, hatte alles niedergeschrieben, was im Haus der Wissenschaften auf alten Tafeln stand, und hatte alles zu erlangen ersucht, was im Volksmund an Liedern, Sprüchen und Andeutungen auf zukünftige Ereignisse noch nicht verlorengegangen war. Selbst der König besaß kein derartig ausführliches Buch. Das war dem einsamen Manne heute ein Trost. Um seinen Geist von fruchtlosen Bitterkeiten abzulenken, beugte sich Ataxikitli über das Werk, das nahezu die ganze große Tischplatte einnahm und nur geringen Raum für Krug und Schale ließ, und begann langsam zu lesen: »Merket euch, die ihr den Weg geht: Jeder Fortschritt ist nur durch Opfer möglich.«
Wieder hob er Tafel um Tafel, las flüchtig und seltsam zerstreut diese oder jene Stelle. Allmählich gelangte er zur Beschreibung der Weltzeitalter und folgte mühsam den verworrenen Zeichen mit dem Finger, denn dieser Teil war nicht im landesüblichen Toltec geschrieben, sondern teils in der toten Tlavitlisprache und teils im ebenfalls nicht mehr gebräuchlichen Rmoahal, das als beste Sprache für heilige Dinge gewertet wurde, das ihm jedoch nicht sehr geläufig war. »Mutternacht der Erde … Wintersonnenwende in der Waage …« Ataxikitli seufzte und sann nach. Das waren die Jahrtausende der Vereisung gewesen und die Menschheit fristete ein elendes Sein.
Er tat einen tiefen Trunk. Das Leben im Stofflichen war schwer, hart der Kreislauf des Seins, unerbittlich die Gesetze. In der Stille des Gemachs über das Zeitbuch geneigt, schien ihm bitter, was ihn sonst begeistert hatte: der weite Ausblick auf unbegrenzte Erfahrungen. Raum mochte der Weg sein, aber um jede Krümmung lag Neues, und dem Wachstum der Seele war kein Ende gesetzt. Wieder tat er einen tiefen Zug aus dem Zinnkrug. Eine quälende Unrast wuchs in ihm, und die Gedanken an die ungeheuren Zeitabschnitte machten ihn erschauern, während sie ihn sonst zu Andacht stimmten. Er drehte die Tafeln mit flüchtigem, wie nach innen gekehrtem Blick, fand keinen Ruhepunkt für seine Augen und murmelte: »Als der Frühlingspunkt im Schützen lag, entwickelten sich Jagd und Fischfang, die Menschen hatten keine festen Wohnsitze; sie wanderten dahin wie Tiere, die Nahrung suchen …«
Überrascht sahen alle Anwesenden auf den Sprecher
»Man muß sich in ein Traumbild hineindenken, daß eine große Sehnsucht nach der Reichshauptstadt besteht. Hunderttausende Deutsche sinken alljährlich ins Grab, die Berlin nicht gesehen haben. Der Mohammedaner erblickt in einer Reise nach Mekka die Haupttat seines Lebens. Berlin fehlt der Tempel völkischer Begeisterung, wo sich alle deutschen Stämme hingezogen fühlen in einem fortgesetzten Pilgerzug. Das Sinnbild deutscher Einigkeit, die Verkörperung des deutschen Wesens und der machtvolle Bau als Wahrzeichen deutscher Kraft: die deutsche Reichsburg!«
Die Stimme des Schriftstellers hatte sich der Stärke des öffentlichen Vortrages genähert.
»Ich zeichne zehn Millionen Mark, Herr Rautenschmied, bringen Sie den Stein ins Rollen!«
Landbürger sprach diese gewichtigen Worte mit fast gleichgültiger Stimme.
Nun heißt es, kaltes Blut bewahren
Am Bahnhof Fürstenbrunn, zwischen Charlottenburg und Spandau, standen am Morgen, in kleinen Gruppen etwa zweihundert Siemenssche Arbeiter. Sie erwarteten die ankommenden Züge und nahmen aussteigende Arbeiter in Empfang. Die meisten, die kamen, waren im Arbeitsanzug; sie stellten sich, die Zigarre im Mund, zu den übrigen. Der Zug brachte drei Leute. Sie gingen nebeneinander auf die Fabriken zu. Der eine war ein langer, starker Mensch von etwa fünfundzwanzig Jahren; der zweite ein älterer Mann mit einem breiten Vollbart; der dritte ein halbwüchsiger Junge. Scheinbar absichtslos stellte sich eine Kette von Männern über den Weg. Der ältere Mann sagte in ruhigem Tone: »Lassen Sie uns durch.« Nachdem er vergeblich seine Bitte wiederholt hatte, faßte er den direkt vor ihm Stehenden am Arm und suchte ihn mit leichtem Druck auf die Seite zu schieben. Sofort wandte sich dieser um. »Was, du Lump, du rührst mich an? Tu das noch einmal, und ich schlag dir eins in die Fresse, du Streikbrecher, daß du Zähne spuckst!«
Unterdessen waren alle andern herbeigekommen. »Kapitalistenknechte, dreckige Streikbrecher!« schrie man von allen Seiten auf sie ein. »Speit sie an.« Und im Nu flog der Speichel aus wohl dreißig Kehlen auf die Männer; es traf ihre Hüte, ihre Kleider, und klatschte ihnen direkt und wohlgezielt auch ins Gesicht. »Ich streike mit!« schrie der Junge in großer Angst. Im Nu eröffnete sich eine Gasse, und der Junge flog, von Hand zu Hand geworfen, in eine hintere Reihe.
»Ihr Schweine!« sagte der alte Mann empört und suchte sich mit dem Ärmel das Gesicht zu reinigen. Er erhielt einen Schlag, daß ihm der Hut vom Kopf flog. Einer packte ihn bei den Schultern, ein andrer bückte sich und riß ihm die Beine weg, und indem er hinfiel, stürzten gleich fünfe, sechse über ihn und hieben blindlings auf ihn ein. Der Große hatte einen Augenblick wie gelähmt gestanden; als er sah, was seinem Begleiter widerfuhr, senkte er den Kopf wie ein Stier, rannte mit dem Schädel dem unmittelbar vor ihm Stehenden in den Bauch, schlug mit schlenkernden Armen links und rechts in die Gesichter, und lief mit gewaltigen Sprüngen auf die Fabrik zu. Ein paar setzten ihm eine Strecke nach. Als sie zu ihren Genossen zurückkamen, fanden sie diese im Kreis um eine blutige, zerstampfte Masse, die auf dem Boden lag und in der man kaum noch einen menschlichen Körper erkannte. Der Rumpf war in den Erdboden hineingetreten, die Glieder ein blutiger Brei, das Hinterhaupt ein furchtbarer Filz zusammengeklebter Haare.
»Bessel will reden, Achtung!« rief man sich halblaut zu.
»Genossen!« sagte er; »es gibt kein Zurück mehr. An dieser Hinrichtung haben wir alle Teil.«
»Ich nicht!« schrie eine Stimme; »ich stand ganz hinten!«
»So, du nicht?« fuhr der Redner fort. »Ja, wie willst du denn das beweisen? Ich habe doch genau gesehn, wie du ihm mit der Faust ins Gesicht fuhrst!«
»Ich auch, ich auch!« riefen Stimmen durcheinander.
»Siehst du?« schrie der Redner – »man hat dich gesehn! Brüder! Es kann sich keiner ausnehmen, keiner! Wir sind solidarisch auch darin. Wenn wir uns einig sind, was kann man uns? Gebt jedem Streikbrecher eins auf den Dachs. Aber seid nicht so blödsinnig, euch niedermetzeln zu lassen.«
Das Eisfest auf dem Koenigssee
war als Ereignis schon seit einiger Zeit Gegenstand der Unterhaltung in der Berliner Gesellschaft. Die letzten Hammerschläge verhallten. Baumeister Rottberg meldete Landbürger die Vollendung der Vorarbeiten. Beide machten einen Rundgang. Als sie zum Empfangszelt kamen, stellten sich bereits die ersten Gäste ein. Zwanglos bewegten sie sich in dem geschmückten Raum, der sich an der Koenigsallee hinzog und von außen ein alpines Riesengemälde zeigte, innen aber einer Tropfsteinhöhle glich, die durch Spalten einen Ausblick über den vorgelagerten See gestattete. Die Militärmusiker setzten mit dem Einzug der Gäste aus Tannhäuser ein; hübsche junge Mädchen, in farbige Gewänder gekleidet, verabreichten Getränke. Aber auch der größte Teil der Geladenen erschien in Trachten, Kosaken, Litauer, Schweizer, alte Germanen in Bärenhäuten, Kriegshörner auf dem verhüllten Haupt. Und so herrschte ein vorgetäuschtes weltbürgerliches Treiben, die flotten Weisen der Musik ließen die von Landbürger bestellten Kunstläufer im Taktlauf über die Eisfläche gleiten. Die Ufer des Koenigssees waren in ein künstliches Eiszapfengewirr gehüllt. Die Dunkelheit setzte ein; plötzlich flammten elektrische Bogenlampen auf. Aus dem Eisgerinsel glühten bunte Flämmchen.
Landbürgers Gäste waren bald hier, bald dort. Edgar Rautenschmied weilte stets an der Seite Constanzes. Die Hände gekreuzt, glitten sie im eleganten Doppelbogenlauf über die hell beschienene Fläche. Der Schriftsteller trug die Tracht eines ungarischen Großgrundherrn. Constanze hatte sich als polnische Edeldame verkleidet. Die Musik spielte einen neuen Marsch: Er naht, der König Winter. Die Bogenlampen verloschen, ein greller Strahl blitzte über die Eisfläche. Wie auf unsichtbaren Wegen glitt ein goldglitzernder Schlitten daher, auf ihm saß König Winter, umgeben von seinen deutschen Lehnsmannen, wie Rübezahl, Schatzhauser. Die Göttinnen Nordsee und Ostsee saßen zu beiden Seiten eines Purpurthrones. Da huschte der weiße Strahl über das Eis und zauberte auf eine große Leinwandfläche die verheißungsvollen Worte:
Die Entstehung der deutschen Reichsburg.
Bild auf Bild folgte in schönster Wiedergabe der vollen Sommerpracht. Plötzlich stand der große, gewaltige Bau vollendet da, hinreißend und überwältigend durch seine gewaltigen Ausmaße, durch seine stilgerechte Baukunst, die in ihrer Gesamtwirkung eine formvollendete Wiedergabe deutscher Baueigenart darstellte. Rauschender Beifall erscholl, als nun auf schwindelnder Höhe die schwarz-weiß-rote Flagge hochging, ein Verkünder das gewaltige Burgtor öffnete und wie zur Einladung beide Arme ausstreckte. Und der Verkünder nahm die Züge des Kaisers an, über ihm im Himmelsblau breitete sich der deutsche Reichsadler aus, und diesen umgaben die Worte:
Wir Deutschen fürchten Gott, sonst niemand auf der Welt.
Auf den Stufen zur Reichsburg aber prangte die Inschrift:
Deutscher Frieden, ist Weltfrieden!
Ein alter graubärtiger General stimmte Deutschland, Deutschland über alles an, und feierlich hallte der Gesang, unterstützt durch die Musik, durch die stille Winternacht.
Erinnern Sie sich der weiten Strahlenmäntel der Heiligen
auf den alten Bildern und nehmen Sie diese bitte wörtlich. Doch das alles sind Gemeinplätze. Was Ihnen, mein Lieber, fehlt, ist das Wunder.
Pastor Eckart öffnete Mara die Türe
Sie stiegen zum Turmzimmer empor. Wie jedesmal beugte sich Mara aus dem kleinen, runden Fenster. Diese Wohnung hoch über der Stadt, die sich um den Limmat lagerte! Wie fernes Brausen stieg der Lärm aus den Straßen zu ihnen empor. Aber das Wunderbarste an diesem Zimmer war die Orgel. Zu beiden Seiten der Orgel, die in einen alten Bauernschrank eingebaut war, brannten Kerzen in meterhohen silbernen Ständern. Er blickte zu ihr hinüber. Wie sie diese Fuge meisterte! So wenig wußte er von ihr! In einem kleinen dalmatinischen Dorf hatte sie ihre Kindheit verbracht. Aber wer waren ihre Eltern. »Sie sind tot. Ich habe sie nie gekannt.« Mara selbst machte sich offenbar keine Gedanken darüber. Sie grübelte nicht, was den Unbekannten in England wohl veranlassen mochte, ihr eine Rente auszusetzen. Er gab seinen Namen nicht preis, er sorgte sich in keiner Weise um das Mädchen, das allein in Zürich lebte und studierte.
Seit Pastor Eckart erfahren hatte, daß seine Schülerin nicht das unberührte Mädchen sei, für das er sie gehalten hatte, wollte er sich nicht mehr damit begnügen, Maras Spiel zu verbessern, mit ihr tiefer in die Werke der großen Tondichter einzudringen. »Sie führen ein Leben in Sünde.«
Der Arzt wandte sich und trat zum Waschtisch. Während er sachlich und so, als gäbe es nichts Wichtigeres, sich die Hände wusch, glitt Mara von dem mit schwarzer Wichsleinwand überzogenem Sofa und begann sich anzukleiden. Sie räusperte sich, aber der Arzt schien nicht zu hören. »Aber ich bin ja so glücklich. Ich werde ein Kind haben«, sagte Mara. Der Arzt vermochte sein Erstaunen nicht zu verbergen. »Wie – aber sagten Sie nicht, Sie sind unverheiratet?«
Mara saß in der Wohnung Professor Wernheims, an dessen Schreibtisch. Wenn sie auch nicht ganz erfassen konnte, worum es hier in diesem stillen Studierzimmer ging, so war sie doch glücklich, wenigstens Handlangerdienst für das große Werk leisten zu dürfen. Sie hatte gelernt mit dem Spektroheliographen Sonnenbilder herzustellen, die der Professor für seine Untersuchungen der Sonnenflecke benötigte. Sie legte Tabellen an und kannte Herschels Sternkatalog fast auswendig. Ich werde mir Bücher kaufen, dachte sie, Bücher, in denen alles steht, was eine Mutter wissen muß.
Das Schlimmste war, daß die Tage so kurz waren. Daß die Zeit des Schlafens kam und zwang, viele Stunden nicht zu sein. Da waren die Bibliotheken, in denen man aus den Händen verstaubt aussehender Angestellter Bücher entgegennahm, die man dann in dem großen Saal lesen durfte. So still war es hier. Wo sollte man beginnen? Da standen in langen Reihen die Bücher der großen Historiker aller Zeiten, die Bücher der Naturwissenschaftler, die von den Sternen, Pflanzen, Kristallen und Tieren die merkwürdigsten Dinge erzählten. Die Philosophen und ihre Systeme, die jedes ein Sternenkreislauf für sich waren. Es gab die Bücher der Dichter, Atlanten, Handschriften, Kodizes, viele, viele tausend Bände, türmten sich zu ebensovielen Stunden, die man in seinem Leben nicht unterbringen konnte. Wo aber ließen sich kulturgeschichtliche Beobachtungen besser und präziser machen als in jenen exotischen, sagenumwobenen Randbereichen einer Bibliothek, wo sich das Beiseitegeschobene, Verdrängte, Verfemte und Marginalisierte findet? Bestände, die zwar wohlgeordnet, aber trotzdem für einen Benutzer nicht oder nur schwer erreichbar waren –
Remota
Was wurde eigentlich weggesperrt? Wer bestimmte den Inhalt?
Merken Sie jetzt, warum Sie von allen Sachen und Dingen abgleiten?
Sie sind ein Phantast mit unzureichenden Mitteln. Die Alchemie, aber auch die katholische Theologie kennen materia remota. Während die Alchimisten darunter ein Mineral verstehen, stellt in der katholischen Sakramentenlehre das Element an sich zusammen mit der materia proxima (Anwendung), und dem Wort, der Form, das sakramentale Zeichen dar, das die Wirkung des Sakraments hervorbringt.
Allen anderen Büchern
zog Mara noch immer die Lebensbeschreibungen großer Menschen vor. Werke, die von Korsaren und Feldherren, von Staatsmännern und Rebellen erzählten. Und jene, die in alter, einfacher Sprache von dem Leben der großen Heiligen berichteten, von der heiligen Katharina von Siena, der heiligen Theresa, der heiligen Gertrud. Das Beispiel der Heiligen ragte fremd in diese Zeit.
Rechts am Fenster
das mit einer dichten Scheibengardine versehen war, stand ein Setzerkasten, im Hintergrund ein roher, großer Tisch. Ein paar Stühle vervollständigten das Möblement. Hinten führte eine kleine Tür in den Raum, in dem die Handpresse und Druckpapier verwahrt war. Vor dem Setzerkasten stand in Hemdärmeln ein Mann mit offenen Gesichtszügen und steil in die Höhe gekämmten blonden Haaren. Er fragte Bessel: »Wen bringst du denn da mit?«
»Das ist Meckel. Ich glaube, wir können ihn brauchen.«
Der Mann kam hinter seinem Kasten hervor, und lud sie ein, Platz zu nehmen.
»Miller ist da.«
»Aus London?«
»Mit ihm gingen drei andere; Hester nach Hamburg, Williams nach Essen, Erman nach Kattowitz.«
Dieses Komitee handelte nach eigenem Ermessen. Es besaß weder Statuten, noch Mitgliederlisten. Jeder wußte, was er wollte, und jeder kannte den andern. Es stand mit dem internationalen Komitee zu London in Verbindung, unterhielt zu den Massen der einheimischen Arbeiter aber keine direkten Beziehungen. Die Männer, die sich in diesem Bunde zusammengefunden hatten, waren durch die Erfahrung belehrt worden, daß der Wert der Masse nur im positiven Ausharren zu suchen ist, daß für energisches, rasches Handeln aber immer nur wenige tauglich sind.
Es wird, um die Bestrebungen dieses Komitees ins rechte Licht zu setzen, das beste sein, eine Broschüre zu zitieren, die unter dem Titel Generalstreik und Terror 1908 im Verlag des Revolutionär erschien; zwar wurde die Schrift konfisziert, aber wie es bei Beschlagnahmungen anarchistischer Druckwerke im allgemeinen zu geschehen pflegt, erst, nachdem die Auflage bereits versandt war und nur noch drei Exemplare in der Druckerei lagen. Dort heißt es, von Seite 5 an wörtlich so: »Wenn man die Emanzipation des Proletariats durchsetzen will, so darf man keinen Augenblick darüber im Unklaren sein, daß dies stets den Kampf einer Minorität gegen eine Majorität bedeutet. Das Proletariat besitzt weder Geld, noch Waffen. Worum es sich handelt, ist, eine Kampftaktik zu finden, die einerseits die Produktionen und den Verkehr hemmt und dadurch Schaden herbeiführt; andererseits aber durch den Schrecken darauf hinwirkt, daß diesem Zustande bald ein Ende und hinterher kein Versuch gemacht wird, die Ausgleichung des Schadens aufs Proletariat zu schieben. Dieser doppelte Zweck erfordert ein doppeltes Vorgehen. Das erste wird erreicht durch die Aktion der Massen, die die Arbeit verweigern. Das zweite durch eine tatkräftige Kampfweise einiger weniger, die ihr Leben in die Schanze zu schlagen bereit sind. Wenige sind sehr schwer zu fassen. Die vielen aber sind, wenn sie tätiges Eingreifen in den Kampf vermeiden, vor der Niederwerfung durch brutale Gewalt gesichert. Wenn die Wenigen, die sich dem Kampf bis aufs Messer widmen, Resultate erzielen wollen, so müssen sie freilich ihre Waffen gegen große Objekte richten. Sie sollen sich auf Unternehmungen stürzen, die arbeiterfeindlich sind. Sie sollen versuchen, ganze Fabriken einzuäschern, Bergwerke zu vernichten, Schiffe ins Meer zu versenken.«
Wir müssen logisch komponieren
aus den logischen Figuren heraus wie Ornamentkünstler. Wir müssen einsehen, dass das Phantastischste die Logik ist.
Auch verdrängte Sexualität, natürlich
Den Studenten Wassilij Gutschkow hatte Mara in ihrem kleinen vegetarischen Restaurant kennengelernt. Der zweite Fenstertisch war sein Stammplatz und Mara war schon daran gewöhnt, immer dem feuchten Blick unnatürlich tief liegender Augen aus einem sehr weichen, sehr fahlen Gesicht zu begegnen, wenn sie sich zu ihrem Mittagsbrot niederließ. Dieser Russe, der immer einen Pack zerschlissener Bücher mit sich herumschleppte, aß niemals etwas anderes als ein einziges Gemüse und trank dazu Tee. Daß Gutschkow Student der Chemie war, wußte Mara auch. Aber Litschew, den sie einmal nach dem Unbekannten befragte, zuckte geringschätzig die Achseln. »Meine Leute verkehren nicht mit ihm. Er ist Anarchist und er und seine Freunde machen uns hier nur Ungelegenheiten. Auch verdrängte Sexualität, natürlich.«
So kannten Wassilij Gutschkow und Mara einander schon sehr lange, als der Russe eines Tages die Wirtsstube betrat, sich wie suchend umsah und dann unsicher auf Mara zukam. »Eine Freundin von mir – sie heißt Vera – ist sehr krank. Wir haben gar kein Geld mehr. Könnten Sie uns …«
Verwirrt griff Mara nach ihrer Börse. Sie leerte den Inhalt in die Hände des Studenten und fragte: »Darf ich mit Ihnen kommen? Vielleicht könnte ich helfen?«
Ein kleines Dachzimmer mit schräger Decke. Ein Tisch voll Bücher am schmalen Fenster, ein Kleiderrechen und im Hintergrund das Bett. Jähes Erkennen geistert über ein erschreckend blasses und mageres Gesicht. »Du, Mara?«
Bald sank Vera müde zurück.
»Wir waren gemeinsam in Fribourg«, erklärte Mara. »Im Kloster. Wir gingen in dieselbe Klasse.«
Die Erbschaft
hatte Prinz Atlanta Millionen gebracht. Er konnte es sich jetzt leisten, eine Entdeckungsreise durch wenig erforschte Gebiete anzutreten. Er war ein vorzüglicher Lichtbildner und ein guter Tierkenner, Rautenschmied machte mit, der beste Reiseschriftsteller war gewonnen. Auf der Landungsbrücke in Cuxhaven standen die Angehörigen der Weltreisenden. Der Forschungsgesellschaft hatten sich noch zwei erfahrene Männer, Doktor Rubrecht Ulmenau und ein Tropenarzt, Doktor Guido von der Gülmen, angeschlossen. Landbürger unterhielt sich angeregt mit den Abreisenden. Constanze stand dabei und suchte sich in eine gleichgültige Haltung zu bringen. Die Glocke des Dampfers Cincinnatti rief zur Abfahrt. Edgar reichte der tiefergriffenen Constanze die Hand. Der hochgewachsene ernste Mann stand vor ihr in der kleidsamen schneeweißen Tropentracht, und fragend senkten sich seine Augen in ihre unruhigen Augensterne. »Leben Sie wohl, vielleicht ist es ein Abschied für das ganze Leben.« Man winkte und schwenkte Tücher. Unbeweglich stand Edgar an der Reling. Starr richtete sich sein Blick in die Ferne, seine Gedanken waren weit, weit weg.
Aber in Gottes Namen
Ihnen ist dieser Dilettantismus nötig. Sie sahen noch nie ein paar Leute, nie ein Blatt. Denken Sie eine Frau unter der Laterne; eine Nase, ein Lichtbauch, sonst nichts. Das Licht, aufgefangen von Häusern und Menschen.
An den Schiffländen brannten schon die kleinen Laternen
In der Wohnung eines Freundes in der Spiegelgasse wollte man sich heute zusammenfinden. Mara war begierig, die Kameradin aus der Klosterzeit wiederzusehen. Ein großes, schönes Mädchen öffnete ihr. Mara sah sich unsicher in dem Raum um, der von Menschen erfüllt war und durch dessen Rauchschwaden die Blicke kaum zu dringen vermochten. Aber schon stand Wassilij vor Mara und zog sie in eine Ecke. Die Studenten nahmen langhalsige Gitarren von den Wänden und begannen zu spielen und zu singen. Mara saß tief zurückgelehnt neben Vera. Diese Lieder, das traurige Spiel der Balalaikas! Wie stieß es Mara in Heimweh und Erinnern! Es waren nur andere Worte, die die Studenten sangen.
»Ich war so glücklich, als dein Geld kam«, flüsterte Vera Mara zu, als alle in erregte Gespräche gefunden hatten. »Wir haben die Bücher ausgelöst und unsere Mäntel.«
»Was soll ich tun, Vera? Es quält mich, daß du entbehren sollst.«
»Es sollte dich quälen, daß Hunderttausende entbehren«, rief Wassilij plötzlich, der offenbar ihrem Gespräch gelauscht hatte.
»Siehst du!« rief der Student mit der tiefen Stimme triumphierend Wassilij zu: »Man muß an die natürliche Güte des Menschen glauben. Nur der Staat ist ein Monstrum.«
»Wir werden nicht ruhen, bis nicht jedem der volle Ertrag seiner Arbeit gehört, den die stehlen, welche die Produktionsmittel in Händen haben!« rief Vera, ihre eingefallenen Wangen glühten auf.
Oft kam es nun vor, daß Mara das Gefühl einer Schuld überfiel, weil die Rente des unbekannten Mannes in London sie jeder Sorge um ihren Unterhalt enthob, und sie erkannte, was sie von ihren Freunden schied. Es schmeckte zuerst nach Abenteuer, daß sie wegen ihrer Geschenke an Vera mit einer sehr geringfügigen Summe durch den Monat kommen mußte. Jetzt aber war es nicht mehr möglich, ein Buch zu erstehen, das sie in einer Auslage gesehen hatte; sie mußte ihre Vermieterin, die ihr die Wäscherechnung überreichte, auf den kommenden Monat vertrösten. Wesentlicher war, daß es seit der Begegnung mit Vera unmöglich schien, weiterhin das Leben der unbekümmerten Studentin zu führen. Hatte Mara ein Recht, zu bestimmen, wieviel sie von ihrem Gelde behalten durfte, seit sie wußte, daß andere hungerten? »Wir nehmen Ihr Angebot an«, hatte ihr Wassilij bei ihrem letzten Besuch gesagt, weil sie ihm erklärt hatte, sie überlasse es ihm und Vera, den angebotenen Betrag für sich und Kameraden zu verwenden. »Vergessen Sie nur nicht: man kann sich niemals loskaufen von der Schuld an der großen Not. Mit Geld allein nicht, Mara.«
ein schwerbeladener Ziegelwagen
von der Seydelstraße herkommend, passierte gegen fünf Uhr den Spittelmarkt. Als er die Kurve nahm, um in die Leipzigerstraße einzubiegen, fuhr er gegen die Bordschwelle und schlug um. Dem Kutscher gelang es, abzuspringen; aber der schwere Wagen, aus dem die Steine herausstürzten, lag mitten über das Gleis der Straßenbahn. Mit der den Berlinern eigenen Beflissenheit, sich dahin zu drängen, wo ohnehin wenig Raum vorhanden ist, schoben sich die Leute im dichten Kreis um die Unfallstätte. Der Zufall wollte, daß um diese Zeit Arbeiter den Spittelmarkt kreuzten, die von einer Gewerkschaftsversammlung kamen. Da weder die Straßenbahnwagen von der Leipzigerstraße, noch vom Spittelmarkt vorwärts konnten, war eine Verkehrsstockung großen Stils entstanden. Zum Überfluß keilten sich in das Getümmel noch ein paar Motoromnibusse, schwere Kasten, so daß die Stauung der Wagen sich bald zu einem unentwirrbaren Tohuwabohu verfilzte. Die Kutscher schrien durcheinander, zerrten und stießen bald hier, bald da. Unterdessen hatten sich Schutzleute in größerer Zahl eingefunden; sie drängten die Menge von den Bordschwellen der Trottoirs zurück und forderten durch ihre aufgeregte Ungeschicklichkeit mehr als ein Spottwort heraus.
Die müßige Menge schwoll immer mehr an, und begann zu schimpfen. Die Situation wurde unangenehm, als durch die recht enge Niederwallstraße ein Rudel halbwüchsiger, angetrunkener Burschen eindrang, sich mit Püffen und Rippenstößen durch die Menge arbeitete und dabei johlte, gröhlte und brüllte. Einen davon bekam ein Schutzmann zu packen, und es entspann sich eine solenne Prügelei. Da rückte von der Gertraudenstraße her eine größere Abteilung von Schutzleuten zu Fuß und eine kleinere Berittener ein. Ein Teil von ihnen besetzte die Wall-, ein anderer die Seydel- und Beuthstraße, so daß die direkten Ausgänge nach Osten und Süden gesperrt waren. Die Leipzigerstraße war wegen der Ansammlung der Wagen nahezu unpassierbar, die Niederwallstraße gar zu eng, als daß durch sie eine schnelle Entleerung des Platzes hätte stattfinden können.
Ein Teil der Menge suchte in den Läden und Restaurationen Zuflucht zu finden. Aber die Besitzer schlossen die Türen ab. Die Glastür zu einem Magazin wurde von der drängenden Menge eingedrückt. Als ein Schutzmannspferd allzu dicht an einen kräftigen Mann in Arbeitstracht heranschnaubte, griff der nach den Zügeln. »Vorwärts, vorwärts!« riefen die Schutzleute und trieben die Menge immer rücksichtsloser an. Die Säbel sausten auf die notgedrungen Zögernden herab und trafen auf Hüte, Schultern, erhobene Hände. Auf einmal sprang ein Pferd rücklings in die Höhe, fiel hart nieder und bedeckte den Reiter. »Wenn noch irgend welcher Widerstand geleistet wird, lasse ich scharf einhauen!« rief mit weithin schallender Stimme ein Polizeioffizier.
»Gemeinheit, Roheit!« Die Menge geriet in Rage. Die Kräftigsten arbeiteten wütend mit Händen und Füßen, pufften links und rechts um sich und schleuderten mit brutalen Stößen die Schwächeren von den Trottoirs. Auf die einen stürzten sich die Fußschutzleute; die andern drängten Berittene mit Hieben wieder in die Menge zurück. Alte Leute wurden zu Boden gerissen; Frauen bluteten und schrien. Angreifer und Angegriffene wälzten sich in dichter Verschlingung auf der Erde, Schutzleute fuchtelten mit den Klingen bald in scharfen, bald in flachen Hieben dazwischen.
Unterdessen war die Kunde von dem Tumult durch die Stadt gedrungen. In entlegeneren Gegenden bildete sich das Gerücht, die Straßenbahnwagen führen nicht mehr, die Menge habe die Führer zum Absteigen gezwungen. Das wurde geglaubt, und darum wurde es nachgeahmt. In der Frankfurter Allee warf man einen Fleischerwagen um, so daß die Straßenbahn zu halten gezwungen war. Gegen Abend war der Aufruhr so weit gediehen, daß Militär aufgeboten werden mußte. Nach Mitternacht entstand auf unerklärliche Weise ein großes Schadenfeuer in der Fabrik von Pietsch, die einen ganzen Block für sich einnahm. Der Feuerwehr gelang es, einen Teil der Baulichkeiten zu erhalten; die Säle, in denen die kostbarsten Maschinen aufgestellt waren, fielen der völligen Zerstörung anheim.
Ja, trotzdem
die Gemütlichkeit der Vernichtung ist das Interessanteste.
Die Zukunft der Hauptstadt
war in der Tat höchst dunkel. Die Berliner Elektrizitätsgesellschaft verschickte eine Erklärung, in der sie unter höflichem Bedauern anzeigte, daß sie nicht mehr imstande sei, für die Anschlüsse Elektrizität zu liefern. Bei Tag und Nacht durchzog Polizei und Militär patrouillierend die Straßen, jede Ansammlung von Menschen auseinandertreibend. Es wurden Fensterscheiben zertrümmert, Telegraphendrähte zerschnitten, Schienen demoliert. Das Abhalten öffentlicher Versammlungen war untersagt. Die Streikenden fanden Mittel und Wege, sich zu verständigen. Sie gingen von Haus zu Haus, und trugen die Nachrichten weiter.
Das Aktionskomitee hatte sein altes Haus in der Stallschreiberstraße aufgegeben; es hatte keinen festen Sitz mehr. So saßen in einer kleinen Destille des Nordostens – sie führte den anmutigen Namen Zum blutigen Knochen – drei Leute beieinander, von denen wir den Führer Bessel schon kennen. Der zweite war ein Mensch von etwa vierundzwanzig Jahren, mit blassem, bartlosem Gesicht und einer langen, fahlgelben Mähne. Der dritte war ein kräftiger Mensch von etwa dreißig Jahren; der Schnitt des Gesichts, die klobige Nase, der dicke, herabhängende Schnurrbart verrieten den Polen; das bestätigte denn auch sein Name, der Mendrzycki lautete.
Der blasse Jüngling nahm das Wort: »Es war vielleicht die einzige Gelegenheit auf Jahre hinaus.«
»Gewiß,« sagte Bessel, »die Proletarier sind reif geworden. Ich habe das Sozialistengesetz mit erlebt, ich habe, als ich noch am Anarchist mitarbeitete, acht Monate gesessen, ich habe John Most und Emma Goldmann gekannt. Damals war der Vorwärts der große Verblödungsapparat.«
»Ich weiß nicht,« murmelte Schwietal; »ich glaube, ich hätte etwas angerichtet damals.«
»Freilich, Propaganda der Tat! Jede solche Sache hat der Bewegung genützt.«
»Sehr gut,« bemerkte Mendrzycki, der das Deutsche mit dem rollenden R der Polen sprach, »wir werden hören, ist in Polen der Teufel los – ich hab’ Nachrichten von gutem Freund.«
»Nationalitäten kümmern uns nichts,« sagte Schwietal mürrisch. »Großpolen! so ein Stumpfsinn.«
Die Tür der Destille wurde aufgerissen; Meckel trat ein, erhitzt und atemlos.
»Nun sag’, was ist los?« fragte Schwietal höchst ungeduldig. Im selben Augenblick hörte man von nicht allzu weit her ein kurzes, scharfes Prasseln. Gewehrfeuer.
Krawall!
sagte Meckel. »Militär ist da! Die Weiber haben angefangen. Da ging eine Frau in einen Bäckerladen in der Prenzlauer Allee, nahm einfach ein Brot und wollte hinausgehen. Es kam zur Prügelei, das Bäckermädchen holte Polizisten. Sie kratzte und biß; sie schleiften sie hinaus aufs Trottoir. Vor dem Laden hatten sich so ein Stücker zwanzig Frauen angesammelt; wie die Polizisten mit Verhaftung drohten, fielen sie über die beiden her. Die Kerle hieben drein, gaben Notsignale. Da kamen die Männer zu Hilfe; zwei haben die Blauen erschossen. Endlich gelang’s ihnen, in den Laden zurückzuweichen, der Bäcker ließ die Rolläden herunter. Die Leute holten Äxte und fingen an, die Läden zu bearbeiten. Da kamen die Berittenen. Einen haben sie vom Pferd gerissen, ein anderer ist mit einer Kugel herunter geholt worden. Es müssen mindestens zwanzig Leute totgeschlagen sein. Wie die Berittenen weg waren, holten die Leute den Ladentisch und die Stühle heraus und schmissen sie auf die Straße; dann plünderten sie ein Eisengeschäft und zogen Stacheldraht quer über, rissen mit Brechstangen das Pflaster auf und haben nun eine Barrikade fertig. Waffen haben sie dem Fritzen auch weggenommen. Vornüber wollten sie einen Graben ziehen, ging aber nicht mehr.«
Eine Salve dröhnte, ein lautes, furchtbares Geschrei folgte.
»Die Bande muß merken, daß wir mächtig sind,« sagte Bessel.
Die ganze Sache vollzieht sich streng kausal
Singen wir das Lied von der gemeinsamen Einsamkeit.
Meckel hatte die Stadt durchquert und war gewandert
immer gewandert; nach Süden zu. Längst hatte er das freie Feld gewonnen; nun ging er am Bahndamm lang, möglichst innerhalb der Schattengrenze. Ab und zu sah er nach der Uhr. Es ging auf zehn. In der Hand trug er einen Beutel voll Sand, dessen Griff zusammengedreht war. Er wog ihn, schlenkerte ihn hin und her, prüfte ab und zu seine Schlagwucht. Er schlich den Damm hinauf, der eine steile Böschung aufwies, und legte sich hin. Er zog aus der Brusttasche eine Stahlsäge und einen scharfen Schraubenzieher und begann, die Kuppelung der Schienen in Angriff zu nehmen. Er hatte kaum begonnen, als er von fern Schritte sich nähern hörte; gleich glitt er zurück hinter den Abhang und faßte den Sandsack fester. Der Bahnmeister kam mit der Laterne die Schienen entlang und leuchtete sorgsam vor sich hin. Ab und zu stieß er mit der Stiefelspitze fest gegen eine Schiene, die den Klang dann kräftig zurückwarf; dann ging er weiter und entfernte sich bald außer Hörweite. Meckel kroch wieder herauf und lockerte die Schraube; dann grub er ein Loch unter die Schwelle und steckte in die Versenkung einen schweren Gegenstand, den er seiner Tasche entnahm. In der Ferne zeigte sich ein Lichterpaar. Eine Maschine sauste in voller Fahrt heran, wie gejagt. Aber – kein Wagen hing daran! Dieser Plan wurde zwecklos, die Katastrophe lohnte die Mühe nicht!
Meckel begann mit hastigen Händen die Bombe wieder zu lockern. Die Schiene war nach unten gesunken und klemmte den Sprengapparat fest. Meckel rüttelte, er hob mit Riesengewalt die Schiene wohl einen Millimeter hoch. Sie schnappte zurück und er fiel aufs Gesicht. In diesem Augenblick brauste die Lokomotive heran; er taumelte auf und wurde von dem Puffer vor die Brust gestoßen. Im selben Augenblicke erfolgte eine Detonation, dann ein Niederprasseln von Eisenteilen auf den Kies des Dammes. Die herbeieilenden Streckenwärter fanden ein tiefes, trichterförmiges Loch, von dem aus Risse durch den ganzen Bahnkörper gingen; der Vorderteil der Lokomotive war in kleine Fetzen zerrissen, der Kohlenwagen halbiert; der Heizer lag verstümmelt eine Strecke weiter hinten; der Führer war in Atome zerpflückt. Man fand endlich, auf die Seite geschleudert, noch Reste eines dritten Körpers, der nach den Anzugsfetzen keinem Bahnbeamten gehören konnte.
ihr Zustand ließ sich noch immer verheimlichen
Mara war im vierten Semester. Dienst an der Wissenschaft hieß der Weg, den ihr das Studium eröffnete. Sie sah das Turmzimmer des Pastors vor sich. Die harten Arbeitsstunden am Spieltisch der Orgel, die Stunden über den Problemen der Harmonielehre, die Stunden unermüdlichen Übens. Man konnte der Musik nicht nebenbei dienen. Aber vor dem werdenden Leben in ihr mußte die Orgel bestehen, vor dem Wissen um die Not von Hunderttausenden. Vielleicht war es die Musik, daß Wassilij sie verächtlich eine Individualistin nennen konnte? Schlief nicht die Stimme des Teufels in Tasten und Registern: Du wirst Macht haben, Mara. Viel Macht. Du wirst nicht ein einfacher Soldat auf der Heerstraße sein. Wie die Schlange im Paradiese war diese Stimme und Mara floh gepeinigt in die Welt Professor Wernheims zurück, in der die Phantastik ihrer Jugend sich der kühlen Herrschaft des Wissens beugen mußte. Sie vergrub sich in die Bücher, die Wassilij und Michail ihr sandten. Sie drang durch Bakunin, Landauer, Proudhon und Marx in ein Reich, das so kühl und gesetzmäßig war wie das Wernheims und dennoch durchglüht von einer großen Liebe und einem großen Haß. Kein Lied lebte in diesem Reich und der Himmel der Kunst bedeutete in ihr nichts als ein Vorrecht der Satten.
Rezept zu einer Wirtschaftskrise
Bei der Abschnürung vom Weltmarkt werden helle Scharen von Arbeitern auf die Straße gesetzt, dem Nichts anheimgegeben. Die Regierung muß angesichts ihrer schwachen Position, der fehlenden Mittel auf Eingreifen verzichten. Und wer zweifelt, daß diese Massen ohne Brot sich nicht auf jene stürzen, denen ihr Haß von klein auf gilt, und die zu morden und in ihren Schätzen zu wühlen, keiner hindert? Aber auch vom Kapitalismus wird der Zersetzungsprozeß ausgehen. Er wird seine nationalen Gefühle nicht in Selbstmord ausarten lassen. Die Grenzpfähle der Länder existieren für den Besitz nicht. Und drittens ist der Rassenhaß, meine Lieben, ein wichtiges Moment! Die Arbeitsnot, die berghoch sich türmenden Preise für das Allernotwendigste, die losgelassenen Genußinstinkte der Verdienerschicht werden das soziale Chaos erzeugen. Und dann, meine Freunde, ist unsere Zeit da!
so daß man bereits von Generalstreik reden konnte
Auch das westliche Industriegebiet war davon ergriffen worden. Die preußische Regierung war stets der Meinung gewesen, daß das Heer der Eisenbahnbeamten eine besondere Verpflichtung zur Treue gegen Kaiser und Reich habe. Es war bei ihnen niemals Streik oder Obstruktion vorgefallen. Aber die Streckenarbeiter blieben weg; die Kohlenzufuhr stockte.
Meckels Attentat war der Anfang einer Reihe weiterer Angriffe auf die Züge. Bald fand man Schienen gelockert, Schrauben abgedreht, Hindernisse auf die Gleise gewälzt. Die ersten Stockungen traten im Osten ein, wo die Polen mit voller Aktivität vorgingen. In der Nähe der Grenze wurden Züge zum Stehen gebracht und auf ganze Strecken hin Bahndämme zerstört. Da erschreckten – am selben Tage – zwei Betriebsunfälle die Eisenbahnverwaltung. Ein um die Mittagsstunden von Küstrin herkommender Güterzug stieß zwischen Müncheberg und Straußberg auf eine Mine, die wohlversteckt im Eisenbahndamm angebracht war. Die Explosion war sehr stark; außer der Lokomotive wurde der erste Wagen völlig zerstört, der zweite sprang aus dem Gleis und riß einen Teil des Trains mit sich hinunter über die steile Böschung. In dem Gepäckwagen eines Personenzuges von Berlin nach Hannover befand sich ein Koffer, der auf eine Fahrkarte dritter Klasse nach Stendal aufgegeben worden war. Diesem Koffer entströmte ein eigentümlich süßlicher Geruch, der die Aufmerksamkeit des Aufsichtsbeamten erregte. In Rathenow machte der Beamte den Zugführer darauf aufmerksam, dieser ließ die Waggons nach dem Eigentümer des Gepäckstückes durchsuchen; ohne Ergebnis. Dicht vor Bismarck erhielt aber der Zug einen Ruck; ein gewaltiger Knall ertönte, die Fensterscheiben splitterten in tausend Stücke. Der Postwagen, der dicht hinter der Lokomotive fuhr, flog in die Luft. Der Koffer, der dem Beamten verdächtig vorgekommen war, hatte eine Höllenmaschine und eine Nitroglyzerinladung enthalten.
Es wird nicht unerwünscht sein
die von uns bereits besprochenen Verbrechen aufzuzählen und einige, die wir im Zusammenhang der Erzählung übergingen, nachzutragen:
15. März: Brand der Prinzschen Werkzeugfabrik in Berlin.
16. März: Brand der Anilinfabrik in Rummelsburg.
21. März: Brand der Maschinenfabrik von Pietsch in Berlin.
22. März: Attentat auf den D-Zug München-Berlin.
23. März: Sperrung des Kaiser Wilhelm-Kanals durch Versenkung eines Schiffs.
25. März: Ermordung des Fabrikanten Franke in Crimmitschau (Revolverschuß).
28. März: Brand der Fechnerschen Weberei in Langenbielau.
29. März: Bombenattentat auf den Polizeipräsidenten von Breslau (erfolglos).
31. März: Plünderungsszenen in Myslowitz.
2. April: Explosion einer Höllenmaschine im Gepäckwagen des Personenzugs Berlin-Hannover.
2. April: Bombenattentat auf Prinz Eitel Friedrich und General v. Deimling.
Aufklärung war nur zu erwarten durch eine Denunziation aus dem Kreise der Verschworenen heraus. So entschloß sich die Regierung, es mit einem außergewöhnlichen, wennschon ungesetzlichen Mittel zu versuchen: sie verhieß demjenigen Anarchisten, der der Polizei ganze Aufklärung geben würde, Straffreiheit. Außerdem versprach sie dem, der eine Verhaftung der Hauptteilnehmer herbeiführe, eine Belohnung von 100.000 Mark. Der Arbeiter rückte weg von den Menschen, die von der Manie systematischer Zerstörung besessen schienen. Die Ausschreibung einer Belohnung weckt stets die Sympathie für den Ausschreibenden. Man muß nur einmal zuhören, wie oft der Polizei ohne Groll gedacht wird, wenn sie auf die Ergreifung eines Raubmörders einen Preis setzt. Es ist nicht Habgier, was da waltet. Nein, da herrscht ein rein sportliches Interesse.
der Wille zur Dummheit
verlangt Entsagung, und man bekommt ihn nur durch sorgfältiges Zuendedenken. Wenn man sieht, dass unsere Gedanken in sich zusammenfallen, wie die Flügel eines geschossenen Wildhuhns; Gedanken, nein, sie sind keine Zwecke für sich, sie sind wert als Bewegung; aber können Gedanken bewegen; o, sie fixieren, sie nageln zu sehr fest, sie konservieren selbst den Revolutionär. Bilder sind Taten der Augen, und mit einem Bilde ist nicht alles gesagt; aber ein Gedanke täuscht stets vor, er habe die ganze Kette erschöpft, und lähmt.
Bessel war zu Fuß losgegangen
denn alle Bahnhöfe wurden scharf bewacht. Sobald er die Großstadt hinter sich hatte, war ein merkwürdiges Gefühl über ihn gekommen; der Wald war ihm fremd, die Einsamkeit berührte ihn mit einem seltsamen Schauder. Es war noch dunkel. Bessel wanderte auf Straußberg zu. In dem ersten Dämmerlicht sah er nahe dem vorspringenden Dach eines Schuppens eine Holztafel angebracht, die ein rotes Plakat trug. Neugierig trat er näher und begann zu lesen, fand unter der Aufzählung seine eigne Personalbeschreibung. Sein Name – eine leise Beruhigung – war nicht genannt. Er sah nach der Uhr. Halb sieben. Jetzt konnte schon einer, der ihn kannte, in Berlin vor der Plakatsäule stehen und von da zur Polizei gehen. Er war gewiß 10.000 Mark wert. Bessel durchzuckte es wie ein Blitz. War da nicht Rettung? Wenn er selbst? Verrat, Verrat! Er war müde, hungrig, abgehetzt. Gestern wäre er noch bereit gewesen, eine Bombe zu werfen, auf die Gefahr hin, sich selbst zu töten. Aber jetzt? Es würde doch keiner seiner Komplizen zur Polizei gelaufen sein? Schwietal, der war ein Schwärmer. Kunard hatte zuviel andres auf dem Kerbholz. Mendrzycki? Bessel gingen die Augen über. Dieser Polack, der verdammte! Und er begann zu laufen, als renne er mit ihm um die Wette, gerade in die Stadt hinein.
Eine Viertelstunde, nachdem er das Polizeipräsidium betreten hatte, lief von einem Revier die Nachricht ein, ein Pole namens Mendrzycki habe sich gestellt. Am selben Tage noch wurden alle in Berlin sich aufhaltenden Terroristen verhaftet bis auf einen: Schwietal. Zu gleicher Zeit wurden in Stettin, Hamburg, Breslau, Bochum und Mülheim Verhaftungen vorgenommen. Die Zahl der in das terroristische Komplott Verwickelten betrug etwa 60 Mann. Da die Straftaten unter der Herrschaft des Kriegsrechts stattgefunden hatten, waren die Urteile sehr hart: 29 Männer wurden zum Tode verurteilt, 16 zu lebenslänglichem Zuchthaus, die übrigen zu langjährigen Zuchthausstrafen. Zweien der Angeklagten gelang es trotz schärfster Aufsicht, sich vor der Verhandlung selbst zu töten. Nur Schwietal war dem Arm der Gerechtigkeit entgangen. Bessel begab sich nach Amerika. Als er den Landungskai betrat, knallte ein Schuß. Er sank, durch den Kopf getroffen, sofort zusammen. Die zweite Kugel jagte sich Schwietal über dem Körper des Getöteten in den Mund.
so viele Welten
die gar nichts miteinander zu tun haben
Der Kapitän schüttelte ungläubig den Kopf
»Unmöglich, dort liegt kein Land. Es ist undenkbar.«
»Aber wenn es neu entstanden wäre?« warf Paul Seebeck ein.
»Das wäre ja –«
Aber jetzt kam von der Seite her feiner Staubregen
der in wenigen Augenblicken die Aussicht verschleierte. Die Herren hüllten sich fester in ihre Mäntel. Der Regen wurde stärker und stärker, und außerdem brach schnell die Nacht herein.
Als sie auf Deck hinaustraten
sahen sie, daß Nebel und Regen völlig verschwunden waren, der Mond schien. Passagiere gingen plaudernd und rauchend auf und ab, oder saßen, in Plaids gehüllt, auf Feldstühlen. Paul Seebeck folgte dem Kapitän auf die Kommandobrücke. Jetzt war kein Zweifel mehr möglich: vor ihnen lag, steil dem Meere entsteigend, ein Vulkan, über dessen kegelförmiger Spitze eine blauschwarze Wolke schwebte. Wieder sah Paul Seebeck dem Kapitän fest ins Gesicht: »Ich habe mein Motorboot, mein Zelt und Konserven für zwei Monate. Sobald wir einen Landungsplatz sehen, setzen Sie mich ins Wasser. Ich will die Insel für das Deutsche Reich in Besitz nehmen.«
und unter Kettengerassel sinkt ein Motorboot
auf die kaum gekräuselte Wasserfläche. Halblaute Abschiedsrufe, ein Winken und Grüßen, der Motor wird eingestellt, und das Boot saust davon. Jetzt verschwindet es hinter einer Klippe, taucht in den Mondschatten, biegt um einen Felsen und ist fort.
Unweit der Feste Herat
im Bergland Afghanistan, an den Ausläufern des Hindukusch, saß Rautenschmied vor dem Zelt und schrieb in ein Tagebuch, die übrigen Reiseteilnehmer lagerten auf Teppichen und rauchten.
»Was sagen Sie zum Wetter, Doktor Ulmenau?« fragte Prinz Atlanta.
»Ein Bergsturm naht, Durchlaucht, wir müssen uns sputen, sonst fegt uns der Orkan von der Ebene weg!« Ulmenau gab einen schrillen Pfiff ab. Diener eilten herbei, und bald befand sich die Reisegesellschaft mit ihren Bergpferden und Lastkamelen auf dem Weg zum Tal Heri Rud.
Der ewige Chorgesang der Wüste, das Läuten der Kamelglocken tönte herüber. Sven Hedin hatte recht, dieses Lied verstummte nie, und wenn das Kamel den Tücken der Wüste zum Opfer fiel, sofort wurden die alten Schellen einem neuen Leittier angeschnallt. Schon fegte der Wind über die Ebene, im flotten Tempo ging es daher der Talniederung zu. Pinusarten, Tamarisken, Platanen und Weiden standen hier urwaldartig zusammen. Noch bevor die Dunkelheit hereinbrach, hatte man Herat erreicht. Über die Heri-Rud-Brücke ging es zur fest umwehrten Stadt, die im Nordwesten von der mächtigen Zitadelle beherrscht wird. Die Gesellschaft nahm ihren Weg nach dem Königsgarten Baghi Schahi und schlug hier ihre Zelte auf. Es fügte sich, daß zufällig der Emir von Afghanistan nach Herat gekommen war. Ein Herold erschien im Lager und überbrachte die Einladung.
»Wie gut, daß wir Berliner Filme aufgenommen haben«, rief Rautenschmied.
Die Herren hatten die Uniformen ihrer früheren Regimenter mitgenommen, damit sie bei öffentlichen Festen feierlicher auftreten konnten. Der Emir saß auf einem thronartigen Sessel, umringt von den Würdenträgern seines Reiches. Kühn stürmten die Reiter daher, was bei europäischen Regimentern die geschlossene Attacke mit ihrem wuchtigen Ansturm, das war hier bei diesen halbwilden Söhnen der Berge die Gewandtheit, die sie auf ihren flinken Pferden entwickelten. Lanzenkämpfe gaben manchen aufregenden Augenblick, und nicht ohne ernstliche Verletzungen gingen diese Vorführungen zu Ende.
Der Emir wollte sich von seinen Gästen verabschieden. Doch Prinz Atlanta bewog ihn zum Bleiben. Eine Leinwand senkte sich hernieder und schon zitterte das erste Bild über die helle Fläche. Bild auf Bild folgte, Denkmäler und Prachtbauten aus Groß-Berlin, darunter das stolze Gebäude der deutschen Reichsburg. »Seine Majestät der Deutsche Kaiser und seine Garde!« sprach nun der Prinz. Das lebensgroße Bild Kaiser Wilhelms II. wurde sichtbar. Atemlose Stille herrschte, und die Augen der Krieger glänzten freudig. Der Eindruck der Macht war vollkommen.
Und nun vertraute Bilder
die Eisenbahn mit der kleinen Lokomotive, die langsam, von Rufen im Dialekt der Heimat begleitet, tief in das Land hineinfährt. In dieses Tal, auf das eine weiße Sonne brennt, mit fernen Bergen ringsumher und breiten Weinfeldern. An allen Stationen stehen Menschen in Gruppen, die die Tracht der Heimat tragen. Mara preßt das erregte Gesicht an die schmutzigen Scheiben. Der Schaffner sagt: »Die nächste Station ist Gruda!«
Die alte Stane brachte vor Erregung kein Wort hervor. Tränen liefen über ihr zerknittertes Gesicht. Oh, wie alt sie geworden war! Wie klein und mager! Ihre Augen aber leuchteten. Niemals hatte die alte Frau dieses Kind vergessen, das ihr dessen Mutter in der Sterbestunde anvertraut hatte. Voll Stolz sah sie an Mara empor. Die Augen und das schwarze Haar, das Mara so kurz trug, wie es die alte Stane noch niemals gesehen hatte. Ja, Mara war schön geworden, viel schöner und seltsamer noch als ihre Mutter gewesen war, der alle Burschen von Gruda so besessen nachgestellt hatten!
Blaß war Mara und die dunklen Haare klebten feucht auf ihrer Stirne, als nach einem Tage, an dem ihr zuckender Leib sich viele Stunden lang in Schmerzen gewunden hatte, Stane ihr den Knaben in die Arme legte. Dieses allererste Staunen in die blicklosen Augen ihres Kindes, in dieses winzige zerknitterte Antlitz, das so seltsam alt aussah, erschreckte und beseligte Mara. Sie ließ es geschehen, daß Stane den Knaben wieder hinaustrug. Eine Frau brachte Mara den Knaben am nächsten Tage. Hinter der Fremden stand Stane. »Du hast ja kaum Brüste,« sagte sie leise. »Und da Anne gerade ein Kind hat …« die roten Backen der Bäuerin verzogen sich zu einem Grinsen, »so ist es das Beste ….« Fast böse sah Mara auf Anne, auf deren so reifen, schwerblühenden Körper.
Auf den Namen Nikodemus hatte der Priester Maras Knaben getauft. »Aber wie wirst du ihn rufen?« fragte die alte Stane, ein wenig verwundert über den altertümlichen Namen. »Nenne ihn Nino, so heißt auch der Sohn des Bürgermeisters.«
Werde ich es ertragen, niemals mehr auf den Orgeln in den großen Städten zu spielen? Mara überlegte alle Möglichkeiten. Die Professoren? Die Kollegen? Sie mußten es nicht wissen. Wenn ich abends heimkehre, werde ich nicht wie bisher in ein leeres Zimmer kommen. Ich werde am Schreibtisch arbeiten und wenn ich aufsehe, werde ich immer dich in deinem Bettchen sehen. Aber die alte Stane konnte unbeugsam sein. »Nino hat sein eigenes Recht. Du mußt arbeiten, Mara, kannst dich nicht Tag und Nacht um ihn sorgen. Du kannst ihn nicht mitnehmen. Aber du mußt kein Jahr verlieren, wie du sagst. Habe ich dich nicht großgezogen und meine eigenen Kinder dazu?«
Sie schrak auf aus dem quälenden Dunkel
Mit welchem Recht sperrt man die Menschen ein, die keine größere Schuld haben, als daß sie im Armenviertel geboren wurden, und die sich ihr bißchen Essen nun von denen nehmen, die reich sind?
Sie fürchten sich wohl vor uns?
fragte Wassilij mit Spott und Trauer. »Sie möchten wohl nicht gerne, daß Ihre bürgerliche Welt samt deren Sternenhimmel von Wissenschaft und Kunst zusammenfällt?«
»Ich bin viel mehr bei Ihnen, als Sie ahnen«, erwiderte Mara gedrückt. »Michail gab mir eine Liste von Büchern. Aber ich habe so wenig Zeit. Die Prüfungen …«
Eigentlich kam Mara, um Michail zu sehen, mit dem sie eine Freundschaft ohne viel Worte verband. Von seinem guten, bärtigen Antlitz, von seinen energischen Händen ging der Ausdruck eines gebändigten Lebens aus, dessen Kraft Mara liebte. Denn es war doch so, daß alle Ideen sich in der Persönlichkeit verschiedener Menschen anders spiegelten. Die russischen Studenten bekannten sich alle zu einer Partei, zu einem Ziel. Aber während der Chemiker Wassilij drohend von der Wirkung neuer Nitroglyzerinverbindungen sprach, und sich nicht genug tun konnte in der Verspottung der Religionen, die er bürgerliche Ideologien nannte, indes Vera in erschreckender Unbekümmertheit von Eisenbahnattentaten phantasierte, die der Weg zum Kommenden Reich der Güte seien, schien Mara die Weltanschauung Michails von tiefem Glauben erfüllt.
Wenn Mara noch immer zögerte, den Hohnreden Wassilijs und der sanften Beschwörung Michails zu folgen und bereit zu sein, an deren Seite zu kämpfen, so war es, weil sie sich den Anschauungen ihrer Freunde über die Mittel des Kampfes nicht anschließen konnte. »Glauben Sie nicht, Michail, daß die religiöse Erneuerung die Menschen auch auf Erden glücklicher machen würde, als soziale Programme allein?«
Das Antlitz Michails verdunkelte sich. »Sie sind ein Kind«, entgegnete er abweisend. »Sie wissen nicht, daß Hunger und Vergewaltigung den Menschen so tief erniedrigen, daß er sich nicht mehr auf sein unsterbliches Teil besinnen kann. Ich teile nicht das materialistische Bekenntnis Wassilijs. Aber ich glaube, daß Gott von meinem Volke will, daß es mit Flamme und Schwert die Händler und Schurken aus dem Tempel seiner Welt treibe. Sie sind zu jung, sonst wüßten Sie, daß ein wohlgezielter Schuß die Menschheit ihrem Ziele näher bringen kann.«
In zwei Reiche
war die Welt früher für Mara zerfallen gewesen. Das eine hatte die Arbeit, das Studium beherrscht, das Erleben im Turmzimmer des Pastors, Besuch von Bibliotheken und viele Nächte über Büchern. Und dann war es nach Wochen heißester Hingabe an diese Arbeit geschehen, daß Mara sich besessen an die Wollust gegeben hatte. Ihr Denken von gestern hatte diese Zweiteilung bejaht. Und mit beiden Händen hatte sie in jedem Erleben ihr Herz festgehalten, damit nichts Tieferes sie an jene Stunden binde, in die ihr heißes Blut sie trieb. Aber eine mahnende Stimme war immer stärker geworden und belud nun vergangene Stunden der Leidenschaft mit Scham. Die Männer stießen einen nur immer tiefer hinab. In eine schrecklich leere Einsamkeit nahm man ihren entfesselten Schrei, ihr verzerrtes Gesicht, ihre nackten Worte mit. Und dann, nachher, mochte man sich mühen, stückweise sich selbst wieder zu sammeln. Ich war damals entsetzlich jung, dachte die neunzehnjährige Mara. Gott ist die Erregung, die den Körper übertrifft.
»Sie haben große Fortschritte gemacht, seit Sie von Ihrem Urlaub zurückgekommen sind«, sagte Pastor Eckart zu Mara. »Sie sind eine andere geworden. Und –« entschlossen hielt er ihren Blick, »irre ich, oder hat Ihnen Gott nun die Kraft gegeben, dem Dunklen in sich zu widerstehen?«
»Nicht immer ist es leicht«, antwortete Mara. »Die Musik verlangt mich ganz.«
Aber der Körper, die Sinne
»Du, mein Gott, das sind die ärmlichsten Gewöhnungen, Vorurteile. Viel stärker, reizvoller, gefährlicher sind die Empfindungen, die keines Erlebnisses bedürfen. Denn schliesslich gibt es Menschen, die kommen auf die Erde und kennen alles. Das Leben ist nur eine mühevolle Darstellung der Erinnerung, nichts Neues.«
»Also kämen wir doch von Gott.«
»Aber woher denn?«
Am Weg zum Frauenmünster
gab es neben der Brücke einen Straßenhändler. Zwischen Büchern, auf deren Umschlägen nackte Frauen frech lachten oder finstere Detektive mit Blendlaterne und Revolver ein düsteres Zimmer betraten, lagen oft Schätze, die vergeblich auf einen Käufer warteten. Hier hatte Mara die Gedichte Jehuda Halevis gefunden, erfüllt von Weltmüdigkeit, Jubel der Gottesschau, Erschütterung der Umkehr. Und nun hatte sie heute die Merkpunkte des hl. Bonaventura entdeckt. Ein fast zerfetztes Büchlein, auf dessen erster Seite in verblaßter Tinte ein Name stand. Und neben diesem Namen war mit der gleichen Tinte, von derselben Hand geschrieben worden: »Dieser, dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden.« Mara legte den kleinen Betrag, den der verwunderte Händler von ihr forderte, auf den schmierigen Tisch. Ehe sie weiterging, blätterte sie noch in dem Buch. Und sie fand einen Satz, der sie erschreckte wie die Stimme des Gerichtes. Denn es war in diesem Satze gesagt, daß nichts so schlimm sei als das Erkalten, weil darin der Weg der Verstörung beschlossen liege, »der da führt zum Tode.«
»Ich habe eine kleine Bitte an dich«, sagte Vera und legte eine Aktentasche auf Maras Schreibtisch. »Wunderschön hast du es hier«, fuhr sie fort, indes sie sich in Maras engem Zimmer umsah. Vera trug einen weiten Mantel aus grobem Tuch und einen breitkrempigen Hut in die Stirn gedrückt. Mara betrachtete sie. In dem großen mageren Mädchen mit den entschlossenen Zügen war nichts mehr von der kleinen, ein wenig ungeschickten Klosterschülerin. »Ich verreise«, erklärte Vera einfach. »Und da ich nicht weiß – es könnte mir etwas zustoßen, nicht wahr – bei Wassilij würden sie ja sogleich suchen. Es sind wichtige Papiere, du verstehst.«
Mara griff nach Aktenmappe. »Selbstverständlich mache ich das für dich.«
»Ich muß gehen«, sagte Vera.
»Du fährst schon heute?«
Die Russin antwortete nicht, aber in einer jähen Bewegung riß sie Mara an sich und küßte sie.
Als Mara sich an einem der nächsten Abende von Professor Wernheim nach der Arbeit verabschieden wollte, nahm er eine Zeitung von seinem Schreibtisch und reichte sie ihr. »Da haben Sie Ihre Weltverbesserer!« sagte er. »So sinnlos grausam ist nicht einmal die Natur.«
Interlaken, 10. Juni.
Eine Mörderin verwechselt ihr Opfer!
Der Seidenfabrikant Sergej Georgewitsch Bozner aus der Krim, der gestern hier zum Besuch seiner Familie eintraf, wurde von der russischen Anarchistin Vera Gutschkow auf der Frühstücksterrasse seines Hotels ermordet. Die Mörderin, die kaltblütig aus dem Hinterhalt geschossen hatte und sich ruhig abführen ließ, brach zusammen, als sie erfuhr, daß sie statt des russischen Polizeiministers, dem das sorgfältig vorbereitete Attentat galt, einen Kurgast erschossen hatte. Sergej Georgewitsch Bozner hinterläßt eine junge Frau und zwei Knaben im Alter von drei und vier Jahren.
Sehr früh am Morgen, als Mara noch im Bett lag, kam ein Agent der Polizei, der Mara gebot, ihm zu folgen. Auf der Polizeistation fand sie neben einem mürrischen Beamten den österreichischen Konsul, einen jovialen Herrn, der nur schmerzlich bewegt den Kopf schüttelte. Mara wartete nicht erst, und begann: »Die wirklichen Mörder sind jene, welche die Opfer eines schändlichen Regimes so weit treiben, daß sie Gewalt gegen Gewalt setzen und selbst schuldig werden.«
»Das interessiert uns nicht«, entgegnete der Beamte und schrieb Maras Daten in ein großes Buch. »Sie haben zu beantworten, wonach man Sie fragt.«
Jawohl, nichts interessierte, als der Umstand, daß wenige Minuten später ein Agent erschien, der in Maras Zimmer Nachschau gehalten hatte und mit einem verächtlichen Blick auf die Studentin die Aktenmappe Veras auf den Tisch legte. Schon nach wenigen Fragen hatte der Beamte festgestellt, daß Mara nichts von dem Inhalt der in russischer Sprache beschriebenen Papiere ahnte, die man ihr zum Aufbewahren übergeben hatte.
»Sie sind ein wenig unvorsichtig«, sagte der Konsul und lächelte schmerzlich. Empört durch die kaltherzigen Reden des Polizeibeamten und noch mehr durch das ewige Lächeln des Konsuls hatte Mara flammend bekannt: »Ich denke genau wie Vera Gutschkow.«
»Das interessiert uns nicht«, brummte der Polizeibeamte. »Es handelt sich um Ihre etwaige Mitschuld an dem Attentat. Seien Sie froh, daß wir Sie nicht wie die anderen Freunde der Mörderin hinter Schloß und Riegel setzen. Ihre Reden ignorieren wir als die Verirrung eines Mädchens.«
»Was gehen Sie denn die russischen Studenten an, meine Liebe?« fragte der Konsul freundlich und betrachtete anerkennend das schöne Mädchen. »Es gäbe viel amüsanteren Verkehr für Sie. Sie werden schon noch darauf kommen.«
Sobald Jakob Silberland das Café Stephanie betreten hatte
holte er sich vom Ständer sechs oder acht Zeitungen und legte sie auf einen Tisch am Fenster. Als er sich zurechtgesetzt hatte, bestellte er einen Kaffee und begann, die Brust an den Tischrand gedrückt, eifrig zu lesen. Gerade als er die Kreuzzeitung mit gerunzelter Stirn fortlegte und nach dem Vorwärts griff, erschien vom Kellner geführt, der Briefträger an seinem Tisch und übergab ihm einen eingeschriebenen Brief. Silberland erkannte sofort die Handschrift seines Freundes Paul Seebeck und schob mit einer energischen Armbewegung die Zeitungen zur Seite.
Lieber Jakob!
Paß mal auf: wir haben eine neuentstandene, vulkanische Insel entdeckt, und zwar bin ich der erste, der sie sah. Ich bin geblieben und habe sie für das Deutsche Reich in Besitz genommen. Die Sache ist Geheimnis, nur der Kapitän und der Erste Offizier von der Prinzessin Irene wissen davon. Wo die Insel liegt usw., kannst du von diesen Herren erfahren. Bitte geh sofort nach Berlin, zum Reichskolonialamt und laß mir eine Vollmacht als Reichskommissar ausstellen. Die Leute sollen aber schweigen, bis feststeht, ob die Insel bewohnbar ist oder nicht. Du verstehst, was ich will: ich denke an unsere Gespräche über den absolut korrekten Staat, der durch keinerlei Traditionen und Rücksichten gehemmt ist – hier können wir ihn gründen, wenn auch nur in einem kleinen Maßstabe. Gruß dein Paul S.
Überall rüstete man sich zur Pilgerreise
es war der erste Tag des Monats Juli, der Tag der Weihe der deutschen Reichsburg! Über Groß-Berlin lagerte der azurblaue Himmel. Unaufhörlich rollten Sonderzüge in allen Bahnhöfen der Reichshauptstadt ein. Studentenverbindungen erschienen in Prunkkleidung mit ihren Fahnen, der deutsche Adel in Trachten längstvergangener Tage. Innungen, mit ihren alten Werkzeichen, durchzogen die Straßen, dazwischen bewegten sich Schützengilden, Turnerschaften und Sängervereine. Planmäßig wurden die Gruppen in den Nebenstraßen verteilt, und vor dem Lustgarten des königlichen Schlosses ertönte Ehrendonner, die Kaiserfahne ging hoch. Unter den Klängen des neuen deutschen Einheitsmarsches setzte sich der Zug vom Schlosse aus in Bewegung.