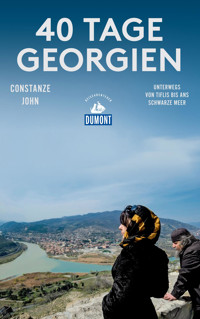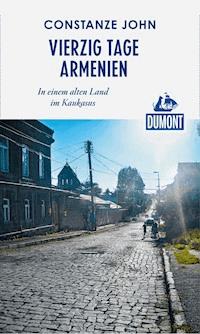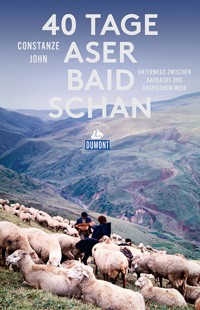
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DuMont Reiseverlag
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: DuMont Reiseabenteuer E-Book
- Sprache: Deutsch
Mit den E-Books der DuMont Reiseabenteuer können viele praktische Zusatzfunktionen nutzen!
Das E-Book basiert auf:1. Auflage 2020, Dumont Reiseverlag
Constanze John bricht zu ihrem nächsten großen Abenteuer auf: Aserbaidschan. Nach ihren Reisen durch Armenien und Georgien vollendet sie damit ihre persönliche Südkaukasus-Trilogie.
Die Autorin blickt hinter die Kulissen des "Land des ewigen Feuers" und erlebt einen Schmelztiegel von Nationen und Kulturen, eine einzigartige Mischung aus Orient und Sowjetvergangenheit. Von der Glitzerwelt der Hauptstadt Baku zu mystischen Welterbestätten und beeindruckenden Nationalparks. Überall in Aserbaidschan erlebt Constanze John große Gastfreundlichkeit – und erhält damit tiefe Einblicke in ein Land zwischen Orient und Okzident.
- Der einzige Reisebericht zu diesem Land im Aufschwung
- Der Kaukasus wird immer beliebter bei Touristen
- Von der Erfolgsautorin von "40 Tage Georgien" und "40 Tage Armenien"
- «Constanze Johns Gewissenhaftigkeit ist ein Segen. » FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG über „40 TAGE ARMENIEN“
Tipp:Setzen Sie Ihre persönlichen Lesezeichen an den interessanten Stellen und machen Sie sich Notizen… und durchsuchen Sie das E-Book mit der praktischen Volltextsuche!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
CONSTANZE JOHN
40 TAGE ASERBAIDSCHAN
UNTERWEGS ZWISCHEN KAUKASUS UND KASPISCHEM MEER
© 2020 DuMont Reiseverlag, Ostfildern
Alle Rechte vorbehalten
Gestaltung: Herburg Weiland, München
Umschlagfoto: laif/KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-RAPHO
(vorne), Constanze John (hinten)
Umschlagkarte: Constanze John, Gerald Konopik, DuMont
Reisekartografie
Fotos, Illustrationen und Karten Innen: Constanze John
ISBN 978-3-7701-8299-2
eISBN 978-3-6164-9163-9
www.dumontreise.de
Für meine Mutter
INHALT
Prolog
Tag 0 Süß und fröhlich
Tag 1 Verschachtelt und einsichtig
Tag 2 Unbestechlich und verschlossen
Tag 3 Magisch und spirituell
Tag 4 Langsam und schön
Tag 5 Butaförmig
Tag 6 Klar und lebendig
Tag 7 Verraten und treu
Tag 8 Manuell und seidig
Tag 9 Kreativ und denkmalgeschützt
Tag 10 Leicht, schwer und erwachsen
Tag 11 Schwach und schwindelig
Tag 12 Morbide und mystisch
Tag 13 Teuflisch und himmlisch
Tag 14 Weiß und rot
Tag 15 Unsicher und sicher
Tag 16 Geschützt und geschätzt
Tag 17 Gemauert und begrünt
Tag 18 Erloschen und stark
Tag 19 Geregelt und verheiratet
Tag 20 Arm und verliebt
Tag 21 Hochwertig und fein
Tag 22 Verbunden und offen
Tag 23 Orangefarben und antik
Tag 24 Energisch und schlau
Tag 25 Sündig und vorübergehend
Tag 26 Unterirdisch und überirdisch
Tag 27 Maßvoll und langlebig
Tag 28 Fließend und einfach
Tag 29 Monstermäßig und märchenhaft
Tag 30 Zwei und eins
Tag 31 Sprachlos und schlaflos
Tag 32 Spielend und heilsam
Tag 33 Historisch und bewahrt
Tag 34 Altmodisch und universell
Tag 35 Verloren und versüßt
Tag 36 Verdient und willkommen
Tag 37 Außerirdisch und außerordentlich
Tag 38 Plastisch und kosmopolitisch
Tag 39 Ölig, blutig und reich
Tag 40 Freundschaftlich und familiär
Epilog
Ortsregister
Quellenangaben
Weiterführende Lektüre
Danksagungen
Vorbemerkung zu den Schreibweisen des Aserbaidschanischen
Allein in den vergangenen hundert Jahren ist die Schrift für die aserbaidschanische Sprache durch mehrere Alphabete gegangen. Und auch wenn heute ein lateinisches Alphabet in Aserbaidschan verwendet wird, gibt es dort einzelne Buchstaben, welche bei uns nicht gängig sind.
Ich habe mich entschlossen, die Übertragung der Namen und Begriffe möglichst der deutschen Aussprache anzupassen.
Zugleich ergeben sich eine ganze Reihe von Ausnahmen dadurch, dass ich die Namen heute lebender Personen, deren Umschreibung in Aserbaidschan wiederum ins Englische üblich ist, in eben dieser Übertragung belasse.
CONSTANZE JOHN, BRASILIA, LEIPZIG, 12. FEBRUAR 2020
… zwar ist der Busbahnhof Baku noch im Bau, aber schon in Betrieb. Ein Reisender hält mir die Tür auf. Während ich diese nun durchschreite, danke ich dem Mann. Gleich hinter der Tür gibt es eine flache Stufe. Ich stürze.
Einige Tage später verlasse ich einen Supermarkt, der durchaus schon in Betrieb ist; nur ist dort, wo in Westeuropa eine Schräge wäre, auch hier eine flache Stufe. Ich strauchele, kann mich dieses Mal aber abfangen.
Als ich eine Woche später durch den dämmrigen Mittelgang eines Busses gehe, bemerke ich die Stufe mitten im Gang sofort.
Nach vierzig Tagen komme ich zurück zum Busbahnhof Baku, öffne wieder genau diese Tür, an der ich anfangs gestürzt bin, schaue und bemerke diesmal eine Schräge hinter der Tür; gegebenenfalls behindertengerecht.
Prolog
Es ist meine erste Reise in den Orient. Meine Freundin, die Journalistin Ludmila Thiele, die, wie sie selbst immer wieder betont, halb Russin, halb Armenierin ist, hat meine bisherigen Reisen durch den Kaukasus mit Herz-Verstand begleitet, mich zugleich an jeder passenden Stelle aber auch daran erinnert: »Einmal musst du nach Baku. Unbedingt. Es wird dir gefallen. Baku ist eine kosmopolitische Stadt.« Geboren in Sibirien, ist Ludmila in Baku aufgewachsen, bis sie in den frühen 1980er-Jahren durch Heirat in den Osten Deutschlands kam, in die DDR.
Vor einigen Monaten traf ich in Georgien einen Aserbaidschaner, einen aus Baku, und der meinte ebenso: »Armenien, Georgien … Warum kommst du nicht auch nach Aserbaidschan? Ich sehe einiges kritisch in meinem Land, zugleich ist vieles sehr interessant. Überlege es dir und dann komm!« – »Ich glaube sogar, dass ich kommen muss. Die Armenier, die Georgier und ihr, ihr seid doch Brüder.« – Mein Gegenüber wirkt fassungslos: »Aber wir sind doch keine Brüder!«
Ich versuche, das Gesagte mittels einer persönlichen Geschichte herunterzubrechen: »Ich habe auch zwei Brüder. Und zwischen denen gibt es immer wieder Streit. Und keiner weiß, warum.«
Mein Gegenüber zeigt sich erleichtert: »Ach so; so – ja.«
Jeder sagt etwas anderes über Aserbaidschan. Und kaum einer war dort. Eine Reihe von Leuten ist sich ohnedies sicher: »Wenn Sie in Armenien gewesen sind, kommen Sie gar nicht erst nach Aserbaidschan.«
Für mich aber ist die Reise beschlossene Sache. Ich werde alles mit eigenen Augen sehen.
Zum Glück bekomme ich über Freunde Kontakt zu Simone Haeberli, die zu diesem Zeitpunkt die stellvertretende Regionaldirektorin für Zusammenarbeit an der Schweizer Botschaft in Baku ist. Ich frage sie, ob es schwierig werden könnte, ein e-Visum zu erhalten. Ihre Antwort ist sachkundig und praktikabel: »Aserbaidschan ist dabei, sich zu öffnen. Sie müssen es nicht vor sich hertragen, dass Sie in Armenien waren. Zugleich muss es auch kein Geheimnis sein. Entscheidend ist, dass Sie nicht in Bergkarabach gewesen sind. Oder waren Sie?«
Nein, in Bergkarabach bin ich nie gewesen. Und das energische Zeichen, diesen Ort im Konfliktzustand unbedingt zu meiden, bekam ich vor Jahren ausgerechnet in Armenien: Ich saß mit Maria, einer armenischen Autorin, im Haus der Schriftsteller in Jerewan. Gerade hatte Maria den Wasserkocher angestellt, um Tee zu machen. Und während wir darauf warteten, dass das Wasser zu kochen begann, lud sie mich ein, gemeinsam mit ihr einmal nach Bergkarabach zu fahren: »Dort ist es nicht gefährlich. Als wir zuletzt in Bergkarabach gewesen sind, mussten wir an der Grenze bloß ein bisschen warten – wegen einer Schießübung.« Und nun, gerade als das Wort Schießübung fiel, explodierte dieser Wasserkocher. Erschrocken schauten wir uns an, bevor ich aussprach, was mir in Anbetracht der Explosion völlig klar schien: »Gott hat gesprochen. Unter diesen Umständen fahre ich ganz bestimmt nicht nach Bergkarabach.«
Zurück zum Orient und zu meiner eigentlich ersten Reise dorthin. Ja, inzwischen sage ich: eigentlich ersten Reise. Denn allmählich wird mir klar, dass ich bereits als Kind durch den Orient gereist bin, für tausendundeine Nacht.
… und zwar fasst Scheherazade, die Tochter des Wesirs, einen riskanten Beschluss: Sie beabsichtigt, dem König Geschichten zu erzählen und ihn damit so in ihren Bann zu ziehen, dass er um jeden Preis das Ende der jeweiligen Geschichte hören möchte. Und es gelingt. Am Ende schenkt der König Scheherazade das Leben und nimmt sie zur Frau.
Auch unsere Mutter erzählte mir und meinen beiden Brüdern jeden Abend Geschichten. Und so unüberwindbar die meisten Landesgrenzen damals für uns gewesen sein mögen, waren wir mittels dieser Geschichten zugleich in aller Welt unterwegs. Dafür sorgte schon unsere liebe Mutter.
Wir liebten Märchen und Geschichten, nicht zuletzt die, die uns in fremde, orientalische Welten führten – Der fliegende Teppich, Ali Baba und seine vierzig Räuber, Aladin und die Wunderlampe. Später kamen die Witze und Streiche des Hodscha Nasreddin dazu, und noch viel später und ganz anders: Hodscha Nasreddin als die zentrale Gestalt einer Reihe von Weisheitsgeschichten der orientalischen Mystiker, der Sufis.
Bis heute liebe ich Geschichten. Und als ich in Baku Samira Hashimzadeh kennenlerne, eine junge, gläubige Frau, die besonders die mystische Seite des Islam sehr liebt – »Das Wort Sufismus bedeutet pur, sauber« –, bitte ich sie, mir eine dieser Sufi-Geschichten zu erzählen.
… und zwar ist der Bruder des Königs reich, geht aber immer arm gekleidet. Die einen sagen: »Er ist ein kluger Mensch.«
Die anderen sagen: »Er muss verrückt sein: Er ist reich und geht gekleidet wie ein Bettler.«
Einmal kommt ein Mann zu ihm und bittet ihn um Rat: »Du bist so klug. Sag, wie kann ich reich werden?« Und der Bruder des Königs rät ihm: »Du musst viel Getreide kaufen. Das Getreide wird im nächsten Jahr sehr teuer sein.«
Der Mann kauft Getreide und wird ein reicher Mann.
Im Jahr darauf geht er erneut zum Bruder des Königs und sagt: »Du bist doch verrückt! Mir gibst du guten Rat. Aber du selbst tust nichts, um reicher zu werden. Sag, Verrückter, was soll ich als Nächstes kaufen?«
Diesmal rät der Bruder des Königs: »Du musst Zwiebeln kaufen und sie anschließend wässern.« Also nimmt der Mann all seinen Reichtum, kauft die Zwiebeln, wässert sie und – sie verderben alle.
Als er ein drittes Mal vor den Bruder des Königs tritt, beschwert er sich: »Warum hast du mir zuerst einen so guten Rat gegeben und dann so einen …?«
»Ganz einfach«, erklärt ihm der Bruder des Königs. »Zuerst hast du mich als einen klugen Menschen befragt, und klug habe ich dir geantwortet. Dann hast du mich aber als einen Verrückten befragt ...«
Vierzig Tage, vierzig Räuber …
»Die Vierzig ist eine heilige Zahl im Orient«, erinnert sich Ludmila. »So gelten die vierzig Tage nach der Geburt des Kindes als eine wirklich kritische Zeit, in der man Kind und Mutter nicht unbedingt besuchen sollte.«
Stirbt ein Mensch, so gibt es wiederum vierzig Tage nach seinem Tod eine Feier für die Seele.
Einer der großen Dichter Aserbaidschans ist neben Füsuli, Nesimi, Mehseti und Natavan zweifellos Nizami. In seinem Werk Die Schatzkammer der Geheimnisse ist zu lesen, dass seinerzeit im Orient, im 12. Jahrhundert, die allgemein geläufige Vorstellung herrschte, dass der Verstand eines Menschen im Alter von vierzig Jahren seine eigentliche Reife erlangt hat.
Und überhaupt: War nicht auch der Religionsgründer des Islam, Mohammed, gerade etwa vierzig Jahre alt, als er seine Visionen empfing?
Zahlen- und Buchstabensymbolik sind im Orient eng miteinander verbunden. Die Vierzig steht für den Buchstaben M – M wie Mohammed. Die Vierzig gilt als die Zahl des Propheten.
Die Vierzig spielt sowohl im Christentum als auch im Islam eine wesentliche Rolle – als Zahl der Prüfung, Bewährung, Initiation, Verwandlung, Tod, Aussöhnung … Und wären wir in Westeuropa ebensolche Freunde von Zahlensymbolik, könnten wir den Fall der Mauer, nur vier Wochen nach dem vierzigsten Jahrestag des dazugehörigen Staates, kaum als Zu-Fall sehen.
Also: Aserbaidschan
In Aserbaidschan, gelegen zwischen Kaspischem Meer und Kaukasus, leben die über zehn Millionen Einwohner auf einer Gesamtfläche von 86.600 Quadratkilometern; davon umfasst die Autonome Republik Nachitschewan 5500 Quadratkilometer. Das Gebiet Bergkarabach ist seit 1993/94 nicht mehr unter aserbaidschanischer Kontrolle. Auch von der Bundesrepublik Deutschland wird die sogenannte Republik Bergkarabach völkerrechtlich nicht anerkannt.
Aserbaidschan, einst Teilrepublik der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, grenzt an Russland, konkret an die Republik Dagestan, sowie an Georgien, Iran, Armenien und mit der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan auch an die Türkei. Hauptstadt der Republik Aserbaidschan ist die Hafenund Erdölstadt Baku.
Das Land wird im Präsidialsystem regiert. Der Präsident wird alle sieben Jahre gewählt. Amtsinhaber ist Ilham Aliyev, der Sohn des Vorgängers Heydar Aliyev. Vizepräsidentin ist die Ehefrau von Ilham Aliyev, Mehriban Aliyeva.
Azize und die altorientalische Heilungsmusik
Vor Jahren begegnete ich bei einem Seminar zu altorientalischer Heilungsmusik in München dem Sufi-Meister Dr. Rahmi Oruç Güvenç. Die Gruppe Tümata stellte Musik der Turkvölker vor und spielte. Mit dieser Musik verfiel ich in eine friedvolle Trance, und habe – wenn auch erfolglos – bei dieser Gelegenheit einmalig den Drehtanz der Derwische probiert, das Himmelstanzen, wie Samira es nennt.
In Anbetracht meiner bevorstehenden Reise erneuere ich die Verbindung zu Tümata, in persona zu Andrea Azize Güvenç. Und so erfahre ich: »Kontakte nach Aserbaidschan gibt es (noch) nicht: Aber wir haben sehr viele aserbaidschanische Lieder im Repertoire.« Bald darauf fügt es sich, dass Azize mit ihrer Karawane der altorientalischen Heilungsmusik erstmalig durch Deutschland zieht und, wo immer möglich, musiziert: »Die Idee ist, die Musik dienend zu den Menschen zu bringen, nach Hause, in Hospitäler, Einrichtungen, Schulen etc., und nicht darauf zu warten, dass die Menschen zu uns kommen. Das Ganze soll im Reisen geschehen, weil das auch im alten Orient sich so verbreitet hat. Es ist ein Experiment.«
Als Reisende mit unterschiedlichen Richtungen und zugleich verwandten Wegen treffen wir uns kurz vor meinem Abflug in Richtung Orient bei mir zu Hause in Leipzig. Und Azize, die ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommt und heute in der Türkei lebt, in der Heimat ihres inzwischen verstorbenen Mannes, eröffnet mir in dieser einen Stunde eine ganze Welt. Unmittelbar bevor wir auseinandergehen, bitte ich auch sie um eine Geschichte. Und weil ihr nicht sofort eine einfällt und ich sie auch nicht bedrängen möchte, frage ich Azize nach der Bedeutung ihres Namens: »Azize hat mehrere Bedeutungen. Es ist einer der schönen Gottesnamen – die Geliebte, die Liebende, die Siegreiche … Und jetzt ist mir auch eine Geschichte eingefallen, die eine – glaube ich – sehr besondere Geschichte ist und von Oruçs Vater kommt. Oruç hat sie nur ganz, ganz selten in unseren Seminaren erzählt:
… und zwar gibt es einen Bürgermeister, in einem kleinen Dorf, der so grausam ist, dass er von niemandem Sympathie erhält. Und dieser Bürgermeister stirbt. Und alle weigern sich, ihn zu beerdigen, und sagen: »Nee, ich tu das nicht. Der hat …« Und so weiter.
Und dann sagen sie: »Gut, fragen wir seine Frau, ob sie das macht.« Und die sagt: »Nee, also der hat mir so viel Schlechtes angetan. Ich bringe ihn nicht unter die Erde.«
Im Islam ist es so, dass, wenn jemand stirbt, er möglichst am selben Tag beerdigt wird. Man sagt, die Seele warte darauf, dass der Körper schnell wieder in die Erde geht, damit sie frei ist.
Selbst der Imam weigert sich. Alle weigern sich. Und dann fällt einem ein: »Mensch, da oben auf dem Berg, da wohnt doch der Murad, der Schäfer. Der kennt den Bürgermeister gar nicht. Und vielleicht kann der …«
Sie packen den Leichnam auf einen Eselskarren und machen sich auf den Weg, treffen den Murad und sagen: »Weißt du, Murad: Wir haben alle so schlechte Erfahrungen mit ihm. Aber würdest du ihn beerdigen?«
Und der Murad sagt: »Ja. Gut. Ich übernehme das. Seid ganz beruhigt.«
Sie gehen wieder. Und nach ein paar Tagen sitzen sie alle im Teehaus, mit ganz langen Gesichtern. Die Stimmung ist bedrückt, bis einer es nicht mehr aushält und sagt: »Ich muss euch was erzählen. Ich hatte jetzt drei Nächte hintereinander einen Traum. Da habe ich unseren Bürgermeister im Paradies gesehen. Stellt euch das vor. Wie kann das möglich sein? Wie kann das sein?« – Und ein anderer sagt: »Ich habe es auch gesehen!« – »Und ich auch.« Und alle hatten denselben Traum in diesen drei Nächten. – »Ja, wie kann das denn sein? Wir müssen noch einmal überlegen. Hat er nicht doch etwas Gutes getan?« – »Nein!« – Und auch der Frau fällt nichts ein; gar nichts. – »Ja, dann muss es an Murad liegen. Irgendetwas hat der Murad gemacht. Das wollen wir wissen.«
Also gehen sie zu Murad und fragen: »Murad, was hast du gemacht?«
»Ja«, sagt Murad. »Ich habe nichts Besonderes gemacht. Ihr wisst doch: Ich bin ein einfacher Mann. Ich bin ein Schäfer. Ich wohne hier in der Höhle. Ich habe ein Loch gegraben, habe ihn beerdigt, und das war’s.« – »Aber Murad, irgendwas musst du gemacht haben. Überleg doch noch mal.« – Sagt der Murad: »Ich habe ihn ganz normal mit meinen Worten beerdigt.« – »Und was hast du gesagt?«
»Ja«, sagt der Murad. »Ich habe gebetet und habe gesagt: Allah, Allah, du hast mir so viele Gäste geschickt. Ich bin ein einfacher Mann. Und du weißt: Ich habe keinen Reichtum. Ich habe nur mein Fell hier, auf dem ich schlafe; ich habe zu essen, was ich im Wald finde. Und wenn ein Gast kommt, dann teile ich mit ihm, was ich zur Verfügung habe. Und auch ich schicke dir jetzt mal einen Gast. Nimm ihn auf und teile mit ihm, was du zur Verfügung hast.«
Tag
0
Süß und fröhlich
Meine Reise nach Aserbaidschan beginnt dort, wo meine letzte Kaukasus-Reise geendet hat – in Georgien, in Tbilissi, wo ich mich mit dem Begründer von Kaukasus-Reisen, Hans Heiner Buhr, treffe.
Heiner stammt aus Berlin und lebt seit 1996 in Georgien, gemeinsam mit seiner georgischen Frau Teona und den Kindern. Er ist Künstler, ehemals Deutschlehrer und jetzt Reiseunternehmer.
Heiner reist gern. Anfänglich spazierte er ausgiebig durch Tbilissi, reiste später bis in die entferntesten Ecken Georgiens, schließlich auch durch die Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan. Dabei erwies es sich als Wert, dass er in der Schule – noch vor Englisch – die russische Sprache gelernt hat und gut spricht; selbst Georgisch beherrscht er inzwischen.
»Wobei ich ja nicht als Unternehmer geboren wurde, sondern mir das erst angeeignet habe. In der DDR gab’s halt immer diesen Kollektivcharakter. Manch einer – in der Schulklasse, in der Studiengruppe, im Arbeitskollektiv – war zwar ein bisschen höhergestellt; das hieß aber nicht, dass er mehr Rechte hatte. Und so ist das auch bei uns, bei Kaukasus-Reisen. Letztlich bin ich allerdings dann doch der Chef: Ich habe die Firma gegründet, ich verwalte das Geld, ich bin für alles verantwortlich. Ganz klar.«
Gemeinsam mit seinem lokalen Team wird Heiner von der Vision beflügelt, interessierte Reisende bei einem schonenden und defensiven Abenteuer- und Bergtourismus orts- und sachkundig zu begleiten.
Derzeit gibt es in Tbilissi ein Team-Treffen, und dabei lerne ich Ashurey Ramazanova kennen, im Unternehmen die aserbaidschanische Reiseleiterin. Ich als die Ältere, zugleich mit Heiner bekannt und befreundet, biete ihr sofort das Du an.
Zu dritt sitzen wir auf Heiners Balkon in der Altstadt. Es ist Ende März, und die Mittagssonne wärmt bereits. »Mindestens einmal im Jahr kommt unser Team zusammen. Manchmal fahren wir auch irgendwohin – mal durch Georgien, mal durch Armenien, mal durch Aserbaidschan. Denn wir arbeiten nicht nur gemeinsam, sondern wir haben auch Spaß miteinander. Unsere Arbeit ist auch unser Leben. Wenn wir als Team nun zum Beispiel nach Aserbaidschan fahren, mit Ashurey in ihre Heimat, dann kann sie uns dort alles erklären. Ashurey, sage ich ab und an: Was können wir Neues machen? Wir überlegen gemeinsam. Und dabei habe ich meine deutsche Denke, und Ashurey denkt ganz anders!«
Eine junge Aserbaidschanerin hatte ich mir ganz anders vorgestellt und auf jeden Fall mit langem, schwarzem Haar. Ashurey, Ende zwanzig, trägt ihr mittelblondes Haar nackenlang und ihren Rock in Mini. Sie hat einen wachen Blick, spricht wunderbar Deutsch, besitzt ein lebensfrohes und energisches Wesen. Sie lacht gern und viel.
»Woher stammst du eigentlich?«, frage ich sie, nicht sicher, ob ich sie das so rundheraus überhaupt fragen darf. Aber es scheint kein Problem zu sein: »Im Norden, in den Bergen, liegt ein kleines Dorf – Zaqatala. Ich stamme aus Zaqatala. Dort gibt es eigentlich nichts Besonderes. Aber Scheki ist in der Nähe. Und Scheki mit seinem alten Khan-Palast ist interessant. Nach Scheki solltest du fahren.« Ich wage mich noch einen Schritt weiter vor: »Aber du siehst nicht aus wie eine typische Aserbaidschanerin.« Ashurey lacht hell, bevor sie mir erklärt: »Ich stamme zu fünfzig Prozent von den Lesginen und den Awaren ab. Die anderen fünfzig Prozent sind Mischmasch. Das sagt jedenfalls meine Mutter.«
Und ich erfahre, dass in Aserbaidschan mehrere Ethnien zusammenleben. Die deutlich größte Gruppe sind die Aserbaidschaner, überwiegend schiitisch-muslimisch, wobei Staat und Religion voneinander getrennt sind. Darüber hinaus leben im Land um die dreißig verschiedenen Ethnien: Lesginen, Awaren, Udinen, Krysen, Chinalugen, Buduchen, Ingilojer, Pontos-Griechen, Neue Assyrer, Ukrainer, Weißrussen, Armenier, Zachuren, Taten bzw. Tats, Mescheten, Tataren, Juhuren (»Bergjuden«), aschkenasische Juden, Russen, Talyschen, Kurden, Georgier … (1)
Aufgrund dieser interessanten ethnischen Vielfalt befördert das Ministerium für Kultur und Tourismus in Aserbaidschan konkret auch den Ethnotourismus. In der vom Ministerium herausgegebenen Broschüre Ethnic tourism in Azerbaijan lese ich: »Ethnotourismus fördert engere Beziehungen zwischen ethnischen Völkern sowie die Integration lokaler Ethnokulturen in das gemeinsame kulturelle Erbe der Welt.« (2)
»Du trägst einen kurzen Rock«, stelle ich fest. Ashurey muss abermals lachen: »Ja, in Baku ist das ungewöhnlich, und die Leute schauen immer gleich. Bei uns in Zaqatala schaut da keiner oder denkt etwas Schlechtes. In Zaqatala sind kurze Röcke ganz normal.«
Ich mag den Austausch mit Ashurey. In ihrer offenen Art kommt sie mir sehr entgegen. Und natürlich interessiert mich auch, warum sie eigentlich so gut Deutsch spricht. Heiner steht auf, bleibt dann aber im Türrahmen stehen, um uns noch ein bisschen zuzuhören.
»Das werde ich immer wieder von meinen Gästen gefragt.« Ashurey lacht ihr Lachen und erzählt, dass sie nach dem Schulabschluss in Gändschä studiert hat, an der Staatlichen Universität. Gändschä – englisch: Ganja – ist die zweitgrößte Stadt in Aserbaidschan.
Zunächst studierte Ashurey Europawissenschaften, Politik und Geschichte. Anschließend ging sie nach Deutschland, um ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache weiterzuentwickeln und die deutsche Kultur kennenzulernen. Dort absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Krankenhaus. Es folgte das Angebot, sich zur Krankenschwester ausbilden zu lassen.
»Als Krankenschwester hätte ich in Deutschland bleiben können. Aber nach diesem einen Jahr wusste ich genau: Krankenschwester zu sein, das ist nicht mein Weg. Damals war ich gerade vierundzwanzig Jahre alt. Und irgendetwas hat mich zurück nach Aserbaidschan gerufen. Vielleicht«, und jetzt lacht sie wieder, »war das ja unser großartiges Essen. Unsere aserbaidschanische Küche habe ich in Deutschland sehr vermisst. Ja, aber als ich dann wirklich zurück war, folgte eine schwere seelische Phase: Ich fühlte mich plötzlich zwischen den Kulturen; ich wusste nicht mehr, wohin ich gehöre. Zu Europa? Oder zu Asien? Welche Leute sind wirklich meine Freunde? Und was ist richtig für mich?«
An sich wäre es perfekt gewesen, sich einige Tage früher auf den Weg nach Aserbaidschan zu machen, um spätestens am 20. März in Baku zu sein, zum berühmten Novruz-Fest. Novruz ist das festliche Ereignis des Jahres. Nur wurde zeitgleich am 20. März die Buchmesse in Leipzig eröffnet, auf der ich 40 Tage Georgien vorzustellen hatte. Ich hoffe sehr, dass man mir meine Verspätung verzeihen wird.
Novruz heißt übersetzt Der neue Tag. Der Frühling beginnt. Das Haus wird geputzt, Bäume werden gepflanzt, die Familie wird neu eingekleidet. Darüber hinaus ist das Fest ein Anlass, um Schulden zu begleichen, und eben auch, um zu verzeihen. Sogar Begnadigungen werden von Staats wegen zu diesem Tag unterschrieben; in diesem Jahr sind es knapp vierhundert gewesen.
»Natürlich helfe ich dir«, hatte mir Ashurey auf meine Anfrage hin versichert. »Ich kenne Novruz von klein auf. Wenn wir uns treffen, dann erzähle ich dir davon!«
»Moment«, sagt sie jetzt und holt eine hellblaue Plastikbox aus ihrer Tasche, während Heiner endgültig in seinem Büro verschwindet. Das Team von Kaukasus-Reisen trifft sich erst in einer Stunde. Uns bleibt also ausreichend Zeit für ein imaginiertes Neujahrsfest.
»Novruz«, beginnt Ashurey und öffnet mit einem geheimnisvollen Blick die Box. Im Inneren liegen übereinandergestapelt mehrere Gebäckstücke. Wie eine Verkäuferin auf einem orientalischen Basar verweist sie auf das, was sich hier bietet. Und das sind: »Sonne, Mond und Sterne. Früher gab es dieses Gebäck nur zu Novruz, heute bekommt man es das ganze Jahr.« Ashurey nimmt ein großes, rundes Blätterteigstück heraus, bricht es in zwei Hälften und reicht mir eine der beiden: »Lass es dir schmecken! Das ist Gogal. Und Gogal steht für die Sonne. – Aserbaidschan hat vier Religionen erlebt: Der Zoroastrismus war die älteste Religion. Im 1. Jahrhundert folgten die Christen, danach kamen für sechs Jahrhunderte die Araber, und mit den Arabern kam der Islam. Während der Sowjetzeit dominierte der Atheismus. – Beim Zoroastrismus, dieser ältesten Religion, haben die Anhänger an die Sonne geglaubt. Normalerweise sagen wir: Sie beten das Feuer an. Wir nennen sie Feueranbeter. Aber eigentlich waren sie für die Sonne. Und Novruz ist verbunden mit dieser Religion. Übrigens wird Novruz nicht nur in Aserbaidschan gefeiert, sondern auch im Iran, in Kirgistan, Turkmenistan … Und jeder feiert es anders. – Ja«, sagt Ashurey und verweist auf das nächste Gebäck, diesmal eines in Halbmondform: »Und das hier ist Schekerbura – der Mond, also: der Halbmond. Und als Drittes kommt Baklava. Diese hier ist extra so geschnitten, dass wir Sterne damit legen können, aus fünf oder acht Baklava. Unser aserbaidschanischer Stern – du siehst ihn in der Flagge oder im Wappen – ist achteckig.«
Ashurey demonstriert mir den fünfeckigen Stern; mehr Baklava hat sie leider nicht dabei. »Sonne, Mond und Sterne. Damals war Gott in diesen ganzen Himmelsfiguren. Man sagt, dass Novruz zum ersten Mal im ersten Jahrtausend vor Christus gefeiert wurde. Zu Sowjetzeiten durften die Menschen ihre Religion nicht leben, die Muslime nicht und auch nicht die Christen. Aber wenn ich mich nicht irre, begann es in den 1960er-Jahren, dass Novruz wieder öffentlich gefeiert werden konnte – 1967, und zwar als Frühlingsfest.«
Es gibt vier Himmelsrichtungen, vier Jahreszeiten, vier Elemente. Die Vier steht für die Ganzheit und die Vollendung. Also dauert Novruz vier Wochen, wobei jeweils der Dienstag eine besondere Rolle spielt. Das Fest beginnt mit dem letzten Dienstag im Februar, dem Wasser-Dienstag:
»Als ich damals nach Deutschland gefahren bin, haben sie mir Wasser hinterhergeschüttet, über die Stufen, auf den Weg. Und sie haben gesagt: Komm gut wieder zurück nach Hause! Wasser gilt bei uns als heilig. In schlimmen Zeiten erzählen die Leute dem Wasser von ihren Schmerzen. Wenn ich als Kind etwas Schlechtes geträumt hatte, sagte meine Mutter: Geh und sprich zum Wasser! Als Kind habe ich überhaupt nicht verstanden, warum ich mit dem Wasser sprechen soll. Aber meine Mutter war davon überzeugt, dass mit dem Wasser mein Albtraum davonfließen würde. – Und an diesem Wasser-Dienstag springen die Leute frühmorgens über das Wasser und sagen dabei: Ich möchte, dass uns in diesem Jahr nichts Schlechtes passiert. Und jetzt bin ich wieder sauber. Das ist wie ein Update auf dem Computer«, meint Ashurey und lacht. »Der zweite Novruz-Dienstag ist dem Feuer gewidmet. Mit dem Feuer veränderte sich das Leben der Menschen. Auch das Feuer gilt als heilig. Aserbaidschan ist ein Land des Feuers, denn wir haben so viel Gas. Und wenn sich das Gas entzündet, kommt Feuer aus der Erde. Das ist auch ein Wunder. Wir haben hier auf der Halbinsel Abscheron den brennenden Berg Yanardagh und den großen Feuertempel Ateschgah. Der dritte Novruz-Dienstag gehört dem Wind, der vierte der Erde. Und mit dem Dienstag der Erde beginnt dann das große, mehrtägige Fest. Zuerst feiert man in der Familie, und dann wird öffentlich gefeiert, getanzt, gesungen … Als ich Kind war, haben wir so sehr auf Novruz gewartet, weil es dann neue Kleidung für uns gab. Und auf jeder Straße wurde ein großes Feuer gemacht, und wir sind darübergesprungen. Wir sind auch zu unserer Nachbarschaft gegangen, um dort zu essen. An diesem Tag achtete man darauf, keinesfalls etwas Schlechtes zu sagen, da gelauscht werden durfte. An jeder Tür durftest du lauschen. Und wenn du etwas Gutes gehört hast, dann würde auch das neue Jahr gut für dich werden«, sagt Ashurey und klatscht, wie um das Ganze zu besiegeln, einmal kräftig in die Hände, bevor sie noch eine Reihe weiterer Novruz-Bräuche aufzählt: »Da ist Samani, das Novruz-Gras, das aus Weizenkörnern gezogen wird. Und es gibt die Tradition, Eier zu bemalen und mit den hart gekochten Eiern richtige Eierkämpfe auszutragen, wobei die Regel gilt: Wessen Eierschale zuerst bricht, der hat verloren. Den ärmeren Nachbarn werden Tabletts voller Walnüsse, Süßigkeiten, vor allem Pilaw gebracht, denn – Reis bringt Fülle ins Haus. Und ganz wichtig: Zum Fest muss man fröhlich sein, ob man nun arm ist oder reich. Denn die Vorstellung ist, dass zu Novruz auch die Verstorbenen mit dazukommen – unsichtbar, versteht sich –, um nachzusehen, wie es ihrer Familie geht. Keiner möchte den Toten Sorgen bereiten. Also zeigen sich alle fröhlich und froh.«
Nicht nur die Zahl Vier, sondern auch die Sieben ist eine symbolische Zahl. Deshalb wird zu Novruz der Tisch gedeckt mit sieben verschiedenen Sachen, die alle im Aserbaidschanischen mit dem Buchstaben S beginnen: zum Beispiel Sumakh (ein Gewürz), Süd (Milch), Sirkä (Essig), Su (Wasser) …
»Ja, und an diesem letzten Novruz-Dienstag gibt es auch Geschenke – für die Kinder. Bei uns in Zaqatala gingen die Kinder immer mit einem Beutel herum, für Süßigkeiten oder auch für Geld. Die Menschen geben den Kindern etwas. Und dann sind auch die Kinder froh.«
Tag
1
Verschachtelt und einsichtig
Vorderseite, Rückseite … Von Kopf bis Fuß bin ich eingeseift, werde ich jetzt gewaschen, was heißt gewaschen, ich werde geschrubbt. Und es ist mir recht: Aus Deutschland habe ich im Kreuz eine kräftige Verspannung mitgebracht. Eine Tasche, ein blauer Koffer und eben diese Verspannung – das ist mein Gepäck. Noch bin ich in Tbilissi, in Georgien, inzwischen im Schwefelbad König Erekle. Wasser ist heilig. Und vielleicht hilft es.
Das König Erekle ist mir vertraut. Nur die Frau, die mich diesmal wäscht und schrubbt, ist mir neu. Nackt liege ich auf der warmen, nassen Marmorbank und fühle mich, wenn auch nicht respektlos, aber doch behandelt wie ein Gegenstand. Fühlt sich so die Totenwäsche an? Was endet jetzt, heute und hier, und was wird beginnen? Ein neuer Tag?
Diese rundliche Frau um die vierzig wirkt bescheiden, wobei sie energisch agiert. Nachdem sie einen Eimer Wasser aus dem Becken geschöpft und schwungvoll über mich bzw. meinen Körper gekippt hat, sage ich auf Russisch: »Ich glaube, ich bekomme gerade ein neues Leben.« – »Dann ist es gut«, meint sie, und über ihr Gesicht fliegt ein Lächeln. – »Wie ist Ihr Name?« – »Adja.« – »Sie sind Aserbaidschanerin?«
Ich hatte gehört, dass gerade in den Schwefelbädern von Tbilissi seit jeher vor allem Aserbaidschaner arbeiten. Die Frau nickt. Und ich freue mich, jetzt sagen zu können: »Heute Abend fahre ich nach Aserbaidschan.« Bevor ich das König Erekle verlasse, umarmen wir uns. Kaum, dass ich meine Verspannung noch spüre.
Später, auf meinem Weg durch die Altstadt, erhalte ich eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Die Nachricht lautet: »Hier ist Ulviya. Ich bin immer für Sie da. Und wenn Sie in Baku etwas brauchen: Bitte schreiben Sie mir. Ich bin jederzeit erreichbar.«
Jetzt erinnere ich mich – die Freundin einer Freundin hat mir von einer jungen Aserbaidschanerin erzählt, die Dolmetscherin ist und drei Jahre lang in Österreich gearbeitet hat.
Es fühlt sich gut an, in der Fremde bereits erwartet zu werden. Außer Ulviya ist da jetzt auch Ashurey. Dazu noch Chingiz Babayev und Elnur Babayev, zwei aserbaidschanische Künstler, die ich beide vor zwei Jahren in Georgien kennengelernt habe und die, obwohl sie denselben Familiennamen tragen, keine leiblichen Brüder sind.
Und was geben mir die Georgier über die Aserbaidschaner mit auf den Weg?
»Es sind gute Menschen«, höre ich immer wieder.
Und ich werde aufmerksam gemacht: »Auch Stalin war in Baku.« Als ich dem nachgehe, erfahre ich: Stalin war erstmals im Februar 1905 in Baku, kurz nach dem St. Petersburger Blutsonntag, der zu Unruhen in ganz Russland führte. In Baku selbst kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschanern; an die 2000 Menschen starben …
Und ich höre: »Zwischen 1918 und 1920 kam eine ganze Reihe von Künstlern der russischen Avantgarde nach Baku. Aserbaidschan war gerade unabhängig geworden. In Russland war es nicht mehr möglich, aber hier, insbesondere in der Hauptstadt, konnten diese Künstler noch ein freies Leben führen. Darüber hinaus hofften sie, hier im Süden dem Hunger zu entfliehen.«
Die Anreise
Ein Flug nach Baku kommt für mich wegen der Kürze der Strecke sowieso nicht infrage. Möglich sind nun immer noch Bus, Marschrutka, Zug oder, wie mir Ralph Hälbig vorschlägt, ein privater Fahrer. Ich schätze Ralph, freier Mitarbeiter beim MDR, als Kenner der Materie sehr. Sein Blog zu Georgien sowie zum Südkaukasus insgesamt wird inzwischen von drei Millionen Followern genutzt.
Ein privater Fahrer? Keine Chance. Mein Budget ist mein ganz persönliches und also: minimalistisch.
Ich entscheide mich für eine Anreise mit dem Zug. Auf dem Zentralbahnhof Tbilissi warte ich keine zwei Minuten, und schon stehe ich am Schalter. Es ist Ende März. Die Hochsaison beginnt erst im Mai. Laut Plan brauchen wir bis Baku zwölf Stunden und zehn Minuten; die Fahrt beginnt am Abend und endet am nächsten Morgen gegen neun.
Das Ticket in der Tasche, treffe ich mich am Nachmittag noch einmal mit Heiner von Kaukasus-Reisen, denn wie sagt er immer: »Aserbaidschan ist mein Lieblingsland.« Ich möchte Genaueres erfahren. Zeit hat er: Sein Team ist abgereist und Ashurey bereits zurück in Baku.
Und wieder sitze ich mit Heiner auf seinem Balkon in der Altstadt von Tbilissi. Ich schaue hinüber zu den Dachterrassen und Fenstern der nächsten Nachbarn. Und ich schaue hinauf in den blauen Himmel.
»Georgien, Armenien, Aserbaidschan – generell sind das ja drei ganz verschiedene Länder mit verschiedener Geschichte, Kultur, Sprache; die Religion ist verschieden. Zugleich liegt alles eng zusammen. Meine Nachbarn hier im Viertel sind Armenier. Die nächsten Nachbarn sind Aserbaidschaner. Und dieser Nachbar dort ist ein Jude. Sie sind hier geboren. Aber trotzdem wird im Kaukasus nie vergessen, woher einer kommt. – Das ist eine freundliche Koexistenz, man lädt sich gegenseitig ein; Freud und Leid wird geteilt. Ja, und wenn man das hier kennt, dann will man eben auch mal wissen: Wie leben die Leute eigentlich in Baku? Was ist ähnlich? Und was ist verschieden? – Ich bin ein visueller Mensch. Und in Aserbaidschan gibt es sehr starke Kontraste. Diese öden Landschaften. Und – wie soll man sagen? Das ist wirkliche Öde! Zum Teil liegt das Land sogar unter der Meeresoberfläche, achtundzwanzig Meter unter null.« Heiner erzählt begeistert, zugleich entspannt, wie ein achtsamer Beobachter. »Dort treffen sich Europa und Asien. In Georgien bin ich noch irgendwie in Europa. Aber sobald ich die Grenze Rote Brücke in Richtung Gändschä überquere, habe ich das Gefühl: Jetzt komme ich nach Asien. Auf aserbaidschanischer Seite steht hinter dem Grenzübergang so ein riesengroßes zwanzig Meter hohes Tor. Und solche Tore gibt es eigentlich nur in Mittelasien.«
Der Zug nach Baku wartet schon im Gleis – groß, breit und schwer auf russischer Spur. Es ist noch ein Zug aus Sowjetzeiten. Die Fenster sind halbhoch mit weißen Gardinen verhangen. Und an den Wagen stehen die jeweiligen Schaffnerinnen, auf Russisch: Provodnitsij, blau uniformierte Frauen der Azerbaycan Demir Yollari.
Am Waggon Nummer acht ist es eine Dunkelhaarige. Sie strahlt Strenge aus. Und so wirkt auf mich die rosafarbene Blüte in ihrem Haar eher wie Dekoration. Ohne eine Miene zu verziehen, nimmt sie Pass und Ticket entgegen, liest, prüft, vergleicht und reicht mir beides ungerührt zurück. Als ich einsteige, fühle ich mich durch die beiden übermäßig hohen Stufen wie bei der Besteigung eines Berges.
Das Abteil Nummer vier teile ich mir mit einer zierlichen, jungen, dunkelhaarigen Frau. Wir sprechen Russisch miteinander, bleiben unter uns, werden aber bereits, und ohne, dass ich es bemerke, genau wahrgenommen.
Zugleich nehme aber auch ich wahr: So richtet sich im Nachbarabteil ein immerzu lächelnder, junger Mensch in Uniform ein. Er fährt bestimmt zum Dienst, denke ich, zum Dienst an der Grenze oder in Baku.
Bald schon rollt der Zug an – träge, sicher, langsam-langsammeditativ. Unsere rosa geblümte Waggonbeauftragte beginnt damit, Bettwäsche und Handtücher zu verteilen. »Geben Sie das Ihrer Tante!«, höre ich sie in familiärem Ton zu meiner jungen Mitreisenden sagen, wobei sie ihr zwei Packen Wäsche in die Hände drückt. Überrascht, ja froh horche ich auf.
Meine Nichte, übrigens eine kasachische Studentin, wird in Baku ihre Verwandten besuchen. Sie ist freundlich, aber der Prüfungen wegen, die sie gerade in Tbilissi abgelegt hat, völlig übermüdet. Mein armes Kind. Sie sieht blass aus und wartet darauf, endlich schlafen zu können. Allerdings erreichen wir erst kurz vor Mitternacht die georgische Station an der Grenze zu Aserbaidschan.
Alles ist hell erleuchtet. Der Zug hat seine Fahrt gestoppt. Und lange Zeit geschieht erst einmal gar nichts. Wir sitzen da und halten die Pässe bereit. Gerade läuft unsere rosa Geblümte noch ein letztes Mal durch den Waggon und ruft streng: »Passaport! Passport! Graniza!«
Eine der Lampen draußen auf dem Bahnsteig verlischt, um dann, genau dreißig Sekunden später, erneut zu erstrahlen. Zum Zählen haben wir jetzt alle Zeit der Welt.
Endlich geht es los. Georgische Grenzbeamte steigen in den Zug. In unseren Waggon kommt eine junge, uniformierte Frau. Auf ihrem Gesicht zeigt sich keinerlei Spur von georgischer Lebensfreude. Sie versieht ihren Dienst und stapelt unsere Pässe. Draußen weht ein starker Wind. Er pfeift durch die Fensterritzen.
Eine Dreiviertelstunde später rollt der Zug weiter zum Grenzpunkt Aserbaidschan. Und wie gehabt sitzen wir im Abteil, die Pässe in der Hand …
Ich erzähle das hier so ausführlich, weil der für mich entscheidende Punkt eben diese Grenze war und ist. Den Antrag auf ein e-Visum hatte ich wahrheitsgetreu ausgefüllt und schon drei Tage später zugeschickt bekommen. Und obwohl ich beständig versuchte, das Unken der anderen zu übergehen und mich auf meine eigenen Erfahrungen zu verlassen, steckte mir, schon aus Mangel an eigenen Erfahrungen, ein Rest dieses Unkens nach wie vor im Hinterkopf.
Ja, und dann wird alles ganz anders als gedacht: Denn dieser immerzu lächelnde, junge Mensch in Uniform, in unserem Nachbarabteil, ist nicht einfach ein Beamter auf dem Weg zum Dienst, sondern er ist bereits im Dienst.
Das Büro des Grenzoffiziers steckt in seinem Aktenkoffer. Den hat er inzwischen aufgeschlagen und auf dem Kofferdeckel die kleine Kamera befestigt, die jeden von uns fotografiert, während er den Pass kontrolliert. Einer nach dem anderen tritt bei ihm ein. Die Schaffnerin reguliert. Und wie erwartet, erbittet er von mir nun neben dem Pass auch das e-Visum. Da er aber mit seiner Rechten noch immer den Stapel der Pässe jongliert, faltet er mein Visum einhändig, ja fast artistisch mit seiner Linken. Alles ist in Ordnung.
»Salam«, verabschiede ich mich leise. An sich ist dieser Gruß Begrüßungsformel. Ich komme erst an. Salam als der sechste der neunundneunzig Namen, die es für Allah gibt: As-Salam: der Frieden. Der Grenzoffizier bleibt gelassen und antwortet mit: »Sagol!«, mit Auf Wiedersehen. Ich selbst nehme es als ein Willkommen und fühle mich so glücklich und erleichtert wie lange nicht. Und das obwohl unsereins, geboren in Leipzig, ja bereits ähnliche Grenzkontrollen kennt, zum Beispiel wenn wir in die Heimat unseres Vaters, nach Tschechien, einreisen wollten, oder in die Heimat unserer Mutter, nach Polen. Für mich war es damals Urlaub; das jetzt aber ist etwas anderes: Es ist eine Reise, vierzig Tage durch Aserbaidschan.
Grafik herunterladen
Tag
2
Unbestechlich und verschlossen
Im Süden des Landes erstreckt sich der Kleine Kaukasus, im Norden der Große. Mit der Fahrt durch die Kür-Aras-Niederung durchfahren wir vor allem flaches, karges Land. Und vielleicht ist ja genau das diese Öde, von der Heiner gestern gesprochen hat.
Inzwischen bin ich also in Aserbaidschan, wo zu neunzig Prozent – der Ethnie nach – Aserbaidschaner leben. Wobei ihr Siedlungsgebiet geteilt ist. Etwa dreimal so viele Aserbaidschaner leben im Iran.
Der Frieden von Gulistan und die Teilung
Es wirkte verworren, als Heiner über die Geschichte dieser Teilung sprach. Heute aber denke ich: Wahrscheinlich war es genauso – verworren und verwirrend, damals im 19. Jahrhundert.
»Kaukasische Geschichte«, meinte Heiner, der ja schon mehr als zwanzig Jahre im Kaukasus lebt, »die hat sehr viel mit dem Temperament, mit der Mentalität zu tun, nämlich mit Treue und mit Verrat. Die russische Eroberung ging seit Katharina der Großen immer weiter nach Süden, in Richtung Schwarzes Meer, fortgesetzt dann unter Peter I. Da kam man sehr schnell mit den Türken ins Gehege, die wiederum die Krim und das Schwarze Meer beherrscht haben. Und im georgischen Raum, in Richtung Kaspisches Meer, herrschten die Perser. Es gab die verschiedenen Kriege zwischen den Russen und den Türken sowie zwischen den Russen und den Iranern. Aber dann gab es 1813 auch den Vertrag bzw. den Frieden von Gulistan – zwischen dem russischen Zarenreich und dem Iran. Damals wurde Aserbaidschan aufgeteilt. Der Süden, das war der größere Teil, südlich von Länkäran, ging an den Iran, und der nördliche Teil, also das heutige Aserbaidschan, blieb beeinflusst von den Russen.« Die endgültige Teilung kam, wie ich später erfahre, 1828 mit dem Frieden von Turkmenchay.
Ankunft
Es ist noch eine knappe Stunde, bis wir Baku erreichen. Während ich also eigentlich noch immer bei Heiner auf dem Balkon sitze, schaut meine Nichte wie abwesend hinaus in die Landschaft. Vielleicht eilt sie schon voraus, zu ihren Verwandten.
Endlich kommt die Silhouette der Zwei-Millionen-Stadt Baku in unser Blickfeld. Kaum vorzustellen, dass dies noch vor zweihundert Jahren eine Stadt in der Wüste gewesen sein soll, bestehend aus Lehmhütten und aus Palästen, das Ganze umgeben von einer Mauer. Ende des 19. Jahrhunderts setzte der Ölboom ein, der das Wesen der Stadt grundlegend verändert hat.
Zunächst sind einfach nur Hochhäuser zu sehen, Wohntürme. Irgendwo dort wohnt Chingiz, in einer der oberen Etagen. Und die Erdölfördertürme dürften, genau wie das Kaspische Meer, auf der anderen Seite der Stadt liegen.
Punkt 8.50 Uhr fährt unser Zug im Hauptbahnhof Baku ein, dem einstigen Sabunchu-Bahnhof. Gemeinsam mit dem Avtovaksal, dem Autobusbahnhof, gelegen am anderen Ende der Stadt, wird der Bahnhof für mich in den nächsten Wochen wichtigster Ausgangspunkt sein – für meine Reisen in die einzelnen Regionen.
Das ursprüngliche Bahnhofsgebäude, heute erweitert durch einen modernen An- und Überbau, entstand Ende des 19. Jahrhunderts im maurischen Stil, erkennbar an dem schönen Wechsel von hellen und dunklen Steinen. Die erste Fernverkehrsstrecke der Transkaukasischen Eisenbahn führte von Baku nach Tbilissi, eng verbunden mit dem Ausbau des Telegrafennetzes durch die Gebrüder Siemens. Ein Vorgang, den Heiner plastisch kommentierte: »Damit brachten die Gebrüder sozusagen das Internet des 19. Jahrhunderts ins Land.«
Schon winkt mir zum Abschied meine Nichte zu, ich erwidere ihren Gruß, der Zug hält und ruckt noch einmal lärmend durch. Einen Moment lang bleibt es überraschend still, bis die schweren Türen lärmend aufgestoßen werden. Wir sind da.
Heute ist Baku Wirtschafts- und Kulturzentrum sowie Verkehrsknotenpunkt, liegt nach wie vor innerhalb des Erdölfördergebietes und besitzt dementsprechend einen Erdölhafen. Erdöl und Erdgas aus Aserbaidschan werden bis in die Länder der EU geliefert.
»Bakinka, das ist eine, die aus Baku kommt. Das ist wie eine Nationalität«, schwärmt meine Freundin Ludmila immer. 1986 ist sie zum letzten Mal in Baku gewesen: »Wir haben gesagt: Mij bakinzem, wir Bakuer, und das stand immer höher als: Wir sind Russen, wir sind Armenier … Das war ja an sich fast ein Traum, den man verwirklichen wollte: dass alle Völker sich miteinander wohlfühlen.«
Das erste Quartier, passend zu meinem Budget, ist nur siebenhundert Meter vom Bahnhof entfernt, gegenüber dem Yashil-Basar, dem Grünen Markt. Die Rufe »Taxi! Taxi!« lasse ich verhallen. Ich bin zu Fuß unterwegs und ziehe meinen blauen Koffer hinter mir her. Der Fußweg wird immer schmaler. Zudem haben hier die Bäume ältere Rechte. Sie stehen mitten im Weg. Ohne einen Koffer schiebt sich der Passant problemlos vorbei. Ich selbst muss auf die Straße wechseln.
Baku ist ein Wesen, das ich noch nicht kenne, aber auf meinem Weg zum Quartier ist erst einmal alles so, wie beschrieben: Hier ist der Yashil-Basar und dort dann das kleine Hotel namens East House.
Im Hotel erwarten mich zwei Herren, beide in anthrazitfarbenen Anzügen. Der Erste schaut ernst, vergeistigt wie ein Dichter; der Zweite wirkt europäischer und lächelt auch kurz. Erschöpft von der Reise, versuche ich, wach zu reagieren.
Ich stehe an der Rezeption des Hotels, reiche dem Zweiten meinen Pass über den Tresen und versuche zu erfassen, natürlich so unauffällig wie möglich, inwieweit ich willkommen bin. Und so beginnt ein Spiel. Immerzu fühle ich mich beobachtet und beobachte doch selbst … Spätestens am dritten Tag, als ich das Ganze plötzlich wie von außen sehe, muss ich lachen. Denn natürlich werde ich hier angeschaut, beobachtet, geprüft: eine europäische Frau, ungeschminkt, die einen bunten langen Rock und flache Schuhe trägt, darüber hinaus allein reist, noch dazu außerhalb der touristischen Saison.
Der Dichter trägt mir den Koffer nach oben. Respektvoll, mit einem schönen Leuchten in den Augen, dabei immer mit Abstand, zeigt er mir das Zimmer: Bett, Tisch, Stuhl, kleines Bad. In der Verabschiedung legt er seine Hand aufs Herz, neigt seinen Kopf und eilt wieder davon.
Ich atme durch: Das ist nun mein Ort auf Zeit. Sofort schicke ich eine erste Nachricht in die Runde: Ich bin gut in Baku angekommen.
»Willkommen und bis bald!«, antwortet Chingiz fast postwendend. In seinem Wohnturm-Zuhause gibt es ein Gästezimmer, und in der nächsten Woche werde ich für einige Tage bei ihm wohnen. Die zweite Antwort kommt von Elnur, der sich derzeit in den USA aufhält: »Gerade arbeite ich an einem großen Mosaik. Wie lange bleibst du? Wir müssen uns sehen. Gruß. Privjet.« Ashurey fragt, wann wir uns sehen. Und Ulviya schlägt vor: »Darf ich Ihnen gleich heute unsere Stadt zeigen?«
Wir treffen uns am Nachmittag und, noch bin ich fremd, gleich wieder am Bahnhof. Den Weg dorthin kenne ich.
Mein erster Tag in Baku ist trüb und kühl. Wenigstens regnet es nicht. Und kein Lüftchen weht in der Stadt der Winde. Auf dem Foto, das mir Ulviya geschickt hat, ist eine junge Frau in einem bunten Sommerkleid zu sehen. Natürlich muss ich dieses Bild jetzt in die aktuelle Frühlingskühle der letzten März-Tage übersetzen, während ich am Haupteingang des Bahnhofs stehe und Ausschau halte. Nach einer Weile bemerke ich eine Frau, knapp dreißig. Unsere Blicke treffen sich. Und strahlend gehen wir aufeinander zu. Ulviya trägt einen schwarzen Mantel, und ihr dunkelbraunes Haar ist unter einer Mütze verborgen. Wir umarmen uns wie längst Vertraute. Sofort lade ich Ulviya ein, vom Sie zum Du zu wechseln.
Ulviya schlägt mir einen Spaziergang in die Altstadt vor: »Itschäri Schähär ist das Herz von Baku. Mit der Metro sind es zwei Stationen. Oder wäre auch eine halbe Stunde zu Fuß für dich in Ordnung?« Ulviya spricht ein sehr gutes Deutsch, mit leicht österreichischem Akzent.
Vom Bahnhof bis zum Mädchenturm
Vom Bahnhof aus durchqueren wir erst einmal die sogenannte Gründerzeitstadt. Wir laufen die Azadliq-Straße, die Freiheitsstraße, in Richtung Uferpromenade und damit in Richtung des Kaspischen Meeres, welches ich heute noch nicht zu Gesicht bekommen werde, da wir zuvor in die Nizami-Straße einbiegen. Jetzt geht sogar der Himmel ein wenig auf.
»Nizami war ein großer Dichter, lebte im 12. Jahrhundert, schrieb auf Persisch und stammt aus Gändschä.«
»Persisch? Liegt Gändschä denn nicht in Aserbaidschan?«
Ulviya nickt: »Doch. Natürlich.«
Im Weitergehen erreichen wir das Denkmal eines aufrecht stehenden, bärtigen Mannes in langem Gewand, der die Hände hinter dem Rücken faltet. Ulviya sagt: »Und das ist Nesimi.«
»Der große Dichter aus Gändschä?«
»Nein, Nesimi ist ein anderer als Nizami. Nesimi schrieb im 14. Jahrhundert und vor allem auf Türkisch. Er war ein Sufi. Ich lese gern klassische Literatur. Wir hatten in Aserbaidschan sehr gute Dichter – Nizami, Nesimi, Füsuli … In meinen Augen sind diese Dichter zugleich auch Philosophen. Sie haben Dinge geschrieben, die ich nicht übersetzen und erklären könnte. Nesimi zum Beispiel schrieb: Meine Seele ist in zwei Welten, passt aber nicht in beide Welten. – Weißt du, was das bedeutet? So wie ich es verstehe, bedeutet das, dass er zuerst einmal im Mutterbauch gewesen ist. Und von dort ist er dann weggegangen in seine eigene Welt. Wenn er stirbt, verliert er auch diese zweite Welt. Und seine Seele fliegt weiter. Das ist doch irgendwie … Ich weiß nicht«, sagt Ulviya lächelnd, während sie durchatmet, um am Ende zu offenbaren: »Ich schreibe auch. Wenn es mir besonders gut geht, oder auch wenn ich traurig bin; wenn ich über etwas nachdenken muss, dann schreibe ich. Aber ich veröffentliche meine Gedichte nicht. Sie sind nur für mich.«
Wir kommen an McDonald’s vorbei und erreichen mit dem Fontänenplatz das Literaturmuseum, das Nizamis Namen trägt. Langsam schreiten wir die Reihe der Fenster ab, denn jedes Fenster gibt einem anderen Literaten den Raum. Zum Beispiel ist da die Dichterin Natavan: »Natavan. Das war ein Pseudonym und heißt so viel wie machtlos. Dieses Pseudonym hat sie sich selbst gegeben. Sie ist berühmt für ihre Gedichte über Liebe, Verlust, Schmerz, Freundschaft, Freundlichkeit. Sie dichtete Gaselen.«
Gasele, Gaselen oder Ghazal sind mir unbekannte Begriffe. Und so erfahre ich jetzt von einer Liebesdichtung, die ein strenges Reimschema hat; eine seit dem 7. Jahrhundert aus dem Arabischen stammende Form, die später auch von den Sufi-Mystikern verwendet wurde.
Das alles ist wirklich sehr interessant, bloß komme ich nach der kurzen Nacht mit der mentalen Verarbeitung des Ganzen kaum noch hinterher. Und gerade als die Flut der neuen Namen und Begriffe mich zu überfordern droht, kommt mir zur Rettung Ludmilas Bakinka wieder in den Sinn, sodass ich, ohne jeden Übergang, Ulviya frage, ob eigentlich auch sie eine Bakinka sei.
»Bakinka?« Überrascht schaut mich Ulviya an. Als sie sieht, dass mich die Frage wirklich interessiert, beginnt sie zu überlegen: »Mh, meine Vorfahren kommen nicht aus Baku, aber meine Mutter und ich wurden hier geboren. Kann ich mich so nennen? Bakinka? Ich habe nie darüber nachgedacht. Die jungen Leute zur Zeit meiner Mutter, die haben sich allerdings alle Bakinka und Bakinijez genannt. Aus ihnen bestand die Intelligenz unseres Landes. Sie haben alle studiert und damals zu Sowjetzeiten Russisch gesprochen. Ich glaube, heute hat das nicht mehr diese Bedeutung. Aber – das ist wirklich eine gute Frage.«
Schweigend gehen wir weiter, und Ulviya denkt währenddessen weiter über die Bakinka-Bakinijez-Frage nach. Das wird mir aber erst klar, als sie urplötzlich auflacht und mit Schalk in den Augen meint: »Ich bin ich. Und das ist meine Antwort: Ich habe keine Zugehörigkeiten.«
Die Altstadt liegt verborgen hinter hohen und breiten Mauern; die Tore stehen weit offen. Wir betreten das Areal, das gemeinsam mit dem Mädchenturm und dem Schirvanschah-Palast zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
Und es überrascht mich schon, wie rasch – je tiefer wir in die Altstadt vordringen – Gassen und Wege enger und verwinkelter werden.
»In Itschäri Schähär kennt jeder jeden. Und immer, wenn ich hierherkomme, blüht meine Seele. Auch das erste Hotel, in dem ich gearbeitet habe, das Shah Palace Hotel, befindet sich hier. Ich würde es dir nachher gern zeigen. Jetzt aber«, sagt Ulviya und verweist auf einen kleinen, alten, leer geräumten Laden, »zeige ich dir die Buchhandlung von Elman Mustafayev.«
Onkel Elmans Buchhandlung
»Onkel Elman haben wir ihn alle genannt. Vor ein paar Wochen ist er gestorben. Schade, dass du ihn nicht mehr kennenlernen kannst. Ich habe mich in seinem Laden immer so wohl gefühlt. Dieser Laden gehörte einfach mit zur Altstadt. Jeden Tag öffnete Onkel Elman um neun Uhr, und abends schloss er um halb sechs. Er hatte ausnahmslos alle Bücher, die in seinem Laden standen, gelesen. Onkel Elman empfahl mir immer etwas; dieses und jenes. Das müssen Sie unbedingt lesen! Und wenn ich mal ein Buch gesucht habe, das er selbst noch nicht kannte, dann fragte er gleich: Wissen Sie denn, worum es geht in diesem Buch? Ich war dann einige Zeit nicht in Baku. Und ich dachte schon: Vielleicht bemerkt er überhaupt nicht, dass ich weg bin. Am Ende waren es immerhin drei Jahre. Aber als ich wiederkam, seinen Laden betrat und mir ein Buch wählte, da sagte er: Ja, voriges Mal habe ich Ihnen etwas anderes gegeben! Er hat sich sofort erinnert, ohne das offen zu zeigen. Er war verschlossen, aber mit einem großen Herzen.«
Möchte ich über eine Gestalt wie Elman Mustafayev nun mehr erfahren, finden sich in aserbaidschanischen Quellen neben Orten und Zahlen vor allem Geschichten. Noch am selben Abend schickt mir Ulviya einen Link zu einem Artikel von Radio Free Europe/Radio Liberty aus dem Jahr 2013, in dem ich fündig werde. Ich erzähle diese Geschichten mal so:
… und zwar gibt es zu Sowjetzeiten das Baku-Buch-Haus. Elman Mustafayev ist der Direktor. Zur Eröffnung 1980 kommen sehr viele Menschen, nur Heydar Aliyev, der 1. Sekretär des ZK der Kommunistischen Partei Aserbaidschans erscheint nicht. »Er konnte leider nicht kommen«, entschuldigt ihn Onkel Elman.
Lesen ist in dieser Zeit nahrhafte Kost. Bevor um zehn Uhr morgens das Baku-Buch-Haus öffnet, warten die Menschen schon. Einmal sollen es sogar über fünfhundert gewesen sein. Elman ruft in aller Ruhe den Bezirkspolizeipräsidenten an und bittet um Hilfe. Daraufhin wird der Besucherstrom zur Buchhandlung polizeilich reguliert.
Als ein Jahr später Heydar Aliyev das Baku-Buch-Haus dann besucht, wird natürlich ein Foto von den beiden gemacht. Heydar Aliyev, der spätere Präsident der Republik Aserbaidschan, bleibt eine ganze Zeit bei Elman in seinem Laden. Sie unterhalten sich. Aber wenn ich »eine ganze Zeit« sage, dann ist das nicht korrekt. Denn Elman wird es später so erzählen: »Am Ende schaut Heydar Aliyev auf seine Uhr und sagt: ›Eine Stunde und vierzig Minuten. Und das ist die eine Stunde und sind die vierzig Minuten, die ich bei der Eröffnung nicht mit dabei gewesen bin.‹ Heydar Aliyev lacht, verabschiedet sich und geht.«
In eben diesem Artikel lese ich auch ein Interview mit Elman Mustafayev: »Meine Karriere? Ich bin nicht hinter dem Geld her. Der Sinn des Lebens liegt nicht im Geld oder in einem Amt. Der Sinn des Lebens kommt den Menschen zugute. Ich bin Besitzer dieses Glaubens.«
Und da es bei der Privatisierung solch eines Lädchens sicher auch einige Probleme gegeben haben dürfte, wird Elman an dieser Stelle gefragt, ob er damals vielleicht mit Geld nachgeholfen habe: »Nein! Bei Allah! Ich habe noch nie in meinem Leben einen Cent genommen oder Bestechungsgeld gegeben. Meine Zunge weigert sich schon, Worte wie Bestechung und Korruption überhaupt auszusprechen. Ich habe eine angenehme Beziehung zu jemandem und gebe ihm ein Buch. Aber Bestechung? Nein!« (3)
Wie ich jetzt höre, ist geplant, Elmans Buchladen nach seinem Ableben zu erhalten: als einen Buchladen mit einem kleinen Café, mit der Möglichkeit, auch online zu bestellen. Hier sollen nicht nur neue Bücher verkauft werden, sondern auch antiquarische.
Vierzig
Ulviya und ich, wir spazieren weiter und erreichen den Mädchenturm, einen mächtigen Hohlzylinder aus Stein. An sich ist dieser Turm das Wahrzeichen von Baku. In Gedanken bin ich aber noch immer bei Onkel Elman. Wir sind schon fast am Mädchenturm vorbei, als Ulviya mich fragt: »Möchtest du den Turm besichtigen?«
»Später!«, sage ich und frage nun meinerseits, wann genau Onkel Elman eigentlich gestorben ist. Ulviya schaut in ihrem Smartphone nach: »Am 11. Februar.«
Ich beginne zu rechnen: Heute ist der 30. März …
»Schade«, sage ich schließlich. »Die vierzig Tage sind vorbei, und seine Seele ist davon.«
Ulviya schaut mich überrascht an: »Meinst du das wirklich?«
Im Shah Palace Hotel
Schließlich stehen wir vor dem Shah Palace Hotel. Es sieht edel aus, mit Balkons und einer Terrasse. Der Hotelpage in klassisch-roter Uniform öffnet uns die Eingangstür.
»Heute arbeite ich in einem Hotel in Guba«, erzählt Ulviya. »Begonnen habe ich aber hier.«
Kaum sind wir im Foyer, grüßt Ulviya glücklich nach allen Seiten hin und wird begrüßt. Sogar der Direktor, ein freundlicher und entspannt wirkender Mensch, kommt auf uns zu und reicht uns die Hand: »Sie brauchen ein Zimmer?« Ulviya umreißt dem Direktor kurz die Situation, erklärt, dass ich schon anderswo Quartier habe …
Ich schaue mich um. Für mich ist alles erstklassig, aber ich sehe nichts, was meinen Blick bindet oder mein Herz fängt.