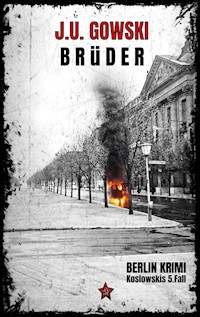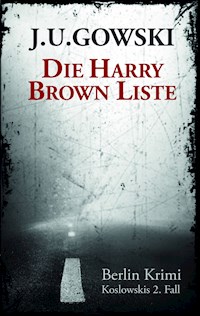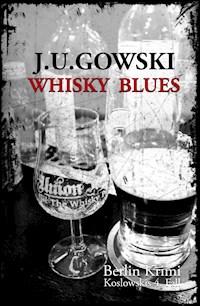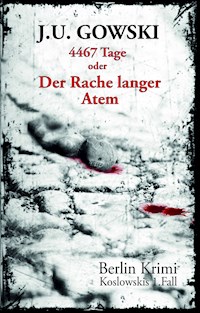
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Vor vielen Jahren ist eine junge Frau und ihre zweijährige Tochter bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Fahrer flüchtete unerkannt. Elf Jahre später übernimmt S.H.Koslowskis Team den Fall eines toten Mädchens, welches im Thälmann Park, einer Neubausiedlung in Berlin Prenzlauer Berg, gefunden wurde. Koslowskis Team ahnt nicht, dass das tote Mädchen zum Begleichen einer alten Rechnung benutzt wird. Es werden Entscheidungen getroffen, die weitreichende und für den einen oder anderen tödliche Folgen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
über das Buch
Es ist der heißeste Frühling seit Jahren. Die Stadt stöhnt unter der Hitze. Eigentlich wollte es sich Kriminalhauptkommissar S.H. Koslowski an diesem Sonntagvormittag in seinem Lieblingspub gemütlich machen, als im Thälmannpark, einer DDR- Neubausiedlung in Berlin Prenzlauer Berg, ein kleines Mädchen tot aufgefunden wird. Koslowskis Team übernimmt den Fall, nicht ahnend, dass das tote Mädchen zur Begleichung einer alten Rechnung benutzt wird. Es werden Entscheidungen getroffen, die für den einen oder anderen weitreichende, sogar tödliche Folgen haben.
Der Autor:
J.U. Gowski wurde 1962 geboren. Lebt in Berlin.
J.U. Gowski
4467 Tage
oder
Der Rache langer Atem
Koslowskis 1. Fall
Ein Berlin Krimi
Texte:
© 2016 Copyright by J.U. Gowski
www.berlin-krimi.com
Umschlaggestaltung:
© 2016 Copyright by Jörg Ugowski
www.ugowski.com
Überarbeitete Neuauflage © 2020
Verlag:
Jörg Ugowski
Tschaikowskistraße 3
13156 Berlin
Druck:
epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb. dnb.de abrufbar.
Für Moni,
David, Sarah, Kora
Meiner Großmutter Ruth Ugowski gewidmet.
In der Hoffnung, dass ihr der Krimi gefallen hätte.
Prolog
11 Jahre, 11 Monate und 4 Tage zuvor
Er brauchte eine kurze Verschnaufpause. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wo er sich gerade befand. Es sah alles gleich aus. Die Häuserfassaden grau, dreckig und marode. Er war einfach losgerannt, um die Ecken, durch die Dunkelheit. Er lief weiter. Stolperte. Versuchte sich mit den Händen abzustützen und knallte mit dem Kopf gegen die Häuserwand. Benommen fiel er durch eine offene Tür in einen Hausflur. Er rappelte sich auf, schloss die Tür und blieb im Schutz des dunklen Hausflures dahinter stehen. Er lauschte. Außer seinem keuchenden Atem war nichts zu hören. Es beruhigte ihn etwas. Vorsichtig öffnete er die Tür und spähte die spärlich beleuchtete Straße hinunter. Kein Verfolger zu sehen. Langsam trat er aus dem Hausflur und sprintete los. Er hatte nur einen Gedanken im Kopf: Weg hier! Das Eckhaus vorne kam ihm bekannt vor. Er erkannte es wieder an den schiefen Holzrollos vor den Fenstern im Erdgeschoss. Eine Straße weiter, hatte er seinen Wagen geparkt. Direkt vor dem Kaiser’s Markt. Ein kurzes Stück noch, dann hatte er es geschafft. Außer Atem sprang er in den BMW seines Vaters, schloss die Zentralverriegelung und versuchte zu starten. In seiner Panik würgte er den Wagen ab. Seine Hände zitterten. Gehetzt warf er einen Blick über die Schulter. Sein rechtes Auge war stark angeschwollen. Es schien ihm keiner gefolgt zu sein. Erleichtert atmete er auf, lehnte sich zurück und schloss die Augen. Warum war die Situation wieder so aus den Fugen geraten? Er schüttelte unbewusst den Kopf. Er sollte nicht mehr trinken. Eine Feststellung, die er schon öfter getroffen hatte. Immer wieder nahm er es sich vor. Es half nur nichts. Er trank dann doch ein Glas. Und dann noch eins und noch eins. Jedes Mal dachte er, er hätte es im Griff. Und jedes Mal lag er falsch. Er atmete tief durch. Ganz ruhig, sagte er sich. Er bereute es, auf die Party gegangen zu sein. Der Aushang vor drei Monaten in der Mensa hatte ihn neugierig gemacht. Erstes Perlenfest in Prenzlauer Berg! Er hatte keinen blassen Schimmer von dem, was ihn dort erwartete. Sein Freund Ronny hatte ihn dann aufgeklärt: Man nimmt bunte Perlenketten und wirft sie den Mädchen über den Kopf, die es wagen ihre Brüste zu zeigen. Nackt natürlich. So soll es wohl Tradition sein in New Orleans, im French Quarter in der Bourbon Street. Für ihn hörte es sich spannend an. Dass man die Perlenketten vor Ort für ein paar Taler bei ihm kaufen musste, sagte Ronny nicht. Er war eben ein Schlitzohr und der Organisator des Festes und sein einziger Freund.
Tja der Osten! Die Frauen dort waren schon immer etwas freizügiger, hatte ihm sein Vater immer wieder vorgeschwärmt. Der hatte gut reden. Bei dem Gedanken an seinen Vater seufzte er. Als Siemensmanager verdiente der gut, war mit seiner D-Mark bis zum Mauerfall im Osten ein gern gesehener Gast. Angebote für amouröse Abenteuer gab es genug. Vielleicht ein Grund weswegen seine Mutter es bei ihm nicht mehr ausgehalten hatte. Sein Vater war ein selbstgefälliger Mistkerl. Er konnte ihn nicht leiden, und schlimmer: Er hatte Angst vor ihm.
Der Abend hatte schön begonnen. Nach drei Mojitos fühlte sich sein Leben lebenswert an. Nach vier hatte er das Bedürfnis gehabt, die Brüste nicht nur anzustarren und nach dem Fünften, diesem auch nachgegeben. In Erinnerung daran kicherte er vor sich hin. Blöd nur, dass das Mädel gleich hysterisch losschrie und ihm eine scheuerte. Seine Grabscherei war eine grobe Regelverletzung, wie die anderen Gäste meinten, einschließlich der Freund der Kleinen. Ein Schrank von einem Kerl mit pickligem Gesicht. Der oder irgendein anderer Typ hatten ihm das eindringlich klargemacht. Die Schwellung an seinem rechten Auge verriet es. In der Hitze der Diskussion hatte er nicht darauf geachtet, von wem die Faust kam. Sie knallte einfach plötzlich in sein Gesicht. Sein Freund Ronny war weit und breit nicht zusehen. Er hätte ihm sicher aus der prekären Lage herausgeholfen, da war er sich sicher. Ronny hätte es klären können. So blieb ihm aber nur die Flucht. Das hatte er davon, dass er versuchte den Osten zu erobern! Zum Glück hatte sein Vater ihm den silbernen BMW geliehen. Widerstrebend! Der Blick, als sein Vater ihm den Autoschlüssel gab, verursachte ihm jetzt immer noch Gänsehaut. Er ließ ihn ahnen, was passieren würde, wenn der Wagen auch nur einen Kratzer abbekäme. Zu Fuß durch den Osten zu touren wäre ihm jedoch im Traum nicht eingefallen!
Ein heftiges Klatschen auf der Motorhaube ließ ihn hochschrecken. Das picklige Gesicht grinste ihn hämisch durch die Frontscheibe an. Er erkannte es sofort. Die große Gestalt stützte sich vornübergebeugt mit beiden Händen auf der Motorhaube ab. Er geriet in Panik. Mit aschfahlem Gesicht drehte er hastig den Zündschlüssel für einen erneuten Startversuch. Sein Handgelenk schmerzte, erinnerte ihn an den Sturz in den Hausflur. Der Motor sprang an. Die Scheinwerfer flammten auf und tauchten die löchrige Fassade des Altbaus in grelles Licht. Er musste da vorn links rum und dann rechts auf die Hauptstraße, das hatte er sich gemerkt. Die Straße war nass. Er bemerkte erst jetzt die feinen Regentropfen auf der Frontscheibe. Hatte es geregnet? Er gab Gas und schoss rückwärts aus der Parklücke auf die Straße.
Der große Kerl sah ihm schweigend nach. Die Hände tief in den Hosentaschen vergraben. Peter Lohmann wusste während er auf das Gaspedal trat, die Geschichte war noch nicht ausgestanden.
Ein alter Skoda bog in die Immanuelkirchstraße. Die grünleuchtende Uhr des Autoradios zeigte 22.01 Uhr. Der Mann hinter dem Lenkrad sah nach hinten. Seine Frau schlief, wie auch die kleine Tochter neben ihr in ihrem Kindersitz. Er lächelte. Geschafft. Er hatte sich erst Sorgen gemacht wegen der langen Fahrt. Zweifel gehabt onb es eine gute Idee gewesen war, in einem Ritt nach Berlin zurückzufahren. Und dann noch der starke Platzregen kurz vor Berlin. Aber jetzt war alles gut. Sie waren gleich vor ihrem Haus und es nieselte nur noch. Das Kopfsteinpflaster der nassen Straße schimmerte wie von einem Ölfilm überzogen. Die vereinzelten Straßenlaternen sprenkelten mattgelbes Licht auf die Fahrbahn. Die bröckelnden Hausfassaden wurden vom Regen und der Dunkelheit fast verschluckt. Das Viertel veränderte sich. Das Morbide, das Rissige, was ihn immer fasziniert hatte, würde bald endgültig aus dem Straßenbild verschwinden. Es war nur eine Frage der Zeit, dachte er wehmütig. Die Häuser wurden saniert, neu verputzt. Sie bekamen frische Farbe.
Langsam ließ er den Wagen bis zur Höhe ihrer Haustür auf der anderen Straßenseite rollen und hielt dann in der zweiten Reihe. Er machte den Motor aus und beugte sich nach hinten zu seiner schlafenden Frau. Die Tochter machte saugende, schmatzende Geräusche. Sie hatte sich die zwei mittleren Fingern der rechten Hand in den Mund gesteckt und nuckelte daran. Der kleine und der Zeigefinger rahmten dabei die Nase ein. Andere Kinder nahmen den Daumen, sie wollte mehr. Zärtlich sah er beide an. Dann streichelte er leicht das Knie seiner Frau. Sie schlug die Augen auf, sah sich irritiert um und fragte benommen: »Sind wir schon da?«
»Ja«, antwortete er leise. »Du solltest die Kleine nehmen und schon nach oben ins Bett bringen. Ich lade inzwischen das Gepäck aus.«
Sie nickte verschlafen und rieb sich mit dem Handrücken über den trockenen Mund, wie um etwas wegzuwischen, was da nicht hingehörte. Wie er diese Geste liebte. Er stieg aus, lief um das Auto und öffnete die hintere Tür. Nach dem lösen der Gurte des Kindersitzes hob er seine zweijährige Tochter heraus. Den Schmatzer auf die Wange nahm die Kleine nur murmelnd zur Kenntnis. Die Wangen waren rot und ihre blonden Locken leicht verklebt vom Schweiß. Seine Frau war inzwischen auch ausgestiegen, gab ihm einen Kuss und nahm ihm die Tochter ab. Leicht tätschelte sie den blonden Schopf und flüsterte etwas Beruhigendes. Die Kleine kuschelte den Kopf an ihre Schulter, steckte wieder die zwei Finger in den Mund und schlief weiter.
»Und schaffst du das Ausladen allein?«
»Ja sicher! Ich muss ja auch noch einen Parkplatz suchen und das kann eine Weile dauern.« Er machte ein betont verzweifeltes Gesicht.
Sie lachte leise. Sie wusste, wie er die ständige Parkplatzsuche hasste. Sie gab ihm einen Kuss und drehte sich dann, mit dem Kind auf dem Arm, um. Sie wollte gerade die Straße überqueren, als sie von einem Lichtkegel erfasst wurde und erstarrte. Ein Auto bog mit hoher, zu hoher Geschwindigkeit in die Straße ein, fing an zu schlingern und tuschierte den parkenden Skoda. Glas splitterte. Metall kratzte auf Metall. Der Wagen erfasste Frau und Kind. Beide wurden durch die Luft gegen eine Laterne geschleudert. Der Wagen gab Gas und bog dann quietschend in die Greifswalder Straße ein.
Dann Stille!
Später erzählten andere, Gäste aus dem indischen Lokal und andere Zeugen, dass er da stand, mit zum Schrei aufgerissenem Mund aus dem kein Laut kam. Dass er den Autotyp und die Autonummer nannte. Und dass allen alles furchtbar leidtat.
Drei Stunden später war das Leben für ihn vorbei. Da erfuhr er durch zwei mitfühlende Polizisten, dass seine Tochter sofort tot gewesen und seine Frau auf den Weg ins Krankenhaus verstorben war.
Fünf Tage später begrub man die Urnen mit der Asche seiner Frau und seiner Tochter unter einem Bergahorn in einem Bestattungswald in der Schorfheide. Alte Buchen und noch ältere Eichen mit ihren hohen Wipfeln spendeten ihm Trost. Sie überragten die jungen Bäume, wie diesen Bergahorn. Er würde versuchen, so oft wie möglich hier zu sein und sich zu ihnen zu setzen. Versuchen, ihre Nähe zu spüren, sehen wie der Ahorn wuchs. Man hatte ihn vom Dienst freigestellt. Sie haben gesagt: Komm wieder, wenn es dir besser geht. Lass dir Zeit. Lass die Wunde heilen. Als ob so etwas heilen könnte wie ein Schnupfen.
Ein halbes Jahr später stand er im Zimmer. In der Hand das amtliche Schreiben welches er in seinem Briefkasten gefunden hatte. Es war es nicht das, was er erwartet hatte. Er musste sich setzen. Noch einmal las er die Mitteilung. Sie war förmlich und unpersönlich. Umschlag und Papier waren grau. Die Worte verschwammen vor seinen Augen. Nur ein Satz hatte sich klar und deutlich in sein Hirn gebrannt: Das Verfahren gegen unbekannt wird eingestellt.
Zitternd legte er das Schreiben auf dem Schreibtisch ab. So nennt man es also wenn der Tod zweier Menschen ungesühnt bleibt, der Fall nach einem halben Jahr zu den Akten gelegt wird. Er atmete tief durch, unterdrückte den Wunsch laut zu Schreien. Das sollte es also gewesen sein?
Der BMW war zwei Tage nach dem Unfall am Alexanderplatz abgestellt gefunden worden. Der Halter, ein hoher Siemens-Manager, hatte ihn als gestohlen gemeldet. Er konnte sich noch gut an die zuversichtlichen Worte des uniformierten Polizisten erinnern: den kriegen wir. Und dann... Außer den Fingerabdrücken von dem Halter und seinem Sohn, sind keine weiteren Spuren in dem Wagen gefunden worden. Der Verdacht, der Sohn des Halters wäre der Fahrer gewesen bestätigte sich nicht. Der Vater sagte aus, sein Sohn wäre den ganzen Abend zu Hause gewesen. Und die Polizei glaubte ihm. Ein weiterer Verdächtiger konnte nicht ermittelt werden.
Der Mann rang mit den Tränen. Er war sich sicher, hätten die Polizei nach einem Taxifahrer gesucht, der zwischen 22:10 und 22:30 Uhr am Alex einen Fahrgast aufgenommen hat, hätte sich das Alibi, das der Vater seinem Sohn gab, in Luft aufgelöst. Er musste ein Taxi genommen haben. Wie wäre sonst der Sohnemann wieder in den Grunewald gekommen? Aber sie hatten es erst gar nicht versucht.
Er stand auf und fing an mit unsicherem Schritt durch die Wohnung zu laufen. Überall standen vollgepackte Kisten. Er hatte sich vor einem Monat eine neue Wohnung gesucht. Eine kleinere. Hier hielt er es nicht mehr aus. Die Erinnerungen lähmten ihn. Er hatte nicht vor viel mitzunehmen. Die meisten Möbel hatte er schon weggegeben. Hier lag nur noch eine Matratze zum schlafen auf dem Boden und der Schreibtisch. Im Flur, vor der letzten Kiste blieb er stehen. Obenauf lagen drei gerahmte Fotos. Er hob sie hoch. Das erste war ein Porträt seiner Tochter, fröhlich lachend. Das andere zeigte seine Frau mit zerzaustem Haar, wie Sie versonnen ihre sommersprossige Nase in den Wind hält. Und dann noch das letzte gemeinsame Foto. Fotografiert in einer Trattoria in Campiglia Marittima in der Toskana bei unserem letzten Urlaub. Der Tisch mit der üblichen rot und weiß karierten Tischdecke. Darauf ein Korb mit Brot und einer halbvollen Karaffe Rotwein. In die Kamera lachend, stießen er und seine Frau mit einem Glas roten Hauswein an und ihre Tochter zweihändig mit Apfelsaft. Er erinnerte sich noch, wie seine Frau den Kellner gebeten hatte sie zu fotografieren. Sie konnte das. Plötzlich übermannte ihn die Schwäche. Die Knie gaben nach. Er rutschte mit dem Rücken an die Wand gelehnt langsam auf den Boden. Ein Schluchzer drang gequält aus seiner Kehle. Dann fing er an zu weinen.
Gegenwart – Samstag 7. Mai
1.
Frau Jacobs ging ihrer abendlichen Lieblingsbeschäftigung nach. Sie sah aus dem Fenster, ihren runden Kopf auf die Hände gestützt. Der Blick ihrer mausgrauen Augen schweifte unablässig über das sich bietende Panorama. Sie hatte es sich mit einem Sofakissen unter ihren dicken Ellenbogen bequem gemacht. Häufig stellte sie Vermutungen über das gesehene an, erdachte sich kleine Geschichtchen. 67 Jahre und immer noch scharf sehende Augen wie ein junges Mädchen. Mit einem Anflug von Stolz lächelte sie vor sich hin. Ihr Mann schaute fern und sie eben gern aus dem Fenster. Sicher, man könnte auch was anderes machen, zum Beispiel reden. Doch irgendwie hat sich das Schweigen in ihrer 45jährigen Ehe immer breiter gemacht. Sie vermisste das Reden aber auch nicht. War es eine gute Ehe? Sie hat sich darüber nie Gedanken gemacht. Kinder hätte sie gern gehabt, aber es sollte nicht sein und ihr Erwin war auch nicht unglücklich darüber. Ja ihr Erwin... Sie seufzte.
Bis 1984 standen hier die Gasometer des Gaswerkes IV, die die Stadt bis 1981 mit Gas aus Verkokung versorgten. Das Resultat war eine hohe Belastung durch Staub, Ruß und Gas. Ab 1979 belieferte die Sowjetunion die DDR mit Gas und damit wurden die nutzlosen Gasometer 1981 stillgelegt. Drei Jahre später wurden sie dann unter Protest von Umweltaktivisten gesprengt.
Frau Jacobs hatte den Protest der Langhaarigen nicht verstanden. Diese großen Dinger waren hässlich und dreckig. Sie fand es gut, dass dafür neue Wohnungen und Grünanlagen geplant wurden. Und wie schön es dann geworden ist. Als sie dann 1986 hier eine Wohnung bekamen, hat Erwin gleich eine Flasche Sekt geöffnet. Rotkäppchen, aus dem Deli-Laden. Jetzt nichts Besonderes mehr, aber damals. Das war jetzt 25 Jahre her.
Die Luft war lau und bewegte sich kaum. Ein schöner Maitag neigte sich dem Ende. Sie hörte, wie ihr Erwin in die Küche schlurfte, wahrscheinlich holte er sich ein kühles Bier aus dem Kühlschrank. Die 19.00 Uhr Nachrichtensendung im ZDF war wohl zu Ende. Wenigstens das schafft er, dachte sie.
Sie wandte ihren Blick wieder dem Park zu. Alles wirkte friedlich und still. Weiter hinten sah sie den Glatzkopf mit seiner Aktentasche nach Hause kommen. Wie immer in Schlips und Anzug. Man konnte die Uhr nach ihm stellen. Klar, es war kurz vor 19.30 Uhr. Wahrscheinlich ein Beamter. Obwohl am Samstag und um die Zeit? Sie schüttelte den Kopf. Dann überlegte sie, ob er mit der Straßenbahn oder mit der S-Bahn gekommen war. Der S-Bahnhof Greifswalder Straße war ja nicht weit weg und ein Auto besaß er nicht, das hätte sie schon mitbekommen.
Hinten am Rondell, in der Nähe der Rutsche sah sie die kleine Luise aus dem Nachbarhaus. Sie wohnte da mit ihrer Mutter im 4. Stock. Ein Mann sprach mit ihr. Sie schienen sich gut zu verstehen. Richtig erkennen konnte sie ihn nicht. Er stand mit dem Rücken zu ihr. Wahrscheinlich ihr Vater, der ab und zu zu Besuch kam, vermutete sie. Luise tat ihr leid. Sie war oft allein. Die Mutter arbeitete viel, soweit sie wusste bei Kaisers an der Kasse. Auch öfter bis spät abends. Es ist nicht einfach in der heutigen Zeit für alleinerziehende Mütter, dachte Frau Jacobs. Schon gar nicht im Handel bei Öffnungszeiten von 8.00-22.00 Uhr. Der Gedanke daran löste wieder ein Gefühl der Empörung aus, das sie immer überkam, wenn sie an die Ungerechtigkeit in der Welt dachte. Früher ging es doch auch. Da hatte der Laden nur bis 18.00 Uhr auf, bis auf den langen Donnerstag einmal im Monat, da ging es dann auch mal bis 19.00 oder 20.00 Uhr. Keiner ist deswegen verhungert. Was muss man denn um 22.00 Uhr noch kaufen? Keiner dachte an die Verkäuferinnen und ihre Familien. Sie seufzte wieder.
Kurz darauf lenkte ein Pfiff ihren Blick in eine andere Richtung. Er kam von dem riesigen Thälmannkopf, der den Hauptzugang zum Park beherrschte, doch sie konnte niemanden sehen. Als sie ihren Blick wieder Luise zuwenden wollte, war der Platz leer. Sie blickte noch mal kurz in die Runde. Nun genug für heute, dachte sie und schloss das Fenster. Es ist Zeit sich bettfertig zu machen, um noch ein bisschen in dem Schmöker zu lesen, der sie schon eine ganze Weile gefangen hielt. Den kurzen dünnen Schrei hörte sie schon nicht mehr.
Der Mann schaute nach oben und lauschte. Die Bäume knarrten leicht im Wind. Irgendwo rief ein Vogel. Sein dünnes, braunes Haar wurde vom lauen Wind leicht gezaust. In seinem hageren Gesicht zeigte sich Erleichterung. Er schniefte. Ein Lächeln umspielte seinen Mund. Niemand schien den kurzen Schrei gehört zuhaben. Die abendliche Stille hatte sich nicht aus ihrer Lethargie reißen lassen. Er fühlte sein Herz vor Erregung laut schlagen. Sie standen in dem Schutz der Bäume und seine schmale kräftige Hand hielt ihren Mund zu. Zärtlich schaute er auf sie hinunter. Sie war still und die graublauen Augen waren weit geöffnet. Er bemerkte die kleine Narbe über der Augenbraue.
»Du brauchst keine Angst haben«, flüsterte seine Stimme heiser. Seine Augen glänzten fiebrig.
»Ich will doch nur mit dir spielen! Du darfst auch bestimmen was.« Er schaute sie fragend an und hoffte auf ein zustimmendes Zeichen.
»Wenn du leise bist, nehme ich meine Hand von deinem Mund. Versprich mir nicht zu schreien, ja?«
Seine Stimme klang flehend, als er zu dem kleinen Mädchen sprach.
Er wollte nur zärtlich sein, sie streicheln. Sie war so schön, so unschuldig. Doch die Stimme erreichte sie nicht mehr. Seine rechte Hand löste sich langsam von ihrem Mund und ihr blondgelockter Kopf kippte haltlos nach vorn.
Das Begreifen dauerte nur einen kurzen Moment. Er ließ den achtjährigen toten Körper auf die Erde gleiten, fiel dann auf die Knie, und fing leise wimmernd an zu weinen.
Die Abendsonne wärmte noch trotz der späten Stunde. Von irgendwo wehte süßer Fliederduft heran, ein Versprechen auf einen kommenden schönen Frühlingstag.
Sonntag 8. Mai
2.
Frank Grabowski sah aus dem offenen Fenster. Es war sieben Uhr. Er hatte schlecht geschlafen. Wieder einmal. Das Fenster im Schlafzimmer hatte er in der Nacht offengelassen, in der Hoffnung, dass sich die Stadt etwas abkühlte. Ein Fehlurteil. Der Preis war die laute nächtliche Geräuschkulisse vom Partyvolk auf dem S-Bahnhof, Motorradgeknatter in der Berliner Straße und die S-Bahn, die am Wochenende die ganze Nacht durchfuhr. Die drückende Hitze und der laute Geräuschpegel waren aber nicht der wirkliche Grund für seine Schlaflosigkeit. Es war Sie. Sie fehlte ihm. Seit er sie verloren hatte, schlief er selten gut. Die Leere, die sie in seinem Leben hinterlassen hatte, machte ihm zu schaffen, raubte ihm einerseits die Ruhe, andererseits lähmte sie ihn. Die Kollegen kannten ihn als gelassenen, unterkühlten Ermittler. Zum Glück schaffte er es, diese Fassade im Dezernat aufrecht zu halten. Doch spätestens hier in der Wohnung fiel sie ab. Die vier Wände waren sein Gehäuse, sein Schutzraum. Grabowski ging ins Wohnzimmer, öffnete dort das Fenster. Auf dem Tisch lag die Schachtel f6. Fünfzehn Zigaretten zählte er. Das bedeutete, dass er schon fünf von seiner geplanten Tagesration geraucht haben musste. War er so oft aufgestanden? Er konnte sich nicht erinnern. Doch der Blick in den Aschenbecher ließ keinen Zweifel zu. Was soll’s. Resigniert zuckte er mit den Achseln und steckte sich eine neue Zigarette zwischen die Lippen. Das Feuerzeug klickte. Er nahm einen kräftigen Zug. Sein schmales Gesicht entspannte sich.
Achter Mai - Tag der Befreiung. Er wusste nicht, warum ihm das plötzlich in den Kopf kam. Egal. Mittlerweile kein besonderer Tag mehr, ein beliebiger Sonntag wie jeder andere auch. Er überlegte, ob er zum Hertha Spiel fahren sollte. Sie spielten in Aue. Wenn sie dort gewinnen, war ihnen der Aufstieg in die 1. Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Aber wahrscheinlich würde er sich dazu nicht aufraffen können und wieder vor dem Fernseher versacken. Auf jeden Fall lagerten genug Flaschen Guinness in seinem ansonsten leeren Kühlschrank. Frisch gezapft schmeckte es natürlich besser. Und wenn er mal die Stimmung unten beim Türken checkte? Flora Bistro. Dort lief der Fernseher Tag und Nacht. Im Vorbeigehen hatte er schon öfter gehört, dass ein Fußballspiel übertragen wurde. Guinness gab’s da ganz sicher nicht. Er wusste nicht mal, ob die überhaupt Bier vom Fass hatten. Aber menschliche Gesellschaft strafft die Körperhaltung. Mal sehen.
Frank Grabowski ging in die Küche und schaltete die Kaffeemaschine ein. Zurück im Zimmer, drückte er die Zigarette aus und schloss das Fenster. Irgendwo trällerte ein Vogel lautstark. Er ging hinüber in das Schlafzimmer mit dem breiten Bett. Ein kleiner Schreibtisch mit Stuhl stand vor dem Fenster. Auf dem Boden lagen Zeitschriften verstreut. Der Monitor auf dem Tisch war an. Er hatte vergessen, ihn gestern Nacht auszuschalten. Er schaltete den PC ein und setzte sich. Als der Webbrowser sich öffnete, gab er die Internetseite der Bahn ein, um die Bahnverbindung nach Aue heraus zu suchen. In die Suchmaske tippte er den Zielort ein. Nach ein paar Sekunden zeigte ihm die Seite die Streckenverbindung an. Fahrdauer etwas über vier Stunden. Wenn er pünktlich zum Spielbeginn da sein wollte, müsste er um 8:27 Uhr mit dem Zug vom Hauptbahnhof fahren. Er sah auf die Uhr, noch knapp eine Stunde. Zeit genug den Zug zu schaffen, er müsste sich nur jetzt beeilen. Zum Hauptbahnhof brauchte er über eine halbe Stunde. Schulterzuckend stellte er fest, er hatte dazu überhaupt keine Lust. Auch so eine neue blöde Angewohnheit von ihm, dieses Achselzucken. Ein Zeichen der Unentschlossenheit, die sich bei ihm eingeschlichen hatte. Trotzdem, er hatte keine Lust auf Eile. Wenigstens hatte er es versucht, redete er sich ein und lächelte schwach. Aus der Küche kamen blubbernd zischende Geräusche. Ein sicheres Zeichen, dass der Kaffee gleich fertig war. Er zog die Schreibtischschublade auf und entnahm das Foto, wie so häufig in den letzten Tagen. Er betrachtete es lange. Zärtlich strich er mit den Fingern darüber.
Der Hund zog heftig an der Leine und wackelte aufgeregt mit seinem Hinterteil. Der Mann, der die Leine hielt, zündete sich eine Zigarette an. Verärgert nahm er einen heftigen Zug. Wieder hatte Marianne es geschafft, ihn dazu zu bringen mit dem Hund Gassi zugehen. Es reichte zu sagen: wenn du die Füße unter meinen Tisch.... Er verstand die Drohung. Der Hund war ein hässlicher Köter und ihr ein und alles. Es war ihm peinlich, mit diesem Vieh gesehen zu werden. Er konnte ihn nicht leiden, was wohl auf Gegenseitigkeit beruhte. Dieses dürre Gestell auf den dünnen Beinen, Glubschaugen und immerzu das Gekläffe. Am Rondell ließ er ihn von der Leine und schon tobte dieser blöde Köter laut kläffend los. Er setzte sich auf die Bank, neben der Rutsche. Es kam für ihn der schönste Teil des Tages. Der Hund war weg und er reckte das Gesicht mit geschlossenen Augen, dem wärmenden Sonnenlicht entgegen. Die Sonne kroch langsam zwischen den Hochhäusern empor. Alles wirkte still und friedlich. Er konnte seinen Gedanken nachhängen, seinen Träumen, seinem was-wäre-wenn. Er wusste natürlich, dass es ein was-wäre-wenn nie geben würde. Um das zu erkennen brauchte er noch nicht einmal einen seiner klareren Momente. Das unbestimmte Gefühl, vom Leben weniger zu bekommen als ihm eigentlich zu stand, begleitete ihn schon lange. Solange wie er zurückdenken konnte. Seine Entscheidung zu Marianne zu ziehen, war das Eingeständnis seiner Niederlage. Das Wissen, dass er an seiner Endstation angekommen war. Er hatte sich in eine Abhängigkeit begeben, aus der er sich nicht mehr befreien konnte. Sie hatte das Geld, die Wohnung und kochte für ihn das Essen. Er hatte nichts. Außer seine Tabletten, die ihn davor bewahrten in einer Anstalt als Fürst Romanow dahin zu vegetieren. Per Attest verschrieben von einer Ärztin, die hübsch und zu dem auch noch verständnisvoll war. Er hatte das Gefühl, sie nahm Anteil an seinem Leben. Der Gegensatz zu Marianne, der Frau, bei der er den Rest seines Lebens zu verbringen hatte. Leider sah er die Ärztin immer nur dann, wenn die Tabletten alle waren oder er vergessen hatte sie zu nehmen oder einfach nicht nehmen wollte. Wenn er sich entschloss aus dem Nebel zu treten.
Er sah auf die Uhr. Es war eine viertel Stunde her, als er den Hund von der Leine gelassen hatte und er war bisher nicht wieder aufgetaucht. Sicher er könnte ihn rufen. Aber er hörte sowieso nicht auf ihn. Und außerdem war ihm der Name peinlich: Adonis. Es war ihm unverständlich, wie man so ein hässliches Tier Adonis nennen konnte. Er stand von der Bank auf und lief in die Richtung, wohin der Hund verschwunden war. Er ging ein paar Meter, konnte ihn aber nicht entdecken. Dann hörte er das aufgeregte Gekläffe. Es kam aus der Böschung weiter vorn, da wo die jungen Birken standen. Er näherte sich dem Gebelle, konnte aber nichts erkennen. Er überlegte, ob er versuchen sollte ihn zu rufen. Er ließ es bleiben. Scheißköter brabbelte er vor sich und kämpfte sich dabei durch das Gebüsch. Als das Gebüsch sich teilte, sah er dort die Gestalt liegen. Er ging vorsichtig näher, griff sich den Hund und leinte ihn an. Dann erkannte er sie und wusste im selben Augenblick: Es war vorbei.
3.
Hauptkommissar Salvatore Hieronymus Koslowski öffnete das Fenster in seinem Wohnzimmer seiner Hinterhauswohnung, nur um es gleich wieder zuschließen. Die stickige Hitze stand schon jetzt unerbittlich im Hof. Er stöhnte auf. Was soll das bloß im August werden, grummelte er. Seine beiden alten Katzen strichen ihm mauzend um die Beine. Sie wollten was zu fressen haben. Er ging in die Küche und kramte aus dem unteren Küchenschrank eine Dose Katzenfutter hervor. Die Graue beäugte sein Hantieren misstrauisch aus nächster Nähe, wie um zu sagen: nimm die Richtige. Anders der rote Kater, der postierte sich gleich in froher Erwartung schnurrend vor dem Futternapf. Nachdem er den Katzen das Futter gegeben hatte, ging er ins Bad.
In dem alten fast blinden Spiegel über dem gesprungenen Waschbecken sah er das ganze Elend. Unter dem wirren, inzwischen angegrauten kurzen Haar, das sich schon lichtete, ein Gesicht mit einem schmalen Mund und mit zunehmenden Alter kleiner werdenden, blaugrauen Augen. Seine Lippen hatten im Mundwinkel diesen leicht verbitterten Hang nach unten. Kein Wunder, wenn man sich eine Zweizimmerwohnung allein mit zwei Katzen teilte, dachte er.
Nach der morgendlichen Prozedur, die er widerwillig abarbeitete, zog er sich an und ging wieder in sein Arbeits- und Wohnzimmer. Er schaltete seinen Laptop an, um Mails abzufragen. Es war 10.00 Uhr. Die Katzen lagen auf der Fensterbank und schliefen. Wider besseren Wissens ging er zum Kühlschrank, um zu sehen, ob sich was Essbares darin befand. Er öffnete die Tür. Außer einer Flasche Weißwein und Licht befand sich nichts darin. Den Weißwein hatte er vor drei Jahren geschenkt bekommen. Seitdem lag die Flasche da und sah sich die verschiedenen Füllstände des Kühlschranks an.
Gut, dachte Koslowski, dann eben doch gleich zu „Ecki“ und verzichtete damit auf seinen morgendlichen Kaffee. Er setzte sein Berlin Thunder Basecap auf und zog die inzwischen blassgrüne Parkajacke über, ohne die er nie die Wohnung verließ. Seine erste Anschaffung vom Begrüßungsgeld nach der Wende. Gekauft in einem Army-Shop in der Wilmersdorfer Straße. Er fand es bequemer, Schlüsselbund und Brieftasche in der Jacke zu haben, als alles in der Hose. Er schloss die Wohnungstür hinter sich. Auf der Straße empfing ihn die Hitze. Es sollte Anfang Mai noch nicht so heiß sein, dachte er. Die Sredzkistraße lag noch ruhig da. Musik klang leise aus einem offenen Fenster. Irgendwo schepperte Geschirr. Für Koslowski die üblichen Sonntagmorgengeräusche die er seit seiner Kindheit kannte und liebte. Nicht mehr lange und die ersten Gerüche von warmen Mittagessen würden durch die offenen Fenster ziehen. Er ging an dem afrikanischen Restaurant vorbei. Vor einem Jahr war es noch ein amerikanisches Diner mit einer Tex-Mex Speisekarte. Noch früher, zu DDR Zeiten, eine Werkstatt für Fotoapparate. Der Schuster, ein paar Schritte weiter, hatte vergessen das Schild ›bin gleich wieder zurück‹ von seiner staubigen Eingangstür abzuhängen. Die Schusterwerkstatt war auch ein Relikt aus längst vergangenen Tagen und seit ein paar Jahren geschlossen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis hier eine Szenekneipe einziehen würde. Koslowski bog er in die Husemannstraße ein. Die Platanen dort boten schattige Oasen, wo der Wind ein wenig kühlte. Das Licht durchdrang das Grün der Bäume und sprenkelte helle Flecken auf die Straße. Er lief an dem asiatischen Restaurant Ostwind vorbei, rüber auf die andere Straßenseite. Eckis Pub lag in der Husemannstraße, ungefähr hundert Meter vor dem Kollwitzplatz. Die einzige Kneipe im Kollwitzkiez, die man noch als solche bezeichnen konnte. Bis zur 750 Jahrfeier Ost-Berlins ein Gemüseladen, wurde es dann als Café neu eröffnet. Die ganze Straße wurde damals zu diesem Anlass restauriert. Der alte Gemüseladen passte da nicht mehr ins Bild. Nach der Wende änderte das Café den Namen und das Angebot. Es wurde ein Irish Pub. Der Wirt blieb. Hier konnte Koslowski in Ruhe sein Bier trinken, ohne von Hipstern zugetextet zu werden. Man durfte sogar mürrisch sein und schweigen. Und zugegeben, das tat Koslowski am liebsten.
Ecki hatte schon seine Lederschürze um und war gerade dabei die Stühle und Tische herauszustellen. Es war noch etwas Zeit, bis er öffnete. Er sah nicht aus wie ein typischer Kneipier, war schlank und von mittlerer Größe. Das unauffällige Gesicht rahmte ein sorgsam gestutzter Vollbart ein, der langsam ergraute. Auf der schmalen Nase saß eine Kassengestellbrille. Für Koslowski das Abbild eines ehemaligen Offiziers, der sich nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Armeedienst den Traum von einer Kneipe verwirklicht hatte. Vielleicht war es ja auch so. Koslowski hatte ihn nie gefragt. Ecki bemerkte Koslowski, trat auf ihn zu und begrüßte ihn mit Handschlag. Sein angedeutetes Grinsen sollte wohl Freude zeigen.
»Geh schon rein, Sal. Dein Bier kommt gleich oder willst du draußen sitzen?«
Koslowski runzelte nur die Stirn.
»Ist ja gut, war nur ’ne Frage.«
Als Koslowski schon halb in der Eingangstür verschwunden war, rief Ecki fragend hinterher: »Harp oder Murphys?«
Koslowski hielt zwei Finger hoch und ging hinein. Er warf die Parkajacke über einen der Stühle an seinen Lieblingstisch im hinteren Raum am Fenster und setzte sich. Hier war es angenehm kühl. Die Einrichtung war rustikal, viel Holz. Die Längsseite gegenüber dem Tresen bestand nur aus drei riesigen Spiegeln, sodass die Kneipe größer wirkte. Nach wenigen Minuten stellte Ecki ihm das Murphys hin.
»Und willst Du noch was?« Ecki schaute Koslowski fragend an.
»Ja, mach mir zwei Buletten mit Spiegelei und Bratkartoffeln«, muffelte Koslowski. »Bitte«, setzte er eine winzige Tonlage freundlicher nach. Er hatte keine Ahnung, was er mit dem Sonntag anfangen sollte, das machte ihm sichtbar zu schaffen. Ecki verdrehte lachend die Augen, um sich dann in die Küche zu verziehen. Er kannte Koslowskis unleidliche Art.
Koslowski schaute in die Spiegel an der Wand, prostete sich zu. Er nahm einen kräftigen Schluck und schloss dabei genießerisch die Augen. Nach ein paar Minuten, kam die bestellte Mahlzeit. Als Koslowski die Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck roch, merkte er erst, was für einen Riesenappetit er hatte. Mit Heißhunger machte er sich über das Essen her. Ecki verzog sich wieder hinter den Tresen, um Gläser zu spülen.
Koslowski hatte gerade die ersten Bissen zu sich genommen, da sprang die Kneipentür scheppernd auf und eine bekannte Stimme rief fragend zum Wirt: »Tach Ecki. Ist Sal hier?«
Ecki schaute fragend zu Koslowski rüber. Der nickte etwas widerstrebend.
»Sal sitzt hinten«, antwortete Ecki und zeigte mit dem Kopf in Koslowskis Richtung, um sich dann gleich wieder dem Gläserputzen zu widmen.
Tom Meyerbrinck schloss die Tür und betrat den hinteren Raum. In dem Moment als Koslowski Meyerbrincks Stimme gehört hatte, wusste er, dass sich die Frage nach der Sonntagsbeschäftigung erledigt hatte.
Meyerbrinck war ein paar Jahre jünger als Koslowski. Ende dreißig und gut fünfzehn Kilo schwerer, was mit seiner Körpergröße und auch den Kochkünsten seiner Frau zu tun hatte. Trotz der Größe und seines Gewichts war er, wenn es drauf ankam, der sportlichere von ihnen beiden. Ihre Charaktere und Biografien hätten nicht verschiedener sein können. Meyerbrincks rheinische Frohnatur mit der Geduld eines Dickhäuters und Koslowskis Ostberliner Kodderschnauze mit dem Hang zur morgendlichen schlechten Laune hatten sich gesucht und gefunden. Seit sieben Jahren arbeiteten sie zusammen und waren inzwischen so etwas wie Freunde geworden, wobei sich Koslowski das nie eingestehen würde. Die Gegensätze zwischen Ost und West, die seit der Wende in dieser Stadt aufeinanderprallten und von den deutschen Medien seit über zwanzig Jahren genüsslich am Leben gehalten wurden, spielten bei ihnen keine Rolle. Sie waren neugierig genug, um sich aufeinander einzulassen.
»Du hast dein verdammtes Handy ausgeschaltet.«
»Keine Ahnung«, brummte Koslowski undeutlich mit vollem Mund. »Ich habe es erst gar nicht mitgenommen. Aber du hast mich ja auch so gefunden.«
Meyerbrinck warf Koslowski einen vorwurfsvollen Blick zu.
Der ignorierte es und sagte: »Setzt dich. Du machst mich nervös, wenn du hier so rumstehst. Bestell dir einen Kaffee. Du weißt ganz genau, dass ich nicht gleich aufspringe. Ich will in Ruhe zu Ende frühstücken!«
»Frühstück? Pah«, machte Meyerbrinck und zeigte auf das Bier.
Koslowski betrachtete es als Aufforderung und genehmigte sich einen großen Schluck. Widerstrebend setzte sich Meyerbrinck an Koslowskis Tisch. Der machte Ecki ein Zeichen, schon war der Espresso in Arbeit. Meyerbrinck fuhr sich durch seine roten Haare und räusperte sich, nur um dann wieder zu schweigen.
»Sag schon, was mir den Sonntag versaut«, forderte Koslowski mit einer halben Bulette im Mund.
»Im Thälmann Park haben sie eine Kinderleiche gefunden. Ein Mädchen, ca sieben bis acht Jahre alt. Wir sollen den Fall übernehmen.«
Koslowski schwieg, kaute weiter an seiner Bulette. Ecki störte das Schweigen kurz mit leichtem Scheppern beim Abstellen der Espressotasse.
»Wieso wir?«, unterbrach Koslowski nach einer Weile das Schweigen. »Wir haben doch erst in zwei Wochen Bereitschaftsdienst?«
Er sah Meyerbrinck fragend an, leerte das Bierglas in einem Zug, rülpste und stand auf. Meyerbrinck nippte zweimal kurz an seinem Espresso, mehr gab das Tässchen nicht her.
»Krankheit und verschiedene Weiterbildungsseminare. Die haben die Einsatzstärke dezimiert, weswegen wir das übernehmen sollen.« Dann grinste er Koslowski an: »Du hast doch an Wochenenden sowieso nie was vor.«
Koslowski runzelte die Stirn und sagte nur: »Lass uns gehen.«
Er setzte sein Basecap auf, griff die Jacke und nickte kurz zu Ecki. Der stand immer noch hinter dem Tresen und polierte die Gläser. Wie immer würde Koslowski die Zeche später bezahlen. Koslowski betrat die Straße. Meyerbrinck stellte die leere Espressotasse ab und folgte ihm.
»Und stimmt, ich hab an Wochenenden selten was vor«, wandte sich Koslowski an Tom, während er sich seine Jacke überzog. »Doch wie sieht es mit dir aus? Deiner Familie? Kann mir vorstellen, dass Charlotte nicht gerade glücklich darüber ist, dass du so leichtfertig deine kollegiale Hilfe anbietest.«
Koslowski brauchte Meyerbrinck nur kurz anzusehen, um zu wissen, dass er Recht hatte. Meyerbrincks hatte seinen fünf Jahre alten Volvo auf der Straße in der zweiten Reihe geparkt. Sonntagvormittag war das noch kein Problem. Meyerbrinck zog sein Jackett aus, warf es auf die Rückbank. Sie stiegen ein. Meyerbrinck meldete über Funk an die Zentrale, dass sie auf dem Weg sind. Langsam fuhren sie los. Er bog links in die Wörtherstraße ein, vorbei an dem Kollwitzplatz, der schon wieder voller Menschen war. Erwachsene lagen auf ausgebreiteten Decken auf der Wiese. Ihre Kinder tollten laut kreischend umher. Wie ein Ostseebad im Sommer, dachte Koslowski genervt. Für viele alleinerziehende Mütter und Väter schien der Platz eine beliebte Informations- und Kontaktbörse zu sein. Ein Glück, dass er ein Stück weiter weg wohnte. Kinderlärm am frühen Morgen, das wäre für ihn die Hölle und würde ganz sicher nicht seine notorisch schlechte Morgenlaune verbessern. Sie kreuzten die Kollwitzstraße und dann die Rykestraße. An der Prenzlauer Allee mussten sie bei Rot halten. Sie schwiegen, jeder in sich versunken.
Meyerbrinck dachte an seine Frau, wie sie seinen Job verfluchte. Bei dem Gedanken daran musste er lächeln. Und Koslowski dachte an das tote Mädchen.
Es wurde grün, der Volvo überquerte die Kreuzung. Das Kopfsteinpflaster der Marienburger Straße erlaubte nur ein mäßiges Tempo. Sie fuhren an einem in der zweiten Reihe stehenden, leeren Streifenwagen vorbei. An der Kreuzung vor der Kaiser’s Kaufhalle standen ein paar Punks mit bunten Haaren und bettelten die wenigen Passanten wegen ein paar Euro an. Ihre Hunde genossen derweil die Freiheit, in die ausgestellten Blumentöpfe zu pinkeln. Stiefmütterchen für 2,50. Ein Werber der Berliner Morgenpost wollte die Sonntagsausgabe an den Mann bringen, schien aber zu merken, dass das ein vergebliches Unterfangen war. Er wirkte leicht verzweifelt. Den Punks tat er leid. Sie boten ihm eine Dose Bier an. Koslowski musste schmunzeln. Der Volvo bog gerade links in die Winsstraße ein, da krächzte das Funkgerät los. »Hier Zentrale.«
»Koslowski! Was gibt’s«, meldete er sich ungeduldig durch das Sprechgerät, die weibliche Stimme am anderen Ende unterbrechend.
»Fahrt doch bitte auf eurem Weg an der Marienburger Straße 9 vorbei. Todesfall. 3. Etage. Wahrscheinlich Suizid.«
Meyerbrinck hielt den Volvo an.
»Toll, da sind wir gerade dran vorbei gefahren. Könnt ihr nicht jemand anderen dahin schicken?«
Koslowski verzog dabei genervt das Gesicht.
»Erstens: Ich habe Bitte gesagt«, entgegnete die Stimme energisch. Auf eine Art, wie es nur Frauen können. »Und zweitens: Wozu? Es ist Sonntag. Ihr seid in der Nähe und die Leiche im Thälmann Park läuft euch nicht weg. Ihr müsst dort ohnehin auf die Spurensicherung warten. Also seid nicht albern«.
Koslowski spürte förmlich, wie die Person am anderen Ende der Leitung ob seiner Renitenz die Augen verdrehte.
»Gut.« Er gab resigniert auf. »Ich lass mich da absetzen. Ende!«
Koslowski klinkte das Sprechgerät in die Halterung und sagte »Hast ja alles gehört. Lass mich hier raus.«
Meyerbrinck öffnete das Handschuhfach, reichte Koslowski ein paar Wegwerfhandschuhe und Asservatenbeutel. Ohne eine Erwiderung abzuwarten stieg Koslowski aus und knallte die Tür zu.
»Hey das ist kein Panzer«, rief Meyerbrinck und trat aufs Gaspedal.
4.
Koslowski lief zurück zur Marienburger Straße 9. Ein typischer Ost-Berliner Altbau. Noch unsaniert mit bröckelnder rissiger Fassade, aus der Eisenträger herausragten. Rostige Erinnerungen an früher mal vorhandene Balkone. Das Haus benötigt dringend eine Sanierung, dachte Koslowski und öffnete die schwere hölzerne Haustür. Es empfing ihn ein Geruch aus einer Mischung von Urin und feuchtem Moder. Unterhalb des Lichtschalters las er eine alte, mit einer Schablone aufgetragene ehemals rote Inschrift: Hier ist keine Latrine! Dem Geruch nach zu urteilen konnten einige Mitmenschen mit dem alten deutschen Wort nichts anfangen. Die Treppe knarrte, als er das dunkle Treppenhaus hinaufstieg. In der dritten Etage stand vor der linken Wohnungstür eine Streifenpolizistin. Sie war eine unscheinbare Person mit aschblonden Haaren, die sie zu einem Zopf nach hinten gebunden hatte. Die grüne Uniform wirkte an ihr zu groß und machte sie nicht attraktiver. Aber auch der Sexappeal einer Veronica Lake würde in dieser Uniform verkümmern, dachte Koslowski. Es soll ja bald neue geben. Wie nannte Meyerbrinck die Entwürfe für die neuen Uniformen: The American Style. Die blonde Polizistin und er kannten sich vom Sehen, das Ersparte Koslowski seinen Dienstausweis zu zeigen. Ein kurzes Hallo reichte. Er betrat die Wohnung. Im Wohnungsflur stand der Partner der Polizistin, ein weißhaariger sehniger Mann von Mitte fünfzig mit einem anderen Mann im blauen Overall, der stark schwitzte. Seine dunkelbraunen Haare klebten am Kopf. Der schwitzende Mann schien vom Schlüsseldienst oder der Hausmeister zu sein. Den Polizisten kannte Koslowski schon seit Jahren. Ein ruhiger, zuverlässiger Zeitgenosse. Nur seinen Namen vergaß Koslowski immer wieder.
»Tag«, begrüßte er ihn knapp.
»Guten Tag«, erwiderte der Weißhaarige freundlich.
»Sie sind vom Schüsseldienst?«, wandte sich Koslowski an den Schwitzenden.
»Ja«, antwortete der beflissentlich und wischte sich nervös mit einem karierten Taschentuch über das gerötete Gesicht.
Koslowski hatte das Gefühl, dass die Haare, die dem kleinen Mann an der flachen Stirn klebten, sich dabei keinen Millimeter bewegten.
»Was ist passiert?«, fragte Koslowski den Polizisten.
»Die Mutter des Toten, Elisabet Meyer hat die Notrufzentrale angerufen, weil er sich nicht wie versprochen bei ihr gemeldet hatte. Sie machte sich Sorgen. Er war wohl noch nicht lange wieder in Berlin. Die Mutter meinte, er wäre depressiv. Außerdem war er wohl geistig etwas zurückgeblieben. Nach dem Anruf sind wir hierher gefahren. Ich habe an der Tür geklingelt, geklopft. Keine Reaktion. Meine Kollegin hatte inzwischen den Schlüsseldienst angerufen, um die Tür öffnen zu lassen. Ich bin in die Wohnung gegangen. Meine Kollegin wartete mit dem Mann vom Schlüsseldienst hier vor der Tür. Im hinteren Zimmer habe ich ihn gefunden. Erhängt. Nachdem ich mich vom Tod der Person überzeugt hatte, informierte ich die Zentrale. Alles weitere wissen sie ja. Es ist nichts berührt worden außer der Türklinke und dem Lichtschalter im Flur«, beantwortete er ruhig und sachlichen die Frage.
»Spurensicherung? Leichenwagen?«
»Sind unterwegs.«
»Haben Sie sich im Zimmer umgesehen?«, fragte Koslowski .
»Nein«, kam prompt die Antwort.
Was anderes hatte Koslowski auch nicht erwartet. Der Kollege war schon zu lange dabei und würde nicht in einen möglichen Tatort platzen und Spuren zerstören.
»Gut, ich werde mich jetzt im Zimmer umschauen während sie hier vor der Tür Posten beziehen. Und Sie«, damit wandte sich Koslowski an den Handwerker »gehen mit der Kollegin nach unten und warten da. Vielleicht habe ich noch ein, zwei Fragen.«
Sofort drehte sich der schwitzende Mann um und stieg die Treppe hinunter. Er schien erleichtert zu sein. Die blonde Polizistin folgte ihm weniger begeistert. Koslowski ging durch den kleinen Flur und zog sich dabei die Wegwerfhandschuhe über, dann öffnete er die Zimmertür mit einem leichten Schubs und blieb im Türrahmen stehen. Es roch ungelüftet nach kaltem Zigarettenrauch. Das Zimmer war mit Raufasertapete tapeziert. Die Wände weiß gestrichen. Der Stuck an der Decke war dunkelbraun abgesetzt, wie es in den 60er, 70er Jahren Mode gewesen war. Ebenso die Rosette in der Mitte der Decke. Der Haken, an dem vielleicht früher mal ein Kronleuchter befestigt war, hatte nun für ein Seil hergehalten. An dem Seil hing ein Mann, der zweifellos tot war. Das Alter schätzte Koslowski auf Mitte, Ende dreißig.
»Das ist also der Wohnungsmieter!«, stellte Koslowski mehr für sich fest.
»Scheint so«, erwiderte der Polizist. Er war unbemerkt hinter Koslowski getreten.
»Wir werden es gleich wissen.«
Koslowski betrat das Zimmer und war mit drei Schritten bei dem Toten. In der ausgebeulten Gesäßtasche der braunen Jeans befand sich die Brieftasche. Komisch, selbst beim Sterben konnte sich der Tote nicht von ihr trennen. In der Brieftasche befanden sich fünfzehn Euro und etwas Kleingeld. Der Ausweis war auf den Namen Thomas Meyer ausgestellt. Das Passbild stimmte überein. Er sah auf das Geburtsdatum und rechnete kurz nach. 32 Jahre.
»Überprüfen sie die Personalien«, wies Koslowski den Polizisten an, der immer noch an der Zimmertür stand, und reichte ihm den Personalausweis.
»Ist gut.« Der Polizist nahm den Ausweis und drehte sich um.