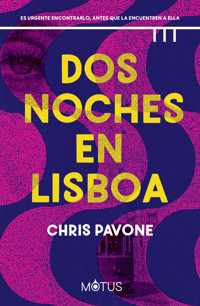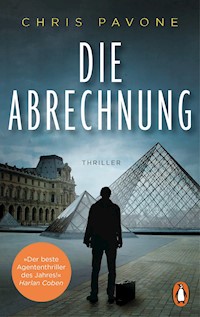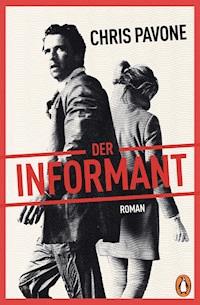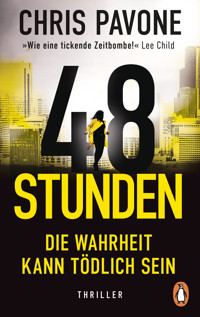
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie weit würdest du gehen, wenn alles auf dem Spiel steht?
Als Ariel Pryce in ihrem Hotelzimmer in Lissabon erwacht, ist ihr Mann John wie vom Erdboden verschwunden. Keine Nachricht, das Handy ausgeschaltet. Ariel spürt, dass etwas nicht stimmt. Doch weder die Polizei noch die US-Botschaft glauben ihr. Stattdessen wird sie mit Fragen konfrontiert, auf die sie keine Antwort hat: Was genau sind die Geschäfte, wegen derer John überhaupt nach Lissabon gekommen ist? Wer könnte von seinem Verschwinden profitieren? Und warum weiß Ariel so wenig über ihren eigenen Ehemann?
Dann bekommt sie einen Anruf mit einer Lösegeldforderung für John. Drei Millionen Dollar binnen 48 Stunden. Ariel läuft die Zeit davon. Und der einzige, der ihr in dieser Situation helfen könnte, ist der, mit dem sie nie wieder etwas zu tun haben wollte …
»Hochspannung, clever und absolut gerissen!« John Grisham
»Wie eine tickende Zeitbombe!« Lee Child
»Man kann es kaum aus der Hand legen!« Stephen King
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
»Lesen Sie die nur die ersten zwanzig Seiten. Versuchen Sie dann, das Buch wegzulegen. Unmöglich!« John Grisham
»Man kann es kaum aus der Hand legen!« Stephen King
»Chris Pavone ist eine Kategorie für sich!« New York Times
»In diesem pulsierenden Thriller über Loyalitäten und Lügen ist nichts so, wie es scheint.« Washington Post
»Eine rasante und außergewöhnliche Story über Macht und die, die nach ihr streben. Und den Preis, den sie andere Menschen dafür zahlen lassen.« Los Angeles Times
Chris Pavone stammt aus New York und hat mehr als 20 Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet, bevor er sich entschloss, die Seiten zu wechseln und Autor zu werden. Seine rasanten und clever konstruierten Thriller wurden bisher in 24 Sprachen übersetzt. Mit 48 Stunden. Die Wahrheit kann tödlich sein gelang ihm sein bisher größter Erfolg. Der Roman wurde von der US-Presse gefeiert, von Autorenkollegen hochgelobt und schaffte es auf Anhieb in die Top Ten der New-York-Times-Bestsellerliste.
Chris Pavone lebt mit seiner Familie und ihrem Labradoodle in New York City.
Außerdem von Chris Pavone lieferbar:
Der Informant
Die Abrechnung
www.penguin-verlag.de
Chris Pavone
48 Stunden.
Die Wahrheit kann tödlich sein
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Cathrin Claußen
Die Originalausgabe erschien 2022
unter dem Titel TWONIGHTSINLISBON
bei FSG, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 der Originalausgabe by Chris Pavone
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Ralf Reiter
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Trevillion Images, Stephen Mulcahey und www.buerosued.de
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31177-3V001
www.penguin-verlag.de
Gerechtigkeit ist Wahrheit in Aktion.
Benjamin Disraeli
1. Teil DAS VERSCHWINDEN
Kapitel 1
Lissabon, Portugal Tag 1, 7:28
Ariel wacht auf, allein.
Sonnenlicht strömt durch den Spalt zwischen den Fensterläden und wirft einen grellen Lichtstreifen an die Wand, dessen Anblick fast wehtut.
Ihr ist heiß. Sie schleudert das Laken von sich, auf die andere Seite des Bettes, wo ihr neuer Mann liegen sollte. Tut er aber nicht. Ihr Blick hüpft im Zimmer umher wie auf Steinen über einen Bach, auf der Suche nach Spuren von John, doch sie findet keine und fällt in das eiskalte, strudelnde Wasser einer vertrauten Panik: Was, wenn sie sich in ihm getäuscht hat? In dieser ganzen Sache?
Die Nachttischuhr zeigt 7 Uhr 28 in Warnrot an. Viel später, als sie normalerweise aufwacht, vor allem zu dieser Jahreszeit, den arbeitsreichsten Monaten auf der Farm, wenn die Vögel um vier Uhr morgens anfangen zu zwitschern, die Feldarbeit im Morgengrauen beginnt, Hunde bellen, Männer über stotternde Motoren hinwegbrüllen. Es ist schwer, bei all dem Lärm zu schlafen, selbst wenn sie wollte.
Seit Georges Geburt ist Ariel eine Frühaufsteherin. Als er noch ein Säugling war, war das auch nötig, aber als der Kleine irgendwann anfing, länger zu schlafen, tat sie das nicht mehr. Das frühe Aufstehen wurde zu einer Frage des Prinzips, ein Zeichen von Charakter. So wollte sie wahrgenommen werden, wenn auch nur von sich selbst: früh aufstehen, früh zu Bett gehen, dazwischen fleißig sein, eine ernsthafte, verantwortungsbewusste Person, nach einer vergeudeten Jugend. Schlimmer als vergeudet.
Obwohl sich Ariels Puls beschleunigt, fühlt sie sich immer noch groggy, ihr Verstand ist trübe. Die letzte Nacht muss sie wirklich umgehauen haben, die Dehydrierung und die allgemeine Erschöpfung von der langen Flugreise, der Jetlag, das Essen, der Wein und der Sex, die Schlaftablette, die John ihr schließlich noch aufgedrängt hat.
Er war aufgestanden – beide waren sie schweißgebadet und erschöpft –, hatte sich zu Ariel umgedreht und sie angestarrt, bewundernd, wie sie dalag, nackt, ausgestreckt, auf der Haut eine feine Röte, die wie eine schnell fortschreitende Infektion auf ihrer gewölbten Brust, über ihren Hals bis zu ihren Wangen erblühte. Er beugte sich zu ihr hinunter, hielt aber inne, kurz bevor sein Mund den ihren traf, sah ihr in die Augen, bis sie es vor Verlangen nicht mehr aushalten konnte und ihren Hals reckte für einen Kuss, der lang und tief war und fast zu viel, sodass er eine neue Welle Schauer auslöste, zusätzlich zu denen, die noch nicht ganz abgeklungen waren. Ihre Haut fühlte sich so lebendig an, ganz prickelnde Nervenenden, die pure Erregung.
Langsam bewegte er sich durch den dunklen Raum, darauf bedacht, nicht zu stolpern oder sich den Zeh zu stoßen. Er stellte sich nackt ans Fenster und fummelte an den alten Fensterläden herum, bis er den Haken fand und ein befriedigendes Klicken erklang, als sie aufgingen. Mit jeder Hand griff er einen Laden und schob die großen Paneele sanft auseinander, bis sie ganz gespreizt und weit geöffnet waren. Eine vertraute Geste, die zarteste Berührung der Fingerspitzen, als ob er um Erlaubnis bitten würde.
Genau das hatte Ariel immer am meisten gewollt. Und am wenigsten bekommen. Bis jetzt.
Ariel hört etwas draußen, außerhalb des Schlafzimmers im morgendlichen Chaos.
»John?«
Keine Antwort.
Sie geht zögernd in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen ist; kurz vor der Tür der Suite bleibt sie stehen, weil ihr klar wird, dass sie nur ein T-Shirt trägt. Sie schaut an sich herunter, um zu sehen, wie viel es bedeckt. Nicht genug. Da, noch mal! Es kommt eindeutig von draußen, von direkt hinter der Tür.
»John?«
»Desculpe.« Es ist die Stimme einer Frau, gedämpft durch die Tür. »Serviço de limpeza.«
Ariel späht durch das Guckloch: eine Reinigungskraft, die ihren Wagen ordnet.
»Desculpe«, wiederholt sie.
Ariel wendet sich von der Tür ab und sieht sich im Wohnzimmer um, dessen Wände in einem hellen Grauton gestrichen sind, so glänzend, als wäre sie in einer Austernschale. Ihr Blick fällt auf die Schlummertrunkgläser vom letzten Abend, die auf dem Boden verstreuten Sofakissen und herumliegenden Schuhe. Auf der Couch haben sie angefangen, noch bekleidet, aber mit offenem Reißverschluss und Knöpfen, den Stoff zur Seite geschoben, sich gestreichelt und befummelt, geleckt und gesaugt, sich die Knie gestoßen und am Teppich aufgeschürft, bis John sagte: »Lass uns ins Bett gehen«, seine Stimme zitternd vor Erregung. Ariel konnte nicht einmal sprechen.
Sie prüft ihr Handy: nichts. Keine Nachricht, kein Alarm, nur ihr Homebildschirm mit dem Foto eines kleinen Jungen, der zwei große Hunde umarmt, ein Bild, das vier Jahre alt ist, aber so perfekt, dass sie es nicht fertigbringt, es durch ein neueres, aber nicht so ideales zu ersetzen.
An der Ostküste ist es erst ein Uhr dreißig morgens, und dort leben fast alle, die sie kennt. Ariel hat noch nicht einmal eine neue Spam-Mail erhalten. Sie startet die App, die die Geräte ihrer Familie ortet – das Handy ihres Sohnes, das ihres Mannes, ihr eigenes. Es dauert lange, bis die Daten geladen und die verschiedenen Geopositionen lokalisiert sind. Die erste Blase, die erscheint, ist ihre eigene, AP, genau hier im Zentrum von Lissabon. Dann die ihres Sohnes, GP, genau da, wo er hingehört, mitten in der Nacht, sechstausend Kilometer entfernt, schlafend, ohne Zweifel mit mindestens einem der Hunde – mit Scotch – in seinem Bett, wahrscheinlich auch mit Mallomar. Die Hunde sind George gegenüber sehr loyal, und umgekehrt. Es kann ganz schön eng werden in dem schmalen Bett mit einem Haufen müffelnder Säugetiere, alle eng aneinandergepresst und träumend.
Die App hat John immer noch nicht gefunden, sein JW-Symbol zeigt »Standortsuche …« an, aber dann kapituliert sie, gibt das Scheitern zu, »Kein Standort gefunden« in einem passiven Ton, als ob Ariel dem Handy die Schuld geben sollte oder der Person oder den Launen des Äthers, bloß nicht der App selbst. Nicht einmal Apps wollen die Schuld auf sich nehmen.
Ariel ist seit drei Minuten wach.
Als sie vor fast fünfzehn Jahren ihren ersten Mann verließ, hat sie auch alles andere hinter sich gelassen. Sie hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt und von vorn angefangen, sich Stück für Stück ihre neue Existenz aufgebaut – ein neues altes Haus an einem ruhigen Ort, ein neues Baby, ein neuer verrückter Hund und dann ein noch verrückterer zweiter, eine neue Frisur und Garderobe, ein neuer Beruf in einem neuen Fachgebiet, neue Freunde und Hobbys, eine neue Haltung, eine neue Art im Umgang mit der Welt und damit, die Welt an sich heranzulassen. Sie wollte nicht mehr länger in erster Linie und ständig und ausschließlich als attraktive Frau durchs Leben gehen.
Erst vor Kurzem ist ihr klar geworden, dass sie bereit war, das letzte neue Puzzleteil hinzuzufügen, um ihr neues Leben, das so neu nicht mehr war und vielleicht auch nicht erfüllt genug, komplett zu machen. Ob sie John wohl durch ihr Verlangen heraufbeschworen hat, oder war es umgekehrt?
Er war letzte Nacht lange am Fenster stehen geblieben, beleuchtet von den Straßenlaternen, die einen verzerrten Schatten von ihm an die Decke warfen, eine gruselige Munch-ähnliche Gestalt in dem unheimlich bläulichen Licht der Stadtnacht. Bei Ariel hatte das einen kurzen Angstkrampf ausgelöst, ein unwillkommenes altes Gefühl, das sie hin und wieder beschleicht, Überraschungsangriffe, überraschend aber nur der Zeitpunkt. Sie weiß, dass sie immer wieder kommen, bloß nicht genau, wann.
Ariel hatte die Augen fest zugemacht, tief eingeatmet und versucht, sich auf die unmittelbaren körperlichen Empfindungen zu konzentrieren – die warme Brise, die vom Tajo heraufwehte, der ferne Schrei einer Möwe, ein Hauch von Seeluft, salzig und vielleicht ein wenig fischig, das Stechen und Pieken ihrer heißen, prickelnden Haut. Sie atmete durch den Mund aus, langsam und ausgiebig und vollkommen kontrolliert. Kontrolle war alles.
Sie öffnete die Augen wieder, beendete das kleine Drama, das nur in ihrem Kopf existiert hatte, eine private Welt der Panik.
Ariel war furchtlos gewesen in ihrer Jugend, was ja auch die Zeit ist, in der Menschen zu Wagemut neigen. Immerhin war sie damals Schauspielerin. Was könnte verwegener sein? Doch dann hat das Leben ihre Kühnheit vernichtet, ihren Mut geschwächt, ihre Zuversicht, dass sie sich sicher durch die Welt bewegen kann, erschüttert. Das konnte sie nicht. Und tat es auch nicht.
John stand immer noch am offenen Fenster, seine nackte Gestalt war ihr plötzlich sehr vertraut – sie hatte das Gefühl, jeden Zentimeter seines Körpers erkundet zu haben, mit den Augen, den Fingerspitzen, der Zunge – und doch so fremd, wie jeder andere Körper es ist, jeder andere Mensch. Sie konnte wissen, wie er aussah, wie er schmeckte; das tat sie. Aber nicht, wie er fühlte, nicht, was er dachte.
Vor Jahren hatte Ariel jeden Glauben an ihre Fähigkeit verloren, andere Menschen klar zu sehen. Sie war sich bei ihrem ersten Mann so sicher gewesen und hatte sich doch so sehr getäuscht, und im Nachhinein war das schockierend offensichtlich. Ariel hatte nur das gesehen, was Bucky sie sehen ließ, was er ihr vorsetzte. Eine unwissende Komplizin seiner Selbsttäuschung war sie, bis es zu spät war. Nicht nur zu spät für diese Beziehung, sondern für all ihre Beziehungen. Sie verlor das Vertrauen in ihr eigenes Urteilsvermögen, in ihre Fähigkeit, das wahre Wesen eines Menschen zu erkennen. Für eine lange Zeit versuchte sie es nicht einmal mehr.
Hat sie etwas gelernt? Ja, natürlich. Aber alle Lektionen verblassen, wenn man nicht weiterlernt. Analysis, Französisch, Kolonialgeschichte, griechische Mythologie – Ariel kann sich an nichts davon erinnern. Sie weiß nicht einmal mehr, was Analysis überhaupt ist. Vor ein paar Jahren hat sie den Begriff in einem Wörterbuch nachgeschlagen, aber das hat ihn kein verdammtes bisschen klarer gemacht.
»Woran denkst du?«, fragte sie.
John bewegte sich, wandte sich zu ihr um und drehte sein Gesicht aus dem Licht der Straßenlaterne. Jetzt konnte sie den Ausdruck darauf noch schlechter erkennen. Eigentlich gar nicht.
»Du weißt schon«, sagte er. »Nur an morgen.«
Morgen war hier. Morgen war jetzt.
Sie geht duschen, das ist es, was sie jetzt tun wird. Sie wird duschen und sich ihr Outfit für heute anziehen, das sie schon vor einer Woche ausgesucht hat, als sie ihren Schrank mit einer kleinen Liste in der Hand durchforstete, welche Kleidung sie für welchen Zweck an welchem Tag dieser kurzen Reise brauchen würde. Heute ein mittellanger Rock und eine schlichte Bluse, einfach, schnörkellos und doch sexy. Ariels normales Outfit besteht aus Jeans und T-Shirt, kein Make-up. Aber diese Lissabon-Reise ist nicht normal, also wird sie sich schminken und eine lange Halskette mit Anhänger tragen, die Teile ihres Körpers betont, die sie normalerweise nicht betont.
Dann wird sie die Tür öffnen und auf der Fußmatte die amerikanische Zeitung mit den Berichten über die Trauerfeier für den Vizepräsidenten und über den Mann, der für seine Nachfolge nominiert wurde, finden – Nachrichten, die seit Monaten die amerikanischen Medien beherrschen.
Ariel wird die Zeitung aufheben und vorsichtig die breite Treppe des Hotels hinuntersteigen, wobei sie sich auf dem glatten Marmor Zeit lassen und über das durch zwei Jahrhunderte Reibung glatt und glänzend geschliffene Holzgeländer streichen wird, über lange Zeit abgetragen von Menschenhand. Sie wird in den großen, sonnigen Frühstücksraum treten, der über dem belebten, von Bäumen gesäumten Platz liegt, auf dem die tödlichen alten Straßenbahnen rattern und quietschen, Frühaufsteher und müde Pendlerinnen ausspuckend, die ihre Frühstückspastéis mampfen und ihre Blicke an der eleganten Fassade des Hotels hochwandern lassen, wo die Vorhänge durch die mittlere Flügeltür im ersten Stock wehen, direkt vor dem niedrigen Tisch, an dem Ariel und John schon zwei Tage hintereinander zusammen gefrühstückt haben. Es ist ihr Tisch, und dort wird ihr neuer Mann sitzen, mit seinem Kaffee und seinen Zeitungen, und auf sie warten, aufsehen mit diesem Grinsen …
Tut er aber nicht.
Kapitel 2
Tag 1, 7:49
WOBISTDU?
Ihr Finger schwebt über SENDEN, aber sie drückt die Taste nicht. Ariel ist kein hysterischer Mensch, und sie will auch nicht so gesehen werden. Ihr wurde schon Hysterie vorgeworfen, Überreaktion. Mehr als einmal hatte man ihr in ernsten Angelegenheiten nicht geglaubt. Sie hatte es aufgegeben, wegen Dingen zu klagen, die sie nicht zweifelsfrei belegen konnte; kein er-hat-gesagt, sie-hat-gesagt.
Im Frühstücksraum ist nur ein weiterer Tisch besetzt, das australische Rentnerehepaar, das auch gestern hier war; sie mag sich gar nicht vorstellen, mit was für einem Jetlag die beiden zu kämpfen haben. Hinter der Bar läuft ein kleiner Fernseher, auf dem die CNN-Nachrichten mit einem unbekannten Logo in der Ecke des bekannten Beitrags zu sehen sind, Aufnahmen von der Trauerfeier in Washington – Senatoren, ehemalige Präsidenten, ein paar Richter des Obersten Gerichtshofs und natürlich der Präsident.
Ariel wendet sich von dem großen Bildschirm ab und wieder ihrem kleinen zu. Sie drückt auf SENDEN und wartet auf das Rauschen, das den erfolgreichen Ausgang ihrer Nachricht bestätigt, die sie nun anstarrt aus ihrer kleinen Sprechblase, mit all dem Pathos einer unbeantworteten Nachricht an jemand Geliebtes.
Joao, der Kellner, trocknet Gläser ab, während ein Hilfskellner Gebäck aus einem Korb auf eine Platte legt. Das Frühstück ist zur Selbstbedienung. Es ist blödsinnig, so allein hier zu sitzen, an einem Tisch, auf dem weder etwas zu essen noch zu trinken steht. Ariel sollte einen Kaffee trinken. Sie sollte hier sitzen, Kaffee schlürfen, die Zeitung lesen und auf ihren Mann warten.
Das ist das Schwierige an einer intensiven Beziehung, oder? Eine der Schwierigkeiten. Das Warten. Vielleicht war es früher einfacher, als die einzige Möglichkeit der Kommunikation ein handgeschriebener Brief war, von Hand ausgetragen, mit dem Pony-Express oder einem Dreimastschoner. Es dauerte Monate, um ein paar Zeilen auszutauschen, und es gab keine Möglichkeit, dass die geliebte Person, egal wie leidenschaftlich sie war – ob real, potenziell oder nur eingebildet –, sofort antworten konnte. Keinen Grund, händeringend herumzusitzen, die Augen immer wieder auf diese kleine Rettungsleine zu richten, zu warten und zu hoffen, dass das Ding aufleuchtete, das kleine Fenster erschien – Hier bin ich, ja, ich liebe dich noch!
Ariel sitzt mit ihrem Kaffee und ihrer amerikanischen Zeitung am Tisch und zwingt sich, auf die Titelseite zu starren, den Aufmacher, die einzige Story in diesen Tagen. Sie hat schon lange kein Problem mehr damit, allein in Cafés und Restaurants zu sitzen, meist mit einem ihrer Krimis, die sie unaufhörlich verschlingt. Sie liebt es, sich in die Rolle der Ermittelnden zu versetzen oder in die des intrigenschmiedenden Bösewichts, sich in Tatortkunde und juristischen Geheimnissen zu verlieren.
Aber nicht heute. Heute starrt sie auf die Zeitungsseite und schafft es nicht, sie wirklich zu lesen.
»Kann ich Ihnen etwas bringen?« Es ist Joao, sehr aufmerksam, wie immer.
»Nein«, sagt sie, »obrigada« – eines von nur einem Dutzend portugiesischer Wörter, die sie kennt. Sie hat die kleine Vokabelfibel im hinteren Teil des Reiseführers studiert, ist aber nicht sehr weit damit gekommen.
»Sind Sie sicher?«
Ariel will keine Frau sein, die sich fragt, wo ihr Mann ist, dieser Archetyp der Unsicherheit. Aber wo ist er? Sie hat keine andere Wahl.
»Haben Sie meinen Mann heute Morgen schon gesehen?«
Eine Sekunde lang weiß Joao nicht, was er sagen soll, dann entscheidet er sich für ein »Es tut mir leid« und ein nachsichtiges Lächeln, wie es jeder in dieser bedauernswerten Situation so einer bedauernswerten Kreatur schenken würde. »Heute noch nicht, Senhora.«
»Oh, dann muss er schon zur Arbeit gegangen sein«, stottert Ariel leise, fast murmelnd, als wolle sie ihre Beteiligung an dieser offensichtlichen Lüge herunterspielen.
»Ich kann meine Kollegen fragen?« Joao scheint aufrichtig besorgt zu sein, was die Demütigung noch vergrößert. In diesem Moment würde sie die amerikanische Art der Ersatzfürsorge vorziehen, mehr Kundenservice als persönliche Interaktion. Völlig unaufrichtig.
»Morgens gibt es zwei – wie sagt man? – quarto-Frauen …«
»O nein, das ist nett von Ihnen, aber bitte …«
»… und Duarte an der Rezeption, und …«
»O Gott, nein, bitte bemühen Sie sich nicht.« Ariel schüttelt energisch den Kopf. »Wirklich.«
»Es macht mir nichts aus …«
»Mein Mann musste heute früher zur Arbeit.« Sie reitet sich immer tiefer rein. »Und ich habe verschlafen.« Faselt Unsinn und überzeugt niemanden von irgendetwas.
»Sie sind sicher?«
»Ziemlich.« Am liebsten würde sie sich unter den Tisch verkriechen. »Ich danke Ihnen sehr für das Angebot.«
»Also, wenn Sie Ihre Meinung noch ändern …«
»… werde ich Sie das sofort wissen lassen.« Sie wird nichts dergleichen tun. »Danke vielmals.«
Erst vierundzwanzig Minuten seit Ariel aufgewacht ist.
»Worum ging es gerade?«, fragt Rodrigo.
Joao will keine Gerüchte verbreiten; er tratscht nicht über Hotelgäste und auch sonst über nichts. Aber etwas an der Amerikanerin ist beunruhigend – wie sie immer wieder auf ihr Telefon starrt, die kaum unterdrückte Verzweiflung. Noch gestern sah sie so glücklich aus.
»Kennst du den Ehemann dieser Frau?«
»Ja, natürlich.«
Das Hotel ist nur zur Hälfte belegt. Es ist einfach, den Überblick über die Gäste zu behalten, vor allem über jene, die lange frühstücken und die Augen nicht voneinander lassen können.
»Hast du ihn heute Morgen schon gesehen?«, fragt Joao.
»Nein. Warum?«
»Sie auch nicht.«
Ariel sieht sich in der Suite genauer um. Johns Handyladegerät ist da, aber sein Telefon nicht. Sie öffnet seinen Arbeitslaptop und wird sofort nach einem Passwort gefragt; sie macht sich nicht die Mühe, es zu erraten. John hat keine Papiere auf diese Reise mitgenommen, keine Akten, keine Mappe mit Tabellen und Diagrammen. Nichts außer seinen Klamotten, seinem Telefon, diesem unzugänglichen Computer und … was noch …?
Sie kehrt ins Schlafzimmer zurück, zum Schrank, dem Safe darin, sie entriegelt ihn über das Tastenfeld …
Ja, da ist sein Reisepass, ihrer auch. Zusammen mit ihren Haus- und Autoschlüsseln und der amerikanischen Währung, all den wichtigen, aber unnötigen Dingen.
Wie lange ist es her? Vierzehn Minuten seit Ariel die Nachricht gesendet hat. Zeit genug für ihn zu antworten, wenn er könnte. John hat es sich zur Regel gemacht, Anrufe und Nachrichten so schnell wie möglich zu beantworten. Das ist eins der Dinge, die sie über ihn weiß. Sie weiß, dass er am liebsten kräftigen Rotwein aus Südfrankreich trinkt, sie kennt sein Geburtsdatum und seine Schuhgröße, viele Kleinigkeiten. Er weiß die gleichen Dinge über sie. Das meiste bedeutungsloser Mist.
Sie hat lange genug gewartet. Es ist an der Zeit, nun doch mal einen Anruf zu machen, aber der landet ohne ein einziges Klingeln auf der Mailbox. Es ist nicht so, dass ihr Mann nicht rangehen will; er kann nicht. Er weiß nicht einmal, dass sie anruft.
»Buon dia«, sagt Ariel und sieht sich in dem reich ausgestatteten Empfangsraum um, Antiquitäten und Kunstwerke, Leder und Seide, alles deutet auf Luxus.
»Guten Morgen«, antwortet der Rezeptionist.
»Ich wohne mit meinem Mann John Wright in der Botschaftersuite.«
»Ja, Senhora Wright. Mein Name ist Duarte. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Ariel überlegt, ob sie ihn wegen ihres Nachnamens korrigieren soll, aber wozu die Mühe. »Als ich heute Morgen aufwachte, war mein Mann nicht in unserem Zimmer, und ich kann ihn auch telefonisch nicht erreichen.«
Duarte wirkt nervös, wahrscheinlich fragt er sich, was von ihm verlangt wird. In einem solchen Hotel können sich die Gäste über alles beschweren. Manche machen einen Sport daraus – das Wasser ist zu heiß, die Klimaanlage ist zu laut, die Handtücher sind zu weich, es gibt keinen Süßstoff. Duarte ist auf jeden Irrsinn vorbereitet.
»Joao erwähnte, dass man vielleicht andere Angestellte fragen könnte. Vielleicht könnten Sie das tun?«
»Kann ich was tun, bitte?«
»Sie fragen. Ob sie meinen Mann gesehen haben.«
»Ja, das ist möglich. Ich kümmere mich darum.« Duarte, dem die Dringlichkeit der Angelegenheit nicht bewusst ist, erwartet, dass Ariel jetzt geht. Aber sie schlägt die Beine übereinander, signalisiert, dass sie hierbleiben und warten wird.
»Ah«, sagt der junge Mann. »Ich verstehe.« Er nimmt den Telefonhörer ab, führt ein kurzes Gespräch und wendet sich wieder an Ariel. »Maria und Leonor kommen. Einen Moment, bitte.«
Ariel nickt.
»Ist mit Ihrem Zimmer alles in Ordnung, Senhora Wright?«
»Mein Name …«, beginnt sie, unterbricht sich aber selbst.
Als sie John heiratete, hatte sie ihren Namen bereits zweimal in ihrem Leben geändert. Auf keinen Fall würde sie ihre neue, mühsam aufgebaute Identität jemals wieder aufgeben. John hatte ihr nicht widersprochen; es war gar keine Frage gewesen.
»Ja«, sagte sie, »danke. Das Zimmer ist in Ordnung.«
Maria und Leonor kommen gemeinsam herein; Maria hat Ariel vor ein paar Minuten auf dem Flur gesehen. Die drei Kollegen sprechen schnell auf Portugiesisch, für Ariel klingt es wie eine Mischung aus Russisch und Spanisch. Sie versteht kein Wort. Das Einzige, was Ariel in dieser Sprache erkennen kann, ist der Ton – gut oder schlecht, ja oder nein. So muss es sein, wenn man ein Hund ist. Was sie wahrnimmt, ist nein. Schlecht. Wenn sie einen Schwanz hätte, würde er zwischen ihren Beinen stecken.
»Maria, sie weiß, wer Ihr Mann ist, aber sie hat ihn heute Morgen nicht gesehen. Und Leonor, sie weiß nicht, wer Ihr Mann ist.«
Ariel scrollt durch die Fotos auf ihrem Handy – Burg, Kathedrale, Kopfsteinpflaster, und ja, hier: ein Pärchen-Selfie vor malerischer Kulisse, die Art von Bild, die Ariel in den sozialen Medien gepostet hätte, wenn sie so etwas tun würde.
»Hier, das ist mein Mann.«
Die Frau betrachtet das Bild, dann Ariel, dann wieder den Bildschirm, als würde sie sich vergewissern, dass die Frau vor ihr wirklich dieselbe Frau ist wie auf dem Foto. Ariel will schreien: »Aber darum geht es nicht!«, hält sich aber zurück und hört sich noch mehr unverständliches Portugiesisch an.
»Es tut mir leid«, sagt Duarte, »Leonor hat diesen Mann heute nicht gesehen«.
Jetzt starren drei Generationen portugiesischer Hotelangestellter Ariel an, und alle fragen sich, ob sie mit ihrem Tag weitermachen können, fern von dieser Amerikanerin.
»Obrigada«, sagt Ariel, und sie lächeln verhalten erleichtert, befreit vom Unbehagen über die Eheprobleme einer Fremden.
Wenn es keine Hinweise gibt, ist das auch ein Hinweis.
Kapitel 3
Tag 1, 8:58
Bevor Ariel auf die Straße tritt, ändert sie ihre Haltung und verhärtet ihr Gesicht, legt eine Rüstung an, um männliche Blicke abzuwehren, unerwünschte Interaktionen zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Eine Zeit lang hat sie schnell den Mittelfinger gezeigt, Schimpfwörter gemurmelt, feindselig reagiert. Nur wenn kein Fluchtweg sichtbar oder keine Zeugen in der Nähe waren, hat sie sich auf die Zunge gebissen. Aber sie wusste, dass die kämpferischen Reaktionen die Situation nicht besser machten, sondern im Gegenteil oft viel schlimmer. Und in einer Kleinstadt wie der ihren konnte jeder dieser Männer, selbst völlig Fremde in vorbeifahrenden Autos, zu einem Feind werden, dem sie vielleicht eines Tages auf einem dunklen Parkplatz, an einem einsamen Strand oder in ihrem eigenen Haus wiederbegegnete.
Also schluckt Ariel inzwischen ihren Stolz hinunter und unterdrückt ihre kämpferischen Instinkte, stattdessen weicht sie aus, deeskaliert, beschwichtigt – das ist zwar demütigend, aber besser als ein schwerer Angriff oder Schlimmeres. Denn die Männer, die Frauen auf dem Gehweg so aggressiv ansprechen, sind dieselben, die Frauen auch schlagen, vergewaltigen oder mit Montierhebeln zu Tode prügeln.
-
Die Morgensonne strahlt voller Kraft von der blendend weißen Fassade des Hotels zurück. Ariel wirft einen Blick den Hügel hinunter, dorthin, wo John sein würde, wenn er im Büro seines Klienten wäre, das irgendwo in der Nähe des gewaltigen Praça do Comérico liegt, auf der einen Seite der imposante Bogen, auf der anderen der sich kilometerweit erstreckende Flussarm. Dieser Hauptplatz war einst das schlagende Herz Portugals, eines der wichtigsten Handelszentren Europas, ja sogar der ganzen Welt. Das ist jetzt vorbei. Heutzutage werden die Geschäfte in glasverkleideten Türmen in weiter entfernten Vierteln gemacht.
Die Praça liegt im Süden. Ariel geht nach Norden, den steilen Hang des Bairro Alto hinauf, durch die engen von Partylichtern und Wäscheleinen überspannten Gassen, flatternde Geschirrtücher und Fußballtrikots über den Tischen vor den Cervejarias und Tabernas, vor kleinen Tante-Emma-Läden, Geschäften, die Turnschuhe oder Sardinen verkaufen oder eine verblüffende Vielfalt von Korkwaren.
Es ist Montagmorgen. Die Stadt erwacht schneller zum Leben als am Wochenende, die Läden öffnen, die Cafés füllen sich, Menschen schlendern auf aus Mosaiken bestehenden Gehwegen zur Arbeit, überall grüne Bäume, viele Wände voller Graffitis: Namen und Initialen, Peace-Zeichen, strahlende Smileys und Zeichentrickhunde. Keine Waffen, keine RIP-Hinweise, keine Gangstersymbole. Die Graffitis von Lissabon spiegeln Ausgelassenheit wider, nicht Verzweiflung.
Ariel läuft mit ihrem Telefon in der Hand herum, drückt immer wieder auf die Home-Taste, wischt über den Bildschirm, und es erscheint nichts und nichts und immer wieder nichts.
Die Bäckereien haben alle geöffnet und verströmen unterschiedliche Gerüche, das reichhaltige Butter- und Zuckeraroma von Gebäck die eine, Mehl und Hefe die andere, diese europäischen Gerüche, die wie Meeresfrüchtestraßenmärkte und Stände mit frisch gepressten Säften nicht Teil des Lebens zu Hause sind. In Amerika gibt es andere Essensgerüche; die meisten haben mit Fleisch oder Frittiertem zu tun.
Ariel steigt weiter den steilen Hügel hinauf, ihre Beine werden müde. Sie spürt ein Stechen im linken Knöchel, den sie sich letzten Herbst verstaucht hat, als sie auf dem Dorfplatz von einem Labrador umgeworfen wurde. Diese Verletzung war nur die letzte von vielen: der von einem schweren Bücherkarton eingeklemmte Daumen, die beim Auswechseln einer Glühbirne gerissene Rotatorenmanschette in der Schulter, Fersensporn in beiden Füßen, einfach so, die gestauchte Bandscheibe im Nacken aus demselben nichtigen, ungerechten Grund.
»Was soll ich Ihnen sagen?«, meinte der Chiropraktiker. »Willkommen im mittleren Alter.«
Eine Zeit lang machte sich Ariel vor, dass sie eines Tages all diese Ärgernisse wieder los sein würde: Die Sehne wird heilen, die neuen Orthesen werden funktionieren, regelmäßiges Yoga wird die Rückenschmerzen lindern, dies oder jenes wird besser werden, und dann wird alles gut sein. Doch seit Jahren überlagern sich die Beschwerden ununterbrochen, und Ariel sieht langsam ein, dass sie wohl nie wieder komplett schmerzfrei sein wird. Es wird eine kleinere Verletzung nach der anderen kommen, dazu gelegentliche größere plus immer schwerere Krankheiten, eine unaufhaltsame Verschlechterung, die schließlich zum Tod führt. Wie der Klimawandel, ein Trend, der nur in eine Richtung geht und in der unvermeidlichen Katastrophe gipfelt, ohne alternative Enden.
Ihr wurde klar, dass sie mit den Dingen, die sie noch tun wollte, jetzt anfangen musste.
Die steilen Hügel Lissabons bieten überall Ausblicke – die mittelalterliche Burg dort drüben, das Labyrinth der Altstadtgassen darunter, die große Biegung des breiten Flusses, die Golden-Gate-artige Brücke, die die Flussenge überspannt. Von hier oben sieht Lissabon riesig aus, so viele Stadtteile, so weit verstreut.
Ariel ist Städte nicht mehr gewöhnt. Als in New York alles zusammenbrach, betraf das jeden Bereich, sie wollte nichts mehr mit der Stadt zu tun haben – die Menschen, die Männer, der ständige Druck, der auf ihr lastete. Sie ließ die Lautstärke, die Menschenmassen und Gerüche, die allgemeine Reizüberflutung hinter sich, alles viel zu groß. Mittlerweile besucht sie kaum noch Städte, nur noch für ein oder zwei Geschäftsreisen pro Jahr für jeweils ein paar Nächte. Dann bestellt sie ihre Mutter aus South Carolina ein, damit sie sich um George und die Hunde kümmert, wie sie es jetzt auch gerade tut.
Ariel versucht erneut, John anzurufen, und kommt wieder nicht durch: Mailbox.
Sie blickt über die Straße hinweg zu ihrem Ziel. Das, was sie jetzt tun muss, will sie nicht tun, will diese Unannehmlichkeiten nicht in Gang setzen. Es erinnert sie an einen Moment im letzten Winter, als sie gerade eingeschlafen war und ihre Brust plötzlich schmerzte und sich ihr ganzer Körper kalt anfühlte. Sie tastete nach ihrem Handy, wählte die Nummer ihrer besten Freundin, ihre Finger erschreckend taub.
»Ariel?« Sarahs Stimme war heiser vom Schlaf. »Was ist denn los?«
»Ich glaube.« Ariel konnte kaum sprechen. »Muss. Notaufnahme.« Sie wollte keinen Krankenwagen, sie hatte Horrorgeschichten über nicht erstattete Kosten gehört.
»O mein Gott, ich bin gleich da.«
George lag auf dem Rücksitz von Sarahs Subaru, trug einen Parka über dem Schlafanzug und umklammerte seinen Teddy, Ariel zitterte auf dem Beifahrersitz, ihre Angst wuchs, während sie sich dem Krankenhaus näherten, in dem sich ihr Leben für immer verändern könnte: Sie könnte einen Herzinfarkt haben, ein Aneurysma, wer weiß. Sie war eine junge Frau – relativ gesehen –, und die Symptome von lebensbedrohlichen Krankheiten kannte sie nur aus dem Fernsehen und aus Filmen. Ariel hatte keine Ahnung, was ihr Körper ihr wirklich zu sagen versuchte. Sie brauchte eine Person, die dolmetschte, und solche arbeiteten in Krankenhäusern.
Innerhalb von Sekunden nach ihrer Ankunft in der Notaufnahme wurde sie auf einer Bahre einen hellen Korridor entlanggerollt, die Leute fragten immer wieder nach ihrem Namen und ihrem Geburtsdatum, machten Tests und noch mehr Tests, ein Farbstoff wurde in sie hineingepumpt, Stunden vergingen, George döste in einem Warteraum neben einem Verkaufsautomaten, der schreckliche Begriff »Lungenembolie« wurde wiederholt geäußert, bis schließlich um halb drei morgens eine Ärztin zielstrebig und lächelnd an ihr Bett trat; Ariel war sich nicht sicher, ob aus Gewissheit oder Erleichterung.
»Ms. Pryce, Sie haben eine Lungenentzündung.«
Nach zwei Tagen Ruhe und Antibiotika ging es ihr gut, alles prima. Aber wenn sie nicht in die Notaufnahme gefahren wäre, wäre sie vielleicht noch in derselben Nacht gestorben. Manchmal kann man es aufschieben. Und manchmal geht das einfach nicht.
Sie steigt die steile Treppe hinauf und tritt ein.
»Buon dia«, sagt sie zu der Beamtin am Empfangstresen. »Mein Mann ist verschwunden.«
Ariel versucht, das lange, schnelle Portugiesisch der uniformierten Polizistin aufzunehmen, das abwechselnd nach Aussagen, nach Anschuldigungen und vielleicht ein paar Fragen klingt.
»Desculpe«, sagt Ariel – das Wort hat sie gelernt, als sie anderen Leuten beim Entschuldigen zuhörte. »Ich kann kein Portugiesisch. Gibt es hier jemanden, der Englisch spricht?«
Die Polizistin starrt sie an.
»Desculpe«, wiederholt Ariel und versucht bedauernd, erbärmlich, des Mitgefühls wert zu wirken.
Noch mehr Starren. Was soll sie tun?
»Ah!« Ariel streckt einen Finger in die Höhe, das universelle Zeichen für »Einen Moment bitte«. Portugiesisch hat Ariel vor dieser Reise zwar nicht viel gelernt, aber sie hat sich eine App gekauft. Die typisch amerikanische Herangehensweise an jedes Problem: etwas kaufen. Das war eins der Dinge, die sie an den Menschen, die sie am meisten hasste, am meisten hasste: der Reflex, alles mit Geld zu bewerfen, aus Routine.
Aber hier steht sie, tippt zu schnell in ihr Telefon, macht zu viele Fehler, und einer ist schon zu viel. Es gibt keine Möglichkeit für eine Übersetzungs-App, falsch geschriebene Absichten zu erraten. Sie hebt erneut einen Finger, murmelt eine weitere Entschuldigung, drückt dann auf ÜBERSETZEN und übergibt ihr Handy.
Die Polizistin schaut auf den Bildschirm, braucht ein paar Sekunden, um zu lesen. Dann blickt sie zu Ariel auf, mustert die brabbelnde Frau, die an einem Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe in die Polizeiwache gestürmt ist. Ihre Gesichtszüge werden weicher, und sie sagt: »Um momento.«
»Mein Mann.« Ariel schaut zwischen den beiden Kriminalbeamten hin und her.
»Er ist verschwunden, sagen Sie?«, fragt der Mann. António Moniz hat ein warmes, offenes Gesicht, aber Ariel kann bereits die Skepsis an seinen Brauen ablesen, seine Augen verengen sich leicht.
»Also, ich weiß nicht, ob er verschwunden ist. Aber ich kann ihn nicht finden.«
Moniz nickt. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Gegen Mitternacht.«
Ariels letzte Erinnerung an die Nacht war John, wie er wieder am offenen Fenster stand und hinausstarrte, in seinen morgigen Tag. Sie weiß nicht mehr genau, wie spät es war, als sie schließlich einschlief, aber Mitternacht könnte hinkommen.
»Mitternacht?« Moniz schaut überrascht. »Mitternacht der letzten Nacht?«
»Ja.«
»Das war vor«, Moniz schaut auf seine Uhr, »zehn Stunden?«
»Korrekt.«
Der Polizist atmet tief ein. Er weiß offensichtlich nicht, was er als Nächstes sagen soll, was er dieser Frau mitteilen soll. Er tauscht einen Blick mit seiner Kollegin aus, einer attraktiven, aber streng aussehenden Frau namens Carolina Santos, die bis jetzt nichts gesagt hat.
»Mir ist klar«, sagt Ariel, »dass das nicht viel Zeit ist.«
»Nein«, stimmt Moniz zu, vielleicht etwas zu schnell, zu inbrünstig. »Ist es nicht.«
»Aber das ist wirklich gar nicht seine Art.«
»Natürlich«, sagt Moniz. »Natürlich«, wiederholt er, aber es klingt nicht wie eine Wiederholung, eher wie ein Widerspruch oder vielleicht Sarkasmus.
In diesem Gespräch geht es noch nicht um John. Es geht immer noch um Ariel und um ihre Glaubwürdigkeit.
»Ich mache mir Sorgen.« Ariel schaut zwischen den beiden Beamten hin und her, sucht nach Unterstützung, findet aber keine. Kommissarin Santos hat nicht nur nicht gesprochen, sie hat nicht einmal ihren Stift in die Hand genommen. Ihre Rolle hier scheint darin zu bestehen, ihre Besucherin anzustarren. Ariel hat ein wenig Angst vor Santos.
»Läuft Ihr Mann?«, fragt Moniz. »Als Sport? Kann es sein, dass er laufen gegangen ist?«
»Nein.« Ariel schüttelt den Kopf. »Seine Laufschuhe sind in unserem Zimmer.«
»Hat er – wie heißt es, wenn man nicht schlafen kann?«
»Ob er schlafwandelt? Nein.«
»Tut mir leid, das ist nicht, was ich meine. Wegen der Reise? Der Zeitumstellung?«
»Jetlag?«
Moniz schnippt mit den Fingern. »Ja. Jetlag. Vielleicht wegen des Jetlags ist er früher aufgewacht und geht spazieren? Ist das möglich?«
»Vielleicht, aber warum sollte er mir keine Nachricht hinterlassen? Oder anrufen? Oder auf meine Anrufe reagieren?«
»Ich weiß es nicht, Senhora. Fällt Ihnen ein Grund ein?«
Sie schüttelt den Kopf. »Wie auch immer, John hat letzte Nacht eine Schlaftablette genommen. Ich auch. Um uns bei der Umstellung zu helfen. Damit er heute für die Arbeit ausgeruht ist.«
»Arbeit? Sie sind geschäftlich in Lisboa?«
»Mein Mann ist Berater, er besucht einen Klienten.«
»Haben Sie den Klienten kontaktiert? Vielleicht ist er schon dort im Büro.«
»Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, wer der Klient ist. John hat es mir gesagt, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich hätte es mir aufschreiben sollen, ich weiß. Hab ich aber nicht.«
»Und Sie?«, fragt er. »Sind Sie auch geschäftlich hier?«
»Nein. Ich begleite ihn nur.«
Moniz hat einen Fleck auf seiner Krawatte, Schmierfett oder Soße, etwas Öliges.
»Haben Sie eine Vermutung, Senhora Pryce? Wo Ihr Mann sein könnte?«
»Nein. Ich mache mir nur Sorgen.«
»Worüber machen Sie sich denn Sorgen?«
Es könnte ihm so viel Schlimmes zugestoßen sein, etwa nicht? John könnte Opfer eines Verbrechens oder eines Unfalls geworden sein, im Krankenhaus liegen, von einer Straßenbahn überfahren oder von einem Auto, einem Lastwagen, irgendetwas. Oder mit dem Gesicht nach unten in einer Gasse liegen, überfallen, blutend, bewusstlos. Er könnte tot auf einem verlassenen Fischmarkt auf der anderen Seite des Tejo liegen, angekettet an ein rostiges Rohr, sein Blut in einen Gully fließend und sich mit dem brackigen Fluss vermischend.
Vielleicht wurde er zu Unrecht wegen irgendetwas beschuldigt, auf einer anderen Polizeiwache verhaftet, in einer Botschaft verhört. Oder unten in Tanger von Sicherheitskräften festgehalten und bezichtigt, ein Spion, ein Schmuggler, ein Flüchtling zu sein.
Und vielleicht ist die Anschuldigung auch gar nicht falsch. Ariel kennt nicht jede dunkle Facette von Johns Geschichte. Vielleicht hat er eine fragwürdige Vergangenheit, die ihn schließlich eingeholt hat, oder eine fragwürdige Gegenwart, die er geschickt zu verbergen weiß. Er könnte in Geldwäsche, Betrug, Steuerhinterziehung verwickelt sein, sich hinter dem Deckmantel eines Beraters verstecken; wer zum Teufel weiß schon, was ein Berater überhaupt tut.
Oder natürlich könnte es ihm gut gehen. Ariel wird am Ende überbehütend, unsicher und dumm dastehen. Genau, was ihr schon einmal vorgeworfen wurde: unglaubwürdig zu sein.
»Ich weiß es nicht«, gibt sie zu.
Moniz tippt mit seinem Stift aufs Blatt, das, wie Ariel feststellt, fast völlig leer ist. Sie hat nicht viel gesagt, was sich aufzuschreiben lohnt.
»Senhora, ich hoffe, Sie verstehen, dass die Polizei nicht nach jedem Mann suchen kann, dessen Frau ihn am Morgen nicht findet. Wir würden nichts anderes mehr tun!« Sein Versuch eines Scherzes misslingt, das merkt er sofort und schiebt nach: »Ich bin sicher, es ist nichts. Ihr Mann ist bei der Arbeit, und er wird am Ende des Tages in Ihr Hotel zurückkehren.«
Das ist die Art von fadem, grundlosem Optimismus, den Ariel verabscheut. Wie ein Politiker, der sich anbiedert, oder ein Sporttrainer. Ariel kann aufmunternde Reden nicht ausstehen.
»Er wird eine Erklärung haben, und es wird eine sein, die Ihnen gefällt oder nicht gefällt, aber bestimmt wird es nichts Kriminelles sein. Nichts Ernstes. Und auf jeden Fall wird er wiederkommen.«
Moniz streckt seine Hände aus, beendet die Geschichte.
»Aber was, wenn nicht?«
»Wenn Ihr Mann morgen früh immer noch verschwunden ist, kommen Sie bitte wieder. Oder rufen Sie mich an.« Moniz nimmt eine Visitenkarte aus einer Messingdose, reicht sie Ariel.
»Hören Sie, ich weiß, es ist nur ein paar Stunden her. Ich weiß, dass ich keine Beweise habe. Ich weiß, dass ich nicht so viel Information habe, wie ich sollte. Das weiß ich alles. Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Er antwortet nicht auf meine Anrufe oder Nachrichten, er hat mir keinen Zettel hinterlassen, und so ein Typ ist er nicht. Können wir nicht jetzt anfangen, ihn zu suchen?«
Moniz nickt, er versteht ihr fehlendes Verständnis.
»Aber, Senhora, diese Informationen, die Sie uns gegeben haben, sie sind kein Beweis für ein Fehlverhalten, wenn sie überhaupt ein Beweis für irgendetwas sind. Und die Zeit, die Sie Ihren Mann nicht gesehen haben, die ist nicht lang genug. In diesem Augenblick gibt es Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen in Lissabon, die seit gestern Abend eine Angehörige oder einen Freund nicht mehr gesehen haben. Deren Ehefrau oder Ehemann nicht ans Telefon geht oder auf eine Textnachricht antwortet. Heutzutage erwarten wir von allen, immer erreichbar zu sein, zu jeder Stunde an jedem Tag und in jeder Nacht mit uns in Kontakt zu stehen, nur weil es möglich ist. Aber nur weil es möglich ist, ist es nicht wünschenswert. Nicht immer und nicht für alle Menschen.«
Damit hat Moniz definitiv recht.
»Das war’s dann also?«
Es hat keinen Sinn, mit ihm zu streiten, oder? Nicht mit einem Mann, der sich bereits entschieden hat.
»Es tut mir leid, dass wir im Moment nichts unternehmen können.« Er steht auf, bietet seine Hand zum Schütteln an. »Ich hoffe, Sie verstehen das.«
Ariel könnte die Hilfe der Polizei in der Zukunft sehr wohl brauchen, deshalb will sie jetzt keine aussichtslose Schlacht schlagen.
António Moniz sieht der Amerikanerin hinterher. »Was denkst du?«
Seine Partnerin braucht ein paar Sekunden, bevor sie antwortet. »Ich glaube, dass diese Frau ihren Mann nicht so gut kennt, wie sie glaubt.«
Nach Moniz’ Erfahrung ist jeder Polizist zynisch, aber Carolina Santos ist, was das angeht, auf einem ganz anderen Level.
»Das gilt natürlich für fast alle Frauen«, fährt Santos fort. »Wir werden alle belogen. Andauernd.«
Moniz streitet nicht mit Santos. Ihre Zündschnur kann bei diesem Thema schrecklich kurz sein. Außerdem ist er ihrer Meinung.
»Hey, Erico«, ruft sie. Ein paar Schreibtische weiter blickt ein jüngerer Polizist von den Fußballseiten auf. »Hast du die Amerikanerin gesehen, die gerade gegangen ist?«
»Ja.«
»Folge ihr.«
Kapitel 4
Tag 1, 10:44
»Guten Morgen, mein Name ist Saxby Barnes.« Er streckt ihr seine Hand zu einem Schütteln hin, das einen Moment zu lange dauert. »Bitte seien Sie so freundlich, mir zu folgen.«
Barnes ist ein teigiger Mann, der sowohl die Anstecknadel mit amerikanischer Flagge am Revers als auch das aufgesetzte Lächeln eines Politikers trägt. Ein Lächeln, von dem alle wissen, dass es falsch ist, aber sich trotzdem einig sind, so zu tun, als ob es nicht so wäre, die Lächelnden und die Angelächelten, vereint in einem umfassenden Pakt vorgetäuschter Unwissenheit.
Er benutzt eine Magnetkarte und führt Ariel durch einen großen, offenen Raum, wobei er ein paarmal über die Schulter schaut, wahrscheinlich um sicherzugehen, dass sie sich nicht abgesetzt hat, um Amok zu laufen. Hier in der US-Botschaft gibt es viele Sicherheitsvorkehrungen, Formulare und Formalitäten und Filter, um zu verhindern, dass dieser Einrichtung etwas Negatives widerfährt, sie sind nicht dafür da, den Besuchern zu gefallen.
Von der anderen Seite des Raumes spürt Ariel einen eindringlichen Blick auf sich. Sie schaut kurz hin, lang genug, um einen Mann mittleren Alters mit kurzem Bart, zerknittertem Oxfordhemd und etwas, das ein Presseausweis sein könnte, wahrzunehmen.
»Sie können also Ihren Mann nicht finden«, sagt Barnes, als sie um eine Ecke biegen.
»Das ist richtig.«
»Und wir gehen wohl davon aus, dass er Sie nicht einfach verlassen hat.«
Barnes dreht sich lächelnd um, und Ariel wirft ihm einen fragenden Blick zu.
»Wie könnte irgendein Mann eine Frau wie Sie verlassen?« Jetzt strahlt er, stolz auf sich, dass er es geschafft hat, eine besorgte, verheiratete Frau in der ersten Minute ihrer Begegnung anzubaggern.
»Sicherlich kein Mann bei Verstand«, fügt er hinzu und sieht sie erwartungsvoll an. Er möchte, dass sie ihm für das Kompliment dankbar ist.
Ariel bemüht sich bewusst darum, das Gute in allen Menschen zu sehen, die sie trifft. Sie versucht, in jeder neuen Beziehung im Zweifel zu deren Gunsten zu entscheiden. Aber bei diesem Typ ist es echt schwer.
Sie schluckt ihren Stolz hinunter und schenkt Barnes ein Lächeln.
»Hierhinein«, sagt er und hält ihr die Tür zu einem kleinen, aufgeräumten Büro auf. Als Ariel an ihm vorbeigeht, nimmt sie einen Hauch von Alkohol in seinem Atem wahr. Von heute? Oder noch von letzter Nacht? Sie kennt diese Art von Typen, die keine Gelegenheit für einen Drink auslassen und es auch nie bei einem belassen.
»Also, Mrs., ähm …«
»Ariel Pryce. Ms.«
»Wie Sie wollen. Ms. Pryce«, sagt er grinsend. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Wasser?«
»Nein, danke«, sagte sie so sanft wie möglich. Nein im Ton von Ja.
»Sie sehen ein wenig, ähm …«
Es hatte eine Weile gedauert, in der prallen Sonne ein Taxi zu finden, und die Klimaanlage des Wagens war nicht überzeugend, dann hatte sie vor der Botschaft warten müssen, und danach in einem engen, überfüllten Raum voller frustrierter Menschen. Sie sieht wahrscheinlich total verschwitzt und zerknittert aus.
»Es ist furchtbar heiß da draußen«, sagt sie.
»Portugal im Juli! War zu erwarten. Aber diese Hitze ist mir sehr vertraut; ich komme aus Georgia.«
Natürlich, der rotgesichtige Saxby Barnes, ein glotzender Südstaaten-Gentleman in seinem engen blauen Seersucker-Anzug, der Regimentskrawatte und den weißen Halbschuhen. Das ganze Programm.
»Sind Sie sicher? Kein Wasser?«
Barnes versteht offensichtlich nicht, wie eine Frau diese alltägliche Höflichkeit ablehnen kann, die er ihr aufzudrängen versucht, unaufgefordert und unerwünscht. Ariel hat gelernt, dass man den übermäßig Höflichen am wenigsten trauen sollte, denjenigen, die versuchen, einen von ihren Gentleman-Manieren, ihrer Großzügigkeit, ihrer Ritterlichkeit zu überzeugen.
»Gut«, räumt Ariel ein. »Vielen Dank.«
Barnes grinst über diesen winzigen Sieg aggressiver Fürsorglichkeit, diese Konversationskeule: ihr einen Gefallen aufzuzwingen, in der Erwartung, später etwas dafür zu bekommen.
»Akzeptiere niemals ein Nein«, hatte seine Mutter ihm zweifellos gesagt, als sie ihrem Sohn die richtigen Manieren eines höflichen Gastgebers beibrachte. »Akzeptiere niemals ein Nein«, hatte ihm sein Vater gesagt, als er seinem Sohn beibrachte, wie man in der Geschäftswelt, der Politik, in jedem Beruf erfolgreich wurde. »Akzeptiere niemals ein Nein«, hatten ihm seine Verbindungsbrüder gesagt, als sie ihm beibrachten, seinem eigenen Urteil darüber zu vertrauen, was ein Mädchen will, egal was sie vielleicht sagt. Und jetzt ist er hier und versucht, all das auf einmal zu tun, genau wie es ihm sein ganzes Leben lang von allen eingetrichtert worden war.
Ritterlichkeit war manchmal nur eine andere Form der Feindseligkeit. Ritterlichkeit war manchmal die Waffe selbst.
»Ist mit Kohlensäure in Ordnung? Ich fürchte, ich habe kein stilles mehr.«
Natürlich: etwas geben, etwas wegnehmen.
»Mit Kohlensäure ist perfekt.«
Es scheint fast, als würde Barnes den Griff des Kühlschranks streicheln. Der muss wohl eine Neuerwerbung sein. Etwas, das Barnes sich verdienen oder erschwindeln musste. Er ist stolz auf sein kleines Gerät.
»Nochmals danke«, sagt sie. »Sie sind sehr freundlich.«
»Gern geschehen.« Er nimmt Platz. »Also gut, wir brauchen ein paar, ähm … Details …«
Barnes öffnet eine Schreibtischschublade und nimmt ein paar Stücke gepolstertes Nylon heraus. »Karpaltunnel«, erklärt er und wickelt sein linkes Handgelenk in eine dieser Vorrichtungen.
Ihr Blick fällt auf die amerikanische Zeitung, die sie heute Morgen nicht gelesen hat und die über die politischen Ereignisse in ihrer Heimat berichtet. Die Titelseite wird von dem Foto eines Mannes beherrscht, der in die nationale Öffentlichkeit katapultiert wurde, zunächst als Sonderberater seines alten Kumpels, des Präsidenten, dann folgte unerwartet, aber weitgehend unbeanstandet die Ernennung zum Kabinettsmitglied, zum Finanzminister. Doch jetzt, nach der Hirnblutung des Vizepräsidenten, ist dieser politische Neuling plötzlich bereit, die Weltbühne zu betreten. Angesichts der sich abzeichnenden Begrenzung der Amtszeit wäre dieser Mann der voraussichtliche nächste Kandidat für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Barnes zieht seinen Klettverschluss fest, reißt ihn dann auf und schließt ihn erneut, bis die Passform optimal ist. Er wiederholt den Vorgang für sein rechtes Handgelenk, wendet sich dann wieder Ariel zu und nickt, vollständig geschützt gegen die doppelte Verwüstung durch Sehnenscheidenentzündung und Schwerkraft. Ariel hat fast ein wenig Mitleid mit dem Kerl. Aber nur fast.
»Könnten Sie Ihren Mann bitte beschreiben? Größe, Gewicht.«
»Er ist etwa einen Meter siebzig groß. Was er wiegt, weiß ich nicht; dabei beobachte ich ihn nicht.«
»Aber so grob?«
»Er ist dünn, schmal.« Sie weiß nicht, wie sie Johns Körper beschreiben soll. Er ist perfekt proportioniert, wunderschön. »Trainiert, aber keine großen Muskeln.«
»Okay.« Barnes will offensichtlich nichts über den attraktiven Körperbau eines anderen Mannes hören. Unsicherheit und Homophobie sind so eng miteinander verbunden, dass Ariel vermutet, dass es sich um ein und dieselbe Sache handelt.
»Was noch? Mal sehen, Haare?«
»Dunkelbraun, voll und gewellt. Grüne Augen.«
»Irgendwelche besonderen Kennzeichen? Narben? Ohrringe? Tätowierungen? Gesichtsbehaarung?«
Ariel schüttelt den Kopf. John ist einer der wenigen völlig schmucklosen Männer, die sie kennt, mit einer Garderobe ganz ohne Logos, Etiketten oder erkennbarem Branding, keine Sportmannschafts- oder College-Fanartikel, kein Schmuck, keine Baseballkappe. Sogar sein Auto ist unauffällig, kein Statement, außer vielleicht das Statement, ausdrücklich keins zu haben.
»Alter?«
»Sechsunddreißig.«
Barnes blickt schnell hoch, dann wieder auf seine Tastatur. In diesem kurzen Blick kann sie ihn rechnen sehen: Ariel ist ein Jahrzehnt älter, ein Unterschied, der in umgekehrter Richtung völlig nebensächlich wäre.
»Würde man ihn als attraktiv bezeichnen?«
»Auf jeden Fall.«
Sie weiß, an welchem Faden Barnes zerrt, welche Vermutungen er angestellt hat, als sie ankam, und welche zusätzliche Geschichte er jetzt konstruiert: Es geht nicht darum, dass Ariel einen jüngeren Mann geheiratet hat, sondern darum, dass John eine ältere Frau geheiratet hat. Barnes ist ungefähr in Johns Alter. Vielleicht fragt sich Barnes, was ihn dazu bewegen könnte, eine ältere Frau zu heiraten. Diese ältere Frau.
Ariel mustert ihn, während er sie mustert. Der Stoff seines Anzugs spannt, knittert an den falschen Stellen; der oberste Knopf seines Hemdes lässt sich nicht schließen. Dieser Mann hat in letzter Zeit etwas zugenommen, mehr als nur ein oder zwei Pfund, und seine Garderobe hat noch nicht aufgeholt. Vielleicht leugnet er es und redet sich ein, dass er dieses zusätzliche Gewicht leicht wieder abnehmen wird, sobald er keinen Nachtisch mehr isst. Nächste Woche vielleicht. Oder übernächste.
»Okay, also, heute Morgen: es gab keinerlei Kommunikation?«
»Nein. Er hat weder auf meine Textnachrichten noch auf meine E-Mails geantwortet. Wenn ich versuche, ihn anzurufen, springt direkt die Mailbox an. Ich habe ein paar Nachrichten hinterlassen.«
Barnes wirft einen Blick auf Ariels Unterlagen, das Ausfüllen war wie bei Krankenversicherungsunterlagen, etwas, das man auf einem Plastikklemmbrett mit einem Klickkugelschreiber erledigt, auf dem der Markenname eines neuen Diabetesmedikaments prangt.
»Und was haben Sie beide so in Lissabon gemacht?«
»Den normalen Touristenkram.«
»Wie zum Beispiel?«
Sie hatten am frühen Morgen eine Segway-Tour unternommen, bei der sie am Flussufer entlanggesaust waren, das ganz auf Freizeitvergnügungen ausgerichtet war – Restaurants und Diskotheken, durch ein Band aus Wegen für Läuferinnen und Radfahrer von den Jachthäfen getrennt, wie ein Traum des 21. Jahrhunderts von städtischer Wiederbelebung. Sie waren mit einer der alten, knarrenden Straßenbahnen gefahren, der berühmten Nummer 28, die um scharfe Kurven und steile Hügel hinauf- und hinunterfuhr wie eine alte Achterbahn, überfüllt und unbequem und ganz schön beängstigend.
Barnes tippt nicht besonders gut, er benutzt nur ein paar der Finger, die aus seiner Orthese herausschauen, und guckt zwischen Tastatur und Bildschirm hin und her, wobei er gelegentlich einen Seitenblick auf sie wirft, auf ihre Brüste. Sie schaut an sich herunter, um sich zu vergewissern, dass sie ausreichend bedeckt ist.
»Hatten Sie mit jemandem Kontakt?«
»Natürlich, mit vielen Leuten. Im Hotel, in Restaurants, in ein paar Museen.«
Sie hatten das Gulbenkian besichtigt, einen massiven Klotz mit einer der größten privaten Kunstsammlungen der Welt, die Beute eines wohlhabenden Nationalstaates. Sie besuchten auch ein Kloster, das in ein Kachelmuseum umgewandelt worden war. Kacheln sind in Lissabon allgegenwärtig – Gebäudefassaden mit faszinierenden geometrischen Mustern, Innenwände von Geschäften und Cafés, Fußböden in Lobbys. Schon der Anblick der glatten blau-weißen Oberflächen sorgt für Abkühlung.
»Mit jemandem, den Sie kannten? Oder Ihr Mann?«
»Nein.«
Von der Frau im Café wird Ariel Barnes nichts erzählen.
»Für morgen Abend ist ein offizielles Abendessen mit den Mitarbeitern der Firma von Johns Klienten und ihren Lebensgefährten geplant. Deshalb hat John mich gebeten, mitzukommen; diese Art von Geschäftsleuten lernt wohl gern auch die Partner kennen.«
»Welche Art von Geschäftsleuten?«
»Europäische.«
Barnes grinst wissend, was er wahrscheinlich für charmant hält. Ist es aber nicht. Der schmierige Südstaatencharme, die ganze Art dieses Typen ist Ariel schon von Anfang an auf die Nerven gegangen.
»Ist Ihr Mann oft auf Geschäftsreise?«
»Ein paarmal im Monat, gewöhnlich für zwei oder drei Nächte, meistens in Europa.«
»Begleiten Sie ihn häufig?«
»Das ist das erste Mal. Wir haben beide viel zu tun, und es ist nicht leicht, Zeit zu finden, um gemeinsam zu reisen. Das einzige andere Mal waren unsere Flitterwochen.«
»Und wann war das?«
»Vor drei Monaten.«
Ariel kann an Barnes’ hochgezogener Augenbraue sehen, dass seine Theorie immer konkretere Formen annimmt – frisch verheiratet, vielleicht zankt ihr euch inzwischen ein bisschen, eigentlich kennst du diesen Mann gar nicht wirklich, vielleicht hat er dich einfach verlassen. Wer könnte ihm das verdenken? Der arme Kerl ist erst seit ein paar Stunden weg, und schon bist du in der Botschaft? Nimm mal eine Beruhigungspille, Lady.
»Und warum dieses Mal?«, fragt er. »Geschäftsreisen anderer Leute sind normalerweise nicht gerade ein Vergnügen.«
»Stimmt«, sagt Ariel. »Aber ich war noch nie in Portugal. Und alles, was ich für diese Reise tun musste, war, ein neues Kleid zu kaufen.«
»Keine so schreckliche Zumutung, oder?«
Ariel hatte das Kleid eigentlich nicht kaufen wollen. Sie war in der Regel sehr sparsam und interessierte sich auch nicht besonders für Mode. Als sie jung war, hatte sie natürlich all die Zeitschriften gelesen, die einem sagen, was man kaufen soll und wie man sich zum Sexobjekt machen kann – Make-up, Kleider, Schuhe, Waxing –, aber heute hat sie für solche Schlagzeilen keinen müden Blick mehr übrig, DIEHEIßESTEN F***-MICH-SCHUHE, ZEHNTIPPSFÜREINENFESTERENHINTERN, GIBIHMDENBESTEN B***JOBSEINESLEBENS. Nie wieder.
»Haben Sie heute schon Ihren Kontostand überprüft?«
Ariel ist überrascht von dieser Wendung, aber andererseits auch nicht. »Nein.«
»Meinen Sie nicht, dass Sie das tun sollten?«
Tut sie nicht. Und es gäbe auch gar nicht so viel abzuheben, selbst wenn das, was Barnes andeutet, wahr wäre. Was unmöglich ist.
»Warum verschaffen wir uns darüber nicht direkt Klarheit?«, schlägt Barnes vor. »Streichen es von unserer Liste.«
Ariel weiß, dass der einzige Grund, es nicht zu tun, Angst vor dem, was sie finden könnte, wäre. Die hat sie definitiv nicht.
»Wollen Sie meinen Computer benutzen?«
»Nein, danke.« Sie holt ihr Handy heraus. »Wie ist das WLAN-Passwort?«
Barnes kritzelt etwas auf einen Zettel und schiebt ihn ihr rüber. Sie tippt die Ziffern in ihr Handy und startet die Banking-App, wartet, bis das Log-in lädt, dann der nächste Bildschirm.
Ariels Puls fängt an zu rasen. Wird sie tatsächlich nervös? Sie sollte es besser wissen. Sie weiß es besser.
Das WiFi-Signal scheint stark zu sein, aber ihr Telefon reagiert nur langsam. Ariel vermutet, dass es sich um das Gegenteil einer sicheren Verbindung handelt, wahrscheinlich um ein Netzwerk, das ausdrücklich dazu gedacht ist, den Browserverlauf, die Bildschirme, die Tastenanschläge und die Passwörter aller Gäste, die es benutzen, aufzuzeichnen. Sie macht sich nicht wirklich Sorgen, dass das Außenministerium die viertausend Dollar auf ihrem Girokonto stehlen könnte, aber sie wird ganz kribbelig bei der Warterei auf das Laden der Seite, warten, warten …
Der Bildschirm öffnet sich endlich und zeigt den Kontostand genau so an, wie er sein sollte. »Alles in Ordnung.«
»Großartig«, sagt Barnes. »Das sind tolle Neuigkeiten.« Aber er ist sichtlich enttäuscht, dass er seine Theorie verwerfen muss: Ein attraktiver jüngerer Mann heiratet eine ältere Frau, räumt ihr Bankkonto leer und verschwindet in einem fremden Land, außerhalb der Reichweite der amerikanischen Strafverfolgung. Vielleicht würde sie das auch annehmen, wenn sie auf seiner Seite des Schreibtischs säße und mit einer Frau wie ihr konfrontiert wäre, die in einer Situation wie dieser auftaucht.
Ariel ist sich sehr wohl bewusst, dass sie hier beobachtet wird, von Kameras, von Menschen. Auf ihrem Weg durch die Büros sind ihr die vielen Objektive aufgefallen, sie kann sich nicht vorstellen, dass sich nicht auch in diesem Raum irgendwo eine Kamera befindet.
Kameras sind ihr nicht neu. Sie war in ihrer Jugend Schauspielerin und sich immer ihres Aussehens bewusst und dessen, was sie nicht nur durch gesprochene Worte und den Tonfall kommunizierte, sondern auch durch Mimik, Körpersprache, Fingerzittern, wippende Knie oder ausweichende Blicke, durch all diese Signale, die wir ständig senden, nicht nur, wenn wir auf der Bühne oder vor einer Kamera stehen, sondern immer, denn wir alle stehen unter Beobachtung, auf die ein oder andere Weise. Manchmal können wir es vergessen, ignorieren oder zumindest so tun, als ob wir das täten. Aber manchmal ist da auch eine echte Kamera, die uns wieder daran erinnert, in der Ecke eines Raumes wie diesem hier. Du wirst beobachtet. Du wirst aufgezeichnet.
Nach ein paar weiteren oberflächlichen Erkundigungen macht Barnes deutlich, dass er nicht gewillt ist, die örtliche Polizei einzuschalten oder andere Botschaftsbedienstete in die Suche nach John einzubeziehen.
»Gibt es denn nichts, was Sie tun können?« Ariel wirft ihm ihren flehendsten, rehäugigsten Blick zu. Darin war sie früher gut – ihr Aussehen zu nutzen, um Männer zu bezirzen, vor allem diejenigen, die nicht schlau oder selbstkritisch genug sind zu erkennen, dass sie manipuliert werden. Manche Männer sind von Natur aus misstrauisch gegenüber gut aussehenden Frauen, die übermäßig nett sind; Saxby Barnes gehört nicht zu ihnen.
Ariel beugt sich vor; sein Blick flackert, senkt sich bis zur Öffnung ihrer Bluse. »Bitte?«
Das ist eine Fähigkeit, die sie bewusst hat verkümmern lassen, eine, von der sie wünschte, sie hätte sie nie besessen, nie gebraucht. Eine Fähigkeit, von der sie wünschte, es gäbe sie gar nicht. Aber zähneknirschend muss sie zugeben, dass sie beim Verhandeln mit dem Patriarchat nützlich sein kann.
»Ms. Pryce, ich bin kein Polizist. Wir sind nicht …«
Bestürzt senkt sie den Kopf, und sie spürt förmlich, wie er die Gelegenheit nutzt, ihr weiter in die Bluse zu glotzen.
»So etwas tun wir hier nicht«, fährt er fort, »Leute aufspüren, die ihre, ähm, Gefährten für ein paar Stunden verlassen haben. Das ist wenn überhaupt Aufgabe der örtlichen Polizei, und ich hoffe aufrichtig, das ist nicht der Fall. Aber nur weil Ihr Mann heute Morgen das Hotel verlassen hat, ohne Ihnen etwas zu sagen, macht ihn das nicht zu einem Vermissten. Nur zu jemandem, der es eilig hat. Oder der rücksichtslos ist. Oder abgelenkt. All das ist viel wahrscheinlicher, als dass er zu Schaden gekommen ist, und nichts davon ist ein Verbrechen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir also nicht …«
Barnes bricht ab und hofft, dass Ariel einspringt und zustimmt, ja, ich verstehe. Aber das tut sie nicht. Er steht auf, streckt seine Hand aus und grinst schon wieder blöd. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen helfen.«
»Tun Sie das?«
Er nickt und versucht, in seiner offensichtlichen Unaufrichtigkeit besonders aufrichtig zu wirken. »Das tue ich.«
Sie ist enttäuscht. Nicht nur, dass er ihr nicht helfen will, sondern auch, dass sie ihn nicht umstimmen konnte, dass ein Mann, der so anfällig dafür zu sein scheint, ihrem Charme widerstehen kann.
Saxby Barnes wird nicht ihr Verbündeter sein. Ariel wird mit dem Lissabonner Polizisten besser dran sein, der zumindest ein sympathisches Gesicht hat und mit einer Frau zusammenarbeitet. Nicht viel, aber mehr als nichts, denn das ist es, was dieser amerikanische Funktionär anbietet. Nichts, plus eine Flasche Wasser. Mit Kohlensäure.
Ariel ist mehr als enttäuscht. Sie ist plötzlich wütend – auf diesen Mann, auf sich selbst, auf die Welt. Sie schleicht sich immer ganz plötzlich an, diese Wut. Wie ein Vulkan, der nach Jahren des Druckaufbaus ausbricht.
»Was für ein Name ist Saxby eigentlich?«
»Ein Familienname. Er geht zehn Generationen zurück.«
Als ob die bloße Tatsache, dass etwas Tradition hat, Bewunderung verdient oder Verteidigung. Genau dieselbe Rechtfertigung wurde für so ziemlich alle Ungerechtigkeiten in der Weltgeschichte verwendet.
»Er ist also was? Ihr stolzes Südstaatenerbe? Aus der guten alten Zeit?«
Das falsche Grinsen verblasst. »Genau.«
Ariel hält das für Schwachsinn. Sie hat reichlich Erfahrung aus erster Hand mit den heimtückischen, ätzenden Auswirkungen der Fetischisierung von Traditionen.
»Wie süßer Tee?«
Barnes lässt seine ungeschüttelte Hand sinken.
»Oder Sklaverei?«
Er bläht seine Brust auf, reckt das Kinn in die Höhe und will seine Ehre verteidigen, frustriert, dass er mit dieser Frau nicht streiten kann. Er ist so ritterlich! Außerdem ist es sein Job, zuvorkommend zu sein.
Ariel wendet sich ab und geht auf die Tür zu.
»Oh, Ms. Pryce?«
Irgendetwas an seinem Tonfall beunruhigt sie. Sie blickt über ihre Schulter.
»Haben Sie zufällig noch einen anderen Namen? Oder Ihr Mann?«
Kapitel 5
Tag 1, 11:27
Sie steht vor der Botschaft und wartet darauf, dass sich ihr Puls beruhigt, dass ihr Geist die Herrschaft über ihren Körper zurückgewinnt. Auf dem Gehweg hält eine Rucksacktouristin ihr Handy hoch und macht ein Foto von der Botschaft, mit Ariel im Vordergrund.
Ariel entsperrt ihr eigenes Telefon und öffnet nacheinander die verschiedenen Kommunikationsapps. Sie ist alt genug, um sich noch gut an das Leben vor dem Handy zu erinnern, ohne Apps, ohne computerausgestattete Autos, Smart-TVs und ferngesteuerte Thermostate. Sie glaubt nicht an die Unfehlbarkeit der Technik, hegt immer den Verdacht, dass der Wecker ausfällt, der Wetterbericht falsch ist, die Sprachnachricht nie angekommen ist.
Aber nein, es gibt nichts von John. Nichts von irgendjemandem, nirgendwo.
»Entschuldigen Sie bitte?« Ein Mann steht plötzlich neben ihr, und Ariel weicht zurück.
»Entschuldigen Sie«, wiederholt er. »Tut mir leid, wenn ich Sie störe.« Es ist der bärtige Mann, den sie in der Botschaft gesehen hat. »Mein Name ist Pete Wagstaff. Ich bin Reporter. Vielleicht kann ich Ihnen helfen?«
Ariel blinzelt ihn im blendenden Sonnenlicht an. Schweißperlen bilden sich in ihrem Nacken.
»Der Botschaft, wissen Sie, oft sind denen die Hände gebunden.« Er greift in seine Tasche und streckt ihr eine Visitenkarte entgegen. Ariel erkennt das Logo einer Nachrichtenagentur, Lissabon-Korrespondent, Telefonnummern, E-Mail, eine Büroadresse.
»Danke«, sagt sie. »Ich möchte nicht abweisend erscheinen, aber ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Es tut mir leid.«
Dieser Mann ist nicht so alt, wie er von der anderen Seite des Zimmers aus gewirkt hat. Er sieht auch besser aus, mit einer Sanftheit in den Augen, die Mitgefühl ausstrahlen.
»Hat Ihnen das jemand verboten?«
Ariel schüttelt den Kopf. »Ich … kann einfach nicht. Nehmen Sie es nicht persönlich.«
Er lächelt. »Okay. Aber wenn Ihnen eine Möglichkeit einfällt, wie ich helfen kann, egal was das Problem ist, melden Sie sich bitte. Ich kenne mich in dieser Stadt gut aus und bin immer erreichbar.«