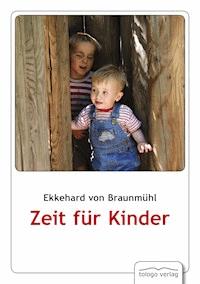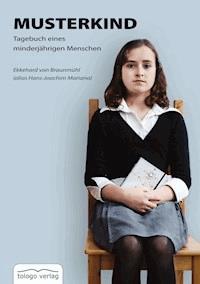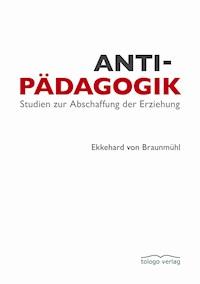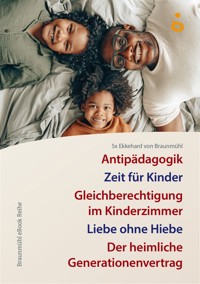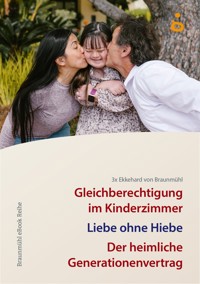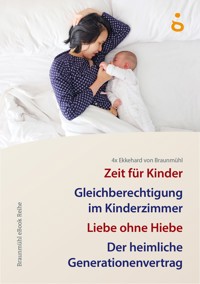
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tologo Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
4 Bücher von Ekkehard von Braunmühl in einem: Zeit für Kinder Zeit für Kinder ist ein eindringliches Plädoyer für Kinderfreundlichkeit, für das Recht des Kindes auf Freiheit, Achtung und Würde. Entgegen dem noch vorherrschenden naiven Sprachgebrauch ist Erziehung das Wort zur Bezeichnung von objektiv kinderfeindlichen, menschenfeindlichen, lebensfeindlichen Handlungen, die aus vordemokratischer und faustrechtlicher Tradition stammen, Machtansprüche durchsetzen und Herrschaftsgelüste befriedigen sollen, die Abhängigkeit von Kindern schamlos ausbeuten und Kindern gegenüber die allen Menschen in unserem Grundgesetz garantierten Rechte auf Achtung ihrer Würde und auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit mit Füßen treten. Wer Kinder erziehen will, will Kinder zerstören - ob er es schon weiß, oder ob er es noch nicht weiß: für die Kinder macht das keinen Unterschied. Gleichberechtigung im Kinderzimmer Die Autoren haben etwas im Angebot, was alle Machtkämpfe mit einem Schlag überflüssig macht und die darin gebundenen Energien für sinnvolle Dinge freiwerden läßt: das Prinzip der Gleichberechtigung zwischen den Generationen. Zwischen den Geschlechtern und Völkern ist Gleichberechtigung inzwischen zu einer fast selbstverständlichen Forderung geworden. Aber zwischen Kindern und Erwachsenen - geht denn das? Es geht. Und nicht nur das. Es ist ganz leicht. Viel leichter als der Machtkampf, in den viele noch verstrickt sind. Wie es geht, das verrät dieses Buch. Liebe ohne Hiebe Mit dem in diesem Buch vorgestellten Harmonie-Spiel wird ein neues Kapitel der menschlichen Lebenskunst aufgeschlagen. Auf der Grundlage eines originellen, leicht verständlichen Praxismodells über das Zusammenspiel von Gefühl und Verstand zeigen die Autoren, wie zwischenmenschliche Beziehungen auch in schwierigen Situationen friedlich und stabil bleiben und dadurch vernünftige Problemlösungen möglich werden. Dabei wird auf jeden moralischen Zeigefinger verzichtet, was dieses Buch zu einer besonders angenehmen und vergnüglichen Lektüre macht. Der heimliche Generationenvertrag Über nichts machen sich Erwachsene mehr Illusionen als über Kinder. Dabei haben sie selber an Leib und Seele erfahren, was es bedeutet, ein Kind zu sein. In Bezug auf Kinder sind sie Experten und Betroffene zugleich. Darum geraten sie fast zwangsläufig in Unsicherheit, häufig sogar in Streit miteinander, wenn es um die richtige Behandlung von Kindern geht. Dieses Buch zeigt aus einer distanzierten Position, welche Funktion Kinder für Erwachsene tatsächlich haben. Es lüftet den Schleier, den die vielen "offiziellen" Willensbekundungen über die wirkliche Rolle der Kinder gelegt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1362
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zeit für Kinder
Ekkehard von Braunmühl
»Das Jahr des Kindes«
Unsere Zeit könnte, sollte, müßte die beste Zeit für Kinder sein, die es je gab. Schließlich leben wir im »Jahrhundert des Kindes«, und das Jahr 1979 wurde von den Vereinten Nationen zum »Jahr des Kindes« erklärt. Zu keiner Zeit wurden Kinder mehr beachtet, wußten die Erwachsenen mehr über das Wesen von Kindern, über die Bedürfnisse von Kindern, über die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen sich Kinder am besten entwickeln. Zu keiner Zeit waren sich die Erwachsenen ihrer Verantwortung für das Gedeihen der Kinder stärker bewußt. Zu keiner Zeit wurden Kinder ernster genommen. In den reichen Staaten des Westens waren auch zu keiner Zeit die wirtschaftlichen und politischen Zustände für eine glückliche Kindheit günstiger: Hunger und Krankheiten sind weitgehend gebannt, die Winter haben ihre Schrecken verloren, es gibt mehr und bessere Wohnungen denn je, die Eltern haben immer mehr Freizeit, mit der Familienplanung steigt die Zahl der Wunschkinder, der letzte Krieg ist fast vergessen, Kinderarbeit längst abgeschafft, Kinderzimmer, Kindergärten und Schulen strotzen von förderlichem Lernmaterial wie Verfassungen, Gesetze, Bildungspläne von kinderfreundlichen Vorsätzen: Das Wohl des Kindes erhält immer mehr Vorrang, die freie Entfaltung der Persönlichkeit wird garantiert, die Würde des Menschen ist unantastbar, Selbstbestimmung und Mitbestimmung, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und andere vielversprechende Begriffe haben Hochkonjunktur – es könnte, sollte, müßte eine reine Lust sein, als Kind in dieser Zeit zu leben.
Aber: Irgendwie und irgendwo ist der Wurm drin. Kinder- und Jugend-lichenkriminalität, Kinder- und Jugendlichenalkoholismus, Kinder- und Jugendlichenselbstmorde, Drogenprobleme, Gewalttätigkeiten, Verhaltensstörungen – allein, daß es ein solches Wort gibt, signalisiert ein übel: Unterdrückte, mißhandelte, in ihrer Würde geschändete Kinder und Jugendliche nennt man nicht leidende Kinder und Jugendliche, nicht unglückliche Kinder und Jugendliche, man nennt sie »verhaltensgestört«. Zwar ist diese Mißachtung der Gefühlsebene nicht auf Kinder und Jugendliche beschränkt, aber sie wirkt sich ihnen gegenüber besonders drastisch aus, weil sie dem Urteil ihrer Umwelt stärker ausgeliefert sind als Erwachsene.
»Zeit für Kinder« kann also diese Zeit nicht meinen. Kindheit heute ist – nicht nur als Schulzeit – eine Zeit gegen Kinder. »Zeit für Kinder« meint aber auch nicht den oft zu hörenden Appell, Erwachsene sollten sich mehr Zeit für Kinder nehmen. Für mehr Zeit könnte man sich nur aussprechen, wenn es eine schöne Zeit wäre, die vermehrt werden sollte. Würde aber zwischen den Generationen Freundschaft statt Feindschaft herrschen, wäre dieser Appell überflüssig, weil die Erwachsenen von sich aus viel mehr Zeit mit Kindern verbringen würden als heute. Wer mit Kindern umgehen kann, liebt es, mit Kindern umzugehen. Aber so, wie es heute aussieht, stünde es noch viel schlimmer um unsere Kinder und Jugendlichen, wenn sich ihre Feinde mehr Zeit für sie nehmen würden.
»Zeit für Kinder« will so nur sagen, daß unsere Zeit eine gute Zeit für Kinder werden kann. Es ist nicht einmal besonders schwierig, das zu erreichen, aber es genügt nicht, es nur zu wollen. Deshalb sagt Ihnen dieses Buch, wie unsere Zeit eine gute Zeit für Kinder werden kann. Es ist gewiß nicht das erste kinderfreundliche Buch, aber es ist das erste, aus dem Sie erfahren, was Kinderfreundlichkeit wirklich ist.
Dieses Buch ist ein Lernbuch. Es will Ihnen nicht, wie die Erziehungsratge-ber, beibringen (»lehren«), wie Sie mit Kindern leichter fertig werden. Es will auch nicht Ihre Unsicherheit im Umgang mit Kindern abbauen. Es ist ein Lernbuch, ein Lerngegenstand, ein Gebrauchsgegenstand, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Unsicherheit im Umgang mit Kindern zu beseitigen. Ich habe zu diesem Zweck – nach den nötigen Informationen und Erörterungen – viele bewährte Rezepte aufgeschrieben, mit denen Sie die Schlußfolgerungen ziehen können, die Ihnen selbst gefallen und entsprechen. So ähnelt dieses Buch einem Kochbuch, dessen Rezepte allein ja auch niemanden sättigen. Die Arbeit des Kochens bleibt Ihnen überlassen, ebenso die Auswahl der Gerichte.
Mir ist sehr klar, daß meine »Speisen« nicht allen Leuten schmecken werden. Für Kinderfeinde und Machtmenschen habe ich dieses Buch nicht geschrieben. Aber wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, im Prinzip mit Kindern gerne gut auskommen möchten, werden Sie in diesem Buch die Antworten auf viele Fragen finden, die bisher einfach falsch gestellt worden sind. Und es ist kein Wunder, hängen doch die meisten Fachleute, die uns Ausbildung und Rat in bezug auf Kinder geben, einer Ideologie an, die von Anfang bis Ende kinderfeindlich ist.
Sie werden jetzt, wenn Sie meine bisherigen Arbeiten nicht kennen, wahrscheinlich stutzen. Aber ich kann Ihnen das nicht ersparen. Sie werden vermutlich noch mehrere Überraschungen erleben, wenn Sie sich den Inhalt dieses Buches erarbeiten, erobern. Manche scheinbaren Selbstverständlichkeiten muß man in Frage stellen, manche falschen Sicherheiten muß man aufgeben, um sich von all den Lügen zu befreien, die über Kinder verbreitet werden.
Aber nicht nur Kinder, auch Erwachsene, insofern sie pädagogische Laien sind, möchte dieses Buch in Schutz nehmen vor jenen kinderfeindlichen Fachleuten, denen Sie wahrscheinlich bisher vertraut haben. Diese Fachleute scheinen es darauf anzulegen, ihr Publikum immer mehr zu entmutigen, ratloser und unsicherer zu machen, damit es nicht auf die Idee kommt, sie seien vielleicht überflüssig oder sogar schädlich. Dagegen will ich zeigen, daß Sie Ihre Probleme selbst lösen können, wenn Sie sich aus dem Bann, aus der Vormundschaft jener Ratschläger befreien.
Um diesen Prozeß nicht unnötig zu erschweren, verzichte ich in diesem Buch fast völlig auf Zitate, auf Zurschaustellung meines Leseeifers und auf komplizierte Streitereien, die nur unter Wissenschaftlern interessant sind. Insbesondere von Lesern der »Antipädagogik« hörte ich manchmal, das Buch sei zu schwer verständlich. Ich mußte zwar zunächst eine Arbeit vorlegen, die auch formal wissenschaftlichen Ansprüchen genügte und von einem pädagogischen Fachverlag veröffentlicht wurde, damit mir niemand mangelnde Kenntnisse vorwerfen konnte, aber inzwischen ist diese Arbeit so anerkannt, daß ich mich jetzt ohne Ängstlichkeit und in der mir gemäßen, sehr persönlichen Weise an ein, wie man so sagt, breites Publikum wende – also an alle Menschen, die an Kinderfreundlichkeit interessiert und bereit sind, ein Buch mit Aufmerksamkeit zu lesen. Andere Voraussetzungen – etwa bezüglich einer »Vorbildung« – sind nicht erforderlich. Ein wenig Mut, vielleicht, für manche. Und die Abneigung, belogen und betrogen zu werden. (Die ist jedenfalls das Hauptmotiv für meine Arbeit, falls Sie das interessiert. Es geht mich ja recht wenig an, was Sie mit irgendwelchen Kindern anstellen. Es tut mir aber weh, macht mich oft verzweifelt, wütend und krank, wenn ich sehe, welche Opfer bestimmte Lügen fordern – ganz gleichgültig, ob sie aus gutem oder bösem Willen oder aus Dummheit verbreitet werden.)
Dieses Buch ist ein Lernbuch, weil man Kinderfreundlichkeit und Sicherheit im Umgang mit Kindern nicht lehren, sondern nur lernen kann. Ich möchte es außerdem als eine Waffe verstanden wissen, als Waffe im antipädagogischen Freiheitskampf, den ich für den überfälligen und einzig sinnvollen Freiheitskampf unserer Zeit und Weltgegend halte. Mit diesem Gedanken spreche ich besonders diejenigen Leserinnen und Leser an, die meine bisherigen Arbeiten schon kennen. Sie werden bemerken, daß ich nur die notwendigen Wiederholungen bringe, um mich nicht immerzu hinter jene Bücher zurückziehen zu müssen, da es ja um einen Vormarsch geht. Und weil ich glaube, in wesentlichen Punkten entscheidend vorangekommen zu sein (ohne daß in jedem Problembereich schon das letzte Wort gefallen wäre, aber letzte Wörter gibt es in diesem geschichtlichen Felde ohnehin nicht zu ernten), bitte ich Sie, die Tauglichkeit dieses Buches als »Waffe« sorgfältig zu prüfen.
Betrachtet man den gegenwärtigen Stand der Dinge, kann einem der Verdacht kommen, die Menschheit habe mit ihren bisherigen Freiheitskämpfen wenig Glück gehabt. Vielleicht muß man gerade deshalb heute so oft betonen, wie »freiheitlich« unsere Gesellschaft ist…
Freiheit unterscheidet den Menschen vom instinktgebundenen Tier, Freiheit ist des Menschen höchstes Gut und tiefstes Verlangen. »Im Gegensatz zu der weitverbreiteten Meinung, daß dieses Verlangen nach Freiheit ein Erzeugnis der Kultur und speziell durch Lernen konditioniert sei, legt ein umfangreiches Tatsachenmaterial nahe, daß es sich beim Verlangen nach Freiheit um eine biologische Reaktion des menschlichen Organismus handelt. Ein Phänomen, das diese Ansicht stützt, ist die Tatsache, daß im ganzen Verlauf der Geschichte Völker und Klassen gegen ihre Unterdrücker gekämpft haben, wenn nur irgendeine Aussicht auf Sieg bestand, und oft auch dann, wenn diese Aussicht nicht vorhanden war. Die Geschichte der Menschheit ist in der Tat eine Geschichte ihres Kampfes um Freiheit, eine Geschichte der Revolutionen«. So schreibt der berühmte Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Professor ERICH FROMM in seinem Hauptwerk »Anatomie der menschlichen Destruktivität« (rororo 7052, S. 223). Und er fügt eine Fußnote an, die ich vollständig zitieren will, weil sie so treffend die Gründe für den antipädagogischen Freiheitskampf benennt und aufzeigt, in welchem Sinne das vorliegende Buch als »Waffe« zu gebrauchen ist. ERICH FROMM schreibt:
»Die Revolutionen, die sich in der Geschichte ereignet haben, sollten nicht die Tatsache verdecken, daß Kleinkinder und Kinder auch Revolutionen machen, daß sie aber infolge ihrer Machtlosigkeit ihre eigenen Methoden, nämlich sozusagen die der Guerilla-Kriegführung, anwenden müssen. Sie kämpfen gegen die Unterdrückung ihrer Freiheit mit unterschiedlichen individuellen Methoden, die von einem eigensinnigen negativen Verhalten, der Weigerung, zu essen und sich zur Sauberkeit erziehen zu lassen, vom Bettnässen bis zu den drastischeren Methoden einer autistischen Abwendung von der Außenwelt und einer Pseudodebilität reichen. Die Erwachsenen benehmen sich dabei wie jede Elite, deren Macht man den Kampf ansagt. Sie wenden physische Gewalt an, oft in Verbindung mit Bestechungsversuchen, um ihre Stellung zu behaupten. Die Folge ist, daß die meisten Kinder nachgeben und lieber kapitulieren, als sich ständig quälen zu lassen. In diesem Krieg kennt man kein Erbarmen, bis der Sieg errungen ist, und unsere Hospitäler sind voll von den Opfern dieser Methoden. Trotzdem ist es eine bemerkenswerte Tatsache, daß alle menschlichen Wesen – die Kinder der Mächtigen wie die der Machtlosen – die Erfahrung gemeinsam haben, daß sie einmal machtlos waren und um ihre Freiheit gekämpft haben. Es ist daher anzunehmen, daß jedes menschliche Wesen – von seiner biologischen Mitgift ganz abgesehen – sich in seiner Kindheit ein revolutionäres Potential erworben hat, das zwar lange schlummern, aber unter bestimmten Umständen auch wieder mobilisiert werden kann.«
Das »revolutionäre Potential«, die Sehnsucht nach Freiheit und die Fähigkeit zur Freiheit, die in jedem Menschen schlummern, können nach meinen langjährigen Erfahrungen als Antipädagoge außerordentlich erfolgreich gerade in Erwachsenen mobilisiert werden, die mit Kindern zu tun haben. Zumal Kinder und Jugendliche heutzutage seltener »kapitulieren«, sondern immer aggressiver und auffälliger gegen ihre Unterdrückung kämpfen – nicht zuletzt deshalb, weil sie mehr von »Freiheit« und »Mündigkeit« erzählen hören als irgendeine Jugend zuvor. Es ist höchste Zeit geworden, sich zu entscheiden, ob man Ernst machen will mit der Freiheit – und dann muß man die »bestimmten Umstände«, von denen FROMM sprach, herstellen – , oder ob man auf GEORGE ORWELLS Vision von »1984« – die totale Manipulation und Kontrolle durch den »Großen Bruder« – zusteuern will. Wenn Sie mich fragen: Ich würde im Zweifelsfalle lieber auf die kleine Schwester hören…
Auch wenn Sie schon wieder stutzen sollten, ist diese Idee nicht abwegig, sondern zeitgemäß. Bereits im Jahre 1961 hat die international anerkannte Kulturanthropologin MARGARET MEAD die sogenannte »präfigurative« Kulturstufe als die kommende erkannt, als den notwendigen »neuen Stil«, durch den »Der Konflikt der Generationen« (so der deutsche Titel ihres Buches, das 1974 als dtv-Band 1042 erschien) einzig gelöst werden kann: »Ich nenne diesen neuen Stil den präfigurativen, weil das Kommende in dieser neuen Kultur vom Kind und nicht mehr von Eltern und Großeltern repräsentiert werden wird.« (S. 104)
So wie MARGARET MEAD die Geschichte in drei verschiedene Kulturepochen teilt, beschreibt der ebenfalls überall anerkannte Psychohistoriker LLOYD DE MAUSE (in dem 1974 von ihm herausgegebenen Buch »Hört ihr die Kinder weinen – Eine psychogenetische Geschichte der Kindheit«, 1977 bei Suhrkamp erschienen) sechs verschiedene Formen der Eltern-Kind-Beziehungen, wie sie sich von der Antike bis heute entwickelt haben. Die 5. Form (19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts, also etwa 1950) nennt er »Sozialisation«, bei der Eltern versuchen, das Kind »auf den rechten Weg zu bringen, es anzupassen, es zu sozialisieren«. Dazu bemerkt DE MAUSE: »Die meisten halten die Beziehungsform Sozialisation noch immer für das einzige Modell, in dessen Rahmen die Diskussion über die Fürsorge für Kinder weitergeführt werden kann.« (S. 84) Dagegen stellt DE MAUSE als zeitgemäße Beziehungsform heraus:
»6. Form: Unterstützung (ab Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts): Die Beziehungsform Unterstützung beruht auf der Auffassung, daß das Kind besser als seine Eltern weiß, was es in jedem Stadium seines Lebens braucht. Sie bezieht beide Eltern in das Leben des Kindes ein; die Eltern versuchen, sich in die sich erweiternden und besonderen Bedürfnisse des Kindes einzufühlen und sie zu erfüllen. Bei dieser Beziehungsform fehlt jeglicher Versuch der Disziplinierung oder der Formung von »Gewohnheiten«. Die Kinder werden weder geschlagen noch gescholten, und man entschuldigt sich bei ihnen, wenn sie einmal unter großem Streß angeschrien werden. Diese Form verlangt von beiden Eltern außerordentlich viel Zeit, Energie und Diskussionsbereitschaft, insbesondere während der ersten sechs Jahre, denn einem kleinen Kind dabei zu helfen, seine täglichen Ziele zu erreichen, bedeutet, ständig auf es einzugehen, mit ihm zu spielen, seine Regressionen zu tolerieren, ihm zu dienen, statt sich von ihm bedienen zu lassen, seine emotionalen Konflikte zu interpretieren und ihm die für seine sich entwickelnden Interessen erforderlichen Gegenstände zur Verfügung zu stellen. Bisher haben nur wenige Eltern konsequent versucht, in dieser Form für ihre Kinder zu sorgen. Doch aus den vier Büchern, die Kinder beschreiben, die im Rahmen der Beziehungsform Unterstützung aufgewachsen sind, geht klar hervor, daß sich in diesem Rahmen Kinder entwickeln, die freundlich und aufrichtig und nicht depressiv sind, die einen starken Willen haben und sich durch keine Autorität einschüchtern lassen.« (S. 84 f)
Von den Büchern, die LLOYD DE MAUSE anführt, ist bei uns erst der Band »Freie Kindererziehung in der Familie« von PAUL und JEAN RITTER erschienen (Rowohlt 1972). Meine eigenen Erfahrungen mit meiner und einer Reihe anderer Familien sowie die Berichte meiner Leser und Gesprächspartner bestätigen aber die vorstehende Beschreibung der Kinder vollständig. (Freie Kinder erkennen übrigens echte Autoritäten durchaus an, sie lassen sich bloß von falschen nicht einschüchtern – was echte überhaupt nicht probieren.) Trotzdem muß ich DE MAUSE in einem Punkt widersprechen. Es ist nicht wahr, daß die Beziehungsform Unterstützung von den Eltern mehr Zeit oder Energie fordern würde. Eher ist das Gegenteil der Fall. Zwar macht der Umgang mit freien Kindern allen Eltern so viel Freude, daß sie möglichst viel Zeit für ihn aufbringen (statt sie z.B. mit dem Fernseher totzuschlagen oder für unnötige Geldrafferei einzusetzen), aber ich kenne auch Familien und einzelne Elternteile, die hart arbeiten müssen und wenig Zeit für ihre Kinder haben. Dies stört aber keineswegs die Qualität der Beziehungen und die Freiheit der Kinder. Freie Kinder gleichen die manchmal fehlende Unterstützung schon im Alter von etwa drei Jahren in bewundernswerter Weise aus. Das »Argument« (ich kenne es zur Genüge), man habe nicht genug Zeit, so kinderfreundlich zu sein, ist eine höchstfaule Ausrede. Es ist allemal schöner für das Kind, einen Freund seltener zu sehen, als einen Feind öfter. Im Gegenteil: Je weniger Zeit man hat, desto wichtiger ist es, wie man sie gestaltet – sozialisierend (erzieherisch) oder unterstützend. Und wer wirklich mit seiner Zeit und Energie sparsam umgehen will oder muß, der braucht nur daran zu denken, wieviel davon die Erzieherei üblicherweise verschlingt.
Ich möchte betonen, daß weder MARGARET MEAD noch LLOYD DE MAUSE mit ihren Einteilungen irgendwelche Forderungen erheben; sie analysieren nur, sie stellen dar, was ohnehin passiert. Die Frage ist allerdings, ob das, was da passiert, in eine Katastrophe mündet, weil so viele Leute – und gerade auch Fachleute – sich weigern, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Zeit für Kinder heißt Freiheit für Kinder, sonst ist es mit der Freiheit überhaupt vorbei. Freiheit ist kein Luxus und auch keine Utopie. Sie ist die Notwendigkeit unserer Zeit.
Daß es viele Mißverständnisse gerade über die Beziehung zwischen Kindern und Freiheit zu bereinigen gibt, ist klar. Deshalb habe ich dieses Buch ja geschrieben. Es muß aber auch klar sein, daß Freiheit die Lösung des Rätsels um gute, schöne, erfreuliche, beglückende Beziehungen zwischen Menschen, vor allem auch zwischen Erwachsenen und Kindern ist. Es gibt da (mindestens) zwei Betrachtungsweisen und Blickrichtungen. Nach der einen, der politischen, ist Freiheit – und zumindest in den entwickelten Ländern der Erde besonders Freiheit für Kinder – die Gretchenfrage um Tod oder Leben. »Links und rechts, fortschrittlich und konservativ, kapitalistisch und sozialistisch bezeichnen keine wichtigen Gegensätze mehr. Nur noch eine Parteinahme zählt: für den Tod oder für das Leben.« So schreibt der Familienrichter HELMUT OSTERMEYER in seinem heftig umstrittenen Buch »Die Revolution der Vernunft« (Fischer Taschenbuch 6368, S. 2), wobei »Tod« ebenso für »Unfreiheit« stehen kann und »Leben« für »Freiheit«.
Diese Betrachtungsweise ist ungeheuer wichtig, aber sie bringt nicht viel ein, wenn unser Sohn gerade eine schlechte Note geschrieben hat. Für den alltäglichen Umgang mit Kindern ist eine persönliche Sichtweise angemessener, die jedoch genauso parteiisch ist wie die politische. Wem am Glück und Erfolg der Kinder, mit denen er umgeht, liegt, der kann (durch dieses Buch gesichert) Partei für seine Kinder ergreifen, Partei für Kinderfreundlichkeit ebenso wie für die Freiheit und das Leben.
Ob Sie dann unbedingt vom »antipädagogischen Freiheitskampf« und diesem Buch als »Waffe« sprechen, ist nebensächlich. Wichtig ist allein, daß wir uns aufrappeln und an allen Fronten, also persönlich und politisch, für Leben, Freiheit, Kinderfreundlichkeit – sei es kämpfen, sei es werben. Lehrbares Wissen ist dafür nicht genug. Viele Leute wissen, daß Übergewicht und Rauchen und Saufen und Bewegungsarmut erhebliche Gesundheitsrisiken darstellen, aber sie richten sich eben nicht danach. Schon gar nicht könnte man sagen, es fehlte den Leuten am Wissen in bezug auf Kinder. Wissen kann auch belasten (es ist kein Geheimnis, daß gerade Fachleute die verkorkstesten Kinder haben), und es kann zum Nachteil der Kinder, gegen die Kinder, eingesetzt werden (Kinderfeinde können heute Kinder viel raffinierter quälen als früher). Außerdem gibt es wohl kaum Erwachsene, die unausgesetzt unfreundlich zu Kindern sind. Sie wissen also, wie man freundlich ist. Was sie nicht wissen und was man ihnen auch nicht lehren kann, was sie aber ausprobieren und selbständig lernen können, ist, aus welchen Gründen sie oft daran gehindert sind, so freundlich (unterstützend) zu sein, wie sie eigentlich sein wollen. Für diese Menschen ist mein Buch als Lernbuch gedacht, das ihnen zu neuen Erfahrungen verhelfen kann im Sinne von LLOYD DE MAUSE, der sagt: »Was den Eltern in der Vergangenheit fehlte, war nicht Liebe, sondern eher die emotionale Reife, die nötig ist, um das Kind als eine eigenständige Person anzuerkennen.« (S. 35)
Gegen jene anderen, die immer noch behaupten, man müsse Kinder erzieherisch bekämpfen bzw. sozialisieren, kann es notfalls als Waffe dienen, wenn sie weiterhin Lügen verbreiten, um ihre eigene emotionale Unreife zu übertünchen und andere in Unsicherheit zu halten. Irren ist menschlich, aber es ist unmenschlich, auf einem Irrtum zu beharren, der so viel Leiden unter die Menschen bringt und so viele Kinder unfreundlich macht.
Das internationale »Jahr des Kindes« sollte die Weltöffentlichkeit hauptsächlich auf die Not von Kindern in Entwicklungsländern aufmerksam machen. In unserer Gegend liegen die Probleme anders. Beispielsweise haben wir einen dramatischen Geburtenrückgang zu verzeichnen, während andernorts von »Bevölkerungsexplosion« berichtet wird. Hierzulande gilt ja die Zurückhaltung beim Kinderkriegen manchen Leuten als Zeichen von Kinderfeindlichkeit – ein Beweis schon, wie verwirrt die Begriffe in Sachen Kinder sind.
In den meisten Staaten der Dritten und Vierten Welt muß massiv für Empfängnisverhütung geworben werden, also für den Verzicht auf oder die Verminderung von körperlich-biologischer Fortpflanzung. In unserer Gegend ist die geistig-seelische Fortpflanzung das Problem: Sie funktioniert nicht mehr, aber sie wird noch nicht aufgeben, denn dazu gehört eben »emotionale Reife«. Die aber wird behindert durch jenen Irrtum (bzw. Betrug), der zwar historisch verständlich, aber in unserer Zeit nicht aufrecht zu erhalten ist. Er bildet den Kern des Hauptproblems unserer Kinder, den Kern der (oft künstlich erzeugten) Unsicherheit ihrer ausgewachsenen Mitmenschen. Wenn diese Unsicherheit beseitigt ist, werden auch wieder mehr Kinder geboren werden…
Obwohl also Kinderfreundlichkeit durch bloßes Wissen und Verstandestätigkeiten nicht zu sichern ist, können neue Erfahrungen gemacht werden, neue Reifungsprozesse einsetzen und neue Traditionen wachsen, wenn falsches Wissen und falsches Denken widerlegt und aufgeklärt wird. So wie falsche Informationen schädliche Auswirkungen haben, kann auch die Aufklärung überholter und gefährlicher Verwirrtheiten nicht wirkungslos bleiben. Manche Erwachsene haben bereits umgelernt und werden von ihren Kindern reich belohnt. Aber es bleibt, in unserer Gegend, eine Aufgabe ersten Ranges, den Irrtum, der Erziehung heißt, in großem Stile und in allen Kreisen aufzuklären. Diese Aufgabe muß von jedem Menschen, der Leben und Freiheit liebt, in Angriff genommen werden, sonst läuft die Zeit für Leben und Freiheit ab. Auch die Zeit für Liebe, für Vernunft, für Sinn, für Glück, für Mitmenschlichkeit, für Demokratie, auch die Zeit für ganz banale Elternfreuden – und auch die Zeit für Kinder.
I. Erziehung gelungen – Zögling kaputt
1. Die Kinderfeindlichkeit der Erziehungsideologie
Was ist Kinderfeindlichkeit?
Es gibt heute wahrscheinlich keinen einzigen vernünftigen Menschen mehr, der die Kinderfeindlichkeit unserer Gesellschaft bestreitet. Weniger eindeutig wird diese Beurteilung, wenn man sich Gründe und Auswirkungen im einzelnen betrachtet. Viele Analysen verstricken sich schon dann in ausweglose Widersprüche, sobald sie genauer bestimmen wollen, was mit den Begriffen »Kinderfeindlichkeit« und »Gesellschaft« eigentlich gemeint ist. Sind die Architekten kinderfeindlich, die so viele Stadtteile in Betonwüsten verwandelt haben? Sind die Bauherren kinderfeindlich, die solche Entwürfe ausführen lassen? Sind die Eltern kinderfeindlich, die in ein solches Hochhaus einziehen und ihren Kindern obendrein die kleinsten Zimmer zuweisen?
Architekten, Bauherren und Mieter sind sicherlich Mitglieder »der Gesellschaft«, aber viele von ihnen würden sich heftig dagegen wehren, wenn man sie persönlich als Kinderfeinde bezeichnete. Sie mögen höchst freundliche und liebevolle Gefühle für Kinder haben, und das gleiche gilt auch für die verantwortlichen Politiker, Städteplaner, Verkehrsexperten usw., die für die Wohnumwelt unserer Kinder zuständig sind.
An diesem Beispiel wird schon der Widerspruch deutlich zwischen den Gefühlen irgendwelcher Erwachsener und dem, was diese Erwachsenen Kindern trotzdem antun. In vielen anderen Bereichen ist es ebenso; man denke nur an die Schule.
Das Problem besteht darin, daß Erwachsene häufig kinderfreundliche Gefühle in sich vorfinden, daß sie aber dennoch vieles tun, was Kinder als Unfreundlichkeiten empfinden müssen.
Am kernigsten findet sich dieses Problem in dem Satz ausgedrückt: »Wen man liebt, den züchtigt man.« Beklagen sich mißhandelte Kinder dann, hören sie womöglich noch den Satz: »Ich, meine es doch nur gut mit dir.«
Es wäre nun verfehlt, dieser Versicherung keinen Glauben zu schenken. Die meisten Eltern und Erzieher meinen es mit den meisten ihrer Kinder meistens gut. Um dem Problem auf die Spur zu kommen, muß man unterscheiden zwischen dem, was Erwachsene in bezug auf Kinder fühlen, meinen und beabsichtigen, und dem, wie dies von Kindern aufgefaßt wird. Großangelegte Untersuchungen haben immer wieder ergeben, daß in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr zwei Drittel der Erwachsenen sich für außerordentlich kinderfreundlich halten, der gleiche Prozentsatz der Erwachsenen aber spricht sich nachdrücklich für die Prügelstrafe aus. Da stellt sich die Frage, was bei den Kindern stärker ankommt: die Liebe oder die Hiebe.
Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, wie es scheint. Zwar will ich das Prügeln keinesfalls verharmlosen oder gar verteidigen: Es gibt aber zahlreiche Menschen, die häufig körperliche Strafen erlitten und dennoch in ihrer Entwicklung verhältnismäßig weniger gestört wurden als andere Menschen, die mit milderen, feineren Methoden dressiert worden sind. Wenn Eltern, Erzieher und Lehrer Kinder quälen wollen, sind sie ja nicht auf Prügel angewiesen; eine Tracht Prügel kann wie ein Gewitter sein, das schnell vorüberzieht, und danach ist die Stimmung oft wieder heiter. Man stelle sich aber vor, wie es auf Kinder wirkt, wenn eine Erzieherin das Dreijährige, über das sie sich gestern geärgert hat, heute einfach nicht begrüßt, oder wenn ein Lehrer einen empfindsamen Schüler vor der Klasse blamiert, oder wenn eine Mutter oder ein Vater einem Kind den üblichen Gutenachtkuß verweigert. Unzählige andere Beispiele sind möglich. In den letzten Jahren, seit ich als »Antipädagoge« bekannt bin und auf öffentlichen Veranstaltungen und Fachtagungen, in Schulen, Volkshochschulen und Universitäten, als Seminar-Leiter oder im Rahmen der Kinderschutzarbeit über Erziehungsfragen diskutiere, versicherten mir Tausende von Eltern, daß sie ihre Kinder außerordentlich frei erziehen, daß sie sehr kinderfreundlich sind, daß sie; ihre Kinder bestimmt niemals quälen. Frage ich dann, welche Schwierigkeiten sie mit ihren Kindern hätten, weil sie mich ja ohne solche kaum angesprochen haben würden, erfahre ich mit erschreckender Regelmäßigkeit Einzelheiten, angesichts derer man von »Freiheit« und »Kinderfreundlichkeit« wahrhaftig nicht sprechen kann. Aber allein die Tatsache, daß Eltern sich freimütig zu ihren häufig sehr gemeinen Maßnahmen bekennen, beweist mir, wie wenig sie wissen, was sie da eigentlich tun.
Die Liebe des Erziehers
Viele Erwachsene glauben, ihre Kinderfreundlichkeit dadurch zu beweisen, daß sie Kinder nicht schlagen. Sie wissen nicht, daß Prügel unter Umständen kinderfreundlicher sein können als andere Erziehungsmaßnahmen.
Es ist klar, hier kommt es entscheidend auf das »unter Umständen« an. Diese Einschränkung bedeutet folgendes: Wenn ein Erziehender ein Kind wirklich liebt und glaubt, das Kind aus Liebe prügeln zu müssen, dann kommt bei dem Kind beides an, die Hiebe wie die Liebe. Denn Kinder spüren nicht nur die Schläge auf der Haut, sondern sie erspüren – gewissermaßen unter der Haut, um nicht zu sagen: in der Seele – auch das Grundgefühl des Erwachsenen, das sein Verhalten verursacht.
Aber umgekehrt ist es ebenso. Wenn ein Erziehender ein Kind in Wirklichkeit ablehnt, mag er ihm mit noch so honigsüßem Lächeln seine Lieblingssendung im Fernsehen anschalten, damit das Kind ihn nur in Ruhe läßt und brav bleibt: Auch hier kommt beides an, in einer Floskel gesagt: der Spaß wie der Haß. Denn Kinder lassen sich zwar Belohnungen und Vergünstigungen gefallen, aber sie erspüren auch hinter diesen sehr genau das Grundgefühl und die Absicht des Erwachsenen.
Alle Erfahrungen über die Ursachen seelischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen zeigen: Hiebe aus Liebe sind weniger schlimm als Spaß aus Haß. Aber auch Hiebe aus Liebe sind schlimm genug, sind kinderfeindlich.
Denken wir jetzt einmal nicht an die Gefühle der Erwachsenen, sondern an die Gefühle der Kinder. Wir können davon ausgehen, daß Spaß aus Liebe von Kindern ohne Probleme als gut und schön erlebt wird, während sie Hiebe aus offenem Haß eindeutig als Zeichen der Feindschaft empfinden. (Ich vernachlässige hier die Tatsache, daß es Hiebe auch aus unbewußtem Haß gibt. Ich komme später darauf zurück.) Natürlich sind Kinder, die von einem wichtigen Beziehungspartner gehaßt werden, keinesfalls zu beneiden, sie sind deshalb aber nicht automatisch verlorene Geschöpfe. Viele Kinder lernen es, mit dem Haß, der ihnen entgegengebracht wird, umzugehen und sich etwa anderen Menschen anzuschließen. Doch braucht uns dieses Problem nur am Rande zu beschäftigen, weil jemand, der ein Kind wirklich haßt (und das auch weiß), dieses Buch nicht lesen wird. Er wird auch kaum unsicher sein im Umgang mit diesem Kind. Die Unsicherheit, über die heute so viel geklagt wird, kommt in der Regel nur bei Erwachsenen zustande, deren Grundgefühl ein liebendes ist. Sie möchten möglichst alles »richtig« machen. Diese Erwachsenen sind gut beraten, wenn sie sich die Erscheinung Hiebe aus Liebe einmal vom Kinde her durchdenken (schon um zu verstehen, warum Kinder gegen diese Liebesbezeigungen protestieren, welcher Protest die ursprüngliche Liebe der Erwachsenen im Laufe der Zeit erheblich zu beeinträchtigen pflegt).
Wie schon gesagt können allerdings andere Erziehungsmaßnahmen Kinder mehr quälen als Prügel. In der Floskel »Hiebe aus Liebe« möchte ich deshalb alle Maßnahmen zusammenfassen, mit denen Kinder von sie liebenden Erwachsenen erzogen, das heißt prostituiert, das heißt einem fremden Willen unterworfen werden sollen.
Ich nehme als Beispiel das erzieherische Fernsehverbot. Was geht in einem Kind vor, das von seinen Eltern etwa wegen einer schlechten Schulnote, sprich wegen »Faulheit«, mit drei Tagen Fernsehverbot belegt wird? Wir haben zugestanden, daß die Eltern es mit dem Kind gut meinen, aber was fühlt das Kind dabei?
Einerseits fühlt es die Liebe der Eltern. Es spürt, daß die Eltern das Kind wichtig nehmen, daß sie sich um es sorgen, daß sie ihm helfen wollen. Ich behaupte allen Ernstes: Gäbe es nicht diese Begleiterscheinung der pädagogischen Bestialitäten im Alltag unserer Kinder, man brauchte keinen antipädagogischen Freiheitskampf zu führen, weil die Kinder sich spätestens beim Schuleintritt massenweise umbringen würden.
Der Preis des Überlebens
Wir wissen ja, wie viele Kinder, die von ihren Eltern in der übelsten Weise gepeinigt werden, trotzdem an ihnen hängen und das Verhalten der Eltern oft sogar heftig verteidigen. Die Psychoanalytiker nennen diese Erscheinung »Identifikation mit dem Angreifer«. Kinder, die als schlecht beurteilt und demgemäß schlecht behandelt werden, wenden – unbewußt – einen seelischen »Trick« an: Sie spalten ihre Persönlichkeit in zwei Teile. Der eine Teil übernimmt das Urteil der übermächtigen Erwachsenen und erklärt den anderen Teil für schlecht. Damit schränkt das Kind zwar die Entwicklung seiner Gesamtpersönlichkeit entscheidend ein, aber es kann wenigstens weiterleben. Würde es den genannten Trick nicht anwenden, sondern sich vollständig dem Gefühl ausliefern, in den Augen seiner es doch liebenden Eltern schlecht (bekämpfenswert, z.B. durch ein Fernsehverbot) zu sein, es müßte allen Lebensmut und damit alle Lebenskraft verlieren. Indem das Kind aber die Liebe der Eltern erspürt, kann es einen Teil seiner Persönlichkeit mit ihnen identifizieren (gleichsetzen) und diesen Teil für wertvoll und wichtig halten.
Aber der Preis, den der Abwehrmechanismus der Identifikation mit dem Angreifer kostet, ist hoch. Das Kind überlebt, doch es hält einen Teil von sich für schlecht. Das Kind fühlt sich geliebt und wichtig genommen, doch es fühlt auch, daß seine Eltern gute Schulnoten noch mehr lieben, noch wichtiger nehmen.
Jedes Kind, das von liebenden Eltern Erziehungsmaßnahmen unterworfen wird, nimmt außer der Liebe auch zur Kenntnis, daß seinen Eltern die angestrebten Erziehungsziele (Sauberkeit, Ordnung, Pünktlichkeit, Fleiß, Ehrlichkeit und so weiter) wichtiger sind als sein Wohlbefinden.
Bleiben wir bei unserem Beispiel. Ein Kind erhält wegen einer schlechten Schulnote bzw. wegen seiner »Faulheit« drei Tage Fernsehverbot. Das Kind kann nun durchaus einsehen, daß diese Maßnahme ihm helfen soll, daß seine Eltern es also gut mit ihm meinen. Die Eltern können ihm auch einreden, daß diese Maßnahme keine Strafe sei – die Untauglichkeit von Strafen als Erziehungsmittel spricht sich ja allmählich herum. Das Kind kann sogar, wenn genügend Erfahrungen und Drohungen vorausgegangen sind, das Fernsehverbot für gerecht halten und ausdrücklich damit einverstanden sein. Vielleicht nutzt es die so »gewonnene« Zeit tatsächlich, um für die Schule zu lernen. (Ich nehme also jetzt die jeweils günstigsten Umstände an.)
Ganz gleich, was das Kind vielleicht für die Schule lernt; für das Leben lernt es mit Sicherheit, daß seine Eltern es nicht lieben, wie es ist, sondern daß sie ihre Liebe mit Bedingungen verknüpfen. Solche bedingte Liebe enthält aber das Gift der Angst. Das Kind nimmt das Fernsehverbot hin aus Angst, seine Eltern könnten es noch schlimmer treiben. Das Gift der Angst zersetzt die Liebe. Das ursprüngliche, spontane und durch und durch vernünftige Gefühl des noch nicht persönlichkeitsgespaltenen Kindes kann aus Maßnahmen, die ihm Leiden bereiten, das Motiv der Liebe nicht mehr erschließen. Das Kind kann den Worten der Eltern glauben, sie meinten es gut, aber in den Stunden, in denen es konkret leidet (etwa weil seine Kameraden jetzt bestimmte Sendungen sehen können), wird es keine Liebe fühlen, weder von den Eltern, noch für die Eltern. Während es sich nach außen hin fügt, toben in ihm Angst, Haß und Rachegefühle. Die irrwitzige (pädagogische) Gedankenkonstruktion der Eltern, jemandem Leid zuzufügen, weil man ihn liebt, kann von einem gesunden, ungeteilt Fühlenden nicht nachvollzogen werden. Das Kind muß sich minderwertig fühlen, solange es Autoritäten nicht zufriedenstellt. Es wird seine unerträglichen Minderwertigkeitsgefühle ausgleichen durch Leistungswut, Autoritätshörigkeit und umgekehrt durch Intoleranz und Herrschlust. Der Erziehungskrieg hat sich in die Seele des Kindes hineinverlagert, von nun an kämpft es gegen sich selbst und jagt nach äußerem Schein, nach Besitz, nach Macht, nach allen möglichen Ersatzwerten, die ihm doch den Frieden mit sich selbst nicht wiedergeben können.
Die geopferte Gegenwart
Jeder Mensch fühlt nur in der Gegenwart. Seine Gedanken mögen sich in der Vergangenheit oder in der Zukunft aufhalten – die Gefühle, die sie auslösen, sind jeweils gegenwärtig. Angst vor morgen ist jetzige Angst, Hoffnung auf übermorgen ist jetzige Hoffnung, Vorfreude ist jetzige Freude, Ärger über gestern ist jetziger Ärger.
Viele Eltern quälen Kinder heute aus einer Liebe heraus, die das morgen meint. Aber die in die Zukunft gesendete Liebe kann von Kindern nicht empfangen werden.
Viele Eltern bekämpfen ihre Kinder (z.B. deren »Unarten«) aus Liebe, aber die Kinder fühlen, daß diese Liebe nicht ihnen selbst gilt, sondern den Erziehungszielen der Eltern. Ein Zweck kann eine Handlung heiligen; aber wenn die Gegenwart eines Kindes durch Erziehungsmittel einem Erziehungszweck geopfert wird, dann wird das Kind selbst als Mittel zum Zweck betrachtet und behandelt. Die Würde des Kindes wird mißachtet, die Würde des Zweckes verraten.
Das Kind kann ein sicheres Selbstgefühl und Selbstbewußtsein nur entwickeln, wenn es von seinen wichtigen Beziehungspartnern in der jeweiligen Gegenwart bedingungsloses Angenommensein erfährt und erfühlt. Diese Tatsache läßt sich mit Erziehungsakten nicht vereinbaren.
Ein Fernsehverbot mag gut gemeint sein und von Liebe getragen. Das Kind jedoch empfindet es als unfreundlichen Akt. Kinder empfinden sämtliche Erziehungsmaßnahmen, die ihr augenblickliches Wohlgefühl beeinträchtigen, als unfreundliche Akte. Sie sind ja auch als solche gedacht! Ich kenne eine Reihe von Eltern, die ihre Kinder gelegentlich verprügeln und glaubhaft versichern, sie litten unter den Schlägen mehr als die Kinder. Es müsse aber eben sein, sonst…
Die pädagogische Einstellung
Hier enthüllt sich eine Einstellung, die hinter den einzelnen Erziehungsmaßnahmen steckt. Diese Einstellung ist vom Kinde aus gesehen prinzipiell kinderfeindlich, sie stiftet die Erwachsenen jedem neuen Kind gegenüber zur Eröffnung des Erziehungskrieges an, sie vergiftet auch die innigste Vater- und Mutterliebe.
HELMUT OSTERMEYER hat in seinem Buch »Die Revolution der Vernunft« diese Erkenntnis meisterhaft und konsequent verarbeitet.
Ich führe hier zwei wesentliche Absätze an:
»Das Ende der Erziehung macht den Weg frei für die unverfälschte Äußerung der Liebe. Wieviel Kinder zweifeln an der Liebe ihrer erziehungsgläubigen Eltern und wieviel Eltern beteuern den Kindern krampfhaft und schuldbewußt, sie liebten es trotzdem und wollten ja nur sein Bestes! Wer sein Kind liebt, der schlägt es. Die Oberschicht erzieht statt mit Schlägen mit Liebesentzug. Wer sein Kind liebt, der entzieht ihm die Liebe, heißt der Spruch dort. Fürwahr eine überzeugende Volksweisheit!
Ich sage nicht, daß Eltern, die ihre Kinder erziehen, sie nicht lieben. Aber sie machen sich die Liebe schwer und zuletzt kaputt. Das dauernde Herumerziehen führt zum Kriegszustand. Das Kind verteidigt seine Bedürfnisse und Rechte. Die Eltern verfolgen ihre kindfremden Ziele: Ein dauernder Stellungskampf vergiftet die Familie. Die Strafen, die die Eltern verhängen, erschüttern das Vertrauen und entfremden die Generationen. Friede ist nur möglich ohne Erziehung.« (S. 186 f)
Kinderfreundliche Gefühle von Eltern und anderen Erwachsenen mögen noch so sehr überwiegen, guter Wille und wohlmeinende Absichten gegenüber Kindern mögen noch so weit verbreitet sein; wie ein Tropfen Arsen genügt, eine große Menge reinsten Wassers oder gesündester Milch zu vergiften, genügt eine kleine Beimengung an pädagogischer Einstellung, an erzieherischer Ambition, an auf Zöglinge gerichtetem Ehrgeiz, damit aus kinderfreundlichen Absichten kinderfeindliche Folgen entspringen. Beispielsweise braucht jeder Mensch, um das für seine Gesundheit, seine Leistungs- und Glücksfähigkeit unbedingt erforderliche Selbstvertrauen zu erwerben und zu erhalten, von seinen wichtigen Beziehungspartnern nichts dringender als Vertrauen. Ein Mensch kann nur Selbstvertrauen entwickeln und damit, sozial gesehen, auch vertrauenswürdig werden und bleiben, wenn er mindestens einen anderen Menschen hat, der ihm Vertrauen entgegenbringt. Bevor ein Mensch sich als vertrauenswürdig erweisen kann, benötigt er also aus seiner Umgebung einen Vertrauensvorschuß. Der Mensch ist nicht ein erziehungsbedürftiges Wesen (wie die Erziehungsideologie behauptet), er ist – mit dem österreichischen Psychotherapeuten GERHARD BRANDL und seinem schönen Buch »Erziehen ohne verwöhnen« (Verlag Jugend und Volk, Wien und München 1977) zu sprechen: ergänzungsbedürftig, und in unserem Zusammenhang muß man sagen, er ist vertrauensbedürftig.
Die erzieherische Grundhaltung wird aber in ihrem Kern von Mißtrauen geprägt. Wenn ich glaube, einen Menschen bestimmten Maßnahmen aussetzen zu müssen, damit er bestimmte Ziele erreicht, dann gebe ich ihm mein Mißtrauen zu verstehen, er könne oder werde diese Ziele ohne meine Maßnahmen nicht erreichen. Und so, wie Vertrauen gewissermaßen ansteckend wirkt, wirkt auch Mißtrauen. Pädagogisch eingestellte Erwachsene begegnen Kindern mit einem Mißtrauensvorschuß. Kein Wunder, daß Selbstvertrauen, Vertrauenswürdigkeit und Vertrauensfähigkeit zu den im Aussterben befindlichen Eigenschaften gehören…
Die beiden Arten von Kinderfeindlichkeit
Ich fasse die Antwort auf die Frage« Was ist Kinderfeindlichkeit?« wie folgt zusammen:
Es gibt zwei Arten von Kinderfeindlichkeit, die subjektive und die objektive. Die subjektive Kinderfeindlichkeit ist das Gefühl, Kinder nicht zu mögen oder sie sogar zu hassen. Die meisten Erwachsenen sind nicht subjektiv kinderfeindlich.
Objektive Kinderfeindlichkeit ist nicht ein Gefühl von Erwachsenen, sondern eine Erscheinung, die sich von ihren Objekten, den Kindern her bestimmt. Objektive Kinderfeindlichkeit drückt sich in Einstellungen und Verhaltensweisen aus, unter denen Kinder leiden oder die Kinder schädigen. Die meisten Erwachsenen heute sind objektiv kinderfeindlich. Alle Erziehungsmaßnahmen sind objektiv kinderfeindlich. Interesselosigkeit für Kinder ist ebenso objektiv kinderfeindlich wie die pädagogische Einstellung.
Ich will nun niemandem seine objektive Kinderfeindlichkeit vorwerfen. Jede Einstellung und Sichtweise, auch die unerfreulichste, hat ihre Gründe, die zu respektieren sind. Der antipädagogische Freiheitskampf soll nicht gegen Menschen geführt werden, sondern gegen falsche Überzeugungen und gegen widerlegte Ideologien.
Fragen zur objektiven Kinderfeindlichkeit
Es gibt nach meinen rund zwölf jährigen Erfahrungen mit Antipädagogik keinen durchschnittlich denkfähigen Menschen, der die Berechtigung ihrer grundsätzlichen Aussagen nicht verstanden hat, wenn er sich mit ihnen nur tatsächlich auseinandersetzte. Ich werde noch zeigen, warum ich es für aussichtslos halte, Menschen, die diese Auseinandersetzung scheuen, überzeugen zu wollen. Man kann nur jemanden aufklären, der aufgeklärt werden will, also ein Gespür für die Wolken und Nebelschwaden schon hat, die seine Wahrnehmungen verzerren, ihm die Wirklichkeit verschleiern. Die Aufklärung gerade einer so intimen Angelegenheit, wie es die Einstellung zu Kindern ist, muß anknüpfen können an eben die Liebesbereitschaft und den guten Willen, den sie als unzureichend entdeckt. Sie muß Menschen enttäuschen, d.h. ihre Täuschungen korrigieren, aber sie kann ihre Motive nicht verändern. Wer an falschen Überzeugungen und an widerlegten Ideologien festhalten will, hat dafür ebenfalls Gründe, die zu respektieren sind. Allerdings muß man vor solchen Menschen Kinder zu schützen versuchen.
Subjektiv kinderfreundliche Erwachsene, denen ihre Beziehungen zu Kindern wichtig genug sind, um sich Anteile objektiver Kinderfeindlichkeit eingestehen zu können, mögen ihr Denken und Handeln an einigen Fragen überprüfen.
Opfere ich manchmal das gegenwärtige Wohlbefinden des Kindes meinen Wünschen für seine Zukunft auf?Muß das Kind Angst haben, ich könnte es unfreundlicher behandeln oder weniger lieben, wenn es sich nicht nach meinen Wünschen richtet?Nehme ich im Falle von Konflikten manchmal für bestimmte Wertvorstellungen (Sauberkeit, Pünktlichkeit usw.) und gegen das Kind Partei?Hege ich Mißtrauen gegen die Fähigkeit oder den Willen des Kindes, sich in Selbstbestimmung persönlich und sozial erfreulich zu entwickeln?Wenige Leser werden alle vier Fragen mit einem glatten Nein beantworten. Auch in meinem persönlichen Umgang mit Kindern kommt gelegentlich ein kleines Ja vor. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der unausgesetzt objektiv kinderfreundlich gewesen wäre. Ich halte es sogar für gut, weil Kinder im Schatten eines solchen Übermenschen schwerlich zur vollen Entfaltung kämen. Niemand kann sich immerzu so benehmen, daß seine Mitmenschen darüber beglückt sind. Es gibt aber eine fünfte Frage, die den vier anderen übergeordnet ist und eine eindeutige Antwort verlangt.
Glaube ich, wenn ich Kinder unfreundlich, mißtrauisch usw. behandle, dies sei im Interesse der Kinder nötig?Wer diese Frage uneingeschränkt mit Nein beantworten kann, hat Antipädagogik im Prinzip verstanden. Die Beziehungen mit den Kindern seines Umgangs werden sich zwangsläufig verbessern. Seine Unsicherheit gegenüber Kindern ist schon auf dem Rückzug, denn er hat die Erziehungsideologie theoretisch überwunden und wird mit den Rezepten im II. Teil dieses Buches keine Schwierigkeiten haben.
Wer weiß, daß er als Erwachsener es manchmal nötig hat, erzieherisch zu handeln – weil ihm keine Zeit zum Überlegen bleibt oder weil er nervös oder wütend oder hilflos ist-, der hat den entscheidenden Schritt zur Freundschaft mit Kindern getan. Man braucht unter Freunden nicht andauernd freundlich zu sein. Man wird aber kaum Freunde finden, wenn man glaubt, sie hätten es nötig, schlecht behandelt zu werden, und Unfreundlichkeit sei für sie gut und förderlich.
Hintergründe der Erziehungsideologie
Es ist mir bewußt, daß mein antipädagogisches Engagement mich dazu verführt, die Kinderfeindlichkeit von Erziehungstheorien und -praktiken stärker hervorzuheben als die Kinderfeindlichkeit von ungeplanten, unbeabsichtigten, auch unbewußten Einflüssen auf Kinder. Ebenso kümmere ich mich bei meinen Analysen selten um die Tatsache, daß viele Kinder nicht nur unter Erziehungsakten leiden, sondern auch unter Vernachlässigung.
Ich pflege dieser Versuchung nachzugeben, weil gegenwärtig die Meinung, man müsse Kinder unbewußt quälen oder bewußt vernachlässigen, nicht vertreten wird. Im Gegenteil arbeiten sehr viele ausgezeichnete Aufklärer daran, den Erwachsenen Verständnis für die Bedürfnisse von Kindern nahezubringen, sie auf die Kinderfeindlichkeit von Vernachlässigung, unbeabsichtigten Einflüssen und Gedankenlosigkeit aufmerksam zu machen.
Deshalb konzentriere ich meine Arbeit auf die Entlarvung der Erziehungsideologie. Ich kann mir keinen größeren Skandal und keinen zerstörerischeren Wahnsinn vorstellen als die Rolle, die Kindern in unserer der Idee nach demokratischen Gesellschaft ganz offiziell zugewiesen wird. Dabei liegt die Betonung auf dem »ganz offiziell«. Um ein Beispiel zu nennen: In jeder Gesellschaft passieren Verbrechen, gibt es Vorurteile, Haß usw. Das ist nicht schön und muß auch nicht unbedingt so bleiben, aber es ist doch eine Erscheinung, mit der auch ein anständiger Mensch zu leben lernen kann. Sobald aber Verbrechen, Vorurteile, Haß ganz offiziell zur Norm erklärt werden, muß meiner Meinung nach ein anständiger Mensch aktiven Widerstand leisten. Die faschistische und die pädagogische Einstellung haben dieselben Wurzeln und vergleichbar unheilvolle Folgen. Nach dem Zweiten Weltkrieg klagte man lauthals über die Millionen Deutschen, die dem Faschismus keinen Widerstand leisteten, die keine Antifaschisten wurden. Ich kann nur hoffen (und dafür arbeiten), daß es keiner ähnlichen Katastrophe bedarf, um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sich einige Leute Antipädagogen nennen und gegen das unermeßliche Leid ankämpfen, das die offizielle Erziehungsideologie nicht nur Kindern, sondern ebenso Eltern und der gesamten Gesellschaft zufügt.
Aber wie gesagt, der antipädagogische Freiheitskampf richtet sich nicht gegen Menschen, auch nicht gegen Pädagogen. Ich kenne viele ausgezeichnete Pädagogen, die sich ihrer Berufsbezeichnung nicht schämen und sich doch – zunehmend auch in der Öffentlichkeit – zur Antipädagogik bekennen. Jeder Mensch guten Willens wird seine Einstellung im antipädagogischen Sinne zu ändern versuchen, wenn er die Folgen der pädagogischen Einstellung verstanden hat.
Das Ansehen von Kindern
Dieses Verständnis möchte ich meinen Leserinnen und Lesern so gut ich kann erleichtern. Um Berechtigung und Notwendigkeit von Antipädagogik zu verstehen, muß man wissen, was Pädagogik ist. Nun gibt es da zu viele Definitionen und Standpunkte, als daß ich hier in Einzelheiten gehen könnte. (Für Studienzwecke verweise ich auf das Buch »Antipädagogik«.) Inzwischen ist mir ein neuer Ansatz eingefallen, mit dem ich bei zahlreichen Veranstaltungen gute Erfahrungen gemacht habe. Immer wenn ich ihn anbot, fand ich mehrheitliche (manchmal auch einhellige) Zustimmung zu dem Programmpunkt »Gleichberechtigung des Kindes« (siehe Fischer Taschenbuch 6338). Dieser Ansatz befragt die verschiedenen Erziehungstheorien nicht nach Nützlichkeit, Wahrheit usw., sondern nach der Rolle, die Kinder in ihnen spielen. Welcher Status wird Kindern zugebilligt, welches »Image« haben Kinder im Lichte dieser Theorien?
Es ist ja für das Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein auch des erwachsenen Menschen von entscheidender Bedeutung, welches Ansehen er in seiner Umgebung genießen kann. Ein »angesehener« Mensch mit »gutem Namen« und »gutem Ruf« fühlt sich grundsätzlich besser als ein übel beleumundeter. Die Menschen nehmen ihr Ansehen so wichtig, daß einige von ihnen, denen es nicht gelingt, auf sozial geachteten Wegen sich den Respekt ihrer Umwelt zu verschaffen, sogar sozial geächtete Wege beschreiten, um wenigstens als Verbrecher Respekt zu verdienen. Viele Menschen sind darauf angewiesen, Angst um sich zu verbreiten, weil sie nach ihren Erfahrungen auf Zuneigung nicht zu rechnen wagen. Jeder Mensch will sich Achtung verschaffen, weil er sie für seine (lebensnotwendige) Selbstachtung braucht. Findet er diese Achtung nicht auf die eine Weise, so sucht er sie auf die andere.
Das Wort »Ansehen« scheint mir in diesem Zusammenhang am besten geeignet, den Sachverhalt zu beschreiben. Zumal man heute weiß, wie wichtig es für das positive Lebensgefühl von Kindern ist, ob sie von ihren Beziehungspartnern freudig (»mit glänzenden Augen«) angesehen werden oder nicht. Indem das Wort »Ansehen« gleichzeitig einen subjektiven (ich will angesehen sein) und einen sozialen Bestandteil (ich kann dieses Ansehen nur von anderen Menschen bekommen) enthält, kann man es unschwer als eine Funktion des Gemeinschaftsgefühls erkennen, das nach ALFRED ADLERS Erkenntnis im Menschen als sozialem Wesen immer schon angelegt ist. Freilich kann dieses Gemeinschaftsgefühl gegen die Gemeinschaft gerichtet werden, wenn die Gemeinschaft ein Kind als ihren Feind ansieht. Deshalb die Fragen: Als was werden Kinder von Erziehungstheorien angesehen? Und welches »Ansehen« gewinnen sie daraus vor ihrer Umgebung und vor sich selbst? Die Antwort ist leicht (wenn auch folgenschwer):
Sämtliche Erziehungstheorien haben eines gemeinsam: Sie sehen Kinder als Zöglinge an, als Erziehungsobjekte, als Unreife, als nicht Vollwertige – letztendlich als Gefahr für die Gemeinschaft. Kindheit wird als Durchgangsstadium gesehen, als Vorstufe des richtigen Menschentums. Der vordemokratische Satz „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ bildet den Hintergrund jeglicher Erziehungstheorie.
In der »Antipädagogik« habe ich diese Behauptung mit einer Fülle von modernen erziehungswissenschaftlichen Zitaten bewiesen. Inzwischen hat die Berliner Lehrerin KATHARINA RUTSCHKY mit ihrer Quellensammlung »Schwarze Pädagogik« (Ullstein Taschenbuch 3318) den endgültigen – und erfreulich vielbeachteten – Nachweis erbracht, daß die Pädagogik, das pädagogische Denken und Handeln, die pädagogische Einstellung, schon seit 200 Jahren nichts anderes ist als ein mörderischer Krieg gegen Kinder. Diese Analyse ist besonders wertvoll, weil KATHARINA RUTSCHKY zu dem Ergebnis kommt, daß die moderne Pädagogik für diesen Krieg immer raffiniertere Waffen schmiedet und ihn immer unnachsichtiger und konsequenter führt. Die Pädagogik ist also keineswegs kinderfreundlicher geworden, seit das Prügeln und ähnliche Brutalitäten offiziell nicht mehr »in« sind.
Ich war etwas traurig darüber, daß KATHARINA RUTSCHKY die »Antipädagogik« nur in einer recht unverständigen Anmerkung erwähnte; wahrscheinlich hat sie mein Buch nicht lesen können, bevor das ihre in Druck ging. So fehlt bei ihr jeder Ansatz einer positiven Alternative. Zu vermuten ist allerdings, daß dies auch an ihrer »materialistischen« Sichtweise liegt: Wer der Theorie anhängt, man könne im Rahmen der bestehenden Verhältnisse ohnehin nichts machen (außer Revolution), der hört natürlich mit seinem Denken gerade dann auf, wenn es spannend zu werden verspricht. Demgegenüber betont LLOYD DE MAUSE (»Hört ihr die Kinder weinen«, S. 14): »Die Evolution der Eltern-Kind-Beziehungen bildet eine unabhängige Quelle historischen Wandels.« Das heißt, die Evolution, Entwicklung der Erwachsenen zu mehr emotionaler Reife ist nicht abhängig von Gesellschaftssystem, Produktionsverhältnissen usw. – wie diejenigen glauben, die immer behaupten, zuerst müsse alles andere anders werden, bevor auch in Seele und Geist der Menschen Verbesserungen möglich sind. Das pädagogische Denken ist eine eigenständige Größe – der schönste Sozialismus (angeblich ohne Herrschaft von Menschen über Menschen) hat noch nicht begriffen, daß die Herrschaft des Kapitals und der Kapitalisten eine Sache ist; eine ganz andere Sache dagegen ist die altersbedingte Herrschaft von Menschen über Menschen (die wesentlich von der Erziehungsideologie am Leben erhalten und verteidigt wird).
Inzwischen gibt es aber immer mehr, zum Teil sehr preiswerte Bücher, die das Ansehen von Kindern als Erziehungsobjekte bekämpfen. Ich erwähne nur die Arbeit von DONATA ELSCHENBROICH: »Kinder werden nicht geboren« (Frankfurt 1977) und das leidenschaftliche Plädoyer für die Gleichberechtigung des Kindes, das CHRISTIANE ROCHEFORT mit ihrem Buch »Kinder« (München 1977) vorgelegt hat. Dieses Vordringen des antipädagogischen Denkens läuft parallel mit den Fortschritten der Antipsychiatrie – hier möchte ich jedem Interessenten das Buch »Freiheit heilt« von SIL SCHMID (Berlin 1977) empfehlen, einen leicht verständlichen Bericht über die Praxis der italienischen Antipsychiatrie, die unwahrscheinlich anmutende Erfolge zu verzeichnen haben. Insgesamt besteht für mich überhaupt kein Zweifel mehr daran, daß es in absehbarer Zeit gelingen wird, der weiteren Pädagogisierung vieler Lebensbereiche Einhalt zu gebieten und viele weitere wieder – wie es die deutschen Pädagogikprofessoren HARTMUT VON HENTIG und HEINRICH KUPFFER bisher erfolglos forderten – zu entpädagogisieren.
Ursprünglich hatte ich vor, in diesem Buch an dieser Stelle einige populäre und fortschrittliche Erziehungsratgeber, wie man so sagt, »in die Pfanne zu hauen«. Ich wollte die totalitäre, faschistoide, jedenfalls antidemokratische Grundtendenz, auch die Lügen und die schlichte Dummheit dieser Autoren entlarven und sie dem Hohn und Spott der Verständigen preisgeben.
Mittlerweile fürchte ich, ein solches Vorgehen wäre unfair. Seit dem Erscheinen meiner beiden ersten Bücher habe ich so viele aufgeschlossene Menschen kennengelernt, daß es mir immer weniger Spaß macht, anderen, die es nicht besser wissen – oder wußten – , eins auszuwischen. Ich bin auf die Millionenauflagen bestimmter kinderfeindlicher Autoren zwar nicht weniger neidisch als früher, aber die vielen Freunde, die ich inzwischen fand, haben mir ermöglicht zu lernen, mit diesem Neid besser umzugehen. Vielleicht ist es auch so, daß die Auseinandersetzung mit Autoren, die kinderfeindliche Theorien vertreten und entsprechende Ratschläge erteilen, eine Art Selbstbefriedigung meinerseits bedeutete und dem Versprechen, meinen Leserinnen und Lesern Sicherheit im Umgang mit Kindern zu ermöglichen, entgegenliefe. Ich will deshalb über die Hintergründe der Erziehungsideologie anders als vorgesehen schreiben. Und ich will auch nicht mehr lange erklären, warum und wieso, sondern fange einfach an. Und zwar mit einer
Zwischenfrage: Wußten Sie schon, was Freiheit ist?
»Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Ketten.« Mit diesem Satz beginnt das Buch »Der Gesellschaftsvertrag« von JEAN-JACQUES ROUSSEAU. Es erschien im Jahre 1762 und wurde eine wesentliche Grundlage für die französische Revolution wie für alle anderen Freiheitsbewegungen danach. Der Name ROUSSEAU steht noch heute für die Ideen von Freiheit und Gerechtigkeit, gegen Willkür und Herrschaftsgelüste totalitärer Machthaber. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, der Bürger von Genf, gilt unbestritten als der bedeutendste Vorkämpfer der heute zumindest auf dem Papier allgemein anerkannten Menschenrechte. Sein Freiheitsbegriff ist allerdings reichlich verworren. Zum Beispiel spricht er davon, daß jeder, der der Gemeinschaft den Gehorsam verweigert, zu diesem Gehorsam »gezwungen werden soll; das hat keine andere Bedeutung, als daß man ihn zwingen werde, frei zu sein«. (Reclam-Ausgabe 1968, S. 48) Der Widerspruch ist offenkundig, denn nach dem normalen Verstande schließen sich Zwang und Freiheit gegenseitig aus.
Unklarheit und Widersprüchlichkeit des Wortes »Freiheit« sind auch nach 200 Jahren philosophischen Bemühens nicht ausgeräumt. 1974 veröffentlichte die Philosophin JEANNE HERSCH, Bürger von Genf wie ROUSSEAU, ein Buch mit dem Titel »Die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen« (Benziger Verlag, Zürich und Köln). Dort sagt sie zum Beispiel: »Frei sein heißt, etwas ganz Bestimmtes unbedingt wollen; es schließt jede Wahl aus. Es bedeutet, von einem absoluten Willen geradezu besessen zu sein und auf ein bestimmtes Ziel zugetrieben zu werden.« (S. 48)
Auch hier wundert sich der schlichte Verstand, wieso Freiheit jede Wahl ausschließen und Besessenheit und Getriebenwerden bedeuten soll. Der Mensch wird frei geboren, und überall ist er in Ketten? Kein Wunder, finde ich, wenn er so mit Begriffen jongliert, daß schließlich jeder etwas anderes meint, und oft genug das Gegenteil. So wurden früher Mädchen »gefreit«, was wenig anderes bedeutete als ihre lebenslängliche Sklaverei. Und sie wehrten sich nicht einmal. Sie gaben ihre Freiheit freiwillig auf.
Trotz seiner Widersprüchlichkeit ist das Wort »Freiheit« ein zentraler Begriff unseres Lebens. Subjektiv, konkret und praktisch wissen wir ganz gut, was Freiheit ist, nämlich der mehr oder weniger gesicherte, mehr oder weniger große Spielraum für eigene Entscheidungen und Handlungen. Vollkommene Freiheit wäre dann gegeben, wenn schlichtweg jeder tun und lassen könnte, was er will. (Die übliche Einschränkung, die Freiheit des einen ende an der Freiheit der anderen, ist bei dieser Formulierung im Grunde überflüssig, denn wenn jeder tun und lassen kann, was er will, ist ja vorausgesetzt, daß jeder die Freiheitsrechte der anderen achtet.)
Aber selbstverständlich gibt es keine vollkommene Freiheit. Beispielsweise kann ich nicht drei Frauen gleichzeitig küssen, und wenn ich das noch so sehr will. Jeder Freiheitsspielraum ist begrenzt durch die wirklichen Möglichkeiten, sowohl die inneren wie die äußeren. Nun ist sich über die äußeren Begrenzungen normalerweise jedermann klar – auch der entschlossenste Erzieher kann ein Kind nicht verprügeln, solange er es nicht in seiner Gewalt hat. Mit den inneren Begrenzungen ist es schwieriger. Offenkundig ist noch, daß jemand nicht Englisch sprechen kann, der diese Sprache nicht gelernt hat. Eine tieferliegende Begrenzung wären etwa Geschmacksfragen – ich kann mich nicht freuen, wenn mich jemand zum Rosenkohlessen einlädt, weil mir Rosenkohl nicht schmeckt, auch wenn ich dem Gastgeber noch so gern gefallen will. Am schwierigsten wird es mit den inneren Begrenzungen des Freiheitsspielraumes, wo bewußte oder gar unbewußte seelische Fähigkeiten in Frage stehen. Am medizinischen Begriff der Zwangsneurose etwa wird deutlich, daß es Menschen gibt, die in bestimmten Bereichen inneren Zwängen vollkommen ausgeliefert sind. Hier von »Freiheit« zu sprechen oder an die Willenskraft solcher Patienten zu appellieren, wäre gänzlich sinnlos.
Der unbewußte innere Zwang bei Patienten mit neurotischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen verhindert, daß sie tun können, was sie wollen. Dieser Zwang betrifft aber in der Regel nur Teilbereiche der Persönlichkeit, außerdem gilt er als krankhaft. Als normal gilt heute noch in vielen Kreisen, daß Menschen überhaupt nicht wollen können, was sie selbst wollen. In der üblichen Gewissenserziehung wird Kindern mindestens mit der Drohung des Liebesentzugs angewöhnt, daß sie nur wollen, was sie wollen sollen. Gelingt diese Gewissenserziehung, dann ist die Freiheit ihres Opfers ebenso eine Illusion wie die des Zwangsneurotikers. Es gibt keine eigenen Entscheidungen, die Stimme des Gewissens verkündet den Willen der Erzieher, der Zögling ist eine bloße Marionette geworden. (Eine Marionette ist eine Puppe, die keinen eigenen Willen hat, sondern sich an Fäden bewegt, wie der Puppenspieler es will.) Jetzt kann der äußere Freiheitsspielraum so groß sein wie er will, der gewissenbehaftete Mensch kann ihn nicht nutzen. Er kann zwar tun, was er will, aber sein Wille gehört ihm nicht selbst. Er wurde innerlich versklavt. »Innerlich versklavt« bedeutet: Er wird sich seiner Sklaverei nicht bewußt, er identifiziert sich mit seinen Angreifern (um wenigstens zu überleben). Er fühlt sich zwar verschwommen unwohl bis verzweifelt, aber anders als ein äußerlich versklavter Mensch kennt er den Grund dafür nicht, gibt sich selbst die Schuld, kann keinen Widerstand leisten. Die Behauptung, ein Mensch, der dem ihm eingepflanzten Gewissen gehorcht, sei ein freier Mensch, ist blanker Hohn und Zynismus. Ebenso die Behauptung, dieser Gehorsam sei ein freiwilliger. Ein gut dressierter Dackel bringt auch »freiwillig« die Zeitung. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
(Doch! Kennen Sie »die königliche Kunst der Freiheitsdressur«? Das geht so: »Ein Pferd soll die ›Pirouette‹ erlernen. Die Longe wird ihm also um den Hals gelegt, das Pferd wird nun ›von der Longe abgewickelt‹. Es dreht sich dabei, etwas anderes bleibt ihm ja nicht übrig. Diese Pirouette-Probe wird viele Male wiederholt, bis das Pferd die Drehungen auf Zuruf von selber, ohne Longe, ausführt.« Tolle Freiheit, nicht wahr? Und doch können unsere Kinder nur neidisch werden, wenn sie lesen: »Ein Pferd darf niemals geschlagen werden, es wird sonst ängstlich und nervös.«
Oder noch schöner, über die Dressur von Schweinen: »Einem Kind darf man mit dem Stock drohen, einem Hund mit der Peitsche, einem Schwein jedoch darf man höchstens einen Strohhalm zeigen!« Der berühmte Erziehungsreformer CARL HAGENBECK über die »alten« Methoden: »Was man früher unter Dressur verstand, verdiente diesen Namen durchaus nicht. Viel eher hätte man alle jene Prozeduren als Tierquälerei bezeichnen dürfen, während die heutige Dressur wirklich den Namen einer Schule verdient.« Und wie sah es in der reformierten Tierschule aus? »Jetzt wurde nicht mehr mit Gewaltmethoden gearbeitet, sondern ausschließlich die Geschicklichkeit und Intelligenz der vierbeinigen Schüler genutzt. Geduld einerseits und Liebe zum Tier waren selbstverständliche Voraussetzungen der Dressur geworden.« – Nachzulesen in dem Buch »Dressuren und Dompteure« von HERMANN DEMBECK, Bayerischer Landwirtschaftsverlag 1966, Pflichtlektüre für alle Pädagogik-Studenten!)
Als Schlußfolgerung scheint nun das Problem »Freiheit« gar nicht so kompliziert zu sein. Wir wissen aus unserer alltäglichen Erfahrung, daß Freiheit dort ist, wo wir einen möglichst großen und sicheren Spielraum für eigene Entscheidungen und Handlungen vorfinden, wo wir über uns selbst bestimmen und bei gemeinsamen Angelegenheiten mit anderen Menschen mitbestimmen können. Wir wissen aber auch, daß wir oft große äußere Freiheitsspielräume wegen innerer Begrenzungen nicht nutzen können: wir schämen uns, obwohl wir uns nicht schämen wollen, wir haben Hemmungen, die uns behindern, wir bringen keinen Ton heraus, obwohl wir schreien möchten, wir wollen freundlich sein und werden plötzlich aggressiv – das einfachste Beispiel ist: Wir liegen in einem gemütlichen, ruhigen Bett und wollen unbedingt schlafen, aber wir können nicht schlafen. Ein innerlich freier Mensch kann fast an jedem Ort und unter fast allen Bedingungen schlafen, wenn er das will.
Damit Menschen innerlich frei bleiben, brauchte man also nur mit der Erziehung von Kindern aufzuhören. Die Sache ist wirklich so einfach wie dieser Satz. Kinder, die von Anfang an tun und lassen können, was sie wollen, leben in Freiheit. Andere nicht. (Man rede jetzt nicht von Vernachlässigung oder Überforderung. Kinder wollen nicht vernachlässigt oder überfordert werden, es kann also nichts passieren, wenn man sich nach ihrem Willen richtet. Damit Kinder tun und lassen können, was sie wollen, brauchen sie selbstverständlich in den ersten Jahren Betreuungs- und Beziehungspartner, die ihnen zur Verfügung stehen.)
Äußere Freiheit ist wichtig, aber innere Freiheit ist wichtiger. Denn innerlich Unfreie können mit äußeren Spielräumen wenig anfangen. Umgekehrt lassen sich innerlich Freie unsinnige oder überflüssige äußere Begrenzungen nicht gefallen. Wer also für Freiheit ist, muß zuallererst für die Freiheit von Kindern sein.
Ich sagte, es ist wirklich so einfach, aber wie wir alle wissen, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Einen wesentlichen Grund hierfür, der zumeist übersehen wird (ich habe jedenfalls diesen Zusammenhang noch nirgends aufgedeckt gefunden), sehe ich in der Tatsache, daß Philosophen und Freiheitskämpfer zwar möglicherweise große Geister, aber doch in erster Linie Menschen sind. Auch Philosophen sind Kinder ihrer Zeit, Kinder ihrer Kultur, Kinder ihres Vaterlandes, ihrer Muttersprache, Kinder ihrer Eltern. Auch Philosophen sind erzogen worden und haben sich mit ihren Angreifern identifiziert.
Diese Selbstverständlichkeit wird plötzlich bedeutungsvoll, wenn man der Frage nachgeht, wie diese Philosophen zum Phänomen Kindheit stehen. Denn in der Kindheit des Menschen bilden sich seine seelischen und geistigen Strukturen, seine Fähigkeiten und Interessen – auch das Interesse an Freiheit.
Im Falle der beiden Genfer Philosophen kann ernsthaft kein Zweifel daran bestehen, daß beide – ROUSSEAU im 18., HERSCH im 20. Jahrhundert – zu den glühendsten Vorkämpfern und Verfechtern der Freiheit gehören. Was aber halten sie von Kindern?
Je eine Äußerung von ihnen als einziges zahlloser Beispiele kann diese Frage beantworten. JEANNE HERSCH:
»Es geht nicht einfach darum, daß wir uns Disziplin angewöhnen, also etwa im Freien keine Plastikabfälle liegen lassen. Das ist wichtig, aber es ist nicht das Entscheidende. Es geht um sehr viel mehr: darum nämlich, unsere Gelüste und Begierden zu kontrollieren und so lange zu verfeinern, bis sie wertvoll sind. Wenn man in der Schule den Kindern beizubringen versucht, ihre Begierden zu zügeln, so vernachlässigt man meiner Meinung nach die Erziehung dieser Begierden, das heißt die Sinngebung in Richtung auf eine Verfeinerung und Vermenschlichung. Gewöhnlich sieht man das Problem so: Entweder machen die Kinder, was sie wollen, oder es herrscht Disziplin. Natürlich sollen die Kinder nicht machen, was sie wollen – aber Disziplin ist auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Man muß eben die Begierden erziehen, bilden.« (»Die Unfähigkeit, Freiheit zu ertragen«, S. 63)
Kinder sollen nicht machen, was sie wollen, sondern machen wollen, was sie sollen. Freiheit soll ihnen »natürlich« verwehrt werden. Aber weil gegenüber gewalttätigen Disziplinierungen Widerstand oder Scheingehorsam möglich ist, sind sie nicht der Weisheit letzter Schluß. Der Weisheit letzter Schluß heißt Erziehung, also listenreiche, unmerkliche Manipulation der Begierden, des Willens, mit anderen Worten: Gehirnwäsche, Dressur, letztendlich Psychoterror (CHRISTIANE ROCHEFORT erklärt klipp und klar: »daß Erziehung einem Mordversuch gleichkommt«) – dies im Namen der Freiheit, zum Wohle der Kinder und der Kultur, gefordert von einer Freiheitskämpferin im Gefolge des berühmtesten Freiheitsapostels.
Aber sehen wir nun, was ROUSSEAU von Kindern hält. In seinem Buch »Emile oder über die Erziehung« (Reclam 1968, S. 265 f) gibt er gegen die übliche Erziehung durch Befehl und Gewalt den folgenden (und immerhin von CARL HAGENBECK beherzigten) Rat:
»Folgt mit eurem Zögling dem umgekehrten Weg. Laßt ihn immer im Glauben, er sei der Meister, seid es in Wirklichkeit aber selbst. Es gibt keine vollkommenere Unterwerfung als die, der man den Schein der Freiheit zugesteht. So bezwingt man sogar seinen Willen. Ist das arme Kind, das nichts weiß, nichts kann und erkennt, euch nicht vollkommen ausgeliefert? Verfügt ihr nicht über alles in seiner Umgebung, was auf es Bezug hat? Seid ihr nicht Herr seiner Eindrücke nach eurem Belieben? Seine Arbeiten, seine Spiele, sein Vergnügen und sein Kummer – liegt nicht alles in euren Händen, ohne daß es davon weiß? Zweifellos darf es tun, was es will, aber es darf nur das wollen, von dem ihr wünscht, daß es es will. Es darf keinen Schritt tun, den ihr nicht für es vorgesehen habt, es darf nicht den Mund auftun, ohne daß ihr wißt, was es sagen will.«
Eines muß man zugeben: ROUSSEAU ist ehrlich. Zwar nicht zu Kindern, aber zu sich selbst und zu seinen Lesern. Spätere Generationen von Pädagogen waren da ängstlicher, vielleicht auch naiver, insofern sie nicht bewußt betrügen wollten, sondern selbst glaubten, Freiheit und Erziehung seien miteinander zu vereinbaren.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß der zitierte ROUSSEAU-Text (der nicht etwa ironisch gemeint ist) vielen Menschen einen Schock versetzt. Ich kenne einen ehemaligen Lehrer, der seinerzeit eine Examensarbeit über ROUSSEAU geschrieben, die zitierte und viele andere ähnliche Stellen aber überhaupt nicht bemerkt hatte. Er hat sie, wie er sagt, »überlesen«. Das von zahllosen schreibenden Erziehungsfachleuten genährte Fehlurteil, ROUSSEAU habe dem freien Aufwachsen der Kinder das Wort geredet, war für ihn als Vorurteil stärker als ROUSSEAUS eigene Worte. Dieser gute Mann hat dann im Original nachgelesen und wurde tatkräftiges Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund (doch über den später, im III. Teil dieses Buches).