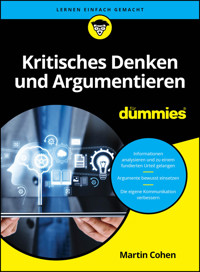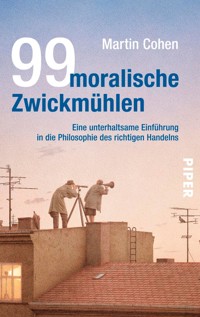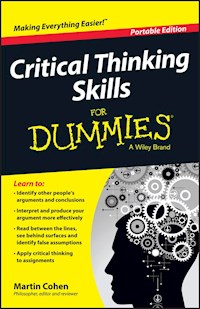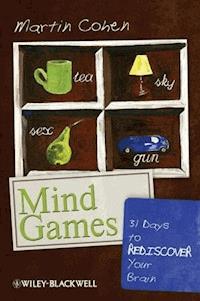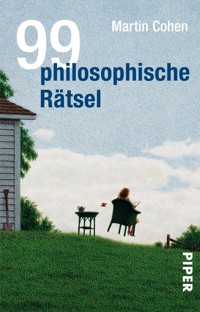
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist Liebe, ist Zeit umkehrbar, und kann Achilles die Schildkröte überholen? Schon die alten Griechen hatten ihre Freude daran, verblüffend einfache Fragen zu stellen, um sich dann tagelang die Köpfe zu zerbrechen. Martin Cohen hat 99 philosophische Rätsel zusammengestellt und damit eine spielerische Einführung in das philosophische Denken geschaffen. Leicht verständlich erklärt er Grundbegriffe der Philosophie und stellt bekannte Geistesgrößen vor. Ein Buch, mit dem jeder zum Philosophen werden kann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Englischen von Dirk Oetzmann und Helmut Reuter
ISBN 978-3-492-97430-1
September 2016
© Martin Cohen 1999, 2002, 2007
Titel der amerikanischen Originalausgabe »101 Philosophy Problems«, Routledge, Tailor & Francis, USA/Kanada 2008
Deutschsprachige Ausgabe:
© Campus Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2001
Abbildungen: 1998 Cordon Art, Barn, Holland (S.101-103), 1998 Molehill Constructions (S.104)
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Quint Buchholz/Hanser
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Frisch ans Werk!
»101 Rätsel«, mag der Leser ausrufen. »Ich wusste gar nicht, dass es so viele philosophische Fragen gibt!«
Schließlich schien Bertrand Russell in seinem grundlegenden Werk Probleme der Philosophie nur etwa ein Dutzend zu kennen, und die meisten hatten lediglich mit Varianten des Wissens zu tun. Es gab das Problem von Schein und Wirklichkeit, das von Geist und Materie, die Frage des Idealismus und die verschiedenen Probleme des Wissens: Wissen durch Erwerb oder durch Beschreibung, Kenntnis allgemeiner Grundsätze, Wissen a priori und Kenntnis universell gültiger Aussagen, intuitives Wissen, Wissen als Gegensatz zum Irrtum (wahr und falsch) und sogar wahrscheinliches Wissen. Und die alles übergreifende Frage nach dem »Wert« der Philosophie.
Aber seien wir großzügig. In der von mir konsultierten Ausgabe las ich eine unterstrichene Passage, in der es hieß: »Jeder Wissenserwerb ist eine Erweiterung des Selbst, doch diese Erweiterung erlangt man am besten, wenn man nicht direkt danach sucht« (kann das vielleicht auch für dieses Buch gelten?), und daneben hatte jemand in Großbuchstaben geschrieben:
IST DAS SELBSTVERGEWISSERUNG?
Dies muss ganz gewiss als neues paradoxes Problem gelten, das wir Russells Buch zu verdanken haben.
In seinem Werk Fundamental Questions of Philosophy (Routledge, London, 1952) zählte A. C. Ewing sogar nur sechs große Probleme der Philosophie, nämlich Wahrheit, Verhältnis von Materie und Geist, Verhältnis von Raum und Zeit, Kausalität und freien Willen, etwas namens »Monismus« als Gegensatz zum »Pluralismus« und zu guter Letzt Gott.
Diese Liste ist recht nützlich, aber nicht lang genug. Wir müssen uns an A. J. Ayers monolithisches[1] Werk Central Questions of Philosophy halten, um einigermaßen in die Nähe der 101 Rätsel zu kommen. Bei näherer Betrachtung erweisen sich diese jedoch als ziemlich unbefriedigend – sie befassen sich nur mit x und y und Professoren. Anstelle realer Probleme haben wir propositionale Funktionen und syntaktische Disjunktionen. Ayer behauptet sogar kühn, Zenons Paradoxien seien keine richtigen. Er löst sie alle auf, etwa mit Ratschlägen wie für Achilles: Er behauptet, »falsch« sei ganz einfach die Problemstellung selbst, nach der Achilles erst einen halben Meter zurückgelegt haben müsse, ehe er einen ganzen Meter vorankomme. (Der Ausdruck »falsch« wird von einer bestimmten Art von Philosophen für jegliche Behauptung verwendet, die keine Tautologie ist. Oder für eine, die sie nicht mögen.) Und auf alle Fälle besteht der Zweck der Philosophie für Ayer, wie er freimütig einräumt, nicht darin, die Welt zu »verändern« (egal, was Marx hier gemeint haben mag), sondern nur darin, unsere »Vorstellung« von ihr zu ändern. Die Philosophie müsse auf die »Anwendung der Analyse« beschränkt bleiben. Obwohl dies wiederum, wie wir erfahren, »für jene, die sie ausüben, nicht die Quelle des Zaubers ist«. Für Praktiker bestehe ihr Wert im »Interesse für die von ihr aufgeworfenen Fragen und im Erfolg, den sie durch deren Beantwortung erreicht«.
Welche Art Buch ist es nun, das 101 philosophische Rätsel enthält? Ist es eine Goldmine für kürzlich entdeckte Paradoxien und verführerische Probleme? Oder ist es ein Verzeichnis schmutziger, ungelöster und ungewaschener Fragen, die von den Sozial- und Naturwissenschaften aufgeworfen werden? Und wie dem auch sei – wie viele der 101 werden am Ende des Buches aufgelöst? Gibt es FÜR DAS GELD EINEN GEGENWERT?
Was das angeht, muss niemand Zweifel haben. Auf diesen Seiten sind alle philosophischen Fragen zu finden, auf die es ankommt. Sogar einige, für die das nicht gilt. Die Erörterung ist kurz, bringt das Problem aber auf den Punkt, geklärt – und nicht bloß lebendiger gestaltet – durch das (zunehmend anerkannte) Stilmittel der »narrativen Fiktion«. Das bei den Akademikern so beliebte Fachkauderwelsch wurde verbannt, nicht aber die Ideen oder Fragen.
Einige Philosophen reagieren auf Klarheit zwar so wie Vampire auf Sonnenlicht: Sie bedecken schaudernd ihre Augen, um die eindeutigen Worte und verständlichen Sätze nicht sehen zu müssen, die ihre private kleine Welt bedrohen. Wir aber brauchen solche Bedenken nicht zu haben. Stattdessen folgen wir einer viel älteren Tradition von Denkern, die Philosophie als Handlung und als erlernbare Fähigkeit verstehen.
Natürlich werden auch hier Fakten vorgestellt. Und was die Arbeitsweise betrifft, ist dies sozusagen ein Handbuch für die subversivste Form der Philosophie: für das »kritische Denken«. Dieser Ansatz gerät heutzutage ein wenig in Vergessenheit, seit Philosophen ihn in einen goldenen Käfig gesperrt haben. Das war nicht immer so. Im alten Griechenland, wo das Wort Philosophie seinen Ursprung hat, galt Klarheit als höchstes Ziel. Verschraubte Sophisterei galt als minderwertige Form der Philosophie. Sollte es diesem Buch gelingen, an diese alte Tradition anzuknüpfen, dann hätte es seinen Anspruch eingelöst. Und wenn dies einigen selbstgefälligen, ernsthaften Denkern noch zu einfach ist, sollten sie versuchen, einige der folgenden Fragen zu beantworten!
Bevor wir aber selbst unseren Versuch starten, sehen wir noch, was Bertrand Russell über philosophische Fragen im Allgemeinen zu sagen hat:
Philosophie soll nicht um der definitiven Antworten auf ihre Fragen willen betrieben werden, denn es kann grundsätzlich keine eindeutigen Antworten geben, sondern um der Fragen selbst willen; diese Fragen sind es, die unsere Konzeption des Möglichen erweitern, unsere intellektuelle Vorstellungskraft bereichern und den Wall von Dogmen durchbrechen, der den Geist am Wandern hindert; vor allem aber wird durch die Großartigkeit des Universums, die die Philosophie zu erahnen versucht, der Geist selbst an Größe gewinnen und dazu fähig, mit dieser Welt eins zu werden und so ihr höchstes Gut zu erlangen.
Wie Sie mit diesem Buch am besten umgehen
Philosophie ist eine Aktivität. Man könnte sie sich sogar als eine Art Gedankenexperiment vorstellen. Daher sollten Sie die Fragestellungen und erst recht die Antworten in diesem Buch nicht einfach geduldig hinnehmen. Natürlich könnten Sie sämtliche Fragen schlicht auswendig lernen, um sich Grundkenntnisse über die Philosophie anzueignen, aber so lernen Sie noch längst nicht zu philosophieren. Dafür müssen Sie dieses Buch mit kritischem Blick lesen, die Hypothesen hinterfragen und die Argumente anfechten. Das zeichnet den Philosophen aus. Das zeichnet allerdings auch Sophisten und Pedanten aus, also Menschen, die versuchen uns zu verwirren, oder die an Kleinigkeiten herumkritteln. Deshalb dieser Beipackzettel mit ein paar warnenden Hinweisen vorab:
1. Dieses Buch macht süchtig, und Sie werden es kaum aus der Hand legen wollen. Dennoch sollten Sie es nicht in einem Anfall philosophischer Raserei von vorn bis hinten durchlesen. Vermeiden Sie, sich zu viele Fragen auf einmal zu stellen. Nehmen Sie sich stattdessen immer wieder ein oder zwei Probleme vor. Die Reihenfolge der Fragestellungen ist bewusst darauf ausgerichtet, philosophisches Denken anzuregen, so dass das Buch mehr ist als die Summe seiner Teile. Die Diskussionen im zweiten Teil des Buches sind als Hilfestellungen für selbstständiges Philosophieren gedacht, sie sollen keine schnellen »Antworten« liefern. Denkpausen machen nicht nur die abschließenden Diskussionen interessanter, sondern auch die Fragen selbst. Denn wie Bertrand Russell bereits bemerkt hat, sind die Fragen wichtiger als die Antworten.
2. Versuchen Sie niemals, die Fragestellungen auf ihren logischen oder symbolischen Gehalt hin zu überprüfen (siehe auch zum besseren Verständnis das Stichwort »Formale Logik« im Glossar), wie es ein Freund von mir getan hat. Der Arme wurde natürlich fast verrückt und fristet sein Dasein nun als Philosophieprofessor an einer Universität in Nordengland.
3. Achten Sie schließlich darauf, dass Sie Ihre Schüler, Kinder oder gar Ihren Hund nicht überbeanspruchen oder ihnen womöglich das ganze Buch als ermüdendes Aufgabenpaket vorlegen. Philosophie lässt sich nämlich mit einem wachen Geist viel besser betreiben als mit einem müden und unwilligen.
Die Fragen in diesem Buch kann man auf ganz unterschiedliche Weise angehen. Auf konventionelle, wissenschaftliche Art betrachtet, sind sie Probleme, die verstanden und gelöst werden müssen. Wenn man sie jedoch intuitiv angeht, gelangt man zu der eigentlichen Aufgabe der Philosophie: Die Entdeckung der Wirklichkeit hinter den Begriffen und der Logik.
Am besten liest man dieses und wahrscheinlich alle Bücher über Philosophie als philosophische Entdeckungsreise, auf der viel Neues zu finden, zu bedenken, aber noch nicht ganz zu verstehen oder gar zu durchschauen ist. Eine Reise also, an deren Ende man erkennt, dass man kaum mehr weiß als am Anfang. Vielleicht wissen Sie hinterher sogar weniger, aber ich bin mir sicher, dass Sie trotzdem einiges gelernt haben.
Zum Aufwärmen: Elf logische Fallstricke und Paradoxien
1 Der gestrenge Richter
Richter Furcht hat bereits mit vielen unangenehmen Menschen zu tun gehabt, aber jener, der sich selbst »der Philosoph« nannte, obwohl er dieses Fach nie studiert hatte, hatte ihn wirklich verärgert. Furcht verkündet:
»Ich werde dich den Wert der Ehrlichkeit lehren, Häftling. Du bist für schuldig befunden worden, ein Gauner und Schwindler zu sein, der das Gericht mehrfach vorsätzlich belogen hat, um seine erbärmliche Haut zu retten. Nun aber erhältst du deine gerechte Strafe, mein Freund. Du wirst dazu verurteilt …« (hier macht der Richter eine wirkungsvolle Pause, zieht ein paar schwarze Handschuhe an und setzt einen kleinen schwarzen Hut auf) »… am Halse aufgehängt zu werden, bis der Tod eintritt. Bis zu diesem Tag bleibst du eingesperrt. Da ich jedoch ein großmütiger Richter bin, gebe ich dir noch eine Gelegenheit, den Wert der Ehrlichkeit schätzen zu lernen. Wenn es dir gelingt, am Tag deiner Hinrichtung eine wahre Aussage auf einem Zettel niederzuschreiben, wird die Strafe in zehn Jahre Gefängnis umgewandelt. Sollte deine Aussage nach Meinung des Obersten Scharfrichters jedoch falsch sein, wird das Urteil sofort vollstreckt. Ich warne dich«, fügt Furcht hinzu, als er sieht, dass seine Worte nicht den gewünschten Effekt hatten: »Der Mann ist Mitglied im Verein der logisch-positivistischen Scharfrichter und wird jeden metaphysischen Unsinn sofort durchschauen, also versuche besser nicht, ihn hereinzulegen! Ich gebe dir einen Tag Bedenkzeit!«
Daraufhin applaudieren die Schöffen dem Richter für sein strenges Urteil. Alle Anwesenden schauen auf den Angeklagten und sind zufrieden, dass dieser Halunke eine so harte Strafe bekommen hat und sich zusätzlich durch seine öffentliche Erklärung demütigen muss. Zur Verwunderung aller aber grinst der Philosoph nur, als er in die Todeszelle gebracht wird.
Am Tag der Hinrichtung überreicht der Verurteilte dem Richter strahlend seinen Zettel. Dieser liest ihn mit wachsender Bestürzung, knüllt ihn schließlich wütend zusammen und bestimmt, dass der Philosoph ohne jede weitere Strafe freigelassen wird.
Mit welcher Aussage kann der Gefangene sich retten?
2 Die Kuh auf der Weide
Bauer Huber macht sich Sorgen um seine preisgekrönte Kuh Lotte. Auch als sein Knecht ihm sagt, Lotte grase friedlich auf der Weide, beruhigt ihn das nicht, denn er will ganz sicher sein. Er will nicht nur mit neunundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit glauben, dass es Lotte gut geht, er will es wissen.
Bauer Huber geht also hinaus und sieht vom Gatter aus hinter ein paar Bäumen in der Ferne ein schwarz-weißes Etwas, das er als seine Lieblingskuh erkennt. Er geht zum Hof zurück und berichtet, dass mit Lotte alles in Ordnung sei.
Aber weiß Bauer Huber dies wirklich genau?
Der Knecht geht ebenfalls aufs Feld hinaus, um nach dem Rechten zu sehen. Er findet Lotte schlafend in einer versteckten Senke, die vom Gatter aus nicht einzusehen ist. Außerdem entdeckt er ein großes Stück schwarz-weißes Papier, das sich in einem Baum verfangen hat.
Lotte befindet sich tatsächlich auf der Weide, wie der Bauer geglaubt hat. Durfte er aber wirklich behaupten, dies zu wissen?
3 Das Problem des Protagoras
Euathlos wurde von Protagoras zum Anwalt ausgebildet. Man traf eine großzügige Vereinbarung, nach der Euathlos nicht für sein Studium bezahlen muss, bis und sofern er seinen ersten Fall gewinnt.
Zum Ärger von Protagoras, der viel Zeit für die Ausbildung seines Schülers aufgewendet hatte, entscheidet dieser sich jedoch, Musiker zu werden und die Robe an den Nagel zu hängen. Protagoras verlangt daraufhin, dass Euathlos ihn für seine Ausbildung bezahlt. Euathlos aber weigert sich, und so geht Protagoras vor Gericht.
So wie Protagoras die Dinge sieht, muss Euathlos, wenn er den Prozess verliert, seine Schulden an ihn zurückzahlen. Aber auch wenn Euathlos gewinnt, muss er bezahlen, da er ja dann seinen ersten Prozess gewonnen hat.
Euathlos sieht die Sache etwas anders. Wenn ich verliere, so denkt er, habe ich meinen ersten Prozess verloren und muss, wie der Vertrag es vorsieht, keinen Pfennig bezahlen. Wenn ich jedoch gewinne, darf Protagoras nicht mehr auf dem Vertrag beharren, sodass ich ebenfalls nicht zahlen muss.
Nun können nicht beide recht haben. Wer aber begeht den Denkfehler?
4 Der Friseur vom Hindukusch
Der Herrscher des Hindukusch legt großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Er erlässt einige Gesetze hinsichtlich Kleidung und persönlicher Hygiene. Die seltsamste Weisung bekommt aber der Barbier der Stadt. Er wird angewiesen, jedem Untertanen innerhalb von sechs Monaten die Haare zu schneiden. Wer danach noch keinen ordentlichen Haarschnitt hat, soll enthauptet werden. Für jeden Haarschnitt soll der Barbier einen Silbertaler bekommen. Aus Gründen der Reinlichkeit werden keine Hobby-Barbiere zugelassen – niemand darf also etwa seinen Freunden die Haare schneiden. Um weiterhin sicherzugehen, dass der Barbier nicht auch für die kassiert, die sich die Haare selbst schneiden wollen, wird ihm eine Wache zur Seite gestellt, die ihm die Hände abhacken soll, falls er eine der Regeln bricht.
Anfangs ist der Barbier hocherfreut – er sieht sich bereits in Silber schwimmen. Dann aber kommt ihm ein entsetzlicher Gedanke, der ihm wie ein Schock in die Glieder fährt.
In der folgenden Nacht, nachdem er den ganzen Tag Haare geschnitten hat, ohne dafür bezahlt zu werden, flieht der Barbier in die Berge, wo er sich die nächsten 20 Jahre versteckt hält.
Warum lässt sich der Barbier diese einmalige Gelegenheit entgehen, viel Geld zu verdienen?
5 Der Rabe
Ein Philosoph am kaiserlichen Hof wird oft damit beauftragt, bestimmte Aussagen zu beweisen. So auch die folgende, auf die ein Baron im Streit gewettet hatte:
Alle Raben sind schwarz.
Für die Beweisführung, überlegt der Philosoph, muss er alle Raben der Welt, die bisher gelebt haben, die jetzt leben und eigentlich auch die, die noch gar nicht geboren sind, finden und überprüfen, ob sie schwarz sind. Das ist ein völlig unmögliches Unterfangen.
Als Alternative dazu, erkennt der schlaue Philosoph, könnte man auch alle nicht-schwarzen Dinge daraufhin überprüfen, um zu sehen, ob vielleicht Raben darunter sind.
»Finde alle Nicht-Raben und überprüfe, ob sie nicht schwarz sind«, weist der Philosoph daraufhin seinen Assistenten an. Was ihm noch zu denken gibt, ist die Tatsache, dass ein Nicht-Rabe sehr wohl schwarz sein darf.
Ein weiteres Problem bleibt bestehen: Selbst wenn nach der Überprüfung alle Raben tatsächlich schwarz sind, kann als Nächstes beispielsweise ein grüner Rabe geboren werden. Der Philosoph lässt sich jedoch nicht beirren. Als er an den Hof des Kaisers zurückkehrt, ist er sich sicher, schlüssig beweisen zu können, dass alle Raben schwarz sind. Er gibt der Versammlung bekannt:
»Meine Damen und Herren, die Antwort ist ganz einfach. Wir definieren alle Raben als schwarz. Unter dieser Voraussetzung ist zum Beispiel ein grüner Rabe gar kein Rabe, sondern nur ein grüner Vogel, der zufällig dieselben Eigenschaften besitzt wie ein Rabe, abgesehen von seiner Farbe. Dennoch kann es sich per Definition nicht um einen Raben handeln. Alle Raben sind also tatsächlich schwarz.« Applaus brandet auf. Da aber tritt der Wärter der kaiserlichen Raben nach vorne, mit einem schwächlichen, krank aussehenden Vogel auf der Hand.
»Was ist dann ein Rabe, dessen Federn aufgrund einer Krankheit zeitweise grün geworden sind?«, fragte der Wärter.
6 Das Kiosk-Dilemma
Zwei Mädchen werden erwischt, als sie versuchen, durch das Fenster des Schulkiosks einzusteigen. Die Rektorin Dr. Schröder fordert sie daraufhin mit aller Strenge auf zuzugeben, die schon lange gesuchten Kioskeinbrecher zu sein. Sie weigern sich. Die Rektorin schickt nun eines der Mädchen aus dem Zimmer und spricht mit der anderen unter vier Augen.
»Anna«, beginnt Dr. Schröder traurig, »es wäre besser, wenn du alles zugibst. Wenn du das tust, werde ich die Strafe bis zum Ende des Semesters aussetzen.«
»Aber ich bin’s nicht gewesen«, jammert das Mädchen.
»Wenn du wirklich nichts getan hast, brauchst du auch keine Angst zu haben. Wenn Annette aber zugibt, dass ihr beide gestohlen habt, werde ich dafür sorgen, dass du von der Schule verwiesen wirst! Geh’ jetzt bitte ins Nebenzimmer, schicke Annette zu mir und denke über das nach, was ich gesagt habe.« Dr. Schröder spricht im Folgenden mit Annette, wiederholt das Gesagte noch einmal und schickt sie dann zum Nachdenken in ein anderes Zimmer.
Eine halbe Stunde später fragt sie Anna noch einmal, ob sie die Vergehen jetzt zugeben will.
Ganz abgesehen davon, ob Anna schuldig ist oder nicht – was kann sie tun, um die Strafe möglichst niedrig zu halten?
7 Die nicht angekündigte Klassenarbeit
Der Lehrer des Philosophiekurses gibt bekannt, dass er bald eine unangekündigte Klassenarbeit schreiben lassen wird. Inhalt des Tests werde der Lehrstoff des Halbjahres sein, vor allem die 256 logischen Thesen des Aristoteles. In scharfem Ton fügt der Lehrer hinzu, dass die Schüler bisher besonders faul gewesen seien. Die Klasse ist verärgert und murrt. »Wann soll das denn stattfinden?«, fragen einige verdrossen.
Der Lehrer lächelt hintergründig. »Ich werde mich hüten, euch das auf die Nase zu binden. Es kann von jetzt an in jeder Stunde so weit sein. Nur eines kann ich euch verraten: Wenn der Test stattfindet, wird es auf jeden Fall eine Überraschung für euch sein!«
Nach der Schule unterhalten sich Robert und Patrizia über die schlechte Nachricht. Robert macht sich Sorgen, weil er ein miserables Langzeitgedächtnis hat.
»Ich weiß, dass ich die Arbeit bestehen kann«, sagt er. »Wenn ich nur wüsste, wann wir den Test schreiben, dann könnte ich mich am Abend davor vorbereiten.«
»Nur keine Angst«, entgegnet Patrizia, »ich glaube, der Pauker macht sich über uns lustig – ich denke, es wird gar keinen Test geben.«
Sie erklärt, dass die Arbeit nicht in der letzten Stunde vor den Ferien stattfinden kann, weil der ganze Kurs dann ja wüsste, dass sie in dieser Stunde geschrieben wird und sich am Tag zuvor vorbereiten würde. »Na toll«, antwortet Robert spöttisch, »dann passiert es eben zwischen morgen und dem vorletzten Schultag?«
Patrizia fährt geduldig fort. »Auch der vorletzte Tag scheidet aus, denn da wir wissen, dass er nicht in der letzten Stunde geschrieben werden kann, ist am vorvorletzten Schultag schon klar, dass der Test am nächsten Tag stattfindet!«
Jetzt versteht Robert. »Also kann es auch in der drittletzten und viertletzten Stunde nicht passieren – eigentlich überhaupt nicht! Hey, das ist großartig, der Pauker versucht nur, uns Angst zu machen! Er kann die Arbeit gar nicht abhalten, ohne die Sache mit der Überraschung zurückzunehmen. Er hat sich selbst reingelegt!«
Die beiden verraten den anderen nichts und amüsieren sich köstlich, weil diese sich in der nächsten Zeit mühen, die 256 Thesen des Aristoteles und ähnlichen Unsinn auswendig zu lernen. Dann, nur eine Woche nach der Ankündigung, erscheint der Lehrer mit der Klassenarbeit in der Hand.
»Das können Sie doch nicht machen!«, ruft Robert aus.
»Warum denn nicht?«, entgegnet der Lehrer erstaunt.
»Weil es eine Überraschung sein muss – Sie können die Arbeit nicht geben, wenn wir es erwarten!«
»Schon, Robert«, antwortet der Lehrer ein wenig von oben herab, »aber du hast die Klassenarbeit nicht erwartet, und ich halte sie ab.«
Gab es einen Fehler in Roberts Überlegungen – oder ist der Lehrer ein Heuchler?
8 Das Schiff des Sorites
Die Athener waren ausgezeichnete Schiffsbauer. Ihr Stolz war ein ganz besonderes Schlachtschiff mit verstärktem Bug, das feindliche Schiffe rammen konnte und das sie »Donnerbug« nannten. Man sagte, dieses Schiff sei von den Göttern gesegnet und daher unsinkbar und unbesiegbar.
Nach vielen siegreichen Seegefechten musste »Donnerbug« im Hafen überholt werden. Die Reparaturen waren so umfangreich, dass die Hälfte der Balken und Planken durch neue ersetzt wurden. Weil das Schiff so ungemein hohes Ansehen besaß, hoben die Bürger der Stadt die ausrangierten Balken und die alten, rostigen Nägel auf, um daraus eines Tages ein Denkmal zu bauen.
Im folgenden Jahr wurde »Donnerbug« noch häufiger eingesetzt, sodass im nächsten Winter noch einmal ein Drittel der Planken ausgewechselt werden musste, und zwar der ausschließlich alten, da die neuen robuster erschienen. Bei den nächsten Fahrten zeigte sich, dass die alten Balken den Belastungen nicht so gut standhielten wie die neuen. Sorites, der Kapitän des Schiffs, befahl deshalb die Rückkehr in den heimischen Hafen und ordnete an, dass auch die übrigen Balken und Planken durch neue ersetzt wurden. Außerdem ließ er neue Segel anbringen und große Teile der Ausrüstung erneuern, damit das Schiff bei der jährlichen Parade einen besonders guten Eindruck machte. Auch dieses Mal wurden die ausgebauten Teile sorgfältig aufbewahrt.
Jetzt geschah aber etwas Außergewöhnliches. Während »Donnerbug« in den Kampf gegen feindliche Schiffe zog, bauten die braven Hafenarbeiter aus den alten Balken das Schiff nach. Natürlich nicht als Schlachtschiff, denn dafür waren einzelne Teilstücke zu stark beschädigt, sondern als Skulptur, die sie weithin sichtbar am Rand des Hafenbeckens aufstellten.
Als »Donnerbug« wieder in den Hafen einlief, war es in einem erbärmlichen Zustand. Im Seegefecht hatte es mehrfach gegnerische Schiffe verfehlt oder nur schwach beschädigt. Bei einem Rammstoß war ein Stück des berühmten Bugs abgebrochen, während das Feindschiff praktisch völlig intakt geblieben war.
Als die ausgelaugte Crew den Hafen erreichte, begann sie zu murren und auf etwas zu deuten. Dort war ein weiteres Boot mit verstärktem Bug ausgestellt. Tatsächlich schien der einzige Unterschied darin zu bestehen, dass an dem aufgebockten Schiff ein Schild befestigt war, das die Öffentlichkeit zum Besuch der »echten Donnerbug« einlud.
»Ihr Dummköpfe!«, rief Sorites den Athenern zu. »Jetzt, da ihr dieses Schiff gebaut habt, ist unser Boot nicht mehr die ›Donnerbug‹. Das einzige Schiff, das unter dem Schutz der Götter steht, ist dieser Haufen Müll, der hier sinnlos aufgebaut wurde!«
Die Bürger behaupteten jedoch, dass dies nicht sein könne. Schließlich hatte es nach dem ersten Umbau keine Diskussion darüber gegeben, ob das Schiff des Kapitäns noch die echte »Donnerbug« sei, und auch nach dem zweiten nicht. Die dritte Reparatur war nicht sehr umfangreich gewesen und konnte die Echtheit des Schiffs erst recht nicht verändern. Wollte der Kapitän wirklich behaupten, dass das Schiff nun, da der letzte Originalnagel herausgezogen worden war, plötzlich nicht mehr »echt« sei? Man könne höchstens behaupten, dass sie eine zweite »Original-Donnerbug« gebaut hatten. Im Übrigen sei die echte »Donnerbug« kein reales Schiff, sondern vielmehr eine Idee, die Vorstellung eines Ingenieurs. Sorites hielt dies für absurd und bestand darauf, dass das ausgestellte Schiff abgerissen, das Holz verbrannt und die Nägel eingeschmolzen werden sollten.
So geschah es dann auch. Aber das schien die Leistungen der »Donnerbug« im Gefecht nicht zu verbessern. Noch viele Jahre später erzählte man sich, dass der Kapitän das einzige griechische Schlachtschiff zerstört hatte, das unter dem Schutz der Götter stand.
Welches der drei Schiffe war tatsächlich die echte »Donnerbug«?
9 Das Problem der Gesellschaft für nutzlose Informationen
Die arme Gesellschaft für nutzlose Informationen! Als sie mit Bewerbungen geradezu überschüttet wurde, entschloss man sich, die Eintrittsbedingungen zu verschärfen. Jedes zukünftige Mitglied musste nun eine absolut nutzlose Information einreichen, um aufgenommen zu werden und in den Genuss der Privilegien eines Mitglieds zu kommen. Dazu gehörte der freie Zugang zum Lesesaal der Gesellschaft (und, was für einige noch wichtiger war, der Einlass in das Raucherzimmer). Diese Aufnahmeregel sollte unter allen Umständen befolgt werden. Zwölf Jahre nach Einführung der neuen Regelung sah sich der Präsident der Gesellschaft allerdings mit einer schmerzhaften Wahrheit konfrontiert: In der gesamten Zeit waren keine neuen Mitglieder hinzugekommen. Die Gesellschaft stand vor dem Aus.
Was war passiert?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!