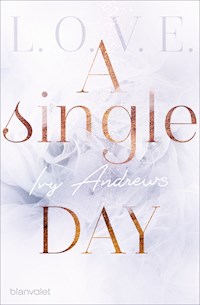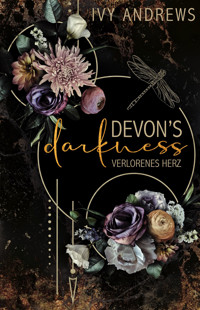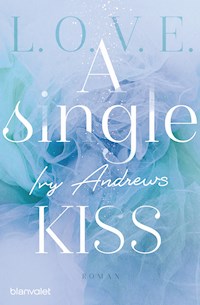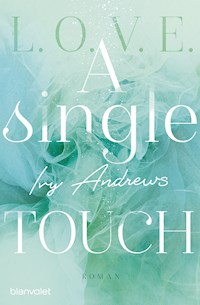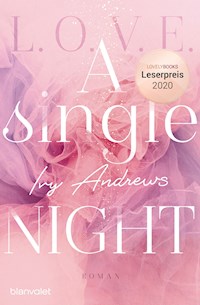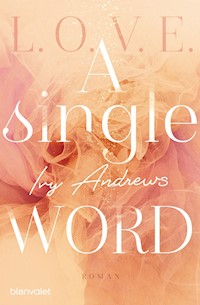
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: L.O.V.E.
- Sprache: Deutsch
Ein einziges Wort kann dein Leben für immer verändern …
Als Oxy den Bruder ihrer neuen Mitbewohnerin Ella kennenlernt, weiß sie sofort, dass Henri nichts als Ärger bedeutet. Denn der gut aussehende Erbe des Modeunternehmens »French Chic« steht nicht nur im Ruf, ein notorischer Frauenheld zu sein, er verhält sich auch wie der weltgrößte Rüpel. Was Oxy nicht weiß: Henri hütet ein dunkles, traumatisches Geheimnis. Gefühle will er nicht zulassen, und dennoch weckt die schlagfertige Oxy etwas in ihm – etwas, dem sich Oxy all seiner Sabotageversuche zum Trotz ebenfalls nicht entziehen kann …
Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet:
Band 1: A single night (Libby & Jasper) – Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020!
Band 2: A single word (Oxy & Henri)
Band 3: A single touch (Val & Parker)
Band 4: A single kiss (Ella & Callum)
Bonuskapitel: A single day
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden.
Die Autorin schreibt auch unter den Pseudonymen Ava Innings und Violet Truelove.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Als Oxy den Bruder ihrer neuen Mitbewohnerin Ella kennenlernt, weiß sie sofort, dass Henri nichts als Ärger bedeutet. Denn der gut aussehende Erbe des Modeunternehmens »French Chic« steht nicht nur im Ruf, ein notorischer Frauenheld zu sein, er verhält sich auch wie der weltgrößte Rüpel. Was Oxy nicht weiß: Henry hütet ein dunkles, traumatisches Geheimnis. Gefühle will er nicht zulassen, und dennoch weckt die schlagfertige Oxy etwas in ihm – etwas, dem sich Oxy all seiner Sabotageversuche zum Trotz ebenfalls nicht entziehen kann …
Autorin
Ivy Andrews alias Viola Plötz, geboren 1979, machte sich nach ihrem Studium im Fach Kommunikationsdesign als Hochzeitsfotografin und Designerin selbstständig. Im Jahr 2014 beschloss sie schließlich, ihren Traum von einem eigenen Buch zu verwirklichen. Was darauf folgte, waren mehrere erfolgreiche Romane als Selfpublisherin und nun die »L.O.V.E.«-Reihe bei Blanvalet. Die Autorin lebt mit Mann und Kindern im Taunus – viel zu weit entfernt vom Meer, das sie so liebt. Doch sie kann sich nicht nur für das Wasser und Wellenreiten begeistern, sondern auch für Musik, Yoga und nicht zuletzt für prickelnde Geschichten.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Ivy Andrews
A
single
WORD
Roman
L.O.V.E. Band 2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Ivy Andrews
blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Redaktion: Ivana Marinović
Umschlaggestaltung: © Sandra Taufer, München
Umschlagmotiv: Sandra Taufer unter Verwendung von Motiven von shutterstock (Alona Siniehina, HS_PHOTOGRAPHY)
DN · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-25306-6 V003
www.blanvalet.de
Meinem Opa, Karl-Heinz »Kalle« Becker 18.06.1933 – 05.02.2020
Sei geduldig, wenn du im Dunkeln sitzt. Der Sonnenaufgang kommt.
1
Oxana
Ein letzter Check, ehe die Show beginnen kann. Hinter den Kulissen herrscht eine angespannte Atmosphäre. Die Luft scheint zu vibrieren, ist geschwängert von großen Erwartungen und Hoffnungen – meinen Erwartungen und Hoffnungen.
Noch einmal gehe ich von Model zu Model und prüfe, ob die Kleider perfekt sitzen, ob Haare und Make-up das Gesamtbild abrunden. Ich bin beeindruckt von der Qualität der Arbeit, die die unzähligen Visagisten und Hair-Designer geleistet haben. Hier und da streiche ich eine Falte glatt, bei einem Model lasse ich noch schnell die Ohrringe und die Kette austauschen. Besser! Viel, viel besser, befinde ich und segne die Änderung mit einem Nicken ab.
Obwohl ich meinen Kontrollgang beendet und mich noch einmal davon überzeugt habe, dass jedes Detail stimmig ist, schlägt mein Herz auf Hochtouren. Alles wird gut, sage ich mir, um mich selbst zu beruhigen. Doch das ist nicht so einfach: Heute geht es um alles oder nichts.
An dieser Kollektion habe ich das letzte halbe Jahr gearbeitet, habe mein Herzblut und mein gesamtes Erspartes in sie hineingepumpt. In jedem der aufwendigen Couture-Kleider stecken zudem unzählige schlaflose Nächte, in denen ich mir wahlweise den Kopf über sie zerbrochen oder direkt an ihnen gearbeitet habe, und nun, nun ist er endlich da: Der große Moment, der über meine Karriere als Modedesignerin entscheidet.
Mein Freund und Mentor, der Stardesigner Origami Oaring, hat seine Kontakte spielen lassen, weshalb heute Abend jeder mit Rang und Namen in der Modebranche anwesend ist. Selbst jemand von der Vogue ist da – von der amerikanischen, nicht der französischen wohlgemerkt. Ich spüre es, dies ist der Wendepunkt. Wenn alles glattgeht, bin ich ab heute kein Nobody mehr. Dann wird jeder in der Modeszene meinen Namen kennen, und das verdanke ich nicht zuletzt Origamis Unterstützung. Wenn er nicht gewesen wäre, dann …
»Oxana!« Als hätte ich ihn herbeibeschworen, taucht er hinter der Bühne auf, drückt mich an sich und wünscht mir viel Glück. Er ist ein kleiner alter Mann, der wie ein zerbrechliches Vögelchen wirkt, aber über die Kraft und Energie eines jungen Hundes verfügt. Seine achtundsiebzig Jahre sieht man ihm äußerlich zwar an, doch innerlich ist er ein Kind geblieben. Unter weißen, dichten Brauen, die an Raupen erinnern, blicken himmelblaue, vor Neugier funkelnde Augen hervor, die anerkennend über meine Kreationen schweifen.
»Ich bin so unglaublich stolz auf dich!«, verrät er mir und umarmt mich noch einmal.
»Ohne dich …«, beginne ich, doch er schüttelt bloß den Kopf.
»Nein. Das warst du! Du ganz allein.« Unter seinem Lob erröte ich. Er greift nach meiner Hand, drückt sie mit erstaunlich festem Griff. »Alicia King ist da, um sich anzusehen, was du auf die Beine gestellt hast.«
»Alicia King …«, wispere ich ehrfürchtig. Sie ist hier. Oh. Mein. Gott. Mit einem Mal ergreift eine ungeheure Anspannung von mir Besitz. Da sind sie wieder, all die Zweifel. Wie ich dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, hasse, und nun, da mich die Angst vor Alicias Urteil packt, wird es geradezu übermächtig.
Sie ist meine absolute Lieblingsdesignerin. Ihre Kollektionen sind elegant, aber nie langweilig. Sie sind klassisch, aber nie bieder. Jedes Mal bin ich aufs Neue beeindruckt, wie es ihr gelingt, mit einfachen Mitteln Akzente zu setzen und ihren Schöpfungen so das gewisse Extra zu verleihen. Ihre Liebe zum Detail ist in jedem Stück unverkennbar. Jede Naht, jeder Knopf, jede Falte … alles wurde bereits im Vorfeld genauestens durchdacht und dient einem bestimmten, wohlkalkulierten Zweck.
Origamis Herangehensweise ist eine ganz andere. Da gibt es keine Struktur, keine durchdachte Planung. Er beginnt irgendwo, wird von der Muse geküsst, flattert herum, wirkt dabei völlig verloren, doch dann – ganz plötzlich und immer wieder überraschend – passiert es einfach, und ein Meisterwerk entsteht. Es ist wie Magie.
»Ja, Alicia King, mon âme, und sie ist ausschließlich deinetwegen hier.« Liebevoll lächelt er mich an, und ich lächle zurück. Auch wenn uns mehr als fünfzig Jahre trennen: Origami ist mein bester Freund. Genau genommen ist er mein einziger Freund. Ich habe das Gefühl, er weiß immer, was in meinem Kopf vor sich geht. Wie um es zu beweisen, als spürte er meine Zweifel und Bedenken, sagt er: »Du wirst sie verzaubern.« Seine gebrechlichen Finger, die ihm so oft zu schaffen machen und Schmerzen bereiten, umschließen meine Oberarme mit kraftvollem Griff. »Glaub endlich an dich, Oxana, ich tue es doch auch.«
Seine Worte sind Balsam für meine Seele, sie nehmen mir die Unsicherheit. »Danke«, wispere ich und drücke ihm einen Kuss auf die faltige Wange.
Seine Augen blitzen freudig auf, als er »Toi, toi, toi!« sagt und dann verschwindet. Einen Moment lang blicke ich ihm nach, ehe ich die letzten Minuten bis zum Beginn meiner ersten eigenen Fashionshow nutze, um mich noch einmal zu sammeln.
Als kurz darauf die Musik einsetzt, stehe ich neben dem Zugang zum Catwalk und schicke ein Model nach dem anderen hinaus. Im Saal ist es ganz still. Es ist, als würde das gesamte Publikum erwartungsvoll den Atem anhalten. Modeblogger, Fotografen und Journalisten verfolgen aufmerksam jede Bewegung.
Es ist perfekt. Ich bin so maßlos erleichtert, so froh …
Ein schriller Schrei dringt vom Laufsteg zu mir. Alarmiert ruckt mein Kopf in die Richtung. Ungläubig blinzle ich, kann nicht glauben, was ich dort sehe. Das Model, welches das Herzstück meiner Kollektion trägt, reißt sich die aufwendige Seidenrobe vom Körper. Nur mit einem Stringtanga bekleidet, greift sie nach einer Metallstange, die bis unters Dach reicht, und schwingt sich daran empor. Ich stürze auf die Bühne. Unmöglich kann ich zulassen, dass meine erste Modenschau durch diesen ungeplanten Auftritt zur Stripshow verkommt. Denn zu meinem Entsetzen ziehen die anderen Models nach. Während ein Teil des Publikums begeistert reagiert und den halb nackten Tänzerinnen zujubelt, wendet Alicia sich Origami zu. Abscheu und Entsetzen stehen ihr ins Gesicht geschrieben. Kopfschüttelnd feuert sie einen Blick in meine Richtung ab und verlässt dann den Saal.
»Nein!«, rufe ich, so laut ich kann. Nein zu alldem hier. Das kann doch nicht sein … Und plötzlich stehe auch ich nur mit einem mikroskopisch kleinen Höschen bekleidet im Rampenlicht und bewege mich lasziv zum Rhythmus des Songs. Die Quasten, die von den kirschroten paillettenbesetzten Pasties, die meine Nippel bedecken, baumeln, wiegen sich ebenfalls im Takt der Musik.
Was zur Hölle tue ich hier? Origami scheint sich das Gleiche zu fragen, denn er starrt mich einen Moment lang fassungslos an, ehe er sich umdreht und Alicia hinterhereilt.
Erst als mir irgendein Typ mit haarigem Unterarm Geld in den Slip steckt, wird mir klar, was hier läuft. Ich träume. Das alles ist bloß ein total verrückter Traum.
Just in dem Moment, in dem ich das realisiert habe, reißt mich das schrille Klingeln meines Weckers aus dem Schlaf. Schwer atmend öffne ich die Augen, stelle den Alarm aus und lasse mich zurück in die Kissen sinken. Einen Moment lang brauche ich, um mich zu orientieren, und blicke zur Decke. Alles hier ist noch so neu. Es riecht fremd. Das Prasseln des Regens gegen das Fenster ist das einzig vertraute Geräusch. Es klingt überall gleich, ganz egal, ob man gerade in Russland, Frankreich oder sonst wo auf der Welt ist. Für ein paar Sekunden erscheinen mir der gestrige Tag und die lange Anreise wie ein weiterer Traum, und ich kann nicht glauben, dass ich wirklich hier bin.
Das Kreischen einer Möwe durchdringt die unglaubliche Stille und erinnert mich nachdrücklich daran, wo ich mich befinde: in Plymouth. Weit, weit weg von meiner Wahlheimat Paris. Einen Moment lang überkommt mich ein erdrückendes Gefühl grenzenloser Einsamkeit. Welten liegen zwischen der Stadt der Liebe und diesem beschaulichen Ort an der englischen Küste. Wie ruhig es in dieser kleinen Straße, der Kingsley Road, ist, fiel mir bereits gestern Abend auf. Verschlafen wirkte die Nachbarschaft, dabei war es noch nicht einmal halb neun.
Auch jetzt ist bis auf den Regen kein Laut zu hören. Kein Straßenlärm, nichts – vielleicht auch, weil mein Zimmer Richtung Hinterhof liegt. Fast bin ich froh, als aus dem Raum nebenan ein bellendes Husten zu mir dringt – ein Lebenszeichen in der mir so fremden Stille, das mich animiert, nicht länger untätig herumzuliegen, sondern in die Puschen zu kommen. Entschlossen schwinge ich meine Beine aus dem Bett, suche ein paar Klamotten und meinen Kulturbeutel zusammen und mache mich auf den Weg ins Bad. Der üble Husten, der im ganzen Haus widerhallt, begleitet mich dorthin. Es dauert eine ganze Weile, bis es in Libertys Zimmer wieder ruhig wird. Valerie, meine andere Mitbewohnerin, hatte recht, die Ärmste hat es übel erwischt.
Gestern, als ich hier eintraf, lag Liberty bereits im Bett und schlief, weshalb ich sie noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Auch mit Valerie, die aus Deutschland stammt, habe ich nach der anstrengenden Anreise nicht viele Worte gewechselt. An eine Sache jedoch erinnere ich mich plötzlich wieder. Als ich gerade hoch auf mein Zimmer wollte, meinte sie noch: »Träum was Schönes, denn du weißt ja, wie es heißt: Was man in der ersten Nacht in einem neuen Bett träumt, wird wahr.«
Als ich eine halbe Stunde später die Küche des kleinen Reihenhauses betrete, treffe ich dort auf Valerie, die am Tisch sitzt und frühstückt.
»Guten Morgen! Du bist ja schon wach.« Erstaunt sieht sie mich an, erhebt sich und geht zur Anrichte: »Kaffee?« Demonstrativ hält sie die halb volle Glaskanne hoch und blickt mich fragend aus grünen Augen an.
»Ja, sehr gerne. Danke.«
»Milch? Zucker?«
»Weder noch!«
»Na, das ist ja einfach«, meint sie und zwinkert mir gut gelaunt zu. »Du bist kein Morgenmensch, was?«, fragt sie, während sie mir eine volle Tasse reicht. »Oder brauchst du einfach nur noch etwas Zeit, um anzukommen?«
»Letzteres, und außerdem hatte ich einen furchtbaren Traum. Ich hoffe sehr, dass das, was du mir gestern Abend erzählt hast, nicht stimmt.«
»Ach, ist doch nur ein dummer Aberglaube. Was du jetzt brauchst, ist erst mal ein vernünftiges Frühstück.«
»Da hast du wahrscheinlich recht. Wo kann man hier denn einkaufen gehen?«
»Oh, du musst jetzt nicht losrennen und dir was besorgen. Du kannst gerne erst einmal was von meinen Sachen abhaben. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Käse habe ich aber auch noch, wenn dir das lieber ist. Oder magst du vielleicht Obst? Ich hätte Trauben und Äpfel.«
Angesichts ihres netten Angebots und der üppigen Auswahl blinzle ich überrumpelt. »Ein Käsetoast. Und Obst dazu klingt toll. Danke.«
Valerie zuckt mit den Schultern. »Keine Ursache.«
Sie nimmt einen Teller aus dem hölzernen Hängeregal über der Spüle und reicht ihn mir, ehe sie den Kühlschrank öffnet, sich bückt und ein großes Stück Cheddar sowie Trauben daraus hervorzaubert.
Kurz darauf sitzen wir einträchtig am Tisch, und ich erzähle auf Valeries Nachfrage hin von meinem üblen Traum.
»Das klingt ja wirklich grauenhaft«, meint sie und sieht mich über den Rand ihrer XXL-Kaffeetasse hinweg mitfühlend an. Ihre rote Lockenpracht hat sie zu einem Messy Bun aufgetürmt.
»Das war es auch. Aber wenigstens ist das Ganze so abwegig, dass es niemals passieren wird.« Zumindest hoffe ich inständig, dass ich nicht als Nackttänzerin ende, wie mir prophezeit wurde, als ich von zu Hause wegging.
»Ich glaube ohnehin nicht daran, dass dieser blöde Spruch stimmt«, beruhigt mich Val und zuckt betont gleichgültig mit den Schultern. Im ersten Moment denke ich, sie hat womöglich meine Zweifel gespürt, doch dann macht es klick.
»So? Was hast du denn geträumt, wenn ich fragen darf?«
Zu meiner Überraschung errötet Valerie so heftig, dass ich fürchte, ich muss ihr gleich mit einem Feuerlöscher zu Leibe rücken. Hastig stellt sie die Tasse ab und legt schützend beide Hände auf ihre Wangen. »Ich hasse es, wenn ich so knallrot werde«, murmelt sie beschämt.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.« Hoffentlich trägt sie mir meine indiskrete Frage nicht nach. Wir müssen es schließlich ein Jahr lang hier miteinander aushalten, und so groß, dass man sich permanent aus dem Weg gehen könnte, ist das Haus nun auch wieder nicht.
»Ach was«, winkt Valerie ab. »Ist ja nicht deine Schuld. Es ist nur … Keine Ahnung. Der Traum war …« Sie verstummt abrupt, und ich könnte schwören, sie ist inzwischen noch röter geworden.
»Oh!«, entfährt es mir, als ich begreife, weshalb sie so rumdruckst. »Na ja, du hattest einen Sextraum, und bei mir wurde gestrippt, also …« Lachend versuche ich, ihr die Befangenheit zu nehmen.
Wenigstens schmunzelt Valerie, als sie beinahe zerknirscht erwidert: »Kein Sextraum.« Einen Augenblick lang denke ich, sie belässt es dabei, doch dann gibt sie sich einen Ruck. »Versprich mir, dass du nicht lachst. Es hat nichts zu bedeuten, okay?«
»Okay.«
»Ich … ich war verheiratet.«
»Daran ist ja erst mal nichts Verwerfliches.«
»Mit unserem Vermieter«, gesteht sie flüsternd, als würde sie mir ein grässliches Geheimnis anvertrauen.
»Du hättest es schlimmer treffen können«, befinde ich, denn unser Vermieter, Mr. Gibson, ist ziemlich heiß. »Dein Unterbewusstsein hätte dich beispielsweise mit Putin verheiraten können.«
Nun ist es Valerie, die lacht. »Oder mit Trump!«, wirft sie glucksend ein, was ihre unzähligen Sommersprossen dazu bringt, munter herumzuhüpfen.
»Oder mit beiden!«
»Dann hätte ich wohl ein echtes Problem.« Grinsend beißt sie von ihrem Marmeladenbrot ab.
»Libby ist übrigens auch wegen Alicia King hier«, kommt Val auf meinen Traum zurück. »Sie ist ein echter Fan.«
»Apropos Libby, dieser Husten hört sich ja schrecklich an.«
Valerie nickt. Besorgnis spiegelt sich in ihrer Miene. »Heute Nacht bin ich sogar davon aufgewacht.«
»War sie denn schon beim Arzt?«
»Nein, aber wenn du mich fragst, sollte sie da vermutlich dringend mal hin.«
»Nicht dass sie eine Lungenentzündung bekommt oder so. Wie läuft das denn, wenn man hier in England zum Arzt muss? Weißt du das?«
Valerie zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sollen wir mal gucken?«
Ich zücke mein Handy, doch Valerie winkt ab. »Komm mit! Wir schauen auf dem Rechner nach. Am großen Monitor ist das bequemer.« Sie erhebt sich und geht in ihr Zimmer. Es ist das einzige Schlafzimmer im Erdgeschoss. Die drei anderen befinden sich im oberen Stockwerk.
»Wow!«, entfährt es mir, als ich entdecke, dass sie sogar ein eigenes Bad hat.
»Ja, echter Luxus«, stimmt sie mir zu. »Es war eine tolle Idee von Parker, aus dem Geräteschuppen ein kleines Badezimmer zu machen.«
»Parker?«, frage ich verwirrt und begreife dann, dass damit der Vermieter gemeint sein muss.
»Mr. Gibson«, bestätigt Valerie meine Vermutung.
»Ihr seid per du?«
Achselzuckend erwidert sie: »Na ja, er hat den August über hier gewohnt, weil er ganz in der Nähe ein Haus renoviert hat.«
»Ihr habt also zusammengelebt? Da war dein Traum ja verdammt nah an der Wahrheit dran.« Ich zwinkere ihr amüsiert zu und sehe mich dann noch einmal in dem Zimmer um. Wie auch die Räume oben ist es mit einem dicken beigefarbenen Teppich ausgelegt. Links neben dem gemütlich aussehenden Queensize-Bett steht ein schmaler Schreibtisch, rechts befindet sich ein Kleiderschrank, und direkt neben der Tür gibt es noch eine Kommode, sodass Valerie genug Stauraum hat. Ordentlich ist es.
Ich staune nicht schlecht, als mein Blick auf Vals Equipment fällt. Auf dem Schreibtisch stehen ein iMac und ein Multifunktionsdrucker. »Du bist ja voll ausgerüstet«, stelle ich anerkennend fest.
»Ja. Fotografie ist leider ein echt kostspieliger Studiengang. Ich hatte keine Ahnung, wie das College hier ausgestattet ist, weißt du. An der Fachhochschule, an der ich in Deutschland studiere, sind die Arbeitsplätze extrem begrenzt, und gerade zum Semesterende gibt es immer Stress. Daher habe ich mir nach dem Grundstudium einen eigenen Rechner zugelegt. Ich konnte ihn günstig gebraucht erstehen, und nun …« Sie deutet auf das Schmuckstück. »… kann und will ich mich einfach nicht von ihm trennen.«
Sie setzt sich an den Schreibtisch und weckt den Computer aus seinem Ruhezustand, um das Grafikprogramm zu schließen, mit dem sie zuvor gearbeitet hat. Derweil erhasche ich einen Blick auf das Foto, das eine wunderschöne Landschaft zeigt: eine steinerne Brücke, die sich über einen kleinen Fluss spannt. Etwas unwirklich mutet sie an, denn auf dem Bild ist kein Weg zu erkennen, der zu ihr führt. Stattdessen sieht man links und rechts des Ufers nur endlose Weite. Das Land ist, bis auf wenige grüne Flecken, mit braunen und gelben Gräsern bedeckt, wodurch es karg und sogar irgendwie lebensfeindlich wirkt. Geschickt hat der Fotograf den Verlauf des Flusses genutzt, um dem Foto räumliche Tiefe zu verleihen. Das Gewässer läuft geradewegs auf die Hügel am Horizont zu. Die untergehende Sonne taucht den Himmel in rosarotes Licht. Malerisch sieht es aus.
»Hast du das geschossen?«
Valerie blickt über die Schulter zu mir hoch. »Ja, das war im Dartmoor. Man mag es gar nicht glauben, aber der englische Sommer ist himmlisch. Den kompletten August über hatten wir herrliches Wetter hier in Devon!«, schwärmt sie. Unweigerlich schweift mein Blick zu der von Gardinen gesäumten Terrassentür. Valerie kann durch ihr Zimmer direkt den Hinterhof betreten. Etwas, das man bei diesem Wetter bestimmt nicht tun möchte, denn momentan regnet es in Strömen.
»Ja, fällt mir in der Tat schwer, das zu glauben«, murmle ich mit Blick auf die triste Aussicht. Zwar kann ich mir vorstellen, dass der Hinterhof bei Sonnenschein eine Oase der Ruhe sein könnte, doch im Moment sieht er einfach nur trostlos aus. Selbst das Grün der zahlreichen Pflanzen – darunter sogar zwei Palmen, die den Außenbereich verschönern sollen – kann da keine Abhilfe schaffen. Müde lassen sie ihre von den schweren Regentropfen gepeinigten Blätter hängen. »Ich wusste gar nicht, dass es hier Palmen gibt«, bemerke ich gedankenverloren.
Valeries Blick folgt meinem. »Das liegt am Golfstrom, der ist für das sehr milde Klima in Südengland verantwortlich.« Sie wendet sich wieder dem Computer zu. »Schau mal, verstehe ich das richtig? Liberty muss in so ein Walk-In-Center gehen, wenn sie zum Arzt will?«
Ich sehe ihr über die Schulter, verenge die Augen, um besser lesen zu können. »Ja, das scheint die sinnvollste Lösung zu sein«, stimme ich ihr zu, nachdem ich den Text überflogen habe.
»Okay, dann schaue ich mal nach, wo das nächste Center ist.« Valerie wird schnell fündig.
»Puh, das ist aber ein ganz schönes Stück«, stelle ich fest, als sie den Routenplaner zu Hilfe nimmt, um zu sehen, wo Libby sich behandeln lassen kann.
»Na ja, mit dem Auto ist es bloß eine Viertelstunde«, meint Valerie.
»Tja, aber wir haben kein Auto«, gebe ich zu bedenken.
»Du vielleicht nicht, ich schon.« Valerie schiebt entschlossen ihren Stuhl zurück und steht auf. »Ich gehe hoch und sage Libby, dass sie sich fertig machen soll.«
»Das ist echt lieb von dir.«
»Ach was, wir sind hier schließlich auf uns gestellt. Ich meine, wir alle sind in einem fremden Land, und jede von uns könnte mal Hilfe brauchen. Ich finde, wir müssen zusammenhalten. Eine für alle, alle für eine.«
»Wie die drei Musketiere?« Der Gedanke lässt mich lächeln.
»Na ja, eigentlich vier Musketiere. Unsere vierte Mitbewohnerin kommt laut Parker noch.«
»Soll ich euch zu diesem Walk-In-Center begleiten?«
»Nein, das brauchst du nicht. Nutz den Tag lieber, um richtig anzukommen, dich ein wenig einzuleben oder auszuruhen.«
»Vermutlich hast du recht. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend«, gestehe ich, woraufhin sie mitfühlend nickt.
»Plötzlich fallen einem noch hundert Dinge ein, die man erledigen muss, und dann ist es ja doch auch eine weite Anreise.«
»Das stimmt. Trotzdem wollte ich mich heute eigentlich schon nach einem Nebenjob umsehen, aber ich bin echt ziemlich müde. Vielleicht lege ich mich einfach noch mal ein Stündchen hin.«
»Mach das, und wegen deines Nebenjobs kann ich einfach mal Parker fragen. Er kennt hier Gott und die Welt und kann sich sicherlich mal umhören.«
»Das würdest du tun?«, frage ich erfreut.
»Klar. Wie gesagt: Musketiere. Nur versprechen kann ich nichts. So, ich schnappe mir jetzt Libby, und dann geht es los.«
Während Valerie Libby holt, bringe ich die Küche auf Vordermann und räume die Lebensmittel meiner spendablen Mitbewohnerin in den Kühlschrank.
Kurz darauf treffe ich im Flur zum ersten Mal auf Liberty, die trotz dicker Jacke fröstelnd die Arme um sich geschlungen hat.
»Hi. Ich bin Oxana«, stelle ich mich vor und strecke ihr die Hand hin.
Ihr blondes Haar ist strähnig, die Nase wund vom Schnupfen, und die blauen Augen sind glasig. Sie atmet schwer. Ihr Anblick ist wirklich mitleiderregend.
»Hi, ich bin Libby«, krächzt sie heiser. Oh ja, sie muss wirklich dringend zum Arzt. »Bleib lieber weg von mir, nicht, dass du dich auch noch ansteckst«, meint sie mit einem Nicken in Richtung meiner noch immer ausgetreckten Hand, woraufhin ich sie zögerlich zurückziehe.
Valerie schnappt sich ihren Schlüssel und eine Tasche von der Garderobe. »So, dann wollen wir mal.« Schwungvoll öffnet sie die Tür. »Bis später dann«, sagt sie an mich gewandt.
Libby folgt ihr seufzend. Einen Moment lang erinnert sie an ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird.
»Gute Besserung!«, wünsche ich ihr. Einen Augenblick lang bleibe ich im Türrahmen stehen und sehe den beiden nach, wie sie über die Straße gehen und in einen roten Kleinwagen steigen, dann treibt mich der Anblick des Regenwetters zurück ins Haus. Statt mich hinzulegen und auszuruhen, mache ich mich ans Auspacken meiner beiden Reisetaschen. Viel besitze ich nicht, doch gestern Abend war ich trotzdem zu müde, um mich darum zu kümmern. Mein Zimmer ist nicht allzu groß, aber für meine Bedürfnisse völlig ausreichend. Vor dem Sprossenfenster, von dem aus man in den Hinterhof sehen kann, steht ein massiver Holzschreibtisch, und auch ich habe, dank des Kleiderschranks und eines Regals mit vier Rattankörben, genug Platz, um meine Habseligkeiten ordentlich zu verstauen. Schnell habe ich mich eingerichtet, und kaum bin ich fertig, nutze ich die Regenpause, um einkaufen zu gehen – wer weiß, wie lange sie andauert.
Der nächste Supermarkt ist rasch gefunden, keine fünf Minuten ist er vom Haus entfernt, was mich hoffen lässt, dass ich trocken bleibe. Und in der Tat habe ich Glück.
Als Valerie und Libby nach rund vierstündiger Abwesenheit zurückkehren, regnet es jedoch wieder in Strömen. Dafür köchelt aber eine deftige Suppe auf dem Herd. Da ich nicht wusste, ob sich meine Mitbewohnerinnen nicht vielleicht vegetarisch oder vegan ernähren, habe ich mich dazu entschieden, Zwiebelsuppe zu kochen. Eigentlich stehe ich nicht gerne in der Küche, und Zwiebeln schneiden hasse ich, doch Valerie hat recht: Wir müssen zusammenhalten, und im umgekehrten Fall würde ich mir auch etwas Rückhalt und moralischen Beistand wünschen. Nicht dass ich bisher selbst oft in diesen Genuss gekommen wäre. Origami bildet da die Ausnahme. Gestern habe ich nur kurz mit ihm telefoniert, um ihn wissen zu lassen, dass ich gut angekommen bin, daher nehme ich mir vor, ihn nach dem Essen noch einmal anzurufen, um ihm ausführlich von meinen ersten Eindrücken zu berichten.
»Was riecht denn hier so lecker?«, fragt Valerie, als sie die Küche betritt.
»Zwiebelsuppe. Die soll bei Erkältungen helfen.« Den letzten Satz richte ich an Libby, die sich zu uns gesellt. »Habt ihr Hunger?«
Valerie nickt lediglich, während Libby sagt: »Oh ja, und vielen Dank! Ich kann jede Hilfe brauchen.« Sie lächelt schwach und setzt sich auf die Bank vor dem Küchenfenster.
»Was hat der Arzt denn gesagt?«, erkundige ich mich und fülle dabei Suppe in die tiefen Teller.
»Sie hat eine schwere Bronchitis und ist anscheinend haarscharf an einer Lungenentzündung vorbeigeschrammt«, beantwortet Valerie meine Frage und fügt hinzu: »Außerdem soll sie ihre Stimme schonen.« Sie schaut Libby streng an, die den Blick schmollend erwidert, aber schweigt. Allerdings nicht lange, denn als Valerie »Echt lecker!« sagt, gibt Libby ein heiseres »Ja, total« von sich. Was mich zum Schmunzeln bringt, denn ich bin wirklich froh, dass es den beiden schmeckt.
Die Umstände, unter denen unser erstes gemeinsames WG-Essen stattfindet, könnten natürlich besser sein. Sicherlich wäre es lustiger, wenn Libby gesund und dazu in der Lage wäre, sich richtig mit Valerie und mir zu unterhalten, aber immerhin ist es kein völliges Desaster.
»Ich spüle!«, kommt es von Valerie, nachdem wir fertig gegessen haben. Sie sieht Libby, die ihre Schüssel in das Waschbecken stellen will, vorwurfsvoll an. »Und du lässt das stehen, gehst ins Bett und wirst wieder gesund.«
»Danke, Val, fürs Fahren, und auch dir vielen Dank, Oxy, fürs Kochen.«
»Oxy?«, frage ich überrascht, denn so bin ich noch nie genannt worden. Überhaupt hatte ich noch nie einen Spitznamen, weder einen coolen wie Oxy noch sonst einen.
Libby blickt mich entschuldigend an. »Sorry!«, murmelt sie betreten.
»Nein, schon okay. Das gefällt mir.« Ich lächle Libby beschwichtigend an und streiche mir eine Strähne meiner Haare aus dem Gesicht. Sie sind unnatürlich hell. Wie aus Mondlicht gesponnen, behauptete mein Exfreund immer, und ich hielt ihn für einen Romantiker – weit gefehlt, wie sich später herausstellte.
Nachdem Libby, bewaffnet mit einer Thermoskanne heißen Kräutertees, nach oben gegangen ist, helfe ich Valerie beim Abwasch.
»So, dann bist du jetzt also Oxy«, meint sie belustigt.
»Und du Val, wie ich gehört habe. Hat Libby dich auch gleich umgetauft?«
Valerie schüttelt den Kopf. »Nein. Parker hat mich auch schon so genannt. Das mit den Abkürzungen scheint eine amerikanische Eigenart zu sein. Ich habe ihm übrigens vorhin, als wir im Wartezimmer saßen, gesimst, und er hört sich wegen eines Nebenjobs für dich um.«
»Oh Mann, das wäre echt der Hammer, wenn es klappt.«
»Parker klang zumindest ziemlich zuversichtlich. Morgen soll das Wetter übrigens gut werden, und ich will ehrlich sein, nach einer Woche Dauerregen fällt mir langsam die Decke auf den Kopf. Ich wollte nach Rame fahren. Das ist nicht allzu weit weg von hier, und es gibt einen traumhaft schönen Strand, den solltest du gesehen haben. Magst du mitkommen?«
»Klar!«, erwidere ich erfreut darüber, etwas von der Gegend zu sehen zu bekommen. »Was ist Rame eigentlich? Eine Stadt?«
»Das ist eine Halbinsel vor Plymouth. Sie gehört aber schon zu Cornwall. Glaub mir, es wird dir gefallen«, verspricht Val, und wie sich am nächsten Tag herausstellt, tut es das in der Tat.
»Du hast recht! Es ist paradiesisch!«, verkünde ich strahlend, als wir – die Schuhe in den Händen – barfuß am Strand spazieren gehen.
»Die Strände von Whitsand Bay mag ich am liebsten«, verrät Val mir. »Manchmal fahre ich bloß hierher, um mir den Sonnenuntergang anzuschauen.«
»Das klingt, als würdest du seit Jahren hier leben.«
Val zuckt mit den Achseln. »So fühlt es sich ehrlich gesagt auch an.« Sie wendet sich um und blickt zur Horizontlinie, wo der blaue Himmel das ebenso blaue Meer küsst. Ein Seufzen entfährt ihr. »Ehrlich, von diesem Anblick werde ich nie genug bekommen. Ich liebe das Meer. Deshalb war ich inzwischen auch echt oft hier. Am Anfang war ich jedes Mal total nervös, wenn ich mit der Fähre übersetzen musste, doch inzwischen habe ich Routine.«
»Ja, das war ziemlich beeindruckend«, gebe ich zu. »Überhaupt finde ich es krass, dass du dich traust, hier Auto zu fahren. Selbst wenn ich einen Führerschein hätte, wäre ich vermutlich nicht so mutig.«
»Ach«, winkt Val ab. »An den Linksverkehr gewöhnt man sich schnell.« Dann zögert sie und fragt: »Habe ich das richtig verstanden? Du hast keinen Führerschein?«
»Äh ja, also ich bin drei Mal durchgefallen, aber nicht weil ich nicht fahren kann, sondern weil ich bei einer Fahrschule war, die keine Lizenz hatte, einen Führerschein auszustellen, und mich daher immer wieder durchfallen ließ.«
Val sieht zu mir, ihre Stirn liegt in Falten, und es ist offensichtlich, dass sie mir kein Wort glaubt.
»Guck nicht so! Das ist Russland. Da werden Führerscheine wie auf dem Basar verkauft. Aber das wusste ich halt vorher nicht, und dann hat mir das Geld gefehlt, um mir anderweitig einen zu besorgen.«
»Aber das ist ja total gefährlich!«, platzt es aus Valerie heraus.
»Wem sagst du das! Aber inzwischen ist es auch egal. Ich bin nach Paris gezogen, und dort braucht man keinen Führerschein.«
»Nun ja, hier ist es schon ganz praktisch, ein Auto zu haben.« Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinanderher. »Ich war erst einmal in Paris«, sagt Valerie irgendwann.
»Und wie hat es dir gefallen?«
»An sich ganz gut, aber es war unfassbar teuer. Muss schwer sein, dort über die Runden zu kommen.« Fragend sieht sie mich an.
»Günstig lebt es sich dort nicht«, gebe ich zu. »Zum Glück musste ich keine Miete zahlen, sondern habe im gleichen Haus, in dem sich das Atelier meines Arbeitgebers befand, in einer Hausmeisterwohnung gelebt.«
»Für wen hast du denn gearbeitet?«
»Für Origami Oaring. Sagt dir der Name was?«
»Machst du Witze? Natürlich kenne ich ihn!« Sie klingt beinahe empört. »Das ist ja, als würdest du mich fragen, ob ich Manolo Blahnik kenne oder Chanel. Spätestens seit Sex and the City sagt einem der Name doch was.«
»Sorry, ich hatte keine Ahnung, dass du dich für Mode interessierst.«
»Na ja, das sollte ich schon tun, schließlich will ich später einmal in die Fußstapfen meines Vaters treten und Modefotografin werden.«
»Wie cool!«, entfährt es mir, und schon haben wir ein Thema, über das wir uns die nächste halbe Stunde angeregt unterhalten.
»Da hast du aber eine steile Karriere hingelegt«, meint Valerie, nachdem ich ihr meinen beruflichen Werdegang dargelegt habe.
»Ich hatte viel Glück«, winke ich ab, was nicht gelogen ist. Mein Traum stand mehr als einmal kurz vorm Scheitern. Beispielsweise, als das Atelier, in dem ich meine Lehre zur Maßschneiderin begonnen hatte, schließen musste und ich vor dem Nichts stand. Händeringend habe ich nach jemandem gesucht, der mich übernimmt, und bin glücklicherweise im Couture-Atelier von Wladislaw Gontscharow gelandet, bei dem ich meine Ausbildung beenden konnte und der mich mit Origami bekannt machte.
»Das war bestimmt nicht nur Glück. Meine Oma sagt immer: ›Das Glück gehört den Tüchtigen.‹ Sicherlich hast du hart gearbeitet, um so weit zu kommen.«
Zustimmend nicke ich, denn das habe ich wirklich. Allerdings lasse ich unerwähnt, dass ich nicht mal ansatzweise dort bin, wo ich hinmöchte.
»Es muss schwer gewesen sein, all das, was du bereits erreicht hast, aufzugeben, um noch mal zu studieren.« Der Wind zerrt an Vals roten Locken und wirbelt sie durcheinander. Es sieht aus, als würde ihr Kopf in Flammen stehen.
»Ja, ich habe auch echt mit mir gehadert«, gebe ich zu. »Mit Origami habe ich lange darüber gesprochen, ob ich es wirklich wagen soll.«
Unweigerlich taucht die Erinnerung in meinem Kopf auf. Ich weiß noch, wie ich im ersten Moment dachte, er würde mich loswerden wollen, als er mir vorschlug, für ein Jahr ans Plymouth College of Art zu gehen, um bei der berühmten Alicia King zu studieren. Ich fragte mich, was ich falsch gemacht hatte, durch was genau ich bei ihm in Ungnade gefallen war.
»Nichts hast du falsch gemacht, mon âme«, erwiderte Origami auf meine Frage. »Aber du willst doch nicht ewig im Atelier eines alten Mannes versauern, oder?«
»Du bist kein alter Mann«, widersprach ich empört.
»Da sagen meine müden Knochen aber etwas anderes. Oxana, meine Liebe, wir wissen doch beide, dass du zu Höherem berufen bist. Wenn es dein Traum ist, eines Tages eine erfolgreiche Designerin zu werden, dann musst du deine Flügel ausbreiten und die Welt erkunden. Wann habe ich dir denn das letzte Mal etwas Neues beibringen können?«
»Täglich! Ich lerne hier noch immer täglich neue Dinge.« Aus dem darauffolgenden Blickduell ging ich als Verliererin hervor, denn er hatte recht – wirklich viel Neues lernte ich bereits seit einiger Zeit nicht mehr. »Aber es bringt doch nichts! Ich kann ohnehin nicht zu Ende studieren und meinen Abschluss machen.«
»Du könntest, wenn du …«
»Ich werde kein Geld von dir nehmen«, widersprach ich, denn ich wusste genau, worauf dieses Gespräch hinauslaufen würde. Nicht zum ersten Mal hatte er mir angeboten, mich finanziell zu unterstützen. »Du weißt doch, was man sagt: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Und das will ich nicht. Meine Reserven reichen genau für ein Jahr … Na gut, vermutlich nicht ganz. Aber ich könnte mir dort neben dem Studium einen Job suchen, um über die Runden zu kommen.«
»Oder ein Privatdarlehen aufnehmen.« Unschuldig lächelnd sah er mich an.
»Was würdest du denn in meiner Situation tun?«
»Ich würde nach Plymouth gehen.«
Er klang so sicher, so als wäre jede andere Option gar nicht der Rede wert. Und doch bin ich nun hier und frage mich, ob ich nicht den größten Fehler meines Lebens begangen habe. Valerie ahnt nicht mal ansatzweise, wie schwer es mir fiel, alles hinter mir zu lassen. Nicht nur meine sichere Anstellung und meine mietfreie Wohnung, sondern auch Origami, dem ich mich so verbunden fühle. Ein wehmütiger Schleier, ein Anflug von Heimweh, trübt mit einem Mal den schönen Sommertag, und ein Seufzen entfährt mir.
»Es war bestimmt die richtige Entscheidung«, spricht Val mir netterweise Mut zu.
»Ja, das denke ich auch«, behaupte ich und klinge viel überzeugter, als ich eigentlich bin. »Das Ganze wird sich für mich sicherlich auszahlen. Alicia King ist schließlich eine der großen Modeschöpferinnen unserer Zeit. Schon jetzt hat sie sich ihren Platz in den Büchern der Modegeschichte gesichert. Sie ist unglaublich stilsicher, und ihre Entwürfe haben eine ganz eigene Ästhetik.« Val grinst breit über meinen schwärmerischen Tonfall. Ich kann es ihr nicht verübeln. Ich klinge, als würde ich einer Boygroup huldigen. Aber wenn es um Alicia King geht, verfalle ich in einen regelrechten Fangirl-Modus. Sie ist einfach fantastisch. In einer Welt, in der alles wild und bunt sein muss, fällt Alicia King mit der klassischen Eleganz, die all ihren Kreationen eigen ist, aus dem Raster. Ihre Konzepte sind wahnsinnig intelligent, ebenso ihre Konstruktionen. »Von ihr kann ich gewiss eine Menge lernen.«
»Du bist ja fast eine ebenso glühende Verehrerin wie Libby«, meint Valerie lachend.
Wir waren so in unser Gespräch vertieft, dass ich gar nicht bemerkt habe, wie nah wir der Wasserkante gekommen sind. Val quietscht vergnügt, als eine etwas größere Welle angerauscht kommt und wir plötzlich knietief im Wasser stehen. Ich versuche, zum Strand zurückzuweichen, merke jedoch, dass der Sog zu stark ist, dass ich mich nicht rühren kann. Einen Augenblick lang überkommt mich Panik. Dann ist die Welle wieder weg, verschwindet in den Weiten des Ozeans, und ich ergreife hastig die Flucht. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, und ich nehme mir vor, in Zukunft vorsichtiger zu sein und einen Sicherheitsabstand zum Meer zu wahren. Nicht auszudenken, wenn es mich mit sich gerissen hätte. Ich wäre jämmerlich ertrunken. Trotz der sommerlichen Temperaturen läuft mir bei dem Gedanken ein Schauer über den Rücken.
Zum Glück bleiben wir nicht mehr allzu lange am Strand. Val und ich erklimmen den steilen Pfad, der in die Klippen gehauen wurde, und kommen nach einem anstrengenden Aufstieg beim Parkplatz an.
»Besser als jedes Fitnesstraining«, meint Val lachend, als wir oben stehen und hinabblicken. Sie deutet auf einen Punkt in der Ferne. »Da fahren wir als Nächstes hin. Also nur, wenn du noch Lust hast, natürlich.«
»Was gibt es da?«
»Auf der Landspitze, sie heißt Rame Head, steht die Ruine einer alten Kapelle. Siehst du?«
Ich kneife die Augen zusammen, und in der Tat meine ich, ein gedrungenes Häuschen zu sehen, das fast die gleiche Farbe hat wie die Felsen, auf denen es steht. Nun bin ich neugierig. »Ja, lass uns dahin gehen.«
»Wunderbar!« Vergnügt schultert Val ihren Rucksack und setzt sich in Richtung Parkplatz in Bewegung.
»Hast du einen Verehrer?«, erkundige ich mich und deute auf die weiße Rose, die unter dem Scheibenwischer ihres Autos klemmt. Val starrt sie einen Augenblick lang an, ehe sie den Kopf schüttelt und sie an sich nimmt. Ich sehe, wie sie ihre Nase zwischen die Blütenblätter steckt und mit geschlossenen Augen den Duft einatmet. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen.
Auf der Fahrt nach Rame Head ist sie verdächtig still, und ich wage zu bezweifeln, dass sie wirklich nicht weiß, von wem die Blume stammt. Allerdings ist es nicht meine Art, Menschen zu bedrängen – zumal ich selbst Themen habe, über die ich ungern spreche. Meine Familie beispielsweise, die nie eine Familie war. Entschlossen schiebe ich den Gedanken an sie beiseite. Damals, als ich sie mit sechzehn verließ, um nach Moskau zu gehen und meine Schneiderlehre anzufangen, habe ich mir geschworen, nicht zurück-, sondern ausschließlich nach vorn zu blicken, und meistens klappt das auch ganz gut.
Als wir rund eine Stunde später vor der kleinen moosbewachsenen Kapelle sitzen und unseren Proviant, bestehend aus Äpfeln und Sandwichs, essen, genieße ich die fantastische Aussicht und das Gefühl der Freiheit, das sie mir vermittelt. Von der Anhöhe hat man einen herrlich offenen Blick die Küste entlang.
»Ein wirklich schöner Ort, aber hast du zufällig Sonnencreme dabei?«
»Bin ich rothaarig?«, fragt Val belustigt, wühlt in ihrem Rucksack und kramt eine kleine Tube hervor.
Nachdem ich mich eingeschmiert habe, cremt sie sich ebenfalls ein. Sie hat unzählige Sommersprossen im Gesicht, auf Schultern und Armen. Ihre Haut ist ebenso hell wie meine.
Während wir so in der Sonne sitzen und das schöne Wetter genießen, erzählt Valerie von all den Ausflügen, die sie in den vergangenen sechs Wochen bereits unternommen hat. Anders als ich ist sie bereits richtig angekommen. Zum Glück bleiben mir aber noch ein paar Tage, ehe das Semester startet, sodass ich gute Hoffnung habe, mich bis dahin ebenfalls heimisch zu fühlen.
Auf dem Rückweg zum Auto treffen wir auf eine kleine Herde wilder Ponys. Inzwischen weiß ich von Val auch, dass sie ein Pferdemädchen ist, weshalb sie anhält und ihre Kamera aus dem Rucksack holt. Während wir auf die Tiere, deren Ohren aufmerksam zucken, zugehen, stoppt Val immer mal wieder, um ein paar Aufnahmen zu machen.
»Erstaunlich, dass sie nicht wegrennen«, denn ganz geheuer scheinen wir ihnen nicht zu sein.
»Man darf halt nicht auf sie zustürmen, sondern muss sich langsam bewegen. Anfassen sollte man sie aber nicht, und auch füttern ist verboten«, klärt Val mich auf, während sie die kleine Herde fotografiert.
Neugierig beobachte ich, was sie macht. Nach einer Weile wird es mir jedoch langweilig, denn anders als Val kann ich Pferden und Ponys nicht sonderlich viel abgewinnen. Stattdessen lasse ich meinen Blick über die Bucht und die unzähligen Boote schweifen, die dort herumschippern.
»Hey, Oxy, guck mal!«, ruft Val plötzlich, und als ich mich umdrehe, macht es »Klick!«.
»Das war gemein!«, beschwere ich mich lachend, woraufhin sie ein weiteres Foto schießt. Sie wirft einen Blick aufs Display.
»Das zweite ist besser«, befindet sie, kommt auf mich zu und zeigt mir die Aufnahme.
Entspannt sehe ich aus. Meine langen silberblonden Haare flattern im Wind, meine blauen Augen funkeln wie verrückt. »Wow, ist das gut geworden. Kannst du mir das später schicken?« Ich weiß, Origami wird sich über die Aufnahme freuen.
Val grinst zufrieden. »Klar. Kann ich gerne machen.« Sie packt die Kamera weg, und wir marschieren zum Auto zurück.
Es ist später Nachmittag, als wir Plymouth erreichen.
»Was ist denn hier los?«, fragt Val verwundert in dem Moment, in dem sie in unsere Straße biegt. Vor der Nummer acht steht ein riesiger LKW und blockiert den kompletten Verkehr. Das orangene Licht der Warnblinkanlage flackert hektisch.
»Der musste sich hier aber auch unbedingt reinquetschen«, murmle ich und beobachte, wie drei Männer aus unserem Haus kommen, nacheinander im Laderaum des Lasters verschwinden und wenig später mit Kartons beladen wieder auftauchen. Das Schauspiel wiederholt sich noch zweimal, ehe Val die Nase voll hat, zurücksetzt und sich wohl oder übel einen Parkplatz in der Dale Road sucht.
»Ich schätze, unsere neue Mitbewohnerin ist da.«
»Das, oder Libby hat ihren kompletten Hausrat aus Amerika liefern lassen«, stimmt Val mir zu und schüttelt ungläubig den Kopf. Sie nimmt ihren Fotorucksack an sich und schließt den Corsa ab. Seite an Seite schlendern wir zurück zum Haus.
Als wir näher kommen, steht der Speditionstyp mit einer hochgewachsenen brünetten Frau, die gerade irgendwas unterschreibt, im Vorgarten. Sie trägt blaue Röhrenjeans zu roten hochhackigen Pumps und einer weißen Stehkragenbluse, die in der Hose steckt. Ein eleganter schmaler cognacfarbener Gürtel mit goldener Schnalle unterstreicht die schlanke Silhouette. Es ist nicht nur ihr Look, der mir verrät, dass sie Französin ist, sondern ihre Attitüde. Jede Menge Selbstbewusstsein, gepaart mit einer lässigen Unbefangenheit. Beim Näherkommen sehe ich, wie unglaublich hübsch sie ist. Als wir das Gartentor erreichen und noch drei, vier Meter von ihr entfernt sind, erkenne ich sie dann. In unserem Vorgarten steht keine Geringere als Emmanuelle Chevallier. Selbst wenn sie und ihre Mutter keine Kundinnen von Origami wären, würde ich Emmanuelle erkennen. In den vergangenen Wochen war ihr Gesicht aufgrund ihrer Affäre mit Félix Lacroix ständig in irgendwelchen französischen Illustrierten zu sehen. Allerdings hatten wir sogar mal persönlich Kontakt miteinander. Vor einem Vierteljahr hat Emmanuelle ihre Mutter zu einer Anprobe in Origamis Atelier begleitet. Eines der drei Kleider, die sie in Auftrag gab, habe ich angefertigt. Doch sicherlich wird Emmanuelle sich nicht an mich erinnern. Ich war bloß Personal, eine einfache Schneiderin, fast so etwas wie Inventar. Für die meisten Kundinnen bin ich quasi unsichtbar. Und selbst wenn nicht, liegt diese Begegnung bereits Wochen zurück.
Was mich aber viel mehr beschäftigt, ist die Frage, was sie hier tut. Ungläubig beobachte ich die Szene, die sich vor meinen Augen abspielt.
Emmanuelle reicht dem Mann von der Spedition das Klemmbrett, holt einen Schein aus ihrem Portemonnaie und sagt: »Das ist für Sie und Ihre Mitarbeiter! Merci beaucoup für Ihre Mühen.«
Verdutzt schaut er auf das Geld in seiner Hand. »Das ist zu viel, Mademoiselle!«, protestiert er, doch Emmanuelle, die French-Chic-Erbin, lässt seine Bedenken nicht gelten.
»Papperlapapp! Sie hatten doch ordentlich zu schleppen, und eine wirklich große Hilfe war ich nicht!« Sie lächelt ihn an, und man kann förmlich dabei zusehen, wie sein Widerstand bröckelt. Nervös reibt er sich den Nacken.
»Dann vielen herzlichen Dank, Mademoiselle!«, meint er und deutet beim Zurückgehen eine leichte Verbeugung an.
»Sehr gerne. Einen schönen Tag noch!«
Val und ich warten, bis er das Gartentor passiert hat, ehe wir zögerlich das Grundstück betreten und den zahlreichen Kartons ausweichen, die den Weg blockieren. Während ich den Hindernislauf absolviere, versuche ich zu verstehen, was Emmanuelle Chevallier hier macht. Ihren Eltern gehört ein milliardenschweres Unternehmen. Warum um alles in der Welt zieht sie in eine Vierer-WG in einem kleinen Reihenhaus in Plymouth? Alle Welt weiß, dass sie an der École de la Chambre Syndicale de la Couture in Paris Modedesign studiert. Okay, vielleicht nicht alle Welt, aber jeder in Paris, der etwas mit Mode zu tun hat. Die Chevallier-Geschwister – Emmanuelle hat noch einen älteren Bruder namens Henri –, gehören nicht nur zur High Society der Modemetropole, sondern werden auch als Gestalter ihrer Zukunft gehandelt.
Während Henri, der zudem als einer der begehrtesten Junggesellen von Paris gilt, bereits seinen Platz in der elterlichen Firma eingenommen hat, eilt Emmanuelle seit Jahren der Ruf eines vergnügungssüchtigen Partyluders voraus. Die gängigen Klatschzeitschriften sind gefüllt mit Fotos und Artikeln über das glamouröse Geschwisterpaar, und Emmanuelle will so gar nicht in das einfache Häuschen in der Kingsley Road passen.
Ehe ich sie fragen kann, was sie hier macht, entdeckt sie Val und mich. »Kann ich euch helfen?« Zugegebenermaßen müssen wir etwas verloren wirken, wie wir uns im vollgestellten Vorgarten umsehen.
»Nee, nicht wirklich, aber du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen«, meint Val, streckt dann die Hand aus und sagt: »Ich bin Valerie, und das ist Oxana. Wir sind deine Mitbewohnerinnen.«
»Excusez-moi! Mein Fehler, entschuldigt bitte. Ihr saht nur gerade so suchend aus.« Sie ergreift Valeries Hand. »Ich heiße Ella.« Sie wendet sich mir zu und reicht mir ebenfalls die Hand.
Ella? Ich muss an mich halten, um nicht ungläubig zu blinzeln. Vielleicht, denke ich, sind Spitznamen gerade groß in Mode.
Ella überrascht mich erneut, indem sie sagt: »Kennen wir uns nicht?«
»Nicht wirklich«, erwidere ich. »Wir …« Ich beäuge Val, die uns neugierig betrachtet, und verstumme. Origamis Kunden – und viel wichtiger er selbst – sind sehr auf Diskretion bedacht. Die Namen in der Kundendatei unterliegen strengster Geheimhaltung.
»Du hast ein Kleid für meine Mutter genäht, oder?«
Ich blinzle verwirrt. Bloß ein einziges Mal war Ella mit ihr zur Anprobe dort, und dennoch erkennt sie mich? »Du erinnerst dich an mich?«
»Natürlich!« Sie klingt beinahe empört. Beide Hände auf den Brustkorb oberhalb ihres Herzens gelegt, sagt sie: »Es ist ja zum einen noch nicht so lange her, und zum anderen hat Origami dich in den höchsten Tönen gelobt. Er hält große Stücke auf dich.«
Unwillkürlich erröte ich bei der Vorstellung, dass Origami bei seinen Kunden über mich spricht. Am liebsten würde ich nachhaken, wie es dazu kam und was genau er gesagt hat, doch ich beiße mir auf die Zunge und schlucke die Frage hinunter.
»Witzig, wie klein die Welt ist«, befindet Valerie. Sie deutet auf das Chaos im Vorgarten, der den Namen Garten definitiv zu Unrecht trägt, denn kein Grashalm ist zu sehen. Die wenigen Quadratmeter bis zum Hauseingang sind komplett zugepflastert und sehen alles andere als einladend oder behaglich aus. »Apropos klein … Du hast keine Ahnung, wie groß dein Zimmer ist, oder?«
»Äh, doch. Inzwischen schon. Aber ich hatte angenommen, mein Zimmer sei größer, sonst hätte ich nicht so viel Kram angeschleppt. Erst dachte ich, ich hätte mich verhört. Das andere Mädchen war so heiser, dass sie kaum einen Ton herausgebracht hat. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht mal sicher, ob ich ihren Namen richtig verstanden habe. Livy, oder?« Sie streicht sich eine Strähne ihres schokoladenbraunen Haars, das sie als Long Bob trägt, hinter das linke Ohr. Unauffällig mustere ich den dezenten, aber hochwertigen Schmuck, mit dem sie ihr Outfit abgerundet hat. Ella verkörpert dieses Pariser Je-ne-sais-quoi bis in die Spitzen ihrer frizzfreien Haare, die trotz des Umzugs perfekt sitzen. Selbst wenn ich hundert Jahre in dieser Stadt, die ich so sehr liebe, leben würde – niemals würde ich, wie sie, diese französische Lässigkeit ausstrahlen. Diese schlichte Eleganz, die so vielen Pariserinnen zu eigen ist, hat mich schon immer verunsichert.
»Nein. Libby. Eigentlich Liberty«, korrigiert Val unsere neue Mitbewohnerin.
»Oh, okay, dann besteht ja vielleicht noch Hoffnung, dass diese Abstellkammer doch nicht mein Zimmer ist, oder?«, fragt sie und sieht gespannt zwischen Val und mir hin und her.
»Ähm, ich bin nur ungern die Überbringerin schlechter Nachrichten, aber …«, mische nun ich mich ins Gespräch ein und lächle entschuldigend.
Ella gibt ein resigniertes Seufzen von sich. »Das darf doch nicht wahr sein!«, platzt es aus ihr heraus. Vorbei ist es mit der französischen Nonchalance. »In dem Zimmer gibt es nicht mal einen Schreibtisch!«, jammert sie. »Wo soll ich denn da arbeiten?«
Val zuckt mit den Schultern. »Vielleicht in der Küche oder im Wohnzimmer«, schlägt sie vor.
Nachdenklich nickend fragt Ella: »Aber wo packe ich nun mein ganzes Zeug hin? Das passt da ja nie rein.«
»Brauchst du das denn wirklich alles?«
Ellas entgeisterter Blick spricht Bände. Offensichtlich ist sie der festen Überzeugung, dass sie den gesamten Inhalt ihrer Kisten in absehbarer Zeit benötigt.
»Was mache ich denn nun?« Verzweifelt schweift ihr Blick über die zahllosen Kartons, zwischen denen ein großer getigerter Kater umherstreift. An der ein oder anderen Kiste bleibt das Tier stehen und reibt sich. Als Val in die Hocke geht und lockend die Hand ausstreckt, tippelt der Kater eilig herbei und schmiegt sein Köpfchen in Vals Handfläche.
»Das ist Lucky«, sagt sie und fügt hinzu: »Zumindest habe ich ihn so getauft.«
Ella geht ebenfalls in die Hocke – bei ihren Absätzen ein echtes Kunststück – und krault den Vierbeiner hinter den Ohren. Da er weiß, dass er die beiden bereits um die Tatze gewickelt hat, dreht er ab und schlendert mit hoch aufgestelltem Schwanz auf mich zu, um mir um die Beine zu streifen.
»Gehört der zum Haus?«, erkundigt Ella sich.
»Nein, er ist ein Streuner, aber er kommt hin und wieder vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.« Unsere Blicke folgen dem Kater, der augenscheinlich mit einem Mal genug von uns hat und davonspaziert.
Ich wende mich Ella zu. »Vielleicht tragen wir erst mal alles hoch«, schlage ich vor. Als sie nickt, schnappe ich mir eine Kiste. »Einen Teil kann man sicherlich auch vorübergehend im Flur zwischenlagern.«
»Ähm ja, also …«, beginnt Ella, und ich sehe, was das Problem ist, als ich den Flur betrete – er ist bereits komplett vollgestellt.
»Puh!«, fasst Valerie die ganze Situation treffend zusammen.
In Ermangelung einer anderen Option marschiert sie mit ihrem Karton die Treppe hinauf. Auch Ella folgt uns. Kurz darauf stehen wir oben in dem kleinen Raum, in dem gerade mal ein schmales Bett, ein Kleiderschrank und eine Kommode Platz haben.
»Nie im Leben bekomme ich hier mein ganzes Zeug unter. Gibt es einen Speicher?« Val schüttelte den Kopf. »Einen Keller? Eine Hundehütte?« Sie klingt verzweifelt.
»Nein, nichts dergleichen«, meine ich bedauernd.
»Mince alors!«, flucht sie wenig damenhaft. »Ich nehme an, keine von euch würde tauschen, oder?«
»Ich auf keinen Fall«, sagt Val. Sie hat mit Abstand das coolste Zimmer. »Ich habe selbst megaviel Zeug dabei. Einen Schreibtisch brauche ich in jedem Fall.«
»Wäre ja auch zu schön gewesen«, meint Ella. »Na ja, einen Versuch war es wert. Dass der Raum hundertachtzig Pfund pro Woche kostet, ist eine absolute Frechheit.«
»Finde ich auch«, stimme ich ihr zu. »Ich würde ja theoretisch tauschen, denn viel Zeug habe ich sowieso nicht dabei, aber dafür so viel Geld hinlegen würde ich auch nicht wollen.«
Ellas Kopf ruckt in meine Richtung. Gespannt blickt sie mich an. »Mal angenommen, du müsstest für das Zimmer hier bloß hundertzwanzig bezahlen?«
»Dann würde ich es sofort nehmen!«, stoße ich, ohne lange nachzudenken, hervor.
»Perfekt, dann machen wir das!«, sagt sie begeistert und streckt mir die Hand hin.
»Was machen wir?«, frage ich etwas verdattert.
»Ich zahle dir sechzig Pfund pro Woche, und dafür nimmst du das kleinere Zimmer. Wenn du magst, kann ich es dir auch gerne im Voraus für das Jahr auf dein Konto überweisen.«
»Ist das dein Ernst?«, hake ich nach, denn das klingt zu gut, um wahr zu sein.
»Mein völliger Ernst!«
Ella tippt auf ihrem iPhone herum und rechnet anscheinend schon fleißig. »Wir haben September … das heißt bis zum Unterrichtsende im kommenden Juni sind es noch vierzig Wochen«, murmelt sie. »Das wären also zweitausendvierhundert Pfund … dann lass uns doch einfach zweitausendfünfhundert daraus machen. Wohin soll ich dir das Geld schicken?«
Zögerlich nenne ich ihr meine Kontodaten, die sie eifrig notiert. Ich kann nicht glauben, was hier gerade passiert. Das ist beinahe wie ein Sechser im Lotto. Die Studiengebühren haben nahezu all meine mühsam ersparten Reserven verschlungen. Bis eben stand ich quasi wieder komplett vor dem Nichts – für mich eine absolut grauenerregende Vorstellung –, und jetzt … Ich kann erst einmal durchatmen und muss nicht den nächstbesten Job annehmen, um über die Runden zu kommen. Zweitausendfünfhundert Pfund reichen genau genommen für die Miete der nächsten zwanzig Wochen. Am liebsten würde ich vor Erleichterung laut jubeln oder Ella um den Hals fallen und sie küssen. Mit einem Mal kommt mir meine Entscheidung, nach Plymouth zu ziehen, gar nicht mehr so zweifelhaft vor.
Beinahe schon beschwingt beginne ich damit, meine Habseligkeiten zu holen und in meinem neuen Zimmer zu verräumen. Da ich, anders als Ella, mit leichtem Gepäck angereist bin, brauche ich keine zwanzig Minuten, bis ich ihr grünes Licht geben kann.
Ich finde Valerie und Ella auf der Terrasse im Hinterhof vor, wo sie Kaffee trinken und einander beschnuppern.
»So, ich wäre dann fertig mit Umziehen, aber alles wirst du auch in dem Zimmer nicht unterbekommen«, warne ich sie vor.
»Ach, das wird schon«, behauptet sie etwas blauäugig und unterschätzt völlig das Ausmaß ihrer Besitztümer.
»War Parker … äh Mr. Gibson … also unser Vermieter, meine ich, denn schon da und hat dir alles gezeigt?«, erkundigt sich Val.
»Ja, aber nur ganz kurz, weil er auf eine Baustelle musste, um eine Lieferung anzunehmen. Wirklich gezeigt hat er mir nichts, aber der Mietvertrag ist unterschrieben, und meine Schlüssel habe ich auch.« Demonstrativ fischt sie den Schlüssel aus der Gesäßtasche und hält ihn hoch.
»Wenn du magst, kann ich dir später alles zeigen«, bietet Val an. »Und wenn du Hilfe beim Hochtragen brauchst, stehe ich dir ebenfalls gerne zur Seite.«
»Das ist lieb von dir, aber echt nicht nötig. Ich muss mir ohnehin erst mal einen Überblick verschaffen. Für eine Hausführung später wäre ich aber dankbar.«
»Klar, sehr gerne.« Als Ella weg ist, sagt Val in verschwörerischem Tonfall: »Das ganze Zeug passt niemals in dein altes Zimmer.«
»Nein«, stimme ich ihr zu. »Niemals.« Wir grinsen einander an.
»Parker kennt bestimmt jemanden, der einen Lagerraum übrig hat«, sinniert Val. »Apropos Parker. Ich habe eine Nachricht von ihm bekommen, die dich sehr freuen wird.«
Überrascht horche ich auf. »Ach ja?«
»Du, liebe Oxy … Trommelwirbel … hast morgen früh um zehn Uhr ein Vorstellungsgespräch im angesagtesten Club der Stadt! The Tarantula heißt er, und sie suchen eine zuverlässige Bedienung. Hast du schon mal gekellnert?«
»Die Frage ist eher, wann habe ich mal nicht gekellnert?«, meine ich und bringe Val damit zum Lachen.
»Super! Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Der Club wird von den Zwillingsbrüdern von Parkers bestem Freund betrieben. Sie heißen Phoenix und Everett. Der Club ist von der Musik her recht retromäßig. Sie spielen dort überwiegend Old-School-Rock.«
»Warst du schon da?«
»Ja, schon ein paarmal. Es ist echt cool. Hast du Lust, heute Abend hinzugehen, um dir im Vorfeld schon mal alles anzusehen? Wir könnten auch Ella mitnehmen und ihren Einstand feiern, wenn dir das recht ist.«
Ich lege den Kopf schief, überlege kurz und sage dann: »Klar, warum nicht? Das ist eine tolle Idee. Und weißt du was? Die Drinks gehen heute Abend auf mich. Nur schade, dass Libby nicht mitkommen kann.«
Val nickt zustimmend. »Vielleicht können wir ihr ja einen alkoholfreien Cocktail to go mitbringen oder so, damit sie nicht ganz außen vor ist.«
»Das ist eine nette Idee«, befinde ich, woraufhin Val breit grinst.
»Wie gesagt: Wir müssen zusammenhalten.«
2
Henri
»Monsieur Chevallier, Ihre Schwester ist am Telefon«, ertönt die Stimme meiner Sekretärin aus dem Kopfhörer meines Headsets.
»Stellen Sie sie bitte durch, Vanessa«, erwidere ich und lehne mich in meinem schweren Sessel zurück. Ein wohliges Seufzen entfährt mir, als ich die Massagefunktion betätige und darauf warte, Ellas Stimme zu hören. Vom langen Sitzen sind meine Muskeln völlig verhärtet. Ich werde nachher auf alle Fälle joggen gehen – komme, was wolle. Seit drei Tagen war ich nicht mehr laufen. Normalerweise ist es fester Bestandteil meines Tagesprogramms, doch mein Projekt steckt in einer schwierigen Phase. Ein Problem jagt das nächste, und ich bin dabei, mir unentwegt den Kopf zu zerbrechen. Gerade als meine Gedanken wieder zu rotieren beginnen, höre ich ein mir so vertrautes: »Bruderherz!«
Ella hat gute Laune. Sie kann ihre Emotionen nicht verbergen – könnte es vermutlich nicht einmal, wenn ihr Leben davon abhinge. Das ist gut und schlecht zugleich. In unserer Welt, in der die makellose Fassade alles ist, in der sich die Meute wie ein Rudel Hyänen auf einen stürzt, sobald diese zerbricht, ist Ella eine erfrischende Abwechslung – allerdings macht ihre Offenheit sie auch angreifbar. Obwohl man sie in der Vergangenheit mehr als einmal schwer enttäuscht, sie belogen und ausgenutzt hat, geht Ella mit einem offenen Herzen durch die Welt. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche über mich sagen.
»Gut angekommen, Bibou?«, frage ich, um das Gefühl, das sich in mir regt, im Keim zu ersticken. Auf keinen Fall werde ich in Selbstmitleid versinken. Das ist armselig! Und wir Chevalliers sind niemals armselig.
»Oh bitte, nenn mich nicht immer so, Henri! Ich hasse das! Ich bin keine acht mehr.«
Ich lache über ihre leidenschaftliche Empörung.
»Du bist ein Idiot!«, mault sie – zu Recht, denn ich weiß genau, dass sie es nicht leiden kann, wenn ich diesen Kosenamen verwende. »Aber ja, ich bin gut angekommen.«
»Ich kann nicht glauben, dass du das durchziehst.«
»Oh bitte!«, schnaubt sie, und ich weiß, dass sie mit den Augen rollt. Hinfort ist ihre gute Laune. »Was hätte ich sonst tun sollen?«
»Du bist immer noch sauer«, stelle ich fest und wünsche, unser Vater hätte Ella nicht verärgert. Hätte es diesen Streit nicht gegeben, wäre Ella nun nicht in Plymouth, sondern immer noch in Paris. Ich mache mir Sorgen, weil die Fronten so verhärtet sind. Beide sind so dickköpfig. Keiner von ihnen wird nachgeben. Auch wenn ich gerade behauptet habe, ich könne nicht glauben, dass Ella wirklich nach Plymouth gegangen ist, so sieht es ihr doch verdammt ähnlich. »Falls es dich freut: Er schäumt vor Wut.« Dass er ihre Idee für dumm und kindisch hält, verschweige ich wohlweislich.
»Ist mir egal«, murmelt sie. »Ich bin nicht gegangen, um ihn zu ärgern, Henri.«
»Sondern?«
»Weil mir einfach alles über den Kopf gewachsen ist und ich das Gefühl hatte zu ersticken. Ich musste einfach weg. Ich wäre sonst verrückt geworden!« Sie klingt verzweifelt, aber auch so, als würde sie hoffen, dass ich sie verstehe. Das ist ein Problem, denn ich tue es nicht. Doch ich will nicht streiten – es wäre ohnehin sinnlos. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wenn man so will. Dort ist es nun. Punkt.
»Wie gefällt es dir denn bisher?«
»Du fragst Sachen! Ich bin doch noch keine zwei Stunden hier! Überraschend warm ist es. Und sonnig.« Ella hört sich beinahe empört an, was mich schmunzeln lässt. Ja, wie kann das britische Wetter sich bloß von seiner besten Seite zeigen, statt mit klischeehaftem Nieselregen und Nebel aufzuwarten? Echt unverschämt! »Und dummerweise bin ich mit so viel Zeug hier angereist, dass es nicht in mein Zimmer passt. Ich werde es irgendwo einlagern müssen.«
Während ich ihr zuhöre, erhebe ich mich schwungvoll aus dem Sessel und trete an die Fensterfront, um meinen Blick über die Seine schweifen zu lassen. Der Anblick von Wasser hatte schon immer eine beruhigende Wirkung auf mich, weshalb ich die exklusive Lage des French-Chic-Hauptquartiers sehr zu schätzen weiß.
»Das Haus ist klein, aber sauber. Besser als erwartet, wenn ich ehrlich bin, und meine Mitbewohnerinnen scheinen nett zu sein.«
»Mitbewohnerinnen? Da wird Étienne beruhigt sein.«
»Er sorgt sich grundlos. Dass ich hier bin, hat nichts mit Papa zu tun und auch nicht mit Étienne.« Das sollte sie lieber ihm sagen und nicht mir. Ich glaube, er nimmt es nicht so easy, dass sie spontan beschlossen hat, ein Jahr im Ausland zu studieren. »Das hier wird mir guttun.« Ich weiß nicht, ob sie versucht, sich selbst zu beruhigen, oder ob die Worte mir gelten, doch ich erinnere mich daran, was sie vor drei Tagen beim Kofferpacken gesagt hat: »Ich habe es so satt, Emmanuelle Chevallier zu sein!«, rief sie trotzig aus. Auch jetzt kann ich bloß den Kopf darüber schütteln.
»Ein Selbstfindungstrip?«
»Habe ich dir heute schon gesagt, dass du ein Idiot bist, Henri?« Ella klingt angefressen.
»Ich? Ich wiederhole mich nicht gerne, aber weil du meine Lieblingsschwester bist, mache ich eine Ausnahme, Bibou: Du kannst nicht davor davonlaufen, wer du bist. Wir sind, wer wir sind! Du denkst, du kannst dich im tiefsten Cornwall verstecken? Vergiss es! Man wird dich erkennen«, prophezeie ich ihr. »Du bist nun einmal Emmanuelle Chevallier! Stilikone, It-Girl, Trendsetterin …«