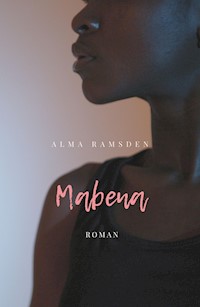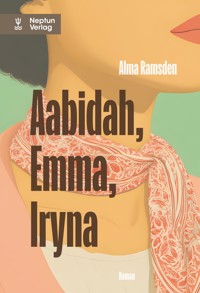
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neptun Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Frauen, deren Wege sich kreuzen. Drei Schicksale. Eine gemeinsame Suche nach Identität, Heimat und Selbstbestimmung. Die junge Syrerin Aabidah führt ein glückliches Leben – bis der Krieg in ihrer Heimat ihr und ihrer Familie alles zu nehmen droht. Als sich die Gelegenheit bietet, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, sagt sie zu – hoffend, dass sie Gehör findet und die Zukunft ihrer Kinder dadurch gesichert wird. Doch ihr tiefstes, schmerzvollstes Geheimnis behält sie für sich. Emma, eine Schweizer Hebamme, fühlt sich gefangen in einem monotonen Alltag mit zwei kleinen Kindern und einer kriselnden Ehe. Ein Moment des Scheiterns stürzt sie in eine Spirale aus Schuld und Selbstzweifeln, aus der sie sich kaum zu befreien vermag – bis das Leben sie erneut vor eine schwere Entscheidung stellt. Die junge Ukrainerin Iryna konnte sich aus schwierigen Verhältnissen in Familie und Ehe befreien. Doch der Preis der Freiheit ist hoch: Ohne finanzielle Sicherheit muss sie eine folgenreiche Entscheidung für sich und ihre Töchter treffen. Der Roman verwebt die Lebensgeschichten der drei Frauen mit aktuellen geopolitischen Ereignissen und lässt dabei ihre persönlichen Kämpfe, Traumata und inneren Konflikte lebendig werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Drei Frauen, deren Wege sich kreuzen.
Die junge Syrerin Aabidah führt ein glückliches Leben – bis der Krieg in ihrer Heimat ihr und ihrer Familie alles zu nehmen droht. Als sich die Gelegenheit bietet, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, sagt sie zu – hoffend, dass sie Gehör findet und die Zukunft ihrer Kinder dadurch gesichert wird. Doch ihr tiefstes, schmerzvollstes Geheimnis behält sie für sich.
Emma, eine Schweizer Hebamme, fühlt sich gefangen in einem monotonen Alltag mit zwei kleinen Kindern und einer kriselnden Ehe. Ein Moment des Scheiterns stürzt sie in eine Spirale aus Schuld und Selbstzweifeln, aus der sie sich kaum zu befreien vermag – bis das Leben sie erneut vor eine schwere Entscheidung stellt.
Die junge Ukrainerin Iryna konnte sich aus schwierigen Verhältnissen in Familie und Ehe befreien. Doch der Preis der Freiheit ist hoch: Ohne finanzielle Sicherheit muss sie eine folgenreiche Entscheidung für sich und ihre Töchter treffen.
Der Roman verwebt die Lebensgeschichten der drei Frauen mit aktuellen geopolitischen Ereignissen und lässt dabei ihre persönlichen Kämpfe, Traumata und inneren Konflikte lebendig werden.
Die Autorin
Alma Ramsden ist promovierte Ökonomin und beschäftigt sich beruflich mit der Analyse von Zahlen – jedoch interessiert sie sich nicht nur für Statistiken, sondern auch für die menschlichen Schicksale, die sich hinter ihnen verbergen. In ihren literarischen Texten verleiht sie den anonymen Daten eine Stimme und bringt das Unsichtbare ans Licht. Geprägt von zahlreichen Reisen und ihrer freiwilligen Arbeit für Menschenrechts- und Asylorganisationen, schreibt Alma Ramsden in einem Stil, der von Empathie und subtiler gesellschaftlicher Kritik geprägt ist. Ihre Erfahrungen fließen in ihre Bücher ein und entfalten sich in persönlichen, vielschichtigen Erzählungen. Alma Ramsden lebt mit ihrer Familie in der Schweiz.
Alma Ramsden
Abidah, Emma, Iryna
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2025 by Neptun Verlag
Rathausgasse 30
CH-3011 Bern / Schweiz
www.neptunverlag.ch
ISBN 978-3-85820-411-0
Vorbemerkung
Der Roman spielt hauptsächlich in den Jahren 2018 bis 2022. Syrien war in jenen Jahren geprägt von einem festgefahrenen Bürgerkrieg, zunehmender wirtschaftlicher Not, einer anhaltenden humanitären Krise sowie der zunehmenden Machtkonsolidierung des im Jahr 2024 zerfallenen Assad-Regimes. Die Ukraine war in jener Zeit von anhaltenden Spannungen mit Russland bestimmt, die mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 in einen offenen Krieg mündeten.
Die Geschichten der Protagonistinnen, ebenso wie die geschilderten politischen und historischen Ereignisse sowie die juristischen Rahmenbedingungen in Syrien, der Ukraine und der Schweiz, beruhen auf wahren Begebenheiten und sorgfältiger Recherche. Die dargestellten Figuren hingegen sind frei erfunden; etwaige Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.
Prolog
Aabidah lag auf dem Sofa, schwer atmend und schweißgebadet, als Emma mit leisen Schritten ins Wohnzimmer ihrer Nachbarn trat, einen schweren Notfallkoffer in der Hand. Das Wohnzimmer war ausgestattet mit antiken Möbelstücken, die einen grotesken Kontrast bildeten zu dem modernen Einfamilienhaus aus Beton, in dem sie sich befanden. Mit der hochschwangeren Aabidah auf dem Biedermeiersofa wirkte es auf Emma wie eine Szene aus dem vorletzten Jahrhundert, als Babys noch zu Hause geboren wurden mit Hilfe von Müttern, Großmüttern oder Nachbarinnen, die sich im Laufe ihres Lebens ein wenig Wissen über Geburten angeeignet hatten.
Ein intensiver Geruch durchdrang Emmas Nase. Jeder Haushalt hat seinen eigenen Geruch, den nur außenstehende Personen riechen können, während man den eigenen nicht wahrnimmt, dachte Emma. Wie ihre eigene Familie wohl roch? Und ob es im neuen, größeren Haus noch der gleiche Geruch war wie damals in ihrem kleinen Reihenhäuschen?
Emma betrachtete die vor Schmerzen gekrümmte Aabidah bestürzt. Sie wusste, was bei einer Geburt alles schiefgehen konnte und dass der vermeintlich natürliche Vorgang voller Tücken war. In vielen Teilen der Welt sterben auch heute noch häufig Frauen infolge von Schwangerschaft und Geburt, weil die erforderliche medizinische Versorgung fehlt. Kurz vor und nach der Geburt ist die Gefahr für Komplikationen besonders hoch.1
»So hilf ihr doch!«
Marcos verzweifelte Stimme holte Emma zurück in die Realität. Die hochschwangere Frau mit den langen, dunkelblonden Haaren und dem blassen Gesicht, die auf dem Sofa lag wie ein von einer mächtigen Welle an Land gespülter Wal, war nicht Aabidah. Natürlich nicht. Sie hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit der charismatischen Aabidah, wie hatte Emma sich dies nur einbilden können? Emma ging auf sie zu.
»Hallo«, sagte Emma zögerlich auf Englisch, »mein Name ist Emma und ich bin Hebamme. Ich kann dir helfen. Darf ich dich untersuchen?«
Die Schwangere nickte mit vor Schmerzen verzerrtem Gesicht. Emma erklärte ihr, dass sie zuerst ihren Bauch abtasten und dann die Herztöne des Babys abhören wollte.
»Ist das in Ordnung?«, fragte sie zur Sicherheit, während sie die beiden Enden des Stethoskops in ihre Ohren stöpselte.
Als die schwangere Frau wieder nickte, legte Emma das Bruststück des Stethoskops mit leichtem Druck auf ihren Bauch. Sie lauschte andächtig. Die Herztöne des Babys waren normal. Emma legte das Stethoskop zur Seite, danach tastete sie vorsichtig den Bauch der Gebärenden ab.
Und sie spürte es sofort: eine Steißlage.
Emma schloss die Augen und zählte langsam von zehn auf eins. Der Befund war angesichts der Situation, in der die Frau sich befand, keine gute Nachricht. Denn das Risiko für Komplikationen war bei einer Geburt mit Steißlage deutlich erhöht.
Sie fragte ihre Patientin, ob sie sie untersuchen dürfe, um festzustellen, wie weit sich der Muttermund geöffnet hatte. Zwischen zwei Wehen presste diese ein verzweifeltes »Yes« hervor.
Emma desinfizierte erneut ihre Hände, bevor sie die Frau mit großer Sorgfalt mit den Fingern abtastete. Es bestätigte ihre Vermutung: Die Austreibungsphase stand kurz bevor. Da sie bereits zwei Kinder geboren hatte – wie Emma am Telefon erfahren hatte, als sie sich nach den Umständen der Schwangeren erkundigte –, konnte es nun sehr schnell gehen. Die Wahrscheinlichkeit war gering, dass sie es rechtzeitig ins nächstgelegene Spital schafften.
Emma atmete tief ein und aus. »Ruf den Notruf an«, forderte sie Marco auf, der neben ihr stand.
»No!« Die Antwort war heftig. Sie stammte von der Gebärenden. »No hospital. I can do this.«
Emma zählte langsam von zehn auf eins. Sie wusste, wozu sie von Berufs wegen verpflichtet war. Aber dann würde sie sich dem Wunsch ihrer Patientin entgegensetzen. Und bis der Rettungsdienst einträfe, wäre das Baby vermutlich sowieso bereits geboren. Es lag jetzt allein an ihr, dem Kind auf die Welt zu verhelfen.
Drei Augenpaare blickten Emma flehend an. Niemand sollte erfahren, was hier geschah. Niemand durfte wissen, dass diese Frau hier war. Denn sie war nicht offiziell hierhergekommen, keine Behörde war involviert gewesen – darum hatte man Emma hierhergebeten.
Ich habe es mit Menschenschmugglern zu tun, schoss es Emma durch den Kopf. Oder wie sonst konnte man ein Paar nennen, das illegal eine werdende Mutter über staatliche Grenzen beförderte, um sich deren Kind anzueignen?
Doch damit durfte sie sich jetzt nicht befassen. Ein Kind musste zur Welt gebracht werden. Sie musste sich ganz auf die eine Aufgabe konzentrieren, dieser Frau und dem Baby die bestmögliche Hilfe zu bieten, und zwar schnell – denn Zeit war, wie vor drei Jahren, ein kritischer Faktor.
Wenn sie damals vor drei Jahren versucht hätte, das Baby auf dem Grenzwachtposten zur Welt zu bringen, hätte es dann überlebt? Hatte ihr Drängen auf die Verlegung in ein Spital dem Mädchen das Leben gekostet? Wenn sie sich geweigert hätte, ins Fahrzeug der Grenzpatrouille zu steigen ... Emma trug die Erinnerung an ihr Versagen noch immer tief in sich. Sie versuchte, diese Erinnerung zu verdrängen, während sie sich darauf vorbereitete, einem Kind unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen auf die Welt zu verhelfen.
Teil 1
Aabidah
»Ich beginne jetzt die Aufnahme, in Ordnung?«
»Ja.«
»Danke, Aabidah, dass du dir Zeit nimmst. Darf ich deinen Namen im Text zitieren? Aabidah Souleyman?«
»Ja.«
»Okay, sehr gut.«
Kurzes Schweigen.
»Wie alt bist du, Aabidah?«
»Ich bin 30 Jahre alt.«
»Noch so jung.«
Wieder Schweigen. Was soll Aabidah darauf erwidern? Sie möchte nicht unhöflich sein, zu wichtig ist dieses Gespräch. Doch es fällt ihr einfach keine Antwort ein.
»Seit wann bist du in der Schweiz?«
»Seit etwa drei Jahren.«
»Noch nicht sehr lange.«
»Nein.«
»Du sprichst aber sehr gut Deutsch!«
Wie oft Aabidah das schon gehört hat. Die Leute in diesem Land sehen eine Frau mit Kopftuch, wenn sie ihnen gegenübertritt, und dieses Kopftuch macht alles andere unsichtbar. Es degradiert sie zu einer unterdrückten, unterwürfigen und bedürftigen Frau, die nicht in die westliche Gesellschaft integriert ist. Dabei könnte sie ihr Kopftuch jederzeit ablegen, niemand zwingt sie, es zu tragen. Ihre Tochter wird es gewiss nie tun. Der Glaube, der Aabidah in den schwersten Zeiten ihres Lebens Halt gegeben hat, bedeutet ihrer Tochter Armira nichts. Sie identifiziert sich, wie ihr großer Bruder Yasin, stark mit den Werten und Vorstellungen der westlichen Gesellschaft. Und das ist gut so. Aber für Aabidah wird es nie möglich sein, so zu denken wie ihre Kinder. Sie hat zu viel erlebt. Aabidah beschützt ihre Kinder, doch wer beschützt sie im Gegenzug, wenn nicht Gott? Er bietet ihr den Schutz, den kein Mensch auf dieser Welt ihr geben kann. Deshalb hält sie an dem Kopftuch fest: Es verbindet sie mit Gott. Aabidah ist intelligent, ehrgeizig, gebildet. Sie hat ein fast abgeschlossenes Studium der Ingenieurwissenschaften vorzuweisen. Sie war in der Schule stets Klassenbeste, und das Erlernen einer neuen Sprache ist für sie ein Leichtes. Aber diese Seite von Aabidah sieht niemand. Und darum sind die Menschen, denen sie hier in der Schweiz begegnet, irritiert, wenn Aabidah den Mund öffnet und fließend Deutsch spricht.
Yasin und Armira sind ebenso intelligent wie sie. Yasin wurde eingeladen, an einer Mathematikolympiade teilzunehmen, nächsten Monat wird Aabidah mit ihm dafür nach Rom fahren. Er übt fleißig, will unbedingt gewinnen. Die zwei Jahre jüngere Schwester versucht, die gleichen Übungen zu lösen, was ihr in vielen Fällen auch gelingt. Yasin und Armira werden eines Tages erfolgreich sein, davon ist Aabidah überzeugt.
»Auch ich hätte erfolgreich sein können, hätte nicht ein nie enden wollender Krieg – seit über zehn Jahren tobt er schon – mein Leben zerstört. Der Krieg ist in mein Leben getreten, wie jeder schwere Schicksalsschlag in das Leben eines Menschen tritt: unerwartet, unausweichlich, grausam. Doch anders als für die Menschen in Ländern mit stabilen Volkswirtschaften, demokratischen Regierungen und sozialen Auffangnetzen hat es für mich und meine Familie keine Hilfe, keine Rettung gegeben. Denn das Problem ist unser Land selbst, oder vielmehr der Präsident, der es regiert.«
Doch diese Worte spricht sie nicht aus. Stattdessen sagt sie nur: »Danke.«
»Wie geht es dir heute?«
»Es geht mir gut, danke.«
»Aabidah, erzähl mir deine Geschichte. Von Anfang an.«
»Von Anfang an?«
»Von Anfang an.«
Emma
Emma hatte ihren Sohn Julian soeben in sein Bettchen gelegt; er war wundersamerweise sofort eingeschlafen. Ein paar Minuten saß sie still neben ihrem friedlich schlafenden Sohn. Sie betrachtete ihn zunächst aus halb geschlossenen Augen, legte dann ihre Stirn an seine und sog seinen süßlichen Duft ein, eine Mischung aus Puder, Milch, Gurken, an denen er geknabbert hatte, und Karottenbrei, von dem mehr auf seinem Strampler als in seinem Bauch gelandet war. Wie sie ihn liebte. Hatte sie tatsächlich vor einer halben Stunde, als sein Gebrüll kein Ende zu nehmen schien, aus dem Haus laufen wollen, um dem Geschrei zu entkommen?
Sie wandte sich von ihrem friedlich schlummernden Kind ab, ging in die Küche und widmete sich dem Abwasch, der sich vor ihr auftürmte. In dem Moment fühlte sie sich wie ein erschöpfter Bergsteiger, der vor dem dritten Gipfel steht, den es noch zu erklimmen gilt. Während sie die Spuren des Mittagessens wegräumte, zählte sie im Kopf die Stunden bis zu dem Moment, in dem ihre beiden Kinder endlich im Bett liegen würden. Den Tag in Etappen zu zerlegen, war für Emma eine unverzichtbare Strategie, um ihren erfüllten, aber eintönigen Alltag zu bewältigen.
Sie warf den von der Tomatensoße rötlich eingefärbten Schwamm ins Waschbecken, noch bevor sie den letzten Topf gesäubert hatte; den konnte sie auch heute Abend noch reinigen. Emma erledigte im Haushalt nur das Nötigste, ganz im Gegensatz zu den Ehefrauen und Müttern in ihrem Umfeld, die offenbar hohe Ansprüche an ihre Haushaltsführung hatten, wie die stets makellose Sauberkeit und Ordnung in ihren Häusern vermuten ließ. Für Emma war der Haushalt nichts weiter als eine lästige Pflicht.
Ihren Beruf als Hebamme hingegen, den sie nach Julians Geburt aufgegeben hatte und inzwischen vermisste, obwohl er anstrengend gewesen war, hatte sie stets mit großer Leidenschaft und Gewissenhaftigkeit ausgeführt. Sie war sich der immensen Verantwortung, die sie für das entstehende Leben und die werdenden Mütter trug, stets bewusst gewesen.
Emma deckte die Reste des Mittagessens mit Frischhaltefolie ab und stellte sie neben den Herd, damit Tim sie am Abend leicht finden konnte, falls er spät nach Hause kam. Ihr Ehemann Tim war das genaue Gegenteil von Emma: Er war fleißig und erledigte all seine Tätigkeiten äußerst exakt und effizient, auch die häuslichen, und selbst wenn es sich um lästige Aufgaben handelte. Er hielt pedantisch Ordnung und war nie zu spät zu einer Verabredung. Für ihn schien es kein schöneres Gefühl zu geben, als seine Tagesziele hochzustecken, sie bereits am frühen Nachmittag erreicht zu haben und dann über sie hinauszuarbeiten. So gesehen war sein Beruf als Sachbearbeiter einer großen Versicherungsfirma ideal: Täglich mussten Anträge geprüft und deren Risiken eingeschätzt werden, und von diesen Anträgen gab es immer genug. Tims Ziel war die Beförderung zum Abteilungsleiter, und er betonte Emma gegenüber immer wieder, dass seine Chancen dafür nicht ganz so schlecht ständen.
Es hatte vor Tim keinen anderen Mann gegeben in Emmas Leben, denn Emma tat sich schwer damit, neue Leute kennenzulernen. Sie war zwar eine attraktive Frau, doch ihre zurückhaltende Art erschwerte ihr das Kennenlernen neuer Menschen. Auf den ersten Blick gefiel Emma der drei Jahre ältere Mann, den sie über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt hatte, überhaupt nicht. Sie hatte sich aus unzähligen Liebesromanen einen Traummann zusammengeschustert: groß, muskulös, strohblond, mit kantigen Gesichtszügen und Bartstoppeln. Tim war das Gegenteil davon: stämmig, unsportlich, mit rundlichem Bubengesicht. Angetan hatten es ihr einzig seine haselnussbraunen Augen, sein verwuscheltes, braunes Haar, das sie als Zeichen von Verwegenheit deutete, sowie sein ewig schiefes Lächeln. Tims Charakter jedoch entsprach durchaus dem Traummann, den sie über die Jahre kreiert hatte: einfühlsam, romantisch, gütig und humorvoll. Also beschloss sie, Tim eine Chance zu geben, und verliebte sich bereits beim ersten Treffen in ihn. Was sie zuvor an seinem Äußeren gestört hatte, war plötzlich wie ein blinder Fleck auf ihrer Retina.
Zehn Jahre war das her. Emmas anfängliche Verliebtheit war längst abgeflaut, doch sie schätzte ihren Mann noch immer sehr. Er war ein fürsorglicher Ehemann und engagierter Vater, der seine Familie über alles stellte, Emma vergötterte und sich, wenn schon nicht mit Mut und Virilität, so doch immerhin mit Fleiß und Ehrgeiz hervortat. Dies, zusammen mit seiner grenzenlosen Anspruchslosigkeit, sorgte dafür, dass Emma und Tim so gut wie nie aneinandergerieten. Seit der Geburt ihrer Kinder lebten sie zunehmend in stiller Harmonie aneinander vorbei. Tim begleitete Emma zwar im realen Leben, aber nicht in ihren vielen Tagträumen.
Emma wusch sich nach getaner Arbeit sorgfältig die Hände, bereitete einen doppelten Espresso zu, setzte sich aufs Sofa und holte ein Buch hervor. Seit einer Woche las sie an einem 300-seitigen Kriminalroman, eine ungewöhnlich lange Zeit für eine leidenschaftliche Leserin wie sie. Nun war sie fast am Ende des Krimis und konnte es kaum erwarten, zu erfahren, wer der Mörder war.
Zwanzig Seiten vor dem Ende des Buches kündigte der Timer ihres Smartphones an, dass sie nur noch zehn Minuten Zeit hatte, bis sie ihre Tochter Lena vom Kindergarten abholen musste. Sie hatte den Timer vorsorglich gestellt, weil sie beim Lesen des Öfteren die Zeit vergaß.
»Immer dieser Stress«, murmelte sie. Seit sie Kinder hatte, war ihr Alltag durchgetaktet. Morgens um halb sieben musste sie die Kinder wecken, ihnen zu essen geben, sie wettergerecht ankleiden und dann mit ihnen losmarschieren. Der Gang zum Kindergarten, nur wenige hundert Meter entfernt, dauerte eine Ewigkeit. Die fünfjährige Lena blieb bei jedem Stein, bei jedem Blümchen, bei jeder Katze und bei jedem Hund, sogar bei jeder Schnecke und bei jedem Regenwurm stehen, um diese Objekte und Lebewesen zu bewundern, zu berühren und zu untersuchen. Zurück zu Hause brauchte Julian seine Flasche. Danach bereitete Emma das Mittagessen vor. Noch ein bisschen spielen mit Julian, dann war es auch schon wieder Zeit, Lena abzuholen, also musste sie Julian erneut fertig machen, um den Gang zum Kindergarten und zurück anzutreten. Um Punkt zwölf wärmte sie das Mittagessen auf, das sie vorbereitet hatte – nur lauwarm, denn Lena mochte es nicht heiß –, und verbrachte die nächste halbe Stunde damit, ihre Tochter zu motivieren, doch wenigstens ein bisschen Gemüse zu essen, während sie Julian ermunterte, ein paar Löffel Brei in den Mund zu nehmen und auch bei sich zu behalten. Julian jedoch spuckte stoisch alles aus, was sie ihm in den Mund schob, und brüllte nach kurzer Zeit so lange, bis er Milch bekam. Am Nachmittag, während Julian seinen Mittagsschlaf hielt und Lena im Kindergarten war oder draußen mit ihren Freundinnen spielte, hatte Emma ein bisschen Zeit für sich. Es war eine kurze Ruhepause, bevor der getaktete Alltag weiterging: Lena im Kindergarten abholen, den Kindern eine kleine Zwischenmahlzeit geben, Abendessen zubereiten, mit den Kindern essen, sie baden, ihnen die Zähne putzen, Gutenachtgeschichten vorlesen, sie ins Bett stecken.
Und am nächsten Tag ging alles von vorne los. Am Morgen kein ausgedehnter Kaffee mit Buch, stattdessen ein hastig heruntergestürzter Espresso.
Emma schaltete den Alarm ihrer Zeituhr aus und erhob sich langsam vom Sofa. Julian würde eine frische Windel benötigen, bevor sie gemeinsam zum Kindergarten loszogen. Doch zuvor wollte sie noch ein paar Minuten im Garten sitzen, eine Zigarette rauchen und ihr Gesicht der Sonne entgegenstrecken. Sie holte die Packung Zigaretten aus dem obersten Fach ihres Kleiderschranks, wo sie zwischen zwei Winterpullovern versteckt lag, entnahm einen Glimmstängel und zündete ihn an, sobald sie im Freien war. Emma rauchte monoton und verdrängte dabei den Gedanken, wie schädlich Zigaretten für die Gesundheit waren. Als die Zigarette zur Hälfte geraucht war, vernahm sie Julians Krähen. Emma schaffte es, Julians Weinen auszuhalten, bis die Zigarette zu zwei Dritteln geraucht war, dann nahm es Dimensionen an, die sie nicht länger ignorieren konnte. Schnell drückte sie die Zigarette auf dem Untersetzer ihrer Kaffeetasse aus und vergrub sie danach im Kompostkübel, bevor sie nach drinnen eilte, um sich ihres Sohnes anzunehmen.
Iryna
Die Hitze drückte auf die Erde wie ein stempelfreudiger Daumen auf Papier. Die Sonne schien grell am Himmel Kiews. Sie spiegelte sich in der weißen Fassade des kleinen Cafés wider, auf dessen Terrasse Iryna mit ihrer Freundin Anastasya saß, und blendete Irynas ungeschützte Augen. Iryna hatte ihre Sonnenbrille verloren und kein Geld, sich eine neue zu kaufen. Sie kniff die Augen zusammen, was sie wohl so vergrämt aussehen ließ, wie sie sich fühlte.
»Alles okay?«, fragte ihre Freundin Anastasya.
»Ja, alles bestens«, erwiderte Iryna und unterdrückte ein Gähnen.
»Du wirkst angespannt«, meinte Anastasya, während sie Iryna kritisch über ihre Kaffeetasse hinweg musterte.
Iryna konnte sich trotz ihres Kummers ein Lächeln nicht verkneifen. Anastasya war schon immer sehr ehrlich gewesen, fast unverschämt, und es passte zu ihr, dass sie mit einem solchen Kommentar nicht zurückhielt, obwohl sich die beiden Freundinnen seit zehn Jahren nicht gesehen hatten.
Die beiden Frauen waren nach Anastasyas Wegzug aus Kiew über soziale Netzwerke lose in Kontakt geblieben. Iryna hatte dadurch am Rande mitbekommen, was sich in Anastasyas Leben tat. Es kam Iryna auch nicht vor, als hätte sie ihre einst beste Freundin ein Jahrzehnt nicht gesehen im realen Leben. Im Gegenteil, es schien, als wäre es erst gestern gewesen, dass sie auf dem überfüllten Pausenhof die Köpfe zusammensteckten. Mitten im Lärm, den unzählige Kinder und Jugendliche erzeugen, zusammengepfercht auf einem Schulhof nach stundenlangem erzwungenem Stillsitzen, tauschten sie tiefste Geheimnisse aus und trösteten sich bei Liebeskummer.
Ein Jahrzehnt war durch dieses eine Treffen zu einem winzigen, unbedeutenden Punkt in der Geschichte der Menschheit zusammengeschrumpft.
Anastasya, die seit Kurzem wieder in Kiew lebte, schien keinen Tag gealtert zu sein, während Iryna fand, ihr selbst sehe man die mit Sorge gefüllten Jahre an: Ihre Haare hatten an Glanz verloren, ihr Körper war unförmiger und die Schatten unter ihren Augen dunkler geworden. Wie die Risse im Mauerwerk des heruntergekommenen Wohnhauses, in dem sie lebte, hatten sich auch kleine Krähenfüße in ihre Augenwinkel geschlichen; feine Linien, die selbst mit viel Make-up nicht zu verbergen waren. Sie probierte deshalb, so wenig wie möglich zu lachen, was in ihrer aktuellen Situation nicht sonderlich schwierig war. Iryna hatte sich nie für gutaussehend gehalten, doch mit dem richtigen Make-up hatte sie einst durchaus passabel ausgesehen. Nun hatten die Jahre das hässliche Entlein offenbart, das schon immer in ihr geschlummert hatte.
In Filmen werden die hässlichen Entlein in schöne Schwäne verwandelt, im realen Leben verhält es sich genau umgekehrt, weil die Zeit uns alle einholt, dachte Iryna. Sie drehte den Kopf mit den schmerzenden Augen weg von der weißen Fassade und blickte direkt in ihr Spiegelbild in der Glasscheibe des Cafés. Was sie sah, war ein gespenstisches Gesicht mit hohlen Augen, blassen Lippen und herabhängenden Mundwinkeln. Das hatten die Jahre des Kummers mit ihr gemacht. Es war die Strafe dafür, dass sie sich für den falschen Mann entschieden hatte. Er hätte ihr Befreiungsschlag aus dem gewalttätigen Elternhaus sein sollen. Statt Freiheit hatte sie erst noch mehr Schläge und Erniedrigungen, dann Einsamkeit und Armut erhalten.
»Ich habe gerade meinen Ex getroffen. Du weißt, dass ich geschieden bin, oder?«
»Ja, das ist mir zu Ohren gekommen ... Was ist denn los? Warum hast du ihn getroffen?«
»Immer die gleiche Leier, er weigert sich, für die Kinder zu zahlen. Ich habe zwei Töchter, das weißt du vielleicht? Daria und Natalia heißen sie. Es ist ihm egal, dass ich nicht weiß, wie ich die Miete für den nächsten Monat aufbringen soll, dass Daria, Natalia und ich uns nur noch von Kartoffeln und Kohl ernähren, weil wir uns nichts anderes mehr leisten können, und sie keine anständigen Kleider haben. Ich habe meine Sonnenbrille verloren, und mir fehlt das Geld für eine neue. So schlimm ist es.«
Die Sorge um das fehlende Geld saß Iryna im Nacken wie ein gieriger Greifvogel, dessen Krallen sich in ihre dünne Haut gruben. Iryna hatte vor einem halben Jahr ihre Festanstellung verloren. Seither arbeitete sie als freischaffende Grafikerin. Doch die Einnahmen aus den sporadischen Aufträgen reichten nicht für ein halbwegs anständiges Leben. Und auf ihre Bewerbungen hagelte es Absagen, weil sie keine abgeschlossene Ausbildung hatte. Die letzte Prüfung, die sie hätte ablegen müssen, hatte sie wegen der Geburt ihrer ersten Tochter nicht schreiben können.
Iryna blickte um sich. Sie saßen in ihrem Lieblingscafé, die Tische auf der Terrasse waren wie immer fast alle besetzt. Die zwei Kellnerinnen glitten mit bewundernswerter Gelassenheit von Tisch zu Tisch, um sich um die Wünsche der Gäste zu kümmern, und balancierten dabei Tabletts hoch über ihren Köpfen. Rechts von Iryna beugten sich zwei Frauen in gepflegtem Business-Look über ihre Laptops, ihre Gespräche mischten Ukrainisch mit Englisch. Links von Iryna lehnte ein junger Mann mit lockigem Haar in seinem Stuhl zurück, Zigarette in der einen Hand, Smartphone in der anderen. Er trug ein ausgeblichenes T-Shirt mit dem Namen einer bekannten Rockband, Okean Elzy. Eine junge Mutter wippte ihren Kinderwagen sanft mit dem Fuß, während sie telefonierte, zwei Männer diskutierten hitzig miteinander, dabei mit den Händen gestikulierend.
»Das tut mir sehr leid zu hören«, sagte Anastasya und riss Iryna aus ihren Gedanken.
»Ach, ich möchte dich nicht mit meinen Angelegenheiten belasten. Lass uns über dich reden, das ist spannender. Du wirst heiraten!«
»Zum zweiten Mal«, lachte Anastasya und hielt Iryna ihren funkelnden Diamantring hin.
»Wunderschön! Der muss ein Vermögen gekostet haben.«
»Hat er«, erwiderte Anastasya und warf ihre langen blonden Haare schwungvoll zurück.
Iryna war erstaunt, dass sie in diesem Moment keinen Neid empfand, denn Anastasya hatte alles, was man sich nur wünschen konnte: einen vermögenden Verlobten, der sie vergötterte, ihre Tochter aus erster Ehe wie seine eigene liebte und all ihre Geldprobleme lösen würde. Zudem sah sie gut aus, und ...
»Und stell dir vor: Ich bin schwanger!«
Anastasyas Augen funkelten, ihre Wangen leuchteten rosig, und ihr Haar glänzte in der nachmittäglichen Sonne. Nun empfand Iryna doch Neid, und tiefe Verbitterung darüber, dass sie selbst ein so viel härteres Schicksal ereilt hatte. Denn sie hatten die gleiche Ausgangslage gehabt: Sie waren in derselben gehobenen Wohnsiedlung in einem Vorort von Kiew aufgewachsen, ihre Väter hohe Beamte gewesen, sie hatten die gleichen renommierten Privatschulen besucht und stets gute Noten erhalten. Nicht, dass Iryna sich noch ein Kind wünschte, doch Anastasyas Schwangerschaft erschien ihr als Krönung eines mit Glück gesegneten Lebenslaufs, der ihr selbst verwehrt geblieben war.
»Darf ich noch etwas bringen?«, fragte in dem Moment die unerträglich gutaussehende Bedienung. Einen Augenblick lang war Iryna irritiert. Nicht nur, weil sie die Schönheit der Kellnerin in ihrer aktuellen Situation als Affront empfand, sondern auch, weil seit der Wiedereröffnung der Restaurants und Cafés nach der pandemiebedingten Schließung die Angestellten in der Regel zu beschäftigt waren, um sich mehr als einmal nach den Wünschen der Gäste zu erkundigen.
»Wodka«, erwiderte Iryna, obwohl es erst vier Uhr nachmittags war und es ihr Budget nicht erlaubte.
Emma
Emma saß im Eurocity nach Milano, der Zürich um kurz nach acht Uhr morgens verlassen hatte, eine leere Kaffeetasse vor sich und ihren E-Reader in der Hand. Wenn die häuslichen Pflichten sie zu ersticken drohten, brachte sie ihren Nachwuchs zu ihrer Mutter Susan oder zu ihrer Freundin Louisa und nahm sich einen ganzen Tag frei. Sie erzählte niemandem, was sie an jenen Tagen, an denen sie sich von ihrer Familie absonderte, tat: Sie stieg in einen Zug in Richtung Süden, genoss die Sonne, ging spazieren, rauchte viel und trank einen Kaffee nach dem anderen.
Über sechs Stunden lesend in einem meist überfüllten und miefenden Zug zu verbringen, nur um sich dann für ein paar Stunden Sonne, Zigaretten und italienischen Kaffee zu gönnen, das bedeutete für Emma Freiheit. Doch wem hätte sie das schon anvertrauen können? Ihre konventionell denkenden Freundinnen würden sie für verrückt erklären, wenn sie wüssten, dass sie, eine zweifache Mutter, ihre Kinder bei der Großmutter oder bei Louisa ließ, um nach Italien zu fahren.
Emmas einzige Freundinnen waren fünf Frauen, die sie aus der Schulzeit kannte und die, wie Emma, noch immer in dem Dorf wohnten, in dem sie aufgewachsen waren. Doch eigentlich stand ihr nur Louisa nahe. Wie Emma war Louisa introvertiert und oftmals in sich gekehrt, daraus erwuchs ihre Verbundenheit. Louisa hatte keine Kinder, was Emma immer wieder erstaunte. Sie hatte als Erste geheiratet und sich mit ihrem Mann ein großes Haus gekauft, in dem viele Kinder Platz hätten. Und sie kümmerte sich stets mit Freude um Emmas Kinder, wenn Emma sie darum bat.
Die räumliche Nähe sowie die gemeinsamen Freuden und Sorgen über ihren Nachwuchs waren das Einzige, was Emma mit den anderen vier Frauen aus der Clique verband. Emma war sich bewusst, dass sie selbst schuld daran war, keine engen Vertrauten zu haben; Nähe zu anderen Menschen ängstigte sie, und selbst die emotionale und körperliche Nähe zu ihren Kindern fiel ihr schwer. Den physischen Kontakt, der sich mit Kleinkindern nicht vermeiden ließ – es musste umhergetragen, gewickelt, getröstet, gebadet werden –, empfand sie als einengend.
Emma liebte ihre Kinder über alles, doch deren emotionale Bedürfnisse drohten sie manchmal zu erdrücken. Dennoch versuchte sie, ihnen so viel Liebe und Geborgenheit zu geben wie möglich, denn aus eigener Erfahrung wusste sie, wie schmerzhaft es für ein Kind war, wenig Zuneigung zu erhalten.
Susan war mit zwanzig Jahren ungewollt schwanger geworden und hatte ihre einzige Tochter allein großgezogen. Weder von Emmas Vater, der sich bereits vor Emmas Geburt von Susan abgewandt hatte, noch von ihren eigenen Eltern hatte Susan finanzielle oder moralische Unterstützung erhalten. Ende der 1980er-Jahre war die Praxis fürsorgerischer Zwangsmaßnahmen2 zwar nicht mehr üblich, doch die soziale Akzeptanz einer alleinerziehenden Mutter war – zumindest in jenem Teil der Schweiz, in dem Susan und Emma wohnten – so hoch wie der Wasserstand des Meeres bei Ebbe. Hatte ihre Mutter von Geburt an unbewusst Groll gegen sie gehegt, sie für ihr Schicksal als alleinerziehende, verarmte Mutter verantwortlich gemacht? War daraus der Wille geboren worden, Emma all jene Optionen zu ermöglichen, die ihr selbst verwehrt geblieben waren – eine gute Ausbildung, eine berufliche Karriere und finanzielle Sicherheit? Emmas Kindheit war geprägt von einem eisernen Regime aus Nachhilfeunterricht und Kontrolle über all ihre Aktivitäten. Emma sollte trotz der widrigen Umstände erfolgreich sein. Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung – das Lesen – gab es kaum.
Sobald sie von zu Hause auszog, flüchtete Emma sich in die große, weite Welt der Romane, so oft sie konnte. Sie las überall und bei jeder Gelegenheit, sie verschlang Bücher geradezu. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit, in den kurzen Pausen im Spital oder abends vor dem Zubettgehen, bei jeder Gelegenheit las sie noch ein paar Seiten. Durch die Lektüre konnte sie in fremde Länder reisen, bei der Aufklärung von Verbrechen helfen und zugegen sein bei heroischen Taten, die Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit vollbrachten.
Die Zugdurchsage kündigte an, dass sie gleich in Milano Centrale eintreffen würden. Emma griff nach ihrer Handtasche, die sie beim Einsteigen in Zürich neben sich gelegt hatte in der Hoffnung, nicht neben einer fremden Person sitzen zu müssen. Sie legte ihren E-Reader in die ausgediente schwarze Handtasche, warf den leeren Kaffeebecher in den kleinen Mülleimer zu ihrer Linken und drängte sich mit vielen anderen Passagieren in Richtung Ausgang.
Aabidah
»Erzähl mir, woher du kommst, Aabidah.«
»Ich komme aus Aleppo. Dort bin ich aufgewachsen und dort lebte ich bis zu meiner Flucht.«
Einen Moment schweigt Aabidah, dann sagt sie: »Einst glaubte ich, die Stadt, in der ich aufgewachsen war, gehöre zu mir, genauso wie ich selbst zur Stadt gehörte. Über die Jahre wird man eins mit der Umgebung, in der man lebt. Doch nun sind diese Stadt und ich sich fremd – zu viel Zeit ist vergangen, seit ich Aleppo verlassen habe.«
Es tut ihr unendlich leid, dass sie gehen musste. Verzeih mir, Heimatstadt, denkt sie immer wieder, im Wissen, dass es der Stadt egal ist. Das Leben dort geht weiter, mit oder ohne Aabidah, so wie das Leben überall auf der Welt weitergeht, im Guten wie im Schlechten.
Es hat sich nicht gut entwickelt in Aleppo. Aabidahs Familie und Freunde berichten von Hunger, da die Inflation hoch und Nahrung knapp ist, von Kälte, weil die Stromversorgung kaum noch funktioniert, und von der täglichen Mühsal, sich überhaupt fortzubewegen. Es dauert manchmal stundenlang, um von einem Ende der Stadt zum anderen zu gelangen, wegen der Grenzposten, an denen man von Soldaten schikaniert wird. Trotzdem vermisst Aabidah die Stadt ihrer Kindheit. Dort verbrachte sie eine glückliche und unbeschwerte Kindheit, nach der sie sich noch heute sehnt.
Aleppo war einst eine einladende Stadt, ein Zentrum für Wirtschaft und Handel, dank seiner vielen Sehenswürdigkeiten gerne besucht von Touristen. Aabidah erinnert sich an warme Lichter, die lachende Menschen in ihren nächtlichen Aktivitäten umfingen. An elegant gekleidete Leute, die über den Al-Zarab-Markt schlenderten, in Straßencafés Tee tranken und plauderten. Und sie erinnert sich an die große Aufregung bei der Eröffnung des prunkvollen Shabah-Einkaufszentrums, in dem sie danach viele Stunden verbracht hatte, um zu flanieren und sich für ihre Hochzeit einzudecken.
Große Teile der Stadt sind innerhalb weniger Jahre zerstört worden. Ihre geliebte Heimatstadt wird auch heute noch, in diesem Moment, Schritt für Schritt dem Erdboden gleichgemacht. Die Nächte dort sind heute dunkel und die Menschen lachen nicht mehr.
»Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?«
Aabidah schweigt eine Weile. Es ist eine schwierige Frage. Noch nie hat sie darüber nachgedacht, wie sie ihre Kindheit beschreiben würde. Sie kommt ihr so normal vor, wie eine Kindheit nur sein kann. Sie wurde geliebt, sie wurde behütet. Sie war glücklich. Mit einer Ausnahme. Das war der Moment, in dem sie erfuhr, dass ihre Eltern ihr kein Studium würden finanzieren können. Vielleicht sollte sie davon erzählen, denn es war das erste Mal, dass sie sich, im Alter von sechzehn Jahren, ungerecht behandelt fühlte.
Aabidah war der Augapfel ihrer Familie, dazu zählten ihre drei Brüder Abbu, Bahir und Tamir, ihre Mutter Faiza, ihr Vater Faris sowie ihre beiden Großeltern, die nur einen kurzen Spaziergang von ihrem Zuhause entfernt wohnten. Darüber hinaus hatte sie drei Tanten, fünf Onkel und zahlreiche Cousins und Cousinen, die über die ganze Stadt verteilt lebten. Aabidah besuchte ihre Verwandtschaft oft und so sah sie viel von der Stadt. Mit ihren Tanten tauchte sie ein in die verlockend riechenden und mit Köstlichkeiten überquellenden Märkte, um Früchte und Datteln zu kaufen. An der Hand ihres Vaters durfte sie manchmal nachts durch die von Straßenlampen beleuchtete Altstadt schlendern und dabei Süßigkeiten naschen. Auf dem Weg zu ihren Cousins, die in der Nähe der Zitadelle wohnten, beobachtete sie die exotisch aussehenden Touristen. Sie kicherte hinter deren Rücken und machte sich lustig über ihren seltsamen Kleidungsstil: kurze Hosen, die unförmige Oberschenkel und spitze Knie preisgaben, was diesen Männern und Frauen offenbar nicht peinlich war. Aabidah fand die fremden Leute abstoßend, und gleichzeitig war sie fasziniert von ihnen. Wie gerne hätte sie einmal die Länder gesehen, aus denen sie stammten.
Aabidah war eine Nachzüglerin, das erste Mädchen ihrer Generation, mit dem niemand mehr gerechnet hatte, das jedoch alle freudig erwarteten, als bekannt wurde, dass Faiza mit vierzig Jahren noch einmal schwanger geworden war.
Aabidah war ein außergewöhnliches Mädchen. Im zarten Alter von vier Jahren brachte sie sich das Lesen und Schreiben selbst bei, zählte ins Endlose, rechnete erste Summen und besaß den Wortschatz und die Ausdrucksweise einer Erwachsenen. Sie übertraf ihre älteren Brüder, die ebenfalls überdurchschnittlich begabt waren, noch bei Weitem. Aabidah, das Nesthäkchen, wurde behütet und verhätschelt. Sie wusste ihren Status als Liebling der Familie schon früh zu ihrem Vorteil zu nutzen: Mit einem koketten Augenaufschlag, einem süßen Lächeln und zärtlichen Umarmungen umgarnte sie die ihr Nahestehenden und erhielt so stets, was sie wollte. Bis zu dem Tag, an dem sie den Wunsch äußerte, sie wolle Ingenieurwissenschaften studieren, wie zwei ihrer drei Brüder vor ihr.
»Wir haben das Geld dafür schlichtweg nicht«, sagte ihr Vater. Das Studium selbst war zwar kostenlos, doch es fielen Ausgaben für Materialien, Studienreisen und Transport an, die sich im Laufe der Jahre zu einem beachtlichen Betrag summieren würden.
Aabidahs Familie gehörte der Mittelschicht Aleppos an. Sie waren also nicht arm, aber auch nicht wohlhabend, und in den letzten Jahren litten auch sie zunehmend unter der wachsenden sozialen Ungleichheit im Land. Durch die Abwertung des syrischen Pfunds war alles teurer geworden, während die Löhne nicht im gleichen Maße gestiegen waren. Die neoliberale Politik der Regierung begünstigte nicht die große Mehrheit, sondern die syrische Oberschicht und ausländische Investoren. Besonders hart traf es die kleinen und mittleren Unternehmen, die einen Großteil der syrischen Wirtschaft ausmachten.
Im Alltag bedeutete das, dass die Familie sich den frisch gepressten Granatapfelsaft vom Straßenstand an der Kreuzung seltener gönnte und der Marktbesuch auf dem Souk al-Madina zunehmend zum Rechnen und Abwägen wurde: ein Kilo Orangen oder lieber Oliven vom Bauern aus Afrin? Die alten Händler und ihre Kunden rollten mit den Augen über die neuen Preise, aber niemand äußerte sich laut dazu. Im Radio lief noch die gleiche Musik wie im alten Jahrtausend, meist Tarab, doch wurde sie nun unterbrochen vom sonoren Ton der Sprecher der im Jahr 2000 neu eingesetzten Regierung.
Aabidahs Schulhefte waren aus grobem, grauem Papier, und die Bleistifte, die sie benutzte, wurden so lange angespitzt, bis man sie kaum noch halten konnte. Stromausfälle kamen häufiger vor, besonders abends, und zwangen die Familien in ihren Wohnungen, sich um eine Petroleumlampe oder eine flackernde Neonröhre zu versammeln. Auch wenn es in den Parks noch lautes Kinderlachen und die vertrauten Stimmen der Wasserverkäufer gab, spürte man in vielen Gesprächen zwischen Erwachsenen eine leise, zähe Sorge. Die offiziellen Parolen von Stabilität und Reform klangen hohl angesichts der Realität, dass sich für die meisten Menschen nichts zum Besseren wendete. Aabidahs Familie klammerte sich an kleine, liebgewonnene Gewohnheiten: den stark gesüßten Schwarztee am Nachmittag, das Brot vom Bäcker an der Ecke, die abendlichen Gespräche.
»Mein Vater kämpfte hart um das Überleben seines Kleinunternehmens«, erzählt Aabidah. Sie hält kurz inne, bevor sie fortfährt: »Doch innerlich hatte er sich wohl längst damit abgefunden, dass ihm das gleiche Schicksal bevorstand wie so vielen vor ihm: der unvermeidliche Weg in den Konkurs. Es war eine bittere Zeit für ihn.«
Faris und Faiza hatten ihre ersten drei Kinder auf die Universität geschickt, doch nun fehlten ihnen die nötigen finanziellen Mittel, um auch ihrer Nachzüglerin, mit der sie nicht mehr gerechnet hatten, ein Studium zu ermöglichen.
Die negative Antwort ihres Vaters erschütterte Aabidah zutiefst. Sie war sechzehn Jahre alt und hatte sich noch nie mit einem Nein konfrontiert gesehen. Kein Schmeicheln, Betteln oder Liebkosen änderten etwas an der finanziellen Situation ihres Vaters und somit auch nichts an seiner Antwort.
Zum ersten Mal in ihrem Leben zog Aabidah in Erwägung, sich auf einen Streit einzulassen. Von Natur aus war sie ein friedfertiger Mensch und im Laufe ihres Lebens konfliktscheu geworden – nie hatte es einen Grund gegeben, Konflikte auszutragen, da sie stets alles bekommen hatte, was sie sich wünschte. Sie realisierte jedoch bald, dass es einfachere Wege gab, ihr Ziel zu erreichen. Sie legte sich einen Plan zurecht: Sie würde erst heiraten, bevor sie ihren Traum vom Studium weiterverfolgte. Da ihre Eltern kein Geld hatten für ihre Ausbildung, sollte ihr zukünftiger Ehemann ihr Studium finanzieren. Sie musste also lediglich einen Mann finden, der an einer gebildeten Frau ebenso interessiert war wie an einer intelligenten.
»Wieso wolltest du unbedingt studieren? Was reizte dich an einem Studium?«
»Intelligenz ist das Potenzial, das durch Bildung erst entfaltet werden muss«, erwidert Aabidah. »Intelligenz ohne Bildung ist nutzlos. Was nützen mir all meine Begabungen, wenn ich sie weder für mich selbst noch für die Gesellschaft nutzen kann? Ich wollte Brücken und Gebäude bauen für mein eigenes Land und für andere Länder. Ich wollte Geld verdienen und die Welt entdecken, denn bisher hatte ich nichts anderes als Aleppo gesehen. Aleppo war einst eine wundervolle Stadt, ich lebte gerne dort, und trotzdem wollte ich mehr von der Welt sehen, so wie viele junge Menschen. Ich war voller Träume, ich wollte hoch hinaus. Ich war ehrgeizig.«
»Das kann ich verstehen.«
Aabidah sieht ihr Gegenüber an und erkennt, dass es keine bloße Floskel ist, sie wird tatsächlich verstanden. Das bekräftigt sie in ihrem Vorhaben: Sie wird dieses Interview weiterführen.
Emma
Um 15.15 Uhr hatte Emma den Eurocity 320 ab Milano Centrale genommen, um rechtzeitig zum Abendessen zu Hause zu sein. Zu ihrer Erleichterung hatte sie einen modernen Zug erwischt; die älteren Eisenbahnwagen mit den breiten, ausgedienten Sitzen, auf denen bereits Millionen von Menschen ihre Spuren hinterlassen hatten, waren ihr zuwider. Das Abteil der zweiten Klasse, in dem Emma saß, war gut besetzt und so fühlte sie sich trotz des schlichten Designs der Sitze, der großen Fenster und der kühlen Lüftung etwas klaustrophobisch. Hin und wieder blickte sie von ihrem E-Reader auf, um ihre Mitreisenden zu mustern. Das war untypisch für sie, denn normalerweise versank sie völlig in der Welt der Geschichten, die sie las. Ihr direkt gegenüber saß ein junges Pärchen, das sehr verliebt und mit sich selbst beschäftigt war. Die idealen Sitznachbarn, denn nichts ärgerte Emma mehr als neugierige Leute, die sich für sie interessierten. Das war manchmal der Fall, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs war. Dann wurde alles kommentiert, vom Benehmen ihrer Sprösslinge bis hin zu deren Kleidung. Meist handelte es sich bei den wohlmeinenden Kommentatorinnen um Frauen mittleren oder fortgeschrittenen Alters. Emma wünschte sich im Nachhinein immer, sie wäre schlagfertig genug, um eine gewitzte Bemerkung auf solche ungebetenen Kommentare geben zu können.
Der Vierersitz auf der anderen Seite des Ganges war von einer vierköpfigen Familie besetzt. Sie hatte Emmas Aufmerksamkeit erregt und veranlasste sie dazu, ab und zu von ihrer Lektüre aufzusehen. Die Familie stach aus der Masse der wohlhabenden Europäer, die das Abteil bevölkerten, hervor: Die Kinder trugen abgetragene T-Shirts und ausgefranste Hosen, ihre Schuhe wirkten zu groß und viel zu warm für diese Jahreszeit. Unter den abgekauten Fingernägeln des Buben und des Mädchens – Emma schätzte sie auf acht und sechs Jahre – hatte sich Dreck angesammelt. Ihre Haare waren zerzaust. Doch das war es nicht, was Emma an den Kindern irritierte. Auch Lena hatte manchmal ungekämmte Haare und schmutzige Fingernägel, trug abgetragene Kleider, meist auch noch verkleckert, und Schuhe, die nicht zur Jahreszeit passten – weil sie sich im Sommer weigerte, Sandalen anzuziehen, und im Winter, in warme Stiefel zu schlüpfen. Nein, was Emma befremdete, war die für ihr Alter ungewöhnliche Apathie der Kinder: Sie saßen still da, nagten lustlos an einem weißen Brötchen und schauten mit glanzlosem Blick aus dem trüben Fenster des Zuges, ohne ihre Umgebung wirklich wahrzunehmen.
Der Vater der Kinder, ein hagerer Mann mit kantigen, attraktiven Gesichtszügen und stoppeligen Barthaaren, dessen verbogene Brille ihm schief auf der Nase saß, trug ein kariertes Shirt, das auch schon bessere Tage gesehen hatte, und Shorts, die ihm mindestens drei Nummern zu groß und mit einer Kordel an seinen knöchernen Hüften festgezurrt waren. Die Mutter trug weite, lange Kleidung und ein dunkles Kopftuch, das ihrem blassen Teint keinen Gefallen tat. Beide Eltern schauten müde drein, besonders die Mutter, die sichtbar schwanger war. Sie hatte die Hände über ihren Bauch gefaltet, der sich unter dem Kleid der zierlichen Frau wölbte. Ihr hübsches, aber verkniffenes Gesicht verriet, dass sie unter der Hitze und der Schwangerschaft litt. Emma fühlte mit ihr – sie wusste, wie beschwerlich die letzten Monate sein konnten, eine bequeme Sitzstellung unmöglich war, das Baby gegen die Rippen trat und einem schon bei milden Temperaturen der Schweiß ausbrach.
Die Familie führte mehrere vollgestopfte Plastiktüten mit sich, die sie unter ihren Füßen und in dem schmalen Gepäckfach über den Köpfen verstaut hatte.
Emma richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihr Buch. Bereits zum zweiten Mal las sie Nicht ohne meine Tochter. Dieser Roman, fast ebenso alt wie Emma selbst, enthielt genau die Art von Geschichte, die ihr zusagte: spannend, emotional und dramatisch, in einer ihr fremden Welt spielend. Während sie las, knabberte sie an einem Kaffeebecher aus Pappe, der sich langsam auflöste; kleine Stückchen Karton landeten in ihrem Mund, die sie hin und wieder diskret zurück in den Becher spuckte. Es war keine schlechte Alternative zu dem Kaugummi, den sie vergessen hatte einzupacken und der gegen den Hunger geholfen hätte. Ein Hunger, der Emma in letzter Zeit immer wieder aus dem Nichts überfiel und dann in ihr nagte wie ein Hamster, der sich in seiner Verzweiflung an den Gitterstäben seines Käfigs festgebissen hatte.
Kurz nachdem der Zug in Chiasso gehalten hatte, öffnete sich die Tür des Abteils, und zwei Grenzwächter traten ein. Die Beamten schritten gemächlich durch das volle Abteil, in dem man den säuerlichen Schweiß der Passagiere riechen musste, wenn man von draußen hereinkam. Sie musterten die Reisenden gelangweilt. Halt machten sie erst vor der fremdländischen Familie, die Emma schräg gegenübersaß, und verlangten mit unüberhörbar italienischem Akzent auf Englisch ihre Ausweise.