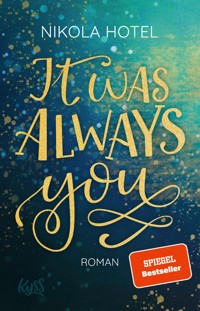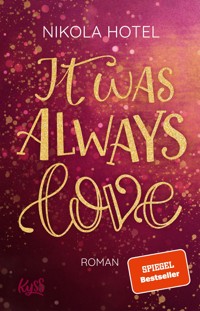8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Herzklopfen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Liebe und andere Risiken.
Wenn es nach Versicherungsagentin Tilly ginge, gäbe es für alles im Leben eine Versicherung. Vor allem für peinliche Momente. Wie kann es sein, dass dieser unbekannte Ganove sie schon wieder ausgetrickst hat und ausgerechnet die zwei wertvollen Diamanten entwendet, die Tilly bewachen sollte? Das nimmt sie persönlich, zumal nicht nur die Steine fehlen, sondern auch ihre Armbanduhr. Tilly weiß, dass er wieder zuschlagen wird. Was sie jedoch nicht ahnt: Diesmal hat er es auf ihr Herz abgesehen. Und für die Liebe gibt es keine Versicherung …
Ein abenteuerlich witziger wie aufregender Liebesroman von Bestseller-Autorin Nikola Hotel.
Der Titel erschien erstmals 2018 als E-Book unter dem Titel "Rette mir den Hals, Kleines!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Versicherungsagentin Tilly weiß genau, was sie will: Endlich dem unbekannten Dieb das Handwerk legen, der ihrer Firma seit Monaten immer wieder Probleme macht. Sie heftet sich an seine Fersen, mit äußerst unangenehmen Folgen: Es gelingt ihm tatsächlich, direkt vor ihrer Nase zwei äußerst wertvolle Diamanten zu entwenden, und, zu ihrem größten Ärger, auch noch ihre Lieblingsarmbanduhr. Gäbe es doch nur eine Versicherung für die peinlichen Momente im Leben! Das kann Tilly nicht auf sich sitzen lassen. Doch als der geheimnisvolle Diamantendieb erneut auftaucht, bringt er ihr Leben höllisch durcheinander, denn diesmal hat er es nicht auf Schmuck abgesehen, sondern auf Tillys Herz ...
Über Nikola Hotel
Nikola Hotel, geboren 1978 in Bonn, hat eine große Schwäche für dunkle Charaktere und unterdrückte Gefühle, deshalb schreibt sie neben ihren RomComs mit Vorliebe auch New-Adult-Romane. Ein Großteil ihrer Bücher schaffte es unmittelbar nach Erscheinen auf die Bestsellerliste. Nikola Hotel lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bonn. Auf Instagram gewährt sie allerlei Einblicke in ihren Schreiballtag.
Im Aufbau Taschenbuch liegen ebenfalls ihre Romane »Jetzt und mit dir«, »Für immer und du« und »Liebe oder gar nicht« vor.
Mehr unter @nikolahotel oder www.nikolahotel.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Nikola Hotel
Ab morgen nur noch Liebe
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Playlist
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Playlist
The Cat – Tom Gaebel
Perhaps, Perhaps, Perhaps – Doris Day
Un Homme Et Une Femme – Nicole Croisille & Pierre Barouh
(They Long to Be) Close to You – Paul Kuhn & SFB Big Band
Those Were the Days – Vera Lynn
Schwarze Augen – Paul Kuhn & SBF Big Band
Turandot Atto III: »Nessun Dorma« – Jonas Kaufmann
It Hurts to Say Goodbye – Vera Lynn
Emmanuelle – Fausto Papetti
Love Letters – Julie London
Alguien Canto (The Music Played) – Matt Monro
Der Pate I: Love Theme – Nino Rota
Lonely Dreamer – The Cliff Hammer Orchestra
Diamonds Are Forever – Shirley Bassey
Kapitel 1
Ungeduldig wippte ich mit den Zehenspitzen. Heute würde ich mir die Katze schnappen, und das ließ meinen Puls trommeln wie verrückt. Ich war mir absolut sicher, dass er gleich hier auftauchen würde, weil es selten eine Gelegenheit gab, bei der so viel Luxus auf einem Haufen anzutreffen war wie auf dieser Beerdigung. Und wenn es etwas gab, das die Katze anzog, dann war es Reichtum, speziell der Reichtum, der illegal angehäuft worden war.
Mit gesenktem Kopf tunkte ich die Fingerspitzen in das Weihwasser und bekreuzigte mich. Im gleichen Moment prallte jemand gegen meine Schulter. »Können Sie nicht aufpassen?« Ich schwankte wie ein Papierboot, bis eine Hand mich am Arm fasste und wieder ins Gleichgewicht brachte.
»Verzeihung.« Der blonde Mann mit dem breiten Oberlippenbart ließ mich los und lächelte, dann drängte er an mir vorbei ins Innere der Kirche. Ich seufzte – was für ein Tollpatsch! Als ich ihm folgte, breitete sich auf meinen Unterarmen eine Gänsehaut aus, die nicht allein von der Kälte in diesem alten Gemäuer herrühren konnte. Mit jedem Klackern meiner Absätze verstärkte sich mein Gefühl, dass heute etwas passieren würde. Die Katze kommt, die Katze kommt, klack-klack, klack-klack. Seit Monaten war ich diesem Gauner schon auf der Spur, und so dicht war ich ihm noch nie auf den Fersen gewesen. Die Katze war ein Phantom. Er war ein Betrüger, ein Hochstapler, ein Dieb, ein Schwindler, doch das Dumme war: Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich wusste nicht, wie er wirklich aussah. Die einzigen Fotos, die von ihm in den Polizeiakten existierten, waren unscharfe Schnappschüsse. Aufnahmen, die jedes Mal einen komplett anderen Menschen zeigten. Die Katze war nicht nur ein hochbegabter Krimineller, er war vor allem auch ein hochbegabter Verwandlungskünstler. Ich hatte also keine Ahnung, nach wem ich wirklich suchte. Einzig gewiss war, dass dieser Gauner versuchen würde, sich so unauffällig wie möglich unter die Reihen der Kondolenzbesucher zu mischen. Genau wie ich. Er würde sich von niemandem unterscheiden, sondern stattdessen so wirken, als wäre er der Enkel des Toten persönlich. Auf keinen Fall würde er so auffällig aussehen wie dieser blonde Tollpatsch, der mich eben am Eingang angerempelt hatte. Kurz rieb ich mir über die Arme und stieg dann die wenigen Stufen hoch, die zum Altarraum führten, wo der Leichnam aufgebahrt worden war. Es roch nach Weihrauch und Lilien, die in üppigen Gebinden neben dem Sarg platziert worden waren. Ich hatte eine, wie ich fand, perfekte Tarnung angelegt und war ganz in Schwarz gekleidet, von den Perlonstrümpfen über das knielange Kleid bis zum adretten Hütchen, aus dem doch tatsächlich einige Federn sprossen. Und unter dem Schleier, der mir bis zur Nasenspitze reichte, konnte ich unbemerkt meine Umgebung mustern.
Der Tote sah so frisch aus, wie man eben aussehen konnte, wenn man bereits vor drei Tagen verstorben war. War das etwa Rouge auf seinen Wangen? Auch die schmalen Lippen sahen so aus, als hätte man sie mit Lipgloss betupft. Die Hände hatte man dem alten Mann vor der Brust gefaltet, und eine weiße Rose steckte ihm zwischen den Fingern. Meine Augen weiteten sich. Dieser klobige Siegelring war bestimmt ein Vermögen wert. Und die Schuhe – unauffällig warf ich einen Blick zum Fußende des Sarges – waren zweifarbige Budapester und eine Maßanfertigung, vom Anzug ganz zu schweigen. Allein das Seidentuch, das dem alten Herrn aus der Brusttasche quoll, kostete bestimmt mehr, als ich im Monat verdiente, und es verströmte einen zarten Rosenduft, als ich mich darüber beugte. Mit gesenktem Blick wollte ich andächtig am aufgebahrten Leichnam vorbeiprozessieren, da sprangen mir erneut die gefalteten Hände ins Auge. Genauer gesagt die Manschettenknöpfe, die am Ärmel des Jacketts herausblitzten.
Da waren sie, die Millennium Twins. O Himmel, die waren riesig! In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so große blaue Diamanten gesehen. Und ich ging davon aus, die Katze hatte das ebenfalls nicht, was genau der Grund war, warum ich mit seinem Auftauchen rechnete. Hastig blätterte ich im Geiste die Informationen durch, die ich aus unseren Akten über den verstorbenen Arcangelo di Titta zusammengetragen hatte: Er war der Kopf eines international agierenden Mafiaclans. Geboren worden war er in einem winzigen Bergdorf Apuliens, sein Vater war ein Schafhirte gewesen, und seine Mutter hatte bei reichen Familien im Ort geputzt, bis sie sich der Sacra Corona Unita angeschlossen hatten, der Mafia, die in Italiens Stiefelabsatz ansässig war. Arcangelo di Titta war unfassbar kriminell und unfassbar reich – fiel also genau in das Beuteschema der Katze –, doch nun war er vor allem unfassbar tot. Die Katze musste wahnsinnig sein, wenn er wirklich vorhaben sollte, einen Angehörigen des Titta-Clans zu bestehlen. Die Tittas waren legendär. Aber diese Diamanten waren ebenfalls legendär, und die Gelegenheit, sie zu stehlen, würde nie wiederkommen. In etwa einer Stunde würden die Manschettenknöpfe samt seinem Besitzer unter mehreren Metern Erde begraben und von einer dicken Marmorplatte bedeckt werden. Dies war die letzte Gelegenheit für die Katze, wenn er sich die beiden Steinchen schnappen wollte. Aber was hieß schon Steinchen? Die Millennium Twins waren monströs und ihre blaue Farbe ausgesprochen selten. Zusammen waren sie fast so viel wert wie der Hope-Diamant, und ganz sicher brachten sie ebenso viel Unglück. Woher ich das so genau wusste? Die Firma, für die ich arbeitete, hatte diese blöden Dinger versichert! Mir war schon mulmig zumute, obwohl ich die Diamanten nicht berührt hatte und mir garantiert niemand ansehen konnte, dass ich hier war, um sie zu bewachen. Trotzdem wäre ich am liebsten auf dem Absatz umgedreht und aus der Kirche geflüchtet. Ich sollte das eigentlich nicht zugeben, aber ich war ein verdammter Angsthase. Als ich diesen Job angenommen hatte, hatte ich nicht ahnen können, dass er so gefährlich werden würde. Denn mal ehrlich, wenn man bei einer Versicherung anfing, dann doch wohl, weil man ein großes Bedürfnis nach Sicherheit hatte, oder nicht? Während ich die Stufen wieder nach unten stakste, umklammerte ich meine Handtasche, in der Oma Julianes Bügeleisen steckte. Herr Kunkel hatte mir geraten, immer etwas zur Selbstverteidigung dabeizuhaben, und ganz bestimmt hatte er dabei an so was wie Pfefferspray gedacht, aber ich hegte eine große Abneigung gegen dieses Zeug. Was aber nichts daran änderte, dass hier genug Männer herumliefen, die wirklich bewaffnet waren. Ich ließ den Blick zurück zum Portal schweifen, bevor ich in die Bank rutschte. Es standen je zwei Gorillas an beiden Eingängen. Man hätte ihnen Leibwächter oder auch gemeingefährlicher Schläger gleich auf die Stirn tätowieren können, was auch nicht auffälliger gewesen wäre als die kurz geschorenen Köpfe und die schwarzen Anzüge, die sich über den muskulösen Oberarmen spannten. Allesamt trugen sie schwarz-weiße Spectators – das war für mich Beweis genug, denn mit Schuhen kannte ich mich aus.
Ich atmete tief durch. In diesem Moment fing in den ersten beiden Reihen ein Singsang an. Mehrere Frauen, deren Häupter von langen Spitzenschleiern bedeckt waren, ließen die Perlen ihres Rosenkranzes durch die Finger gleiten und murmelten dabei das Ave Maria.
Mit bemüht andächtiger Miene starrte ich auf meine gefalteten Hände und atmete ein weiteres Mal tief durch. Am Handgelenk trug ich eine Uhr, deren Anblick mir kurzfristig ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Sie war nicht besonders wertvoll, trotzdem hing ich sehr daran. Jeden Freitag musste sie von Hand aufgezogen werden, was ein wenig lästig war, aber sie zeigte immer die exakte Zeit an. Im Augenblick 11.23 Uhr, was bedeutete, dass mir noch sieben Minuten blieben, bis der Trauergottesdienst begann. Und weitere dreißig Minuten, bis di Titta zur letzten Ruhe gebettet worden war, der Versicherungsschutz erlosch und ich meinen Job zu aller Zufriedenheit erledigt hätte. Ich sehnte den Moment herbei. Liebevoll ließ ich die Finger über das zerkratzte Glas der Uhr gleiten. Auf der Unterseite des Gehäuses waren die schnörkeligen Initialen meines Uropas Manfred eingraviert – MB –, was ich schön fand und zufällig auch genau die Anfangsbuchstaben von meinem Namen waren: Mathilde Blum.
Als hinter mir plötzlich ein Rumpeln ertönte, fuhr ich herum, und gleichzeitig mit meinem folgten mindestens hundert weitere Augenpaare, denn die Kirche war bereits gerammelt voll. Sogar der Singsang verstummte für einen Moment.
Schon wieder dieser blonde Typ, der mich eben angerempelt hatte. Er war offenbar an den Tisch mit den Gebetbüchern gestoßen und hatte einen ganzen Stapel heruntergerissen, den er jetzt mit hochrotem Kopf wieder einsammelte. Was für ein Tollpatsch! Keinen Meter davon entfernt stand ein unscheinbarer Korb, in dem die Gäste ihre Kondolenzschreiben ablegten. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Geld sich in diesen Umschlägen befand! Sicher ein kleines Vermögen. Als ich wieder nach vorn sah, schnappte ich Herrn Kunkels Blick auf. Er saß auf der anderen Seite des Kirchenschiffs und nickte mir unmerklich zu, was mir signalisierte, dass er den Korb mit dem wertvollen Inhalt im Auge behalten würde. Herr Kunkel war mein Partner im Außendienst und – ich musste es leider zugeben – der Erfahrene von uns beiden. Seit mehr als zehn Jahren arbeitete er für Secur-SORGLOS und war so entspannt wie Buddha. Ihn konnte wirklich nichts aus der Ruhe bringen, was daran liegen musste, dass er nur noch von seiner Rente träumte und gefühlsmäßig schon auf den Bahamas weilte. Oder im Hunsrück. Ich merkte, dass ich auf meiner Unterlippe kaute, und blies absichtlich langsam die Luft aus. Ich hatte Angst, es zu vermasseln. Es war nicht das erste Mal, dass sich unsere Wege kreuzten, und bisher hatte die Katze seinem Spitznamen alle Ehre gemacht und war jedes Mal mit seiner Beute spurlos davongeschlichen. Das durfte auf keinen Fall erneut passieren. Vor allem nicht jetzt, da in unserer Firma jeden Tag mit der Ankunft des neuen Teilhabers zu rechnen war.
Ein Glöckchen bimmelte, und die Orgel fing an zu spielen, als sich die Tür zur Sakristei öffnete und die Messdiener in Reih und Glied heraustraten, gefolgt vom Pastor in einem violetten Fummel. Jemand drängte sich zu mir in die Bank. Na wunderbar, der blonde Tollpatsch hatte sich den Platz neben mir ausgesucht! Als wäre es nicht schon schwer genug, sich hier unauffällig unter die Trauernden zu mischen, musste sich nun ausgerechnet dieser Typ neben mich setzen, der sich wie ein Elefant im Porzellanladen aufführte. Auf morbide Art gefesselt, musterte ich seinen Schnäuzer. Wie ein haariger Wurm ringelte er sich über der Oberlippe, und ich stellte mir vor, wie Kaffee heraustropfen würde, sollte er versuchen, damit aus einer Tasse zu trinken. Der Mann wirkte jung, höchstens Ende zwanzig, denn ich konnte keine einzige Falte in seinem Gesicht erkennen. Die Statur war sportlich, doch presste er die Knie zusammen wie ein schüchterner Schuljunge.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mich wieder auf meine Umgebung zu konzentrieren. Nicht dass ich etwas übersah, bloß, weil ich von einem blonden Kerl mit hässlichem Schnäuzer abgelenkt wurde. Der Pfarrer besprenkelte den Sarg mit Weihwasser und begrüßte die Trauergemeinde. Beim Kyrie-Gebet schaltete ich sofort auf Durchzug und murmelte bloß an der richtigen Stelle ein »Herr erbarme dich«, während ich zum einen den Sarg im Auge behielt, und zum anderen wieder zu Herrn Kunkel schaute, der so tief in der Bank nach unten gerutscht war, dass man meinen könnte, er mache ein Nickerchen. Wie konnte der bloß so entspannt sein? Ich hatte jetzt schon Herzrasen und das Gefühl, gleich zu hyperventilieren. Was, wenn die Katze gar nicht kam? Oder noch schlimmer: Was, wenn er mir schon wieder entwischte? Stöhnend schob ich die Handtasche auf dem Schoß hin und her, weil ich darunter zu schwitzen begann. Dieses blöde Bügeleisen! Es schien direkt ein Loch in das Leder zu brennen. Nervös knetete ich den Henkel der Tasche, da nahm ich wahr, wie mein Sitznachbar sich zu mir umdrehte.
»Keine Sorge«, sagte er und lächelte so herzlich, dass der haarige Wurm zu tanzen begann. »Das ist alles halb so wild. Der spannende Teil folgt erst auf dem Friedhof, wenn sich die Töchter ihre Krokodilstränen herauspressen.«
Um seine braunen Augen bildeten sich Fältchen. Ich klappte den Mund auf und wieder zu. Wie konnte dieser Mann nur so … so etwas Respektloses sagen? Ich hätte schließlich eine tief betroffene Nichte sein können. Woher wollte er wissen, dass ich nicht zur Familie gehörte und ihn nicht gleich von einem der Gorillas rauswerfen ließ? »Das ist wohl nicht Ihre erste Beerdigung«, mutmaßte ich und erntete dafür sogleich ein Zischen aus den Bänken hinter uns.
»Die dritte diese Woche. Sterben im Moment alle wie die Fliegen.« Er gähnte und tastete dann seinen Schnurrbart ab, als müsse er sich vergewissern, dass er noch da war. »Ein Virus in Ihrer Familie?« Ich setzte einen möglichst unschuldigen Blick auf, obwohl er das durch meinen Schleier bestimmt nicht sehen konnte. Genauer gesagt, sah er nicht einmal zu mir. Sein Blick war starr nach vorn gerichtet, obwohl es dort nichts Spannendes zu sehen gab außer dem Pastor, der seine Handflächen zur Kuppel öffnete.
»Oder ist das Ihr Job?«, versuchte ich es erneut. »Ich meine Beerdigungen.«
Jetzt nickte er. »Könnte man so sagen. Irgendeiner muss es ja machen.«
»Stimmt.« Ich nickte vor mich hin, dabei sah dieser Mann nicht so aus, wie ich mir einen Bestatter vorstellte. Eher wie ein Steuerprüfer. Seltsam, überlegte ich, als ich ihn näher musterte und feststellte, wie armselig meine Schuhe neben seinen aussahen. Er trug einen sehr teuren Schuh mit offener Schnürung. Einen Derby. Ich tippte auf Kalbsleder. Langsam wanderte mein Blick an seinem Bein nach oben. Auch der schwarze Anzug sah alles andere als billig aus, irgendwie schien da etwas nicht recht zusammenzupassen.
»Und Sie?« Er wandte mir das Gesicht zu.
»Ich?«, krächzte ich.
»In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Verstorbenen? Da Sie nicht vorne in den ersten beiden Reihen sitzen, nehme ich an, Sie sind bloß eine …« Er ließ den Satz unbeendet, und seine rechte Augenbraue zog sich nach oben.
»N… Nichte?« Meine Stimme klang dünn wie Seidenpapier.
»Tatsächlich? Di Tittas Schwestern sind alle über siebzig. Ich frage mich, welche von denen Sie wohl geboren hat.« Er streckte eine Hand aus, als wollte er meinen Schleier anheben, ließ sie dann aber sinken.
»Sie sehen gar nicht so alt aus.«
»Zweiten Grades«, verbesserte ich. »Und wir haben gute Gene in der Familie.« Ich lachte meine Verlegenheit weg und richtete meine Aufmerksamkeit wieder nach vorn. Woher sollte ich denn wissen, dass di Titta bloß uralte Schwestern hatte, verflixt?
»Das stimmt«, sagte er.
»Was stimmt?« Ich hatte den Faden verloren.
»Dass Sie gute Gene haben.« Unsicher sah ich zur Seite und nahm ein Schmunzeln wahr, das seinen Schnurrbart vibrieren ließ.
»Ruhe!«, rief jemand hinter uns, und ich war erleichtert, dass mir dadurch eine Reaktion erspart blieb. Gerade hatte der Pfarrer zu einer Lesung aus dem Alten Testament angesetzt, da schlug der Mann neben mir die Beine übereinander und kreuzte die Hände über dem Knie. Dabei rutschten die Ärmel seines Jacketts nach oben, und mir fiel auf, dass er wie der Verstorbene ebenfalls Manschettenknöpfe trug. Allerdings sahen seine aus, als hätte er sie aus einem Kaugummiautomaten gezogen. Der große runde Knopf war mit zwei schwarzen Masken bemalt, die eine zeigte einen breit grinsenden Mund, die andere einen traurigen. Das erinnerte mich an irgendwas, aber mir wollte in diesem Moment partout nicht einfallen, an was.
Meine Überlegungen wurden durch die Orgel unterbrochen, die uns aufforderte, aufzustehen. Als ich zur Tarnung nach dem Gebetbuch vor mir greifen wollte, rutschte mir die Handtasche aus dem Arm und plumpste geräuschvoll zu Boden. Das Bügeleisen! Ich bückte mich, aber ehe ich danach greifen konnte, hatte mein Sitznachbar die Tasche schon aufgehoben und drehte sich zu den Trauergästen um, die gleich empört losgezischelt hatten. »Pardon. Meine Schuld«, raunte er und hob die Hand, bevor er mir die Handtasche reichte.
»Danke«, brachte ich hervor.
»Ruhe!«, zischte es erneut von hinten, und wir fingen beide an zu lachen. Ich kichernd, er mit einem warmen Brummton.
Mir war nicht entgangen, dass er die Tasche für einen Sekundenbruchteil in der Hand gewogen hatte. Dieses verflixte Bügeleisen war uralt und wog eine halbe Tonne. Mit glühendem Gesicht stellte ich die Tasche hinter mir auf der Bank ab und umklammerte das Gebetbuch.
»Ist doch nichts passiert.« Er fasste mir beruhigend an den linken Arm. »Ja«, flüsterte ich.
»Ruhe noch mal!«, kam es von hinten.
Der Schnurrbart bog sich zu einem Grinsen nach oben, dann räusperte er sich und schlug hastig sein Gotteslob auf, um gleich darauf voller Inbrunst »Großer Gott wir loben dich« anzustimmen. Schließlich brachte der Pastor salbungsvoll ein paar Worte zum Abschied hervor und kündigte an, dass eine Sängerin nun das Lieblingslied des Verstorbenen vortragen würde. Die nächsten Angehörigen hätten währenddessen die Gelegenheit, sich einzeln von Arcangelo di Titta zu verabschieden. Als ich noch überlegte, ob ich als angebliche Nichte nicht nach vorn gehen müsste, war mein Sitznachbar bereits aufgesprungen und hatte sich in die Schlange eingereiht. In der nächsten Sekunde zuckte ich zusammen, denn Mandolinenklänge zirpten durch die Kirche. Eine schwarz gekleidete Dame, die Caterina Valente ähnelte und karminroten Lippenstift trug, betrat die Kanzel und fing an zu singen.
Ich sah zu dem blonden Mann, der sich zeitgleich in der Schlange zu mir umdrehte. Er zwinkerte mir zu, während die Sängerin die erste Strophe trällerte und dazu ihre Hüften wiegte. Sinn für Humor schien der seltsame Bestatter ja zu haben. Schade nur, dass er mit diesem Schnäuzer so dämlich aussah.
Wie lange musste ich diesen Blödsinn noch ertragen, bis der Sarg geschlossen und nach draußen getragen wurde? Ich fieberte dem Augenblick entgegen, an dem die Last der Versicherung endlich von mir abfallen würde. Wie spät war es überhaupt? Ich fasste mir an den Arm, um die Uhr geradezurücken, und berührte mein nacktes Handgelenk.
Wo war meine Uhr?
Das durfte doch nicht wahr sein! War der Verschlussdorn etwa rausgerutscht? Normalerweise ließ sich die Uhr nur mit grober Gewalt öffnen. Wie zum Teufel hatte sie mir runterfallen können, ohne dass ich es bemerkt hatte? Ich ließ mich von der Bank rutschen, schob meinen Rock hoch und landete mit den Knien auf dem kalten Steinboden. Fahrig tastete ich die Fläche ab und warf einen Blick unter die Bank, doch das Einzige, was ich sah, waren ein Paar schwarz bestrumpfte Beine von der Dame, die hinter mir saß.
Oh! Die Dame trug doch tatsächlich Peeptoes mit einer schwarzen Schleife, wie ich sie neulich in einem Magazin für Vintage-Mode entdeckt hatte. Ein Traum! Doch damit durfte ich mich jetzt nicht aufhalten. Ich konnte nicht glauben, dass ich meine Uhr verloren hatte. Vor wenigen Minuten war sie doch noch da gewesen, und ich hatte mich seitdem gar nicht von der Stelle gerührt. Ich hob das dünne Sitzkissen an, das die Bank bedeckte, und fuhr mit der Hand unter das Polster – nichts.
»Haben Sie etwas verloren?« Die Dame mit den Peeptoes beugte sich nach vorn und stützte sich mit ihrer behandschuhten Hand ab. »Signorina! Suchen Sie etwas?«
»Meine Uhr! Ich muss sie verloren haben.« Ich riss meine Handtasche auf in der Hoffnung, dass ich sie gedankenlos dort hineingestopft haben könnte, doch auch dort war sie nicht zu finden. Nun fing auch die Dame an, das Polster abzuklopfen, und im nächsten Moment raschelte es in der gesamten Bank, da alle mir behilflich sein wollten. Diese Uhr war seit Generationen im Familienbesitz, sie war ein Erbstück. Meine Initialen waren darin eingraviert, verdammt! Hatte ich die Uhr denn eben noch angehabt, als der blonde Schnurrbartträger mich am Arm getätschelt hatte? Vielleicht hatte sie sich dabei gelöst und war abgefallen? Doch wohin? Ich zermarterte mir das Hirn, zog mich am Sitz hoch und ließ mich enttäuscht auf der Bank nieder. Dann schoss mir durch den Kopf, dass ich gerade überhaupt nicht aufgepasst hatte, und ich rief mich zur Ordnung.
Nicht das Ziel aus den Augen verlieren, Tilly! Denk an die Katze! Wo war der Korb mit den Geldumschlägen? Puh, schien alles noch am rechten Platz zu sein, somit hatte er also noch nicht zugeschlagen. Doch wo war Herr Kunkel? Oje, Herr Kunkel war wohl tatsächlich eingeschlafen. Sein Kopf war nach hinten gekippt und sein Mund halb geöffnet. Auf die Entfernung konnte ich es zwar nicht hören, aber ich wettete, er schnarchte wie ein Igel. In der nächsten Sekunde hörte ich dafür einen spitzen Schrei. Er gellte durch das gesamte Kirchenschiff und brachte alles in mir zum Schwingen. Von den Zehen bis zu den Haarspitzen schoss er mir durch den Körper und ließ mir die Ohren vibrieren.
»Die Diamanten!«, kreischte eine Frauenstimme lauthals. »Jemand hat die Millennium Twins gestohlen!«
Kapitel 2
Wenn man wie ich für Secur-SORGLOS arbeitete, dann gab es eine Sache, die wirklich extrem blöd war: Schrie jemand nach der Polizei, war es meist schon zu spät. Dann konnte man nicht abwarten, was passierte, da musste man irgendwie reagieren. Ich sprang von der Bank hoch, konnte mich jedoch nicht entscheiden, was ich zuerst tun sollte. Nach vorn zum Sarg laufen, wo ein hektisches Gerenne und Gekeife ausgebrochen war, oder doch lieber die Eingänge der Kirche bewachen? Außerdem war ich hier inkognito. Ich konnte unmöglich jetzt einfach so meinen Auftrag offenbaren.
Mensch, Kunkel, wach auf! Ich brauchte dringend Hilfe, aber mein Partner döste vor sich hin, was ich in Anbetracht des Lärms wirklich bemerkenswert fand. Schließlich setzten sich meine Beine ganz von allein in Bewegung. Ich quetschte mich durch die Menschenmenge, die aufgescheucht nach vorn drängte. Unbedingt musste ich mir Gewissheit verschaffen. Vielleicht war das alles auch nur ein Irrtum, und die Millennium Twins hingen immer noch an Arcangelo di Tittas Ärmel. Jedoch kamen mir arge Zweifel, weil die Menge geradezu aus dem Häuschen war. Jemand riss mir an den Haaren, und der Hut rutschte mir vom Kopf. Als Nächstes boxte mir ein Ellbogen in die Rippen, und mir blieb die Luft weg. Ich benötigte mehrere Anläufe, bis ich endlich eine Lücke fand und den Pulk von Menschen durchbrach. Durch die plötzliche Freiheit stolperte ich nach vorn und hielt mich am Sarg fest. Im selben Moment gefror mir das Blut in den Adern.
Es stimmte. O Himmel, es stimmte! Jemand hatte die Millennium Twins gestohlen. Nein, verbesserte ich mich, nicht irgendjemand. Die Katze! Dieser Verbrecher hatte wieder zugeschlagen und zwei besonders wertvolle Diamanten ergaunert und das auch noch direkt vor meinen Augen. Wenn ich an die Summe dachte, die auf dem Versicherungsschein stand und die wir, also Secur-SORGLOS, nun womöglich an den Titta-Clan auszahlen mussten, wurde mir heiß und kalt. Ich sah mich bereits mit gesenktem Kopf vor dem neuen Teilhaber stehen und meine Kündigung in Empfang nehmen. Wie hypnotisiert stierte ich auf die gefalteten Hände des Toten, der in seinem Leben vermutlich nie so unschuldig ausgesehen hatte. Und auch nicht so blass. Erst jetzt entdeckte ich die Flecken auf den Händen, die mich an Schokostückchen in Vanilleeis erinnerten. Es dauerte ein paar Sekunden, bis in meinem Gehirn ankam, was meine Augen wahrnahmen. Da war kein blaues Funkeln mehr, aber du liebe Güte, di Titta trug trotzdem Manschettenknöpfe. Nur dass diese ziemlich billig aussahen und von zwei schwarze Masken geziert wurden. Komisch, blitzte es in meinen Gedanken auf, der Bestatter besaß genau dieselben Manschettenknöpfe … O mein Gott! Dieser Mann mit den schüchtern zusammengepressten Knien …
… war die Katze!
Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da stürzte ich bereits die Stufen nach unten und kämpfte mich durch die Trauergemeinde zum Kirchenportal. Wieso war mir nicht gleich klar geworden, was mit diesem Typen nicht stimmte? Ich konnte nicht fassen, dass ich mich so hatte täuschen lassen. An diesem Mann hatte doch wirklich überhaupt nichts zusammengepasst, und sein breiter Schnäuzer hatte mich die ganze Zeit vom Wesentlichen abgelenkt.
Die Gorillas versperrten mir den Weg, und ich tat etwas, was ich normalerweise nie getan hätte: Ich riss die Handtasche mit dem Bügeleisen in die Höhe. »Aus dem Weg!«, rief ich.
Keine Ahnung, ob die beiden einfach nur perplex waren, jedoch traten sie tatsächlich beiseite. Keine zwei Sekunden später sprang ich die Stufen nach unten auf die Straße. Da war er! Der blonde Mann mit den teuren Derbys überquerte die Straße. Seine Bewegungen hatten nun überhaupt nichts Schüchternes oder Schuljungenhaftes mehr an sich. Wie eine Raubkatze ging er zu einem federweißen Cabrio, das aussah, als wäre es aus flüssiger Sahne direkt auf die Straße gegossen worden. Das war ein BMW 507. Für wen hielt der sich eigentlich? Elvis Presley? Wenn ich den mit meiner Vespa verfolgen wollte, konnte ich gleich einpacken. Und Kunkel hatte den Schlüssel für den Dienstwagen.
Die Katze öffnete die Fahrertür und ließ sich lässig in den Sitz gleiten. Gebannt sah ich zu, wie der Mann sich mit einem Ratsch den aufgeklebten Schnäuzer abriss. In aller Seelenruhe stellte er den Rückspiegel ein, während ich, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße sprintete, dabei hielt ich mir keuchend die Seite. Gute Gene – von wegen! Das Lauftraining hätte ich beim letzten Mal besser nicht geschwänzt. »HALT!« Ich war keine zwanzig Meter von seinem Wagen entfernt, da brach dieser Ruf aus meiner Kehle. Der Kopf der Katze fuhr zu mir herum, und bei seinem Grinsen blitzten die Augen genauso auf wie die Diamanten, die nun an seinen Hemdsärmeln hingen. Im Versicherungsschein stand, dass sich die seltene Farbe der Millennium Twins Fancy Vivid Blue nannte, und in diesem Augenblick verstand ich vollkommen, was an diesem Funkeln so faszinierend war. Genauso wie an dem Funkeln in den Augen der Katze. Dann schob sich eine Sonnenbrille in das Gesicht, und der Motor des Sportwagens schnurrte auf.
Ich schaffte es. Mit einem letzten Satz erreichte ich das Auto. »Stehen bleiben!« Mein ausgestreckter Arm hielt die Handtasche mit dem Bügeleisen hoch. Wirf sie ihm an den Kopf! Na los, Tilly, mach schon! Aber ich konnte den Arm nicht bewegen. Missmutig dachte ich an das Pfefferspray, das im Büro auf meinem Schreibtisch lag. Aber was hätte ich damit schon tun können? Es ihm ihn den Nacken sprühen? Mit einem Elektroschocker hätte ich ihn vielleicht außer Gefecht setzen können. Was für ein blöder Fehler. Ein ganz blöder Fehler!
Meine Finger berührten den Türgriff, da spürte ich einen Ruck, als der Wagen sich in Bewegung setzte, und der Schwung schleuderte mich zur Seite. Die Tasche rutschte mir aus der Hand und schlitterte über den Asphalt. Ich knallte sehr unelegant mit dem Hintern auf den Boden und stieß einen Schmerzenslaut aus. Fluchend schlug ich mit der flachen Hand auf den Boden, da stoppte das Fluchtauto völlig überraschend. Ich blickte in ein dunkles Augenpaar, das mich im Rückspiegel über den Rand der Sonnenbrille hinweg prüfend ansah. »Alles in Butter mit Ihnen? Haben Sie sich verletzt?«
Hatte ich richtig gehört? Dieser Gauner fragte mich allen Ernstes, ob bei mir ALLES IN BUTTER WAR? Mit einem Stöhnen kam ich auf die Füße.
»Nichts ist in Butter!«, fauchte ich, und mit jedem Wort wurde meine Stimme lauter. Die Katze wartete meine folgende Tirade nicht ab, sondern stieß nur ein erleichtertes Lachen aus. Sein Wagen setzte sich langsam wieder in Bewegung, und ohne einen weiteren Blick in den Rückspiegel zu werfen, hob er den linken Arm und winkte mir ein letztes Mal zu, bevor er davonbrauste. Was ich dabei entdeckte, verschlug mir endgültig die Sprache: Er hatte meine Uhr. Er trug tatsächlich meine silberne Uhr am Handgelenk!
* * *
Wieso konnte man eigentlich nicht vor Scham sterben? In diesem Augenblick hätte ich gerne auf ein paar Jahre meines Lebens verzichtet, wenn ich dafür nicht hätte ertragen müssen, von den Trauergästen angestarrt zu werden, die nun aus der Kirche strömten wie Kakao über einen Tassenrand.
Ich zog mein Mobiltelefon hervor und ließ mich mit Kommissar Kubitschek verbinden, der die Spuren der Katze schon seit etlichen Monaten verfolgte. Ihm gab ich das Kennzeichen vom Fluchtauto weiter plus eine mehr oder weniger genaue Personenbeschreibung. »Mittelgroß, circa eins achtzig, sportlich, mittelblonde Haare, kurz geschnitten. Augenfarbe …« Ich hielt inne, weil ich beinahe etwas Blumiges wie rehbraun gesagt hätte, und räusperte mich. »Einfach braun. Ganz normales Braun. Mittelbraun halt.« Mir fiel auf, dass ich gerade sehr viel Mittelmäßiges aufgezählt hatte, was wohl die volle Absicht der Katze gewesen sein musste. Denn er war alles andere als mittelmäßig.
»Kleidung?« Kubitscheks Stimme hallte nach, als spräche er in eine Kaffeetasse hinein.
»Er trägt einen schwarzen Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte«, führte ich aus. Und eine antike Uhr, fügte ich in Gedanken hinzu und biss die Zähne aufeinander. Kubitschek schlürfte und schluckte hörbar. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihn über die wichtigsten Erkenntnisse aufzuklären.
»Seine Schuhe sind bemerkenswert. Derbys. Ganz sicher italienisches Kalbsleder. Wenn mich nicht alles täuscht, eine Manufaktur aus Mittelitalien. Eventuell aus Ancona …« Der Kommissar gab ein Schnauben von sich. »Nun gut«, gab ich zu, »sie könnten auch aus Ascoli Piceno sein.«
Im Hintergrund stieß Metall auf Porzellan. »Und sonst haben Sie keine besonderen Kennzeichen festgestellt? Einen Haarschnitt aus Mailand oder eine Maniküre, die ganz sicher in Paris gemacht worden ist?«
»Was hat denn eine Maniküre mit besonderen Kennzeichen zu tun?«, fragte ich, aber da hörte ich schon ein Tuten in der Leitung.
Dieser Kubitschek! Verstand er denn nicht, wie wichtig dieser Hinweis war? Wieso ein Polizeikommissar und auch der Rest der Menschheit keinen Blick für gute Schuhe besaßen, war mir ein Rätsel.
Doch das alles war sinnlos. Meine Beschreibungen waren sinnlos. Wer wusste schon, wie lange die Katze so aussehen würde, wie er gerade aussah. Es wäre nicht das erste Mal, dass er sich innerhalb von Minuten in einen anderen Menschen verwandelte.
Hoffentlich hatte das eben niemand von der Presse gesehen, betete ich, was sich aber als zwecklos erwies, denn wer brauchte schon die Presse, wenn jeder Trauergast über einen Social-Media-Account verfügte? Geschätzte zwanzig Smartphones schossen gerade ein Foto von mir. Morgen würde ganz Deutschland wissen, dass die Katze die Polizei, eine Mafiafamilie und vor allem Secur-SORGLOS an der Nase herumgeführt hatte. Ach, was hieß ganz Deutschland? Es ging hier um die Millennium Twins, verdammt, es würde weltweit in der Zeitung stehen! Ich war erledigt. Das würde ich diesem Arsch nie verzeihen, denn das war nun nicht mehr rein beruflich – das nahm ich persönlich. Wir hatten zusammen gelacht oder nicht? Wenn ich ehrlich war, dann musste ich zugeben, dass mir diese Diamanten piepegal wären, wenn die Versicherungssumme nicht so unsagbar hoch wäre, aber er hatte meine Uhr geklaut! Die Uhr von meinem Uropa Manfred. Die Uhr mit meinen Initialen. Allein bei dem Gedanken daran wurde mir schlecht. Wer wusste schon, was er damit machte, wenn er bemerkte, dass sie völlig wertlos war und es sich dabei höchstwahrscheinlich nicht einmal um Silber, sondern bloß um Edelstahl handelte? Würde er sie verkaufen? Verschenken? Womöglich sogar wegwerfen? Mir wollte nicht in den Kopf, warum er das getan hatte. Das war überhaupt nicht sein Stil. Die Katze stahl normalerweise nur äußerst kostbare Dinge, er gab sich nicht mit Peanuts ab. Außerdem mutmaßte ich, dass er auf den ersten Blick den Wert eines Schmuckstücks einschätzen konnte. Genug Erfahrung hatte er, schließlich war er schon seit Jahren im Geschäft. Diese Überlegung brachte mich zu einem weiteren Punkt, der bemerkenswert war: Die Katze war ziemlich jung. Durch die Bilder, die die Überwachungskameras von ihm geliefert hatten, war ich kein bisschen darauf vorbereitet gewesen, wie jung er war. Aus irgendeinem Grund hatte ich eher an einen Mann wie Sean Connery gedacht: schwarzer Anzug, grau melierte Schläfen, schottischer Akzent. Und ein Paar schwarzer Captoe Oxfords wie in Diamantenfieber.
Ich verstaute mein Handy und atmete frustriert aus. Der Wagen war vermutlich ebenfalls gestohlen. Das war ganz sicher eine weitere Markierung in seinem Kerbholz. Zu den beiden kostbaren Manschettenknöpfen und meiner Uhr reihte sich dann auch noch ein BMW in die Liste. Ein Oldtimer. Ich konnte nur hoffen, dass der Wagen nicht auch bei Secur-SORGLOS versichert worden war.
»Tilly!« Es war Kunkel, der mit gemächlichem Schritt aus der Kirche kam und sich dabei einen Kamm durch das dünne Haar zog. »Hast du ihn gesehen? Wissen wir, wer es war?«
Ich dachte an die Schuhe der Katze, die ich für wichtiger hielt als einen Fingerabdruck, und schüttelte den Kopf. Betrübt starrte ich auf die Straße, wo eben noch der Wagen gestanden hatte, und konnte ein Flimmern auf dem Asphalt wahrnehmen. In meinen Gedanken flimmerte es ähnlich.
Kunkel steckte den Kamm in seine Brusttasche und fuhr sich mit derselben Hand über den Bauch. »Es ist schon bald Mittag«, sagte er. An Essen konnte ich nun wirklich nicht denken. Eher daran, dass mein Arm an der Stelle juckte, wo ich mit der Teerdecke in Berührung gekommen war. Ich fing an, mich zu kratzen, da bemerkte ich, dass etwas an meinem Ellbogen klebte. Angewidert tastete ich danach und zog einen haarigen Wurm von meiner Haut ab.
»Sauerbraten.« Kunkels Blick schweifte in die Ferne. »In der Kantine gibt es heute Sauerbraten. Wenn wir bis halb eins da sind, ist bestimmt noch was über.«
»Ganz schön haarig«, sagte ich, mein Fundstück heimlich betastend. »Ich meine, äh, es wird ganz schön haarig, noch eine Portion zu erwischen.« Nachdenklich betrachtete ich das Stück Fell in meiner Hand, bevor ich es hinter meinem Rücken verschwinden ließ. Ein Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus.
Die Katze hatte tatsächlich einen Fehler gemacht. Einen Fehler, auf den ich bereits seit Monaten lauerte. Ich drehte Kunkel den Rücken zu, der nach den Autoschlüsseln für den Dienstwagen suchte und sie mit einem Klirren hervorzog. Heimlich streichelte ich über die dunkelblonden Haare und schnupperte dann daran. Sie rochen nach einem Rasierwasser, das ich nicht kannte, und ein wenig harzig nach dem Klebstoff, der auf der Rückseite haftete. Was ich da in den Händen hielt, war ein Schnurrbart. Der Schnurrbart der Katze.
Kapitel 3
Der Schnurrbart steckte immer noch in meiner Handtasche, als ich nach Hause kam. Mit dem Fuß trat ich hinter mir das Gartentor zu, das wieder einmal sperrangelweit offen gestanden hatte. Weil ich zu faul war, den Schlüssel für den Briefkasten herauszusuchen, fummelte ich durch den schmalen Schlitz eine Postkarte heraus und wurde dabei prompt von Dominik aus dem ersten Stock erwischt, der sich, ein Paar Kopfhörer um den Hals baumelnd, aus dem Fenster lehnte.
»Hey Tilly.« Er schnalzte mit der Zunge und legte seine Fingerspitzen aneinander, als würde er diese Pose für eine Kabinettssitzung im Bundestag üben. (Was nebenbei bemerkt ganz und gar nicht zu seinem schlabberigen T-Shirt passte. War das da etwa ein Senffleck?) »Ich sach ma so, du siehst grauenhaft aus. Habt ihr heute ein Pferd beerdigt?«
Dominik war insgeheim in mich verliebt. Anders konnte ich mir nicht erklären, dass er eine geradezu diebische Freude dabei empfand, mich zu ärgern.
Ganz automatisch fasste ich mir an den Kopf, um zu prüfen, ob mein Haar auch nicht in alle Richtungen abstand, und berührte das Hütchen, das ich eben nachlässig wieder festgesteckt hatte. »Spar dir deine Witze, ich bin in Trauer!« Und wenn ich an Uropa Manfreds Uhr dachte, stimmte das sogar.
»Das sieht man.« Dominiks Kopf wippte nickend auf und ab wie ein Wackeldackel. Sein Deckhaar hatte er am Hinterkopf zu einem Zopf zusammengebunden, die Seiten waren rasiert und ließen ihn mit dem Schlangentattoo unter dem Ohr gefährlicher aussehen, als er war. Er griff neben sich und zog eine Zigarettenschachtel hervor. Im nächsten Moment wehte mir eine Gauloises-Wolke entgegen. »Ich sach ma so, schlimme Sache mit dem Diebstahl heute. Hab’s im Radio gehört. Wirst du Schadenersatz zahlen müssen? Wird diese Familie dich verfolgen, oder dir einen abgeschlagenen Pferdekopf ins Bett legen wie in Francis’ bestem Film?« Dominik war ungefähr der größte Francis-Ford-Coppola-Fan des Universums. Außerdem sprach er von Filmregisseuren immer, als wären es alte Kumpels von ihm. Als ich nicht antwortete, runzelte er die Stirn und saugte an dem gelben Filter wie an einem Strohhalm. »Was meinst du«, fragte er und machte eine Pause, um die nächste Wolke auszustoßen, »wie lange wird es noch dauern, bis man dich aus der Firma schmeißt?«
Ich seufzte tief und zerrte den Schlüssel aus meiner Tasche. Die Post unter dem Arm geklemmt, stocherte ich im Schloss herum und überlegte, was ich darauf erwidern sollte. Es war schließlich nicht so, als hätte ich mir diese Fragen nicht auch schon gestellt. Allerdings übertrieb Dominik gern. Er war schon seit Jahren arbeitslos, behauptete aber, ein Hacker zu sein, ein Computer-Genie. Er schaute einfach zu viel fern. Ein echter Hacker hätte das doch bestimmt niemandem verraten, oder?
»Ich glaube, mein Chef gibt mir noch eine Chance. Wäre ja auch schlimm, wenn wir demnächst zu zweit aus dem Fenster starren müssten. Aber falls …«
»Ich könnte dich da raushauen«, unterbrach er mich. Seine Augenbrauen ragten in die Höhe, was seinem Gesicht einen gewichtigen Ausdruck verlieh. »Ich sach ma so … du weißt schon …« Er tippte auf einer imaginären Tastatur herum und schnippte dann etwas Asche ab, die durch die Luft schwebte wie ein nicht ausgesprochener Wunsch. »Kostet mich keine halbe Stunde. Eure Sicherheitsschranken sind ein Witz. Wenn du willst, ändere ich irgendeine von diesen Scheißklauseln, dann müsst ihr keinen Cent zahlen, und es kann dir total egal sein, ob die Klunker wieder auftauchen oder nicht.«
»Netter Vorschlag«, winkte ich ab. »Aber unsere Verträge werden immer noch von Hand unterschrieben. Daran kann selbst ein Computergenie wie du nichts ändern.«
Jetzt legte Dominik lässig den Kopf zur Seite, so dass ich einen perfekten Blick auf sein Schlangentattoo hatte. Von hier unten sah es aus, als würde die gespaltene Zunge an seinem Ohrläppchen lecken. »Kein Ding. Ich könnte auch ein bisschen mit den Bankdaten spielen. Ich sach ma so, wenn der Mafia-Wichser seine Raten nicht bezahlt hat, ist der Vertrag ungültig, oder? Ich schiebe einfach ein paar Zahlen hin und her und zack! …« Was nach dem Zack passieren sollte, verriet er nicht – er nahm noch einen Zug.
»Im Ernst?« Nicht, dass ich ihm geglaubt hätte, er könne so was wirklich, aber die Idee klang interessant.
Dominik grinste breit. So breit, dass ich einen Kaugummi in seiner Backentasche sehen konnte. »Natürlich mach ich das nicht umsonst. Du könntest mir dafür … die Wohnung putzen oder so.«
Die Wohnung putzen? Wollte er mich auf den Arm nehmen? Mit offenem Mund starrte ich ihn an.
»Natürlich nicht so.« Seine Hand deutete an mir herunter. »In meine Wohnung lasse ich ja nicht jeden einfach so rein. Zu gefährlich, du verstehst das sicher, ist immerhin mein Hauptquartier. Du müsstest dich vorher von mir durchchecken lassen. Auf Wanzen und so’n Zeug. Ich sach ma so, am besten ziehst du dich komplett aus.«
»Vielleicht komme ich darauf zurück«, sagte ich so ruhig wie möglich, dabei rauschte mir das Blut durch den Kopf.
»Cool.« Er schnippte den Zigarettenstummel auf den Gehweg zu meinen Füßen, und ich unterdrückte das Verlangen, den brennenden Stängel auszutreten. »Hätte nicht gedacht, dass du so locker bist.«
Ich verkniff mir einen Kommentar. Aber als ich die Haustür aufschob, hörte ich dennoch, wie Dominik mir hinterherkrähte, dass auf seinem Bett immer ein Plätzchen für mich frei wäre, dann fiel die Tür ins Schloss. Im Hausflur war es zu dunkel, um die Post genauer in Augenschein zu nehmen, aber ich wusste ohnehin, dass es nur eine Karte von meinen Eltern sein konnte. Die letzte war vor drei Wochen gekommen und hatte völlig euphorisch geklungen:
Du wirst es nicht glauben, wir sind tatsächlich noch einmal nach Kuba gesegelt! Der Törn hierhin war großartig, kein Gewitter, keine riesigen Wellen, einfach perfekt. Es hat perfekt zwischen 28 und 35 Knoten gepfiffen. Dein Vater hat perfekt angelegt …
Perfekt, perfekt, alles perfekt! Ich spürte, wie mir ein Kribbeln durch die Arme in den Brustkorb fuhr, und verdrängte jeden weiteren Gedanken an die perfekte Weltreise meiner Eltern.
Aus unserer Wohnung drang kein Laut. Nicht einmal Moses gab ein Geräusch von sich, dabei musste er doch gemerkt haben, wie das Türblatt über die Fliesen schabte – schon vor Wochen war ein Steinchen unter die Tür geraten. Als Wachhund war Moses ein Totalausfall. Und das, wo seine Schnauze mir fast bis zur Hüfte reichte und er wirklich imposant aussah. Ich hatte Moses geerbt. Zusammen mit Oma Juliane. Nicht so, wie man eine Uhr oder einen Haufen Aktien erbte natürlich. Und leider auch nicht wie eine alte Villa. Sondern eher so, wie man ein großes Kinn erbte. Oder krumme Füße. Und man konnte das Erbe auch nicht ausschlagen. Man konnte nicht sagen: Sorry, liebe Eltern, aber ich verzichte darauf, die Hakennase von Onkel Franz zu erben, dafür nehme ich aber gerne die Brüste von Tante Jutta. So lief das nicht.
Als meine Eltern zu ihrer Weltreise aufgebrochen waren, waren Moses und meine Oma bei mir eingezogen, weil jemand ein Auge auf sie haben musste. Früher hatte Oma Juliane als Schneiderin in einem Gardinengeschäft gearbeitet, doch seit fünfzehn Jahren war sie in Rente, was sie jedoch nicht daran hinderte, sich jeden Tag an die Nähmaschine zu setzen. Heute trug sie eine weiße Bluse zu einem himmelblau gemusterten Kostüm. Ich erinnerte mich, dass der geblümte Stoff vor ein paar Tagen noch als Vorhang in meiner Küche gehangen hatte, und seufzte.
Omas schlohweißes Haar war perfekt onduliert, die Lippen hatte sie nur dezent geschminkt, jedoch hatten ihre Wimpern etwa die doppelte Länge als noch gestern Abend. Im Augenblick saß sie pfeilgerade in ihrem Sessel, was aber nicht darüber hinwegtäuschen konnte, dass sie tief und fest schlief. Moses lag auf ihren Füßen. Er hob lediglich seine Augenbrauen an, was sein kurzes Misstrauen signalisierte. Und wenn ein Riesenschnauzer seine Augenbrauen anhob, konnte einen das ziemlich verunsichern. Sein ganzer Kopf bestand fast nur aus Augenbrauen. Aus dem kleinen Radio, das in Omas Zimmer stand, swingte leise ein Doris-Day-Song. Ich schloss die Haustür zweifach ab (sonst zahlte keine Versicherung), dann verriegelte ich das Zusatzschloss, das ich erst vor einigen Wochen hatte einbauen lassen. Dabei handelte es sich um einen breiten Riegel, der sich quer über das ganze Türblatt zog und potenzielle Einbrecher zur Verzweiflung treiben sollte. Seitdem ich für Secur-SORGLOS arbeitete, entdeckte ich immer mehr Sicherheitslücken in meiner Wohnung und bemühte mich, Abhilfe zu schaffen. Leider sah meine Oma das nicht immer ein, und an Dominik biss ich mir ohnehin die Zähne aus. Er behauptete, dass jeder, der es wirklich wollte, in dreißig Sekunden hier reinkäme. Außerdem weigerte er sich, die Fenster in der Nacht geschlossen zu halten. Er bräuchte Luft zum Atmen, behauptete er, aber ich wusste genau, dass er mich damit nur ärgern wollte. Wann immer ich es von draußen kontrollierte, sah ich die weißen Vorhänge auf die Straße wehen, was beinahe einer Einladung für Einbrecher gleichkam. Hätte ein echter Hacker nicht eher alles verrammelt und in einer dunklen Höhle gehaust? Ich war der Überzeugung, dass man nur am täglich klingelnden Pizzaservice merken durfte, dass ein Hacker in dieser Wohnung lebte.
Mit diesen Gedanken beschäftigt, schleppte ich meinen Einkaufsbeutel in die Küche und war erleichtert, dass hier kein Chaos herrschte und meine Oma nicht versucht hatte zu kochen. Es fiel ihr immer schwerer, und ich hasste den Gedanken, dass sie sich mir zuliebe damit abquälte. Für heute hatte ich ihr Erbsensuppe versprochen und hoffte, sie würde nicht merken, dass die bloß aus der Dose war. Aber ich hatte einen verdammt stressigen Tag hinter mir, und mein Magen knurrte lauter als Moses, wenn man seinen Napf zur Seite zog. Hastig, bevor Oma aufwachen und mich erwischen konnte, fischte ich den Dosenöffner aus der Schublade und kämpfte mich mit dem blöden Ding ab. Da hörte ich ein herzhaftes Gähnen, dem ein Quietschen folgte, und war mir sicher, dass es Moses war. (Man sollte nicht in der Nähe seiner Schnauze sein, wenn er gähnte. Es roch daraus wie aus der Biotonne, die hinterm Haus stand. Im Hochsommer wohlgemerkt.) Ich kratzte die letzten Reste aus der Dose in den Topf und band in dem Moment die Schürze zu, als Omas Schritte auch schon über den Flur hallten.
»Christine-Kind?«, nuschelte sie.
Christine ist meine Mutter. »Ich bin’s, Oma. Hast du gut geschlafen? Essen ist gleich fertig.« Ich fing an, wie wild im Topf zu rühren, was sich anfühlte, als schlüge man einen Sack Zement auf. »Im Flur liegt eine neue Postkarte von Mama.« Endlich stieg etwas Dampf auf, und die Küche füllte sich mit dem süßlich-herzhaften Geruch meiner Kindheit. Ich hörte Oma durch den Flur schlurfen, dann ging die Tür auf. Über ihrer Goldbrille runzelte sie die Stirn, als sie eintrat. »Bahamas.« Sie drehte und wendete die Postkarte in ihrer Hand, als wäre es ein Wackelbild. »Ich komme da nicht mehr mit. Deine Mutter wollte doch schon längst wieder zurück sein.« Oma hatte ihr Gebiss nicht im Mund, weil es ihr oft am Zahnfleisch wehtat, und lispelte dann immer ein wenig.
»Sie sind auf den Bahamas?« Ich nahm ihr die Karte ab. Auf dem Bild war der typische weiße Sand zu sehen mit nichts außer türkisgrünem Meer im Hintergrund.
Das ist nun schon unser zweites Mal auf den Bahamas. Wir lassen es uns so gut gehen wie die Schweine, die hier durchs Wasser paddeln. Sie sind die Hauptattraktion. Morgen segeln wir nach Harbour Island, wo man in einem alten Leuchtturm herrlich essen kann. Die Schrift wurde immer kleiner und quetschte sich auf die letzten freien Zentimeter:
Pass gut auf Oma auf! Wir werden mindestens noch drei Monate länger unterwegs sein. Dein Vater möchte unbedingt noch nach Fort Lauderdale, den 4. Juli feiern wir dort und segeln anschließend …
Ich ließ die Karte sinken. In einem Nebensatz erklärten meine Eltern, dass sie ihre Weltreise mal eben um ein Vierteljahr verlängerten. Keine Frage danach, ob Oma überhaupt so lange bei mir wohnen wollte, geschweige denn, ob ich damit einverstanden war. Als meine Eltern vor einem Jahr angefangen hatten, ihre Reise zu planen, hatten sie noch versprochen, sich im Sommer eine neue Wohnung zu suchen, sobald ihr Katamaran verkauft wäre. »Also kommen sie noch nicht?«
»Offenbar nicht.« Ich wich ihrem Blick aus, zog ein Messer aus der Schublade, von dem ich nicht wusste, was ich damit tun sollte. In der Schneide spiegelten sich mein Gesicht und im Hintergrund Omas Schultern, die verzerrt nach unten sackten wie in einem Spiegelkabinett. Als ich mich zu ihr umdrehte, sah sie ganz zerbrechlich aus. Ohne das Gebiss lag ihr Mund in Falten wie ein Ballon, dem man die Luft abgelassen hatte.
»Wir kommen doch auch ohne sie gut zurecht«, sagte ich zuversichtlicher, als es sich anfühlte. »Findest du nicht?« Meine Stimme kletterte nach oben. Viel zu hoch, fiel es mir auf. Wenn ich nicht aufpasste, würde sie herunterfallen. Oma nickte stumm.
Ich konzentrierte mich wieder auf den Topf vor mir. Immer schneller rührte ich in der Erbsensuppe, bis sich ein Strudel bildete, den ich wie hypnotisiert anstarrte. Früher hatte ich meine Ferien oft bei meinen Großeltern verbracht. Opa hatte mich damals schon auf seiner alten Vespa sitzen lassen, und wenn wir zum Baden an den See fahren wollten, kletterte Oma hinter ihn und hielt sich an seinem Hemd fest. Ich hockte mich zwischen Opas Füße, die in gepflegten Loafern steckten und herrlich nach Bienenwachs rochen. Zu dritt ratterten wir über die Straße, was nicht erlaubt war, aber erwischt worden waren wir nie. Noch heute konnte ich jeden Stein fühlen, über den wir gerumpelt waren, denn am Ende des Sommers hatten immer blaue Flecken an meinem Hintern geblüht wie ein Strauß Erinnerungen. Den angenehmen Geruch von Opas Schuhwichse hatte ich immer sofort in der Nase, wenn ich daran dachte. Vielleicht war das der Grund, warum ich heute so von Schuhen besessen war.