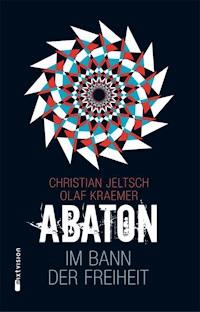
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mixtvision
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Abaton
- Sprache: Deutsch
Edda und Simon landen auf einer geheimnisvollen Plattform mitten im eiskalten Meer. Von hier aus planen hochspezialisierte Rebellen den ultimativen Schlag gegen Gene-Sys und die Macht des Geldes. Edda, Simon und Linus sind der wichtigste Teil dieser Aktion. Doch Linus bleibt verschwunden. Als die Rebellen vernichtet werden, bleibt nur noch eine Chance: Linus zu finden, um das Abaton zu erwecken und die komplette Gleichschaltung zu verhindern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Paula, Annekatrin, Horst und Hans
PROLOG
[3P01]
Rau schlug der Sturm in sein Gesicht, als Bernikoff an Deck des kleinen Schiffes wankte. In der Finsternis tastete er nach einem Halt und seine rechte Hand fand eine Stiege hinauf zum Schlot. Hastig umklammerten seine Finger das nasse Eisen.
Wild und angriffslustig türmte sich das Meer um die »Blaue Auster«, jagte die helle Gischt auf den kleinen Kutter und seine Besatzung zu. Bernikoffs Linke griff nach dem Ende eines im Wind schlagenden Seils, zog es straff zu sich heran, und dann stand er da mit ausgebreiteten Armen an der Wand des Schiffsaufbaus. Wie gefesselt. Prometheus in Erwartung des Adlers, dachte er und lachte bitter. Prometheus, der Freund der Menschen, der sie erweckt hatte, der ihnen das Feuer der Erkenntnis gebracht hatte und dafür an den Felsen geschmiedet ewige Qualen hatte leiden müssen. Es war wahr. Es hatte sie immer gegeben, ob in der Mythologie oder in der Wirklichkeit, die Gestalten, die den Menschen die Augen öffnen wollten. Für ihre Einzigartigkeit, ihre unbegrenzten Möglichkeiten. Doch was hatten die Menschen stets daraus gemacht? Sie hatten diese Propheten verdammt, ermordet und dann wieder verehrt und heilig gesprochen.
Aus dem Schwarz der Nacht formten sich plötzlich seltsame Gebilde vor Bernikoffs Augen. Wie gigantische Ungeheuer auf kerzengeraden Beinen ragten sie aus den tosenden Wassern. Stoisch trotzten sie dem unerbittlichen Toben des Meeres. Ihre winzigen leuchtenden Augen strahlten in die Nacht. Von dem kleinen Boot aus wirkte es, als reichten diese Ungetüme bis in den Himmel. Bernikoff wusste nicht, ob er Gespenster sah. Sein Blick suchte nach dem Kapitän. Bernikoff sah ihn am Steuer stehen und erschrak. Alle Gelassenheit, alle Zuversicht hatte den Körper des erfahrenen Seemanns verlassen. Er kämpfte mit den Gewalten der Natur, und Bernikoff begriff, es stand nicht gut um die »Blaue Auster«. Noch stampften die Dieselmotoren voran. Doch wuchsen die Berge aus schwarzem Wasser immer höher, und immer tiefer und steiler stürzte das kleine Schiff in die Täler hinab, die sich dahinter verbargen. Die »Blaue Auster« ächzte und krachte in ihren Fugen. Längst war sie bereit, sich zu ergeben, doch noch kämpfte die Besatzung um die Ladung und um ihr Leben.
Die entscheidende Welle hatte sich aus dem Nichts vor ihnen aufgetürmt und die Wucht ihres hinterhältigen Schlages drückte den Bug des Schiffes unter Wasser. Für eine schreckliche Unendlichkeit streckte es das Heck in die Höhe wie eine Ente den Bürzel beim Gründeln.
Immer noch klammerte sich Bernikoff an die Stiege und das Seil, die längst keinen Halt mehr versprachen. Mit böser Langsamkeit sah er das Wasser auf sich zukommen wie ein gefräßiges Raubtier. Die ersten Wellen schwappten heran, als wollten sie in Vorfreude ein wenig von ihm kosten. Da füllte sich der Rumpf des Kutters mit Wasser. Die»Blaue Auster«hatte nicht mehr die Kraft, sich aufzurichten. Wie ein Stein versank sie im Wasser. Prometheus war frei ...
„Nein!“, schrie Bernikoff voller Trotz. „So werde ich nicht sterben! Niemals. Nein!“ Damit verschlang ihn das Meer ...
„Talisker ... 15 Jahre“, sagte der Mann in der Uniform eines britischen Offiziers. »McQueen« stand auf dem Namensschild und sein rötlicher Bart unterstrich die schottische Herkunft. „Gibt nichts Besseres, um die Lebensgeister wieder zu wecken!“ Der große, stämmige Mann hatte den Malt aus einer Karaffe in einen Tumbler gegossen und hielt Bernikoff das Glas hin, der in eine Decke gehüllt vor ihm saß.
Bernikoff war dankbar. Die Ungeheuer, die er aus der wilden See hatte wachsen sehen, hatten ihm das Leben gerettet. Jetzt befand er sich auf einer der englischen Küste vorgelagerten Plattform, die die britische Armee zur Flugabwehr und Funkspionage nutzte. Die Soldaten dort hatten die Havarie entdeckt und die Besatzung der »Blauen Auster« retten können. Bernikoff nahm einen Schluck vom Talisker und schmeckte den Rauch und den torfigen Boden der Isle of Skye. Er spürte, wie der Malt die Wärme in seinen Körper zurückbrachte.
„Danke“, sagte Bernikoff.
„Sie sind der erste Kriegsgefangene, der uns dankbar ist“, sagte McQueen und setzte sich Bernikoff gegenüber. „Sie sind doch Deutscher.“
„Ich hab auch einen indischen Pass“, sagte Bernikoff in akzentfreiem Englisch. „Ich bin dort geboren.“
„Indien, soso. Mögen sie etwa diesen Gandhi, der sich jetzt da so dicke tut?“, fragte McQueen und fixierte sein Gegenüber. Bernikoff hielt den Blick und nickte offen. McQueen lächelte leicht, griff nach seinem Glas und prostete Bernikoff zu.
„Cheers!“
Die beiden Männer tranken, und es war beiden klar, dass sie Spaß an der Gegenwart des anderen hatten.
„Sie waren auf dem Weg nach London?“, fragte McQueen. „Spion?“
„Mich interessiert, was man in England über den Weg der Menschheit denkt.“
„Die geht in den Orkus, wenn Sie mich fragen.“ McQueen lachte laut. „Dahin, wo sie hingehört!“
Bernikoff registrierte die Bitterkeit, die aus seinen Worten klang.
„Wir sind alle komplett verrückt geworden“, sagte McQueen nach einer Weile. „Cheers! Auf das Ende der Welt!“ Er trank und sah, dass Bernikoff nicht mitgetrunken hatte. „Oho. Sie haben noch Hoffnung. Endsieg?“
„Endsieg der Menschlichkeit wäre schön.“
„Sie sind kein Soldat, mein Freund“, sagte McQueen und kramte in den anderen durchnässten Papieren, die sie bei Bernikoff gefunden hatten.
„Was hat es damit auf sich?“, fragte der Schotte und hielt Bernikoff einen alten Handzettel hin, der für den Auftritt des Großen Furioso im »Berliner Wintergarten« warb. „Das sind doch Sie.“
Bernikoff nickte und er begann von sich zu erzählen. Es tat gut, all das zu rekapitulieren, was sein Leben bisher ausgemacht hatte. Denn erst durch die staunenden Reaktionen des immer maltseligeren Schotten erkannte Bernikoff, wie viel Großes ihm doch gelungen war. Er berichtete von Studien über das Wissen der Kulturen, von seinem Ringen um das Gute im Menschen, von der Kraft der Sonnenräder, von »Abatonia« ... und von Marie.
Das Grau des Morgens drang bereits durch die Bullaugen des Raumes, als Bernikoff mit seiner Erzählung endete. McQueen hatte ihm bis zum Ende aufmerksam zugehört.
„Sie bekommen ein Extrakapitel in meinem Tagebuch“, sagte der Offizier und stand kerzengerade auf. Die halbe Karaffe Talisker war ihm nicht anzumerken.
„Jetzt muss ich mich um meinen Sauhaufen hier kümmern“, sagte er und schnäuzte sich. „Nicht, dass uns noch ein paar von euch Krauts in ihren Messerschmitts durch die Lappen gehen.“
Er strich seine Uniform glatt und in der Tür drehte er sich noch einmal um.
„Apropos Sauhaufen ... Sie könnten meinen Jungs doch mal vorführen, was der Große Furioso noch so draufhat. Als Dankeschön fürs Lebenretten. So was mit Hypnose oder so. Ein bisschen Show. Als ob es doch noch mal ein ‚danach‘ geben könnte.“
Bernikoff nickte. McQueen lächelte.
„Hat gut getan, mal was anderes zu hören als Kriegsgeschichten“, sagte er und verschwand.
Bernikoff saß da und spürte, wie sich allmählich die Müdigkeit ausbreitete. McQueen hatte ihm ein spartanisches Lager bereitet, doch Bernikoff wollte nicht schlafen. Er wollte diesen Schwebezustand, den die große Müdigkeit und der Malt in ihm schufen, noch ein wenig auskosten. Wie in Trance fühlte er sich. Prometheus ist dem Felsen entkommen, dachte er und lächelte. Auch wenn McQueen ihm klargemacht hatte, dass er ihn und die Besatzung der »Blauen Auster« nach Deutschland zurückschicken musste, fühlte sich Bernikoff gut. Er hatte das Gefühl, als wäre er nach der Rettung seines Lebens durch den „Feind“ endlich wieder bereit, neue Gedanken zu denken.
Die alten Gedanken, die ihn vor Kurzem noch hatten verzweifeln lassen, kamen ihm in den Sinn. „Es hat den Anschein, als wollte die Welt nicht gerettet werden.“ So hatte es Bernikoff zu Beginn seiner Reise nach England in sein Tagebuch notiert. „Längst sind die unzähligen Toten, die der große Krieg gefordert hat, keine Mahnung mehr, sondern Ansporn zu blutiger Rache, zu gnadenloser Vergeltung. Auge um Auge. Blut für Blut. Es ist nicht die Büchse der Pandora, die geöffnet wurde; die Menschen selbst haben den Zugang zu ihrem Bösen gefunden. Es ist in uns, im Bündnis mit der Angst als Feind aller Freiheit. Verwirrt von der eigenen unfassbaren Grausamkeit, sind sie der Verlockung verfallen, in der totalen Vernichtung den Keim einer besseren Welt zu erhoffen. Unvorstellbar ist der Weg zurück. Zerstöre und werde.“
Bernikoff erinnerte sich an seine Unzufriedenheit mit diesen Sätzen, seine Wut, weil er die richtigen, die treffenden Gedanken nicht denken, nicht hatte formulieren können. War es überhaupt möglich, den Schrecken, der die Welt ergriffen hatte, in Worte zu fassen?
Bernikoff schüttelte den Kopf – was für ein Dummkopf er doch gewesen war. Sein Leben lang hatte er an den geraden Weg der Menschheit zum Guten geglaubt. Hatte für sich eine Möglichkeit gefunden, diesen Glauben in eine Theorie zu verwandeln. Seine Theorie der Konstanten. Nun musste er sich eingestehen, dass er sein ganzes Handeln der Wahrheit dieser Theorie untergeordnet hatte. Sogar Marie, seine Tochter, hatte er der Gefahr ausgesetzt, dem Bösen ins Auge zu sehen. Nur um nicht an seiner Theorie zweifeln zu müssen. Dieser Krieg jedoch war der Beleg, dass der konstante Weg des Menschen zum Guten eine Farce war. Ein naives Wunschdenken. Und dem hatte er alles geopfert. Er hatte Marie verloren und stand vor den Trümmern seiner Überzeugung.
Bernikoffs Reise nach Englandwar der Versuch, ihn von seinem Verzweifeln über sich, seine Arbeit ... über die Welt zu erlösen. Er hatte Kontakt zu Wissenschaftlern und Philosophen in London aufgenommen, die angesichtsdes endlosen Krieges so ähnlich dachten wie er. Doch nun war klar, dass er England nieerreichen würde.
Bernikoff spielte mit dem kristallenen Verschluss der Karaffe, den McQueen nicht wieder auf den gläsernen Hals der Flasche gesetzt hatte. Er ähnelte einem runden, spitzen Kegel. Bernikoff hing dem Gedanken an die wiederkehrenden Versuche der Erweckung der Menschheit nach, während seine Finger um das Rund des Kegels kreisten. Und plötzlich stand es vor ihm in aller Klarheit. Ein Gedanke, der ihn elektrisierte. Die Konstante war ein Irrweg. Natürlich. Warum hatte er das nicht erkannt? Es war der Kegel. Das Sinnbild für den Weg der Menschen. Es gab Hoffnung.
Bernikoff suchte nach Papier und Schreibzeug, fand es und begann, wie im Fieber zu notieren ... Er hörte nicht die nahenden Motoren der deutschen Bomber, die im Morgengrauen ihren Weg nach London flogen. Erst das Flakfeuer der stählernen Insel ließ Bernikoff hochschrecken. Einen Moment war es still, dann näherte sich das Geräusch eines hochdrehenden Motors. Immer unerbittlicher kam es heran. Immer lauter. Bernikoff schaute durch das Bullauge auf das Meer und sah die brennende Maschine mit ohrenbetäubenden Schreien in die Wellen stürzen. Für einen Moment glaubte Bernikoff, das entsetzte Gesicht des jungen Piloten zu sehen. Dann war alles wieder still.
Bernikoff setzte sich zurück an den Tisch und schrieb weiter. Das Sterben musste ein Ende haben. Und er musste seinen Teil dazu beitragen ...
TEIL [01]
[3101]
In nassen Flocken fiel der Schnee auf das dämmernde Berlin. Je näher er der Stadt kam, desto bunter glitzerten die Kristalle, desto hektischer spiegelte sich in ihnen das rotierende Flirren aus Blau und Rot.
Unzählige Rettungswagen verstopften die Rampe zur Notaufnahme des St.-Marien-Krankenhauses und immer noch dröhnten weitere Sirenen durch die endende Nacht. „Massenkarambolage auf der Avus“, meldete der Verkehrsfunk im Viertelstundentakt und reduzierte die Tragödie auf die Länge des Staus. Kein Wort über die Schreie vor Schmerz. Das Weinen, das Wimmern, die Resignation. Das Rangeln, Bitten, Flehen einiger Angehöriger um bevorzugte Behandlung.
Mit kurzen, energischen Befehlen versuchten Notärzte und Pfleger das Chaos zu ordnen. Unermüdlich rollten Tragen von den Ambulanzen in die Klinik. Im Dauerlauf wurden Tropfe gelegt und erste Diagnosen gestellt. Parallel zu einer improvisierten Reanimation forderten Stimmen frische Blutkonserven an. Pfleger verbannten die Schaulustigen vom Ort des Geschehens und alle dienstfreien Ärzte wurden aus ihrem Wochenende zurück in die Klinik beordert. Der aufkommende Wind schnappte sich ein paar der zerknüllten, goldenen Wärmefolien und wirbelte sie durch die Luft wie taumelnde Weihnachtsengel.
Inmitten des Kampfes um Leben und Tod stand plötzlich ein alter Mann. Er trug den leblosen Körper eines Jungen auf dem Arm. Nur kurz hielt er inne, dann ging er durch das Chaos hindurch zielstrebig weiter auf die Notaufnahme zu.
„He! Sie!“, rief eine Ärztin. „Der Reihe nach. Anders geht’s hier nicht!“
Unbeirrt schritt der Mann weiter. Für sein Alter besaß er erstaunliche Kraft, denn der Junge auf seinem Arm war sicher schon fünfzehn Jahre alt.
Die Ärztin holte ihn ein, stellte sich vor ihn.
„Wir können niemanden bevorzugen. Tut mir leid“, sagte sie energisch und blickte dem Mann in die Augen. Ihr Blick traf auf eine Entschiedenheit, die sie verstummen ließ.
„Der Junge stirbt“, sagte Olsen ruhig. „Auf ihn ist geschossen worden.“
Einen kurzen Augenblick hielt die Ärztin inne. Dann nickte sie und gab Olsen den Wink, ihr zu folgen. Ohne ein Zeichen von Erschöpfung ging er hinter der Frau her. Immer wieder sah er dabei in das leblose Gesicht von Linus, als wolle er sich vergewissern, dass er ihn nicht verloren hatte. Die bunten Lichter der Rettungswagen wischten über Linus’ schon blasse Haut.
„Das schaffst du“, flüstert Olsen und machte damit vor allem sich selber Mut. „Du musst doch noch die Welt verändern, weißt du nicht?“
Olsen versuchte zu lächeln und wandte dann doch nur seinen Blick ab. Eilig schritt er weiter voran. An der Rampe hatte die Ärztin eine Trage organisiert.
„Du wirst die Welt noch verändern“, sagte Olsen. „Ganz sicher.“ Damit legte er Linus auf die Trage und half, sie in die Notaufnahme zu bugsieren. Meine Schuld, dachte Olsen und wünschte sich in diesem Moment, dass er an irgendetwas glauben könnte. Meine gottverdammte Schuld.
[3102]
„Gotcha!“
Der junge Kerl vor dem Bildschirm ballte die Faust. Er lehnte sich zurück und trank mit abwesendem Blick den letzten Rest des Energydrinks, der so lange neben seinem Rechner gestanden hatte, dass er warm und klebrig geworden war. Der fahle Geschmack der Plörre schien ihn nicht zu stören. Vielleicht nahm er ihn nicht einmal wahr. Zu fesselnd war dasGeschehen vor ihm auf dem Monitor, doch kaum jemand hätte begriffen, was sich dort auf dem blau schimmernden Display gerade abspielte. Ein kleiner und ein größerer weißer Punkt hatten sich aufeinander zubewegt, bis sie zu einem Punkt verschmolzen waren. Das war alles. Und das war es, was ihm keiner geglaubt hatte. Dass er den Satelliten würde hacken können, um ihn zur Überwachung des Meeres zu nutzen. Er hatte es geschafft. Fast ohne Zeitverzögerung konnte er jetzt die Satellitenbilder auf einen Computer holen. 5000 Pfund hatten sie ihm versprochen, wenn er das hinbekäme. Und er hatte Ja gesagt.
5000 Pfund. Die konnte er wirklich gut gebrauchen. Deshalb brachte er es fertig, nicht darüber nachzudenken, warum seinen Auftraggebern diese Sache so wahnsinnig wichtig gewesen war.
Mit sanftem, fast geräuschlosem Wischen öffnete sich die Glastür zu dem fensterlosen Raum und eine Frau trat ein. Sie war Ende vierzig, hatte praktisch-kurze Haare, kalte Augen und trug ein dezent-graues Kostüm. Schon eine Weile hatte sie hinter der Tür getanden und dem Jungen zugeschaut. Wie naiv er doch war. Er glaubte wirklich, er arbeite für das britische Innenministrium und es gehe darum, die Küsten des Königsreichs vor illegaler Einwanderung zu schützen. Die Fau hatte das Schlagen von Big Ben als Zeichen genommen und den Raum betreten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
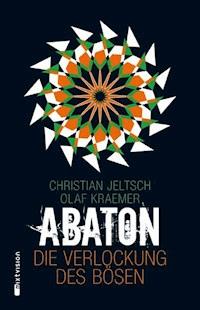
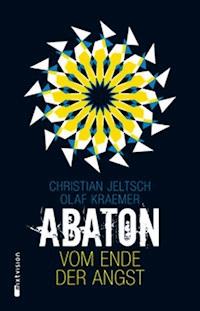













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













