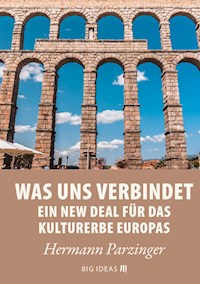14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Auf den Traumpfaden uralter Kulturen führt der international renommierte Prähistoriker Hermann Parzinger durch Millionen Jahre Menschheitsgeschichte bis in die Gegenwart – und macht uns gleichzeitig mit der Arbeit der Archäologen vertraut. Er lehrt uns das Staunen über die Rätsel der Vergangenheit und zeigt, welche konkreten Beiträge die Archäologie seit über 100 Jahren zur Entschlüsselung dieser Geheimnisse leistet. In diesem mit zahlreichen farbigen Abbildungen und Karten ausgestatteten Band erläutert Hermann Parzinger an vielen Beispielen, wie Archäologen mit immer weiter verfeinerten Methoden – etwa modernen Gen-Untersuchungen - helfen, wichtige Weg- und Wendemarken in der Entwicklung des Menschen zu erkennen und besser zu verstehen. Er führt uns auf den Spuren des Homo sapiens von Afrika aus durch alle Kontinente, Zeiten und Kulturen – vorbei an den Feuern der Eiszeitjäger und Höhlenmaler, durch die ältesten Tempelbezirke und Städte der Menschheit, zu den Pyramiden der Ägypter und den Palästen der Mykener und weiter noch durch das Imperium Romanum, das Karolingerreich und die Städte des Mittelalters bis in die Neue Welt und schließlich auf die Schlachtfelder des 20. Jahrhunderts und zu den Raubgrabungen unserer Tage im Irak.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Hermann Parzinger
ABENTEUER ARCHÄOLOGIE
Eine Reise durch die Menschheitsgeschichte
C.H.Beck
Zum Buch
Was wir über die Geschichte der Menschheit wissen, verdanken wir vielfach der Archäologie. So fördern Ausgräber Hausrat, Kunstwerke und bisweilen ganze Städte längst vergangener Epochen zu Tage. Doch auch wenn wir uns ein zutreffendes Bild von jüngeren Perioden machen wollen, kommen wir ohne Archäologie nicht aus. Dies zeigt der Prähistoriker Hermann Parzinger in seinem spannenden, reich illustrierten Buch über Funde und Forscher, Entdeckungen und Arbeitsweisen der Archäologie. Seine Leserinnen und Leser erwartet eine faszinierende Spurensuche, die von der Steinzeit bis in die Gegenwart führt.
Über den Autor
Professor Hermann Parzinger – international renommierter Vertreter seines Faches – hat das Deutsche Archäologische Institut geleitet und ist heute Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
INHALT
1: Von Kontroversen, Methoden und politischer Dimension – eine Einleitung in die Archäologie als Wissenschaft
Mythen, Menschen und Methoden
Bedeutende Entdeckungen und hitzige Debatten
Naturwissenschaften verändern Weltbilder
Archäologie im Spannungsfeld der Weltanschauungen
2: Die Frühzeit des Menschen – vom Vegetarier zum spezialisierten Jäger
Der Anfang vom Anfang
Die ältesten Werkzeuge
Von Afrika nach Europa
Waffen und Feuer
Ein sensibler Urahne – der Neandertaler
3: Erfindungsgeist und große Kunst – kulturelle Modernität weltweit
Neue Welten für den neuen Menschen
Der Homo sapiens gegen Ende des Eiszeitalters
Wie der Mensch auf den Hund kam
Mit der Nähnadel in die Eiszeitwelt
Der Kult für die Toten und die Kunst für die Lebenden
Ein neues Zeitalter kündigt sich an
4: Sesshaftwerdung und frühe Landwirtschaft – die erste Revolution
Der Wald kehrt zurück
Die rätselhaften Funde von Lepenski Vir
Die Anfänge der neolithischen Revolution im Fruchtbaren Halbmond
Gesellschaft und Landschaft in der Jungsteinzeit
Sesshaftigkeit und Bandkeramik
5: Technologie und Rohstoffe – die Basis von Macht und Herrschaft
Von der Kunst, Metall zu bearbeiten
Gesellschaftliche Folgen einer neuen Technologie
Siedlungsformen der frühen Metallzeit in Südosteuropa
Pflug, Rad und weitere folgenreiche Innovationen
Der «Ötzi» – Wanderer zwischen den Welten
Das Aufkommen der Megalithkultur
Die Bronzezeit bricht an
6: Von Gottkönigen, Baumeistern und Bürokraten – frühe Reiche im Nahen Osten
Auf dem Weg zu den ersten Hochkulturen des Alten Orients
Eridu und Uruk – die ersten Städte entstehen
Der Aufstieg Ägyptens
Die Anfänge des Pharaonenreichs
Die Entstehung der Pyramiden
Die unsterbliche First Lady des Alten Ägypten
Archäologie in der Verantwortung
7: Wirtschaftskrise, zerstörte Paläste und religiöser Wandel – eine Welt im Umbruch
Der älteste Friedensvertrag der Welt
Aufstieg und Fall der minoischen Hochkultur
Die Welt der Mykener
Die rätselhaften Seevölker
Radikale Veränderungen in Mitteleuropa im Spiegel archäologischer Funde
8: Wein und Feigen, Mode und Möbel – Mitteleuropa im Bann des Südens
Aufstieg und Fall der Phönizier
Die große Kolonisation der Griechen
Die Hallstatt-Zeit in Mitteleuropa
Sehnsucht nach südlichem Lebensstil
Der Keltenfürst von Hochdorf
Die Heuneburg
9: Migrantentum und wirtschaftlicher Aufstieg – die Kelten in Europa
Die Latène-Kultur
Das Fürstengrab vom Glauberg
Die Welt der Kelten in Aufruhr
Oppida – keltische Großsiedlungen entstehen
Fast schon eine Hochkultur
Das Ende der antiken Kelten
In dieser Situation verließen die keltischen Bojer ihre Gebiete und machten sich auf den Weg ins Königreich Noricum. Am Westalpenrand taten es ihnen die Helvetier gleich und brachen nach Gallien auf, wo sie von Caesar besiegt wurden. Der Niedergang der Oppida-Zivilisation ging also einher mit einem massiven Umbruch der ethnischen und machtpolitischen Verhältnisse in Mitteleuropa. Als die Römer im Jahre 15 v. Chr. schließlich nach Süddeutschland vorrückten und die Gebiete bis zur Donau in Besitz nahmen, war die Welt der Oppida schon längst untergegangen. In Manching dürfte sie eine Geisterstadt erwartet haben. 10: Zwischen Vernichtung und Akkulturation – Römer und Germanen
Römische Expansion in Germanien
Ein Traum wird zum Alptraum – die Varuskatastrophe
Kalkriese oder das Rätsel der Varusschlacht
Römische Germanienpolitik nach der Schlacht im Teutoburger Wald
Die Sicherung der obergermanisch-rätischen Gebiete
Städte und städtisches Leben
Die Kultur des Feindes
11: Christen, Ritter, Gurkenzüchter und Händler – das heutige Europa entsteht
Das Imperium Romanum in Gefahr
Die Bedrohung durch germanische Stämme
Der Aufstieg des Christentums
Die Völkerwanderung
Langobarden, Franken und Slawen – die Welt des Frühmittelalters nimmt Gestalt an
Die Gräber der Krieger
Burgen, Kirchen, Handelswege
12: Latrinen, Schlachtfelder oder «entartete» Kunst – keine Geschichte ohne Archäologie
Bedarf es noch der Archäologie für das Verständnis jüngerer historischer Epochen?
Die Zeit der Kreuzzüge
Quellen zur Stadtgeschichte, die nicht verbrennen
Stadtluft macht frei – und ist gefährlich
Die Welt der Burgen und Ritter
Die Unterwerfung der Neuen Welt im Spiegel der Archäologie
Die Archäologie der Schlachtfelder und Gefangenenlager
Die Rettung der Erinnerung durch die Archäologie
Archäologie fördert «entartete Kunst» wieder ans Licht
Schlussbetrachtung
Anhang
Literatur
1 Einleitung in die Archäologie als Wissenschaft
2 Die Frühzeit des Menschen
3 Kulturelle Modernität weltweit
4 Sesshaftwerdung und frühe Landwirtschaft
5 Die Basis von Macht und Herrschaft
6 Frühe Reiche im Nahen Osten
7 Wirtschaftskrise, zerstörte Paläste und religiöser Wandel
8 Mitteleuropa im Bann des Südens
9 Die Kelten in Europa
10 Römer und Germanen
11 Das heutige Europa entsteht
12 Keine Geschichte ohne Archäologie
Personenregister
Register geographischer Begriffe und Völkernamen
Nachweis der Abbildungen und Karten
Für Barbara
1
Von Kontroversen, Methoden und politischer Dimension – eine Einleitung in die Archäologie als Wissenschaft
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), der Begründer der modernen Archäologie.
Mythen, Menschen und Methoden
Hollywood hat so manche abenteuerliche Vorstellungen über die Archäologie befeuert: Mal ist es der mit Tropenhelm, Khakikleidung und Pinsel ausgerüstete Nickelbrillenträger, mal der mit Schlapphut, Lederjacke und Peitsche bewaffnete, raubeinige Forscher, der Goldschätze zu Tage fördert, mysteriöse Begebenheiten aufdeckt und neuerdings dabei natürlich ständig sein Laptop auf den Knien hält. Indiana Jones scheint allgegenwärtig. Seit «Jurassic Park» begegnet man mitunter auch dem Irrglauben, dass die Erforschung der Dinosaurier zum Aufgabenfeld der Archäologen gehöre; es sind allerdings die Paläontologen, die sich darum kümmern, so wie die Paläoanthropologen die Entstehung des Frühmenschen aufklären. Geht es etwas seriöser zu, so wird die Archäologie gerne mit der Enträtselung von Geheimnissen im Alten Ägypten gleichgesetzt; aber auch das sind bewährte Klischees, die freilich mit der Realität nur wenig zu tun haben.
Die Archäologie ist eine der faszinierendsten Wissenschaften überhaupt. Sie ist so international, interdisziplinär und Völker verbindend wie kaum ein anderes Fach. Klischees entstehen ja nicht selten aus dem enormen Interesse der Öffentlichkeit an einem Thema. Nahezu jeder Mensch ist doch irgendwie an der Frage interessiert, wo er herkommt und wie sich unser heutiges kulturelles Leben entwickelt hat. Archäologie fasziniert, weil sie diese Fragen gleichsam aus dem Nichts beantwortet. Die Müllhalden der Vergangenheit erlauben es, die früheste Geschichte der Menschheit zu entschlüsseln – und längst sind wir noch nicht am Ende der Erkenntnis angelangt: Ständig hören wir von neuen Entdeckungen und Aufsehen erregenden Grabungsfunden, unentwegt ändert sich unser Bild von fernen Zeitperioden, weil es noch längst nicht vollständig ist und vielfach auf Fragmenten und Zufallsentdeckungen beruht. Kann eine Wissenschaft spannender sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass Archäologie eine so große Faszination auf die Menschen ausübt, weil jedes noch so unbedeutende Detail und jede noch so unspektakuläre Ausgrabung durchaus unser Geschichtsbild von Grund auf verändern, ja sogar auf den Kopf stellen kann. Hätten wir beispielsweise vor der Entdeckung der Himmelsscheibe von Nebra gedacht, dass der prähistorische Mensch auf dem Gebiet des heutigen Mitteldeutschlands schon vor den alten Ägyptern in der Lage war, Beobachtungen der Gestirne in eine bildliche Darstellung zu übertragen? Eine geradezu unglaubliche intellektuelle Leistung!
Doch wie fing eigentlich alles an – wie wurde die Archäologie zur Wissenschaft? Archäologie ist – wörtlich übersetzt– die Kunde von alten Dingen. Es klingt vielleicht erstaunlich, aber an keiner einzigen deutschen Universität kann man heute Archäologie studieren. Dieses Fach existiert nicht. Die «alten Dinge», also die materiellen Hinterlassenschaften, sind stets in ihrem kulturellen, historischen und geografischen bzw. kulturgeografischen Kontext zu betrachten. Und genau deshalb gibt es keine «Archäologie» als Universitätsfach, aber es gibt eine Klassische Archäologie, eine Vorderasiatische, eine Biblische, eine Christliche, eine Byzantinische, eine Provinzialrömische, eine Islamische, eine Chinesische, eine Altamerikanische und eine Naturwissenschaftliche Archäologie und neuerdings auch eine Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Immer widmen sich die Forscherinnen und Forscher als Vertreter dieser Fächer bestimmten Zeitepochen, bestimmten Kulturräumen oder ganz spezifischen Quellengattungen.
Am universellsten ist die Prähistorische Archäologie oder Ur- und Frühgeschichte. Sie ist nicht an bestimmte Räume gebunden, auch wenn sie sich überwiegend der frühen Menschheitsgeschichte Europas widmet. Prähistoriker erforschen – und zwar weltweit – die Geschichte des Menschen seit dem Zeitpunkt, an dem er seine ersten Werkzeuge zu fertigen beginnt, und das geschah vor mehr als 2,7 Millionen Jahren. Die Erforschung der Urgeschichte ist jenen Perioden gewidmet, in denen es noch keine schriftlichen Zeugnisse gab – Epochen aus der dunklen Anonymität frühester Jahrtausende. Die Urgeschichte wird ab jenem Zeitpunkt zur Frühgeschichte, wenn die Wissenschaft zusätzlich mit ersten Schriftquellen arbeiten kann. Doch zwei Überlegungen sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig: Erstens reichen diese Schriftquellen bei weitem nicht aus, um die Geschichte umfassend zu rekonstruieren – folglich braucht man weiterhin die Archäologie. Und zweitens ist für frühgeschichtliche Kulturen charakteristisch, dass immer nur Andere über sie schreiben, also etwa Griechen über Kelten oder Römer über Germanen – Kelten und Germanen aber nie über sich selbst. Erst wenn Völker über eine eigenständige Geschichtsschreibung verfügen, endet ihre Frühgeschichte. Im Mittelmeerraum trifft dies schon auf die antiken Kulturen der Griechen und Römer zu; in weiten Teilen Mitteleuropas beginnt Geschichtsschreibung hingegen nicht vor dem Frühmittelalter, in Nord- und Osteuropa sogar erst im Hochmittelalter.
Als Begründer einer wissenschaftlichen Archäologie, die in erster Linie aus kunstgeschichtlichen Betrachtung entstand, gilt Johann Joachim Winckelmann (1717–1768). Nach einem Studium der Theologie, Geschichte, Medizin, Philologie und Philosophie reiste er nach Italien, begann, in Rom und Pompeji Antiken zu sammeln, und wurde schließlich von Papst Clemens XIII. im Jahr 1763 zum Aufseher der Altertümer im Kirchenstaat ernannt. Winckelmann sah die vornehmste Aufgabe der Kunst darin, die Schönheit darzustellen. Er prägte die berühmte Formel von der «edlen Einfalt und stillen Größe». Seine Begeisterung für männliche Helden- und Götterstatuen der Antike war auch Ausdruck homoerotischer Neigungen, wie in seinen Briefwechseln zum Ausdruck kommt. Die Vollendung jeglicher Kunst schien ihm die griechische zu sein, während er der römischen nur eine Rolle als deren Nachahmerin zugestand – so wie er die griechische Demokratie als dem römischen Despotismus überlegen betrachtete. Während seiner Forschungstätigkeit erkannte Winckelmann bereits früh die Notwendigkeit, sich dem Altertum auf dem Wege systematischer Ausgrabungen zu nähern, und so forderte er diese Vorgehensweise zum Beispiel für die bedeutende antike Stätte von Olympia ein, wo tatsächlich deutsche Archäologen 1874 die Arbeiten aufnahmen und dort bis heute tätig sind.
Nur wenige Jahre nach Winckelmann begründete Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865), Antiquar am Kopenhagener Nationalmuseum, eine Gliederung der heimischen Altertümer in eine Stein-, Bronze- und Eisenzeit – das so genannte Dreiperiodensystem. Er richtete – fehlte es doch in seiner Heimat an einer mit Rom und Griechenland vergleichbar ‹großen› Kunst – den Blick erstmals auf die gesamte materielle Hinterlassenschaft der Vergangenheit, also etwa auf alltägliche Gerätschaften und Schmuck, die wegen ihrer Unscheinbarkeit wenig spektakulär anmuteten.
Fast zur selben Zeit, als die Evolutionstheorie von Charles Darwin (1809–1882) Verbreitung fand (seit 1858), entdeckte man eigentümliche Menschenknochen «vom Geschlechte der Flachköpfe» im Neandertal bei Düsseldorf (1856). Doch selbst ein so anerkannter Anthropologe wie der berühmte Rudolf Virchow (1821–1902) hielt ein hohes Alter dieser menschlichen Überreste für ausgeschlossen und vertrat die Auffassung, dass diese Knochen von einem neuzeitlichen Menschen stammten, der durch Krankheit extrem deformiert gewesen sein soll. Allein aufgrund des enormen Ansehens Virchows wagte es die Forschung fast ein halbes Jahrhundert lang nicht, diese fundamentale Fehleinschätzung, die schon bald offensichtlich war, zu korrigieren.
Bedeutende Entdeckungen und hitzige Debatten
Die Anfänge vieler Wissenschaften stecken voller Irrtümer und Fehler. Glücklicherweise konnte sich die Archäologie schon bald von etlichen befreien – doch letztlich auch nur, um neue zu begehen. Auch der von den Schriften Homers inspirierte, ja begeisterte Autodidakt Heinrich Schliemann (1822–1890) griff gehörig daneben, als er glaubte, in den von ihm im Jahr 1872 in Troja entdeckten Schätzen den Hort des sagenhaften trojanischen Königs Priamos erkennen zu dürfen. Fairerweise muss man jedoch anmerken, dass er beim damaligen Kenntnisstand noch gar nicht wissen konnte, dass die Stücke fast 2000 Jahre älter waren. Immerhin war Schliemann wesentlich an der Entwicklung der stratigrafischen Methode beteiligt: Er war es, der in Troja erstmals einander überlagernde Siedlungsschichten aus ganz unterschiedlichen Epochen freilegte. Und Schliemann machte die Archäologie als ‹Spatenwissenschaft› endgültig hoffähig, wobei er einen ganzheitlichen Ansatz verfolgte, bei dem alle entdeckten Überreste zur Rekonstruktion der Vergangenheit beitragen sollten – eine ungemein moderne Sichtweise.
Heinrich Schliemann wirkte durch seine Ausgrabungen in Troja und Mykene im späten 19. Jahrhundert trotz etlicher Irrtümer bahnbrechend. Dieser kolorierte Holzstich zeigt ihn während der Ausgrabungen 1882 in Troja mit dem Blick auf die Substrukturen des Süd-Ost-Tores.
Die Archäologie lebt schon immer von ihren großen Forschungskontroversen, und so manche bewegte auch die Gemüter der Öffentlichkeit. Einer der Nachfolger Schliemanns als Ausgräber von Troja – der viel zu früh verstorbene Manfred Korfmann (1942–2005) – erlebte dies vor einigen Jahren sehr hautnah. Er interpretierte Ergebnisse seiner Forschungen als Hinweise auf eine ausgedehnte bronzezeitliche Unterstadt. Der seit Schliemann untersuchte Hügel von Hissarlik war also nicht die ganze Siedlung von Troja, sondern nur deren Zitadelle oder Zentrum. Dies veränderte den Blick auf Troja grundlegend. Und obwohl die Hinweise auf Bebauung in dieser Unterstadt ausgesprochen schütter waren, ließ sich Korfmann dazu hinreißen, gleich Rekonstruktionsbilder einer dicht bebauten bronzezeitlichen Großstadt zu verbreiten. Dies rief Althistoriker wie Frank Kolb auf den Plan, die – weil an Schriftquellen gewohnt und in theoriegestützter Begriffsbildung geschult – den Interpretationen Korfmanns nicht zu folgen gewillt waren, und Korfmann sah sich schon bald zum «Däniken der Archäologie» abgestempelt. Natürlich lag am Fuße des Burgbergs von Troja eine Niederlassung, daran lassen die Befunde gar keinen Zweifel. Aber Korfmann hatte es versäumt, überzeugende Belege für seine Deutung als Großstadt vorzutragen. So ist eben nicht klar, wie ausgedehnt und wie dicht bevölkert diese Außensiedlung tatsächlich war und ob sie die Bezeichnung ‹Stadt› verdiente oder ob es sich vielleicht doch nur um eine dörfliche Außensiedlung mit einigen Gehöften handelte. Man kann daraus die Konsequenz ziehen, dass Ausgrabungsergebnisse begrifflich immer äußerst sorgsam zu interpretieren sind.
Naturwissenschaften verändern Weltbilder
Die Kontroversen der Archäologie scheinen umso vehementer zu verlaufen, je mehr lieb gewonnene Bilder ins Wanken geraten. Doch jede Wissenschaft lebt vom Fortschritt und von der ständigen Infragestellung des Erreichten. Die Einführung neuer Methoden war für die Archäologie nicht immer schmerzfrei, so auch beispielsweise im Falle der Radiokarbonmethode. Bis in die 1960er Jahre versuchte man, prähistorische Kulturen über ihre zeitliche Parallelisierung mit Ägypten, Mesopotamien oder Griechenland absolut zu datieren, weil diese Hochkulturen bereits eine Kalenderrechnung kannten. Diese Verknüpfungen über Tausende von Kilometern waren zwangsläufig nicht immer sehr verlässlich. Als Willard Libby im Jahre 1960 für die Entwicklung der Radiokarbonmethode den Nobelpreis für Chemie erhielt, ahnte noch niemand, dass der Prähistorischen Archäologie eine ihrer großen Zerreißproben bevorstand. Durch den Zerfall von 14C – einem radioaktiven Isotop des Kohlenstoffs, das über den Stoffwechsel von Pflanzen und über die Nahrungskette von Tieren und Menschen aufgenommen wird – lassen sich organische Materialien auf Kalenderjahre umgerechnet absolut datieren. Die dabei erzielten Ergebnisse machten viele frühe Kulturen um Jahrhunderte älter als bis dahin gedacht und brachten so ein ganzes ‹Weltbild› zum Einsturz. Daraufhin wurde über Jahrzehnte die Radiokarbonmethode hartnäckig bekämpft und brachte ganze ‹Schulen› von Wissenschaftlern gegeneinander auf. Heute ist man längst darüber hinweg und blickt staunend und amüsiert zugleich auf diese Zeit zurück. Die Vertreter der Radiokarbonmethode hatten Recht, auch wenn diese selbst noch einmal erheblich korrigiert werden musste. Doch die unselige, unproduktive Diskussion darüber hat auf Jahre den wissenschaftlichen Fortschritt behindert.
Die Dendrochronologie (Baumringmessung) liefert der Archäologie ein verlässliches Datierungsinstrument für Hölzer von der Gegenwart bis zurück in fernste Vorzeit. Sie können aus ganz unterschiedlichen Fundzusammenhängen stammen, sind aber anschlussfähig, soweit sich die Baumringe überlappen.
Zum Glück tat man sich nicht immer so schwer, neue Methoden zu akzeptieren. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten haben die Naturwissenschaften die Archäologie grundlegend verändert. Es ist gewiss keine Übertreibung, zu behaupten, dass die Archäologie diejenige unter den Geisteswissenschaften ist, die am konsequentesten die Fortschritte der Naturwissenschaften in ihre Methoden aufnimmt und umsetzt. Der Erkenntniszugewinn ist enorm und trägt erheblich dazu bei, ein immer lebendigeres Bild von der Vergangenheit zu zeichnen: Die Baumring- bzw. Dendrochronologie – bei der man das Alter von hölzernen Artefakten mit Hilfe der darin zu erkennenden Jahresringe bestimmt – ist inzwischen in der Lage, Hölzer aus den letzten 12.000 Jahren bei entsprechendem Erhaltungszustand auf das Jahr genau zu datieren. Die Luftbildarchäologie gibt es seit dem frühen 20. Jahrhundert. Sie war ein Produkt der Flugaufklärung im Ersten Weltkrieg. Mit ihrer Hilfe werden unter der Erdoberfläche befindliche Strukturen sichtbar, die man, wenn man zu Fuß über die betreffende Fläche geht, auf dem Boden gar nicht erkennen kann. Gleichfalls in der Archäologie eingesetzte Satellitenbilder sind hingegen eine Frucht des Kalten Krieges. Sowjets und US-Amerikaner fotografierten sich zunächst gegenseitig und dann auch noch den Rest der Welt und dokumentierten dabei Bodendenkmäler dankenswerterweise gleich mit. Heute holt man sich die Satellitenbilder in beliebiger Auflösung aus dem Internet und kann darin Strukturen bis auf einen halben Meter genau erkennen.
Verschiedene geophysikalische Prospektionsverfahren zeigen Mauerzüge, Gruben oder Grabanlagen an, und auf kaum einer Ausgrabung verzichtet man heute auf diese Voruntersuchungen. Phosphatanalysen fördern zu Tage, wo in überdurchschnittlich hohem Maße menschliche und vor allem tierische Ausscheidungen in den Boden gelangten. Dadurch lassen sich Stallungen für Vieh und andere Funktionsbereiche innerhalb von ländlichen Siedlungen feststellen.
Die Physische Anthropologie befasst sich mit der Entwicklung des Menschen. Ebenso liefern morphologische – die äußere Erscheinungsform betreffende – wie auch paläopathologische – dem Gesundheitszustand eines längst Verstorbenen geltende – Analysen viele Informationen über Krankheiten und Verletzungen, Ernährungsbesonderheiten bzw. Mangelernährung sowie über die Lebensweise des Menschen in frühen Epochen. Die Isotopenanalyse, mit deren Hilfe man den Zerfallsfortschritt von radioaktiven Elementen in einem organischen Objekt untersucht, erlaubt Rückschlüsse auf die Mobilität von Menschen und Tieren im Laufe ihres Lebens. Die Paläogenetik wiederum liefert nicht nur Hinweise zu verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Individuen und zur Homogenität von Bevölkerungsgruppen, sondern man vermag inzwischen mit wachsender Probenzahl eine regelrechte Populationsgeschichte zu schreiben. Dass die ersten Ackerbauern des 6. Jahrtausends v. Chr. in Mitteleuropa nicht aus den ansässigen Wildbeutern des Mesolithikums (ca. 10.000 bis 7000 v. Chr.) entstanden sind, sondern möglicherweise aus Südosteuropa zugewandert, hat man zwar schon immer vermutet, doch erst der Fortschritt der paläogenetischen Forschung hat Gewissheit darüber gebracht.
Forscher auf dem Gebiet der Archäozoologie und Archäobotanik werten Tier- und Pflanzenreste aus archäologischen Kontexten aus. Beide Disziplinen sind nicht nur von enormer wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung, sondern sie lassen auch Rückschlüsse auf die Vegetation und damit auf das Klima vergangener Epochen zu. Die Archäometrie hingegen stellt materialkundliche und metallanalytische Untersuchungsverfahren zur Verfügung, die für die Bergbauarchäologie und damit für die Frage nach der Rohstoffversorgung früher Kulturen enorm wichtig sind. Beurteilen Sie selbst, ob es eine weitere Geisteswissenschaft gibt, der so viele Naturwissenschaften zu Diensten sind!
Doch die Archäologie hilft ihrerseits auch anderen Fächern. So werden geomorphologische – die Erdoberfläche betreffende – Veränderungen vielfach über archäologische Befunde datiert. Ein Beispiel: Die einzelnen Etappen der schrittweisen Austrocknung des Aralsees in Mittelasien lassen sich mit Hilfe von Fundstellen ziemlich genau zeitlich fixieren. Das Überraschende dabei ist: Die extreme Austrocknung des Aralsees ist nicht nur eine Erscheinung der Gegenwart, sondern ein Phänomen, das bereits im Mittelalter einmal auftrat, wie sich nun zeigt, weil die erst vor kurzem trocken gefallenen Bereiche Fundplätze aus dem Mittelalter freigeben, welche während der letzten Jahrhunderte unter Wasser lagen.
Archäologie im Spannungsfeld der Weltanschauungen
Archäologie ist aber auch eine Wissenschaft, die durchaus politische Dimensionen hat – ob einem das gefällt oder nicht. Bedenklich wird es, wenn sich totalitäre Regime der Archäologie bedienen, um ihren unlauteren Zielen scheinbar historische Weihen zu verleihen. Berüchtigt war dabei insbesondere die Rolle, die Gustaf Kossinna (1858–1931) im frühen 20. Jahrhundert als Wegbereiter eines nationalistischen Wissenschaftsverständnisses spielte. Er ging von der Deckungsgleichheit von Land, Volk, Sprache und materieller Kultur aus und folgerte umgekehrt, dass eine übereinstimmende Sachkultur in einem klar umrissenen Gebiet auch ein Volk repräsentiere. Kossinna legte damit den Grundstein für den Germanenmythos und die Bestimmung von Territorien weit im Osten bis nach Südrussland hinein als ehemals germanische Siedlungsgebiete, wodurch er dem NS-Regime später eine vermeintlich historische Rechtfertigung für ihre verbrecherischen Eroberungskriege lieferte. Wie fast alle Deutschen haben damals auch Vertreter der Altertumswissenschaften und in diesem konkreten Falle auch die deutsche Archäologie Schuld auf sich geladen. Es gab nur wenige unabhängige Geister, die sich angewidert abwandten und sich entweder in die innere oder in die wirkliche Emigration begaben.
Gustav Kossinna (1858–1931) lehrte von 1902 bis 1927 als Professor für Archäologie an der Berliner Universität. Er ebnete einer nationalistisch geprägten Betrachtung der Vorgeschichte den Weg.
Doch die politische Instrumentalisierung der Archäologie war natürlich kein deutsches Phänomen. Einer der begabtesten Schüler von Kossinna, der Pole Józef Kostrzewski, wandte nach dem Ersten Weltkrieg dieselbe Methode an, um den Nachweis zu führen, dass die von Deutschland an Polen abgetretenen Territorien schon seit der Steinzeit polnisch gewesen wären. Selbst Saddam Hussein hat 1990 den Einmarsch nach Kuweit mit dem Rückgriff auf die glorreiche Vergangenheit von Nebukadnezar begründet, mit dem er sich gerne verglich. So waren und sind es immer wieder dieselben Mechanismen der Instrumentalisierung von Geschichte, die in Diktaturen zur Anwendung kommen.
Heute ist in einem zerfallenden Irak die Rückbesinnung auf die große Vergangenheit der mesopotamischen Hochkulturen fast das einzig verbliebene Band, das diesen ethnisch und religiös sehr heterogenen Staat überhaupt noch zusammenhält. Wir stellen immer wieder fest, dass insbesondere abgelegene und krisengeschüttelte Weltregionen stolz auf die zivilisatorischen Leistungen der Vergangenheit sind. Aufsehen erregende Entdeckungen der Archäologie rücken selbst entlegene Gebiete in den Fokus der internationalen Öffentlichkeit. Die Archäologie kann dabei Langzeiterfahrungen aus der Vergangenheit für die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft nutzbar machen, ganz besonders auch im Dialog mit der islamischen Welt. Die strukturelle Koppelung der Archäologie mit Politik und Wirtschaft kann dabei ganz konkrete Beiträge zur Lösung aktueller Probleme liefern.
Im Jemen etwa haben deutsche Archäologen bis vor ein paar Jahren in Gebieten, die den Bewohnern kaum Aussicht auf Sicherung ihres Lebensunterhalts und kaum Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft boten und so zu Rekrutierungsfeldern für Islamisten wurden, durch ihre Ausgrabungen erhebliche Strukturveränderungen bewirkt, die ihrerseits wieder den Menschen eine Perspektive geben konnten. Es entstand eine touristische Infrastruktur, die plötzlich eine Vielzahl von Jobs hervorbrachte – von der Pflege der Ruinenstätten bis zu Souvenirshops, Hotels und Restaurants. Infolgedessen kam es bald auch zur Errichtung von Schulen und Krankenhäusern; endlich entstand ein wenig Zukunft in einer der ärmsten und unterentwickeltsten Regionen im Nahen Osten. Das liegt nun schon eine Weile zurück. Wer sich heute als ausländischer Archäologe in jenen Gegenden aufhalten wollte, würde sein Leben riskieren.
Dennoch, es ist deutlicher als jemals zuvor, dass die Archäologie nicht nur eine faszinierende Wissenschaft ist, international und interdisziplinär, die auf spannende Weise die großen Rätsel unserer Vergangenheit löst. Die Archäologie hat zudem eine enorme kultur- und entwicklungspolitische Dimension gewonnen, weil sie wichtige Strukturveränderungen bewirken kann. Sie ist überdies Türöffner für den Dialog mit Staaten, wo in der Politik Sprachlosigkeit herrscht. Manchmal ist es eine Mischung aus Staatsdoktrin und von interessierten Kreisen geschürten Ängsten vor dem Kontakt mit Vertretern anderer Kulturen, welche die Kooperationen auf dem Gebiet der Archäologie erschweren. So hat es beispielsweise eines langen Atems bedurft, ehe deutsche Archäologen nach der Islamischen Revolution 1979 gemeinsam mit ihren iranischen Kollegen erst im Jahre 2000 wieder ein gemeinsames Projekt aufnehmen konnten. Doch haben sich Überzeugungsarbeit, Diplomatie und Fingerspitzengefühl in dieser Sache gelohnt, weil am Schluss beide Seiten überzeugt waren, dass man auf dem richtigen Weg ist. Die Archäologie ist ein wichtiger Schlüssel zum gegenseitigen Verständnis, denn man arbeitet miteinander an der Erforschung früher historischer Epochen, um das alte Erbe der Menschheit zu begreifen – Epochen, die weltanschaulich gar nicht oder kaum belastet sind. Und wenn man das gemeinsam tut, kann es unglaublich verbinden. Zudem stand und steht im Zentrum der Archäologie immer der Mensch. Den Menschen vor Jahrtausenden will sie wiedergewinnen und in seinem Handeln verstehen. Und dem Menschen von heute will die Archäologie genau diese Erkenntnisse über seine eigene Vergangenheit vermitteln – aus der tiefen Überzeugung heraus, dass das Wissen über andere Kulturen Respekt und Toleranz fördert. Das ist die wirklich humane Dimension und zugleich die Mission der Archäologie heute. Elfenbeinturm ist längst nicht mehr.