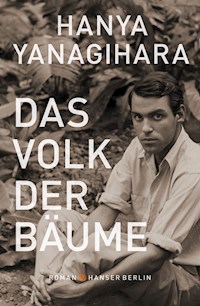Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein wenig Leben" handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New York, die sich am College kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe – ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. "Ein wenig Leben" ist ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1566
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
- Top E-Books & Hörbücher im Juni '24
- Top E-Books & Hörbücher im Mai '24
- Pride Month!
- Top bewertete Synchrobooks
- Top E-Books & Hörbücher im Februar '24
- Hanser Highlights
- BookTok o´clock: Beliebte Bücher bei TikTok
- Tiefgehende und emotionale Geschichten aus aller Welt
- Dicke Schinken, Bücher mit mehr als 400 Seiten
Ähnliche
Über das Buch
EIN WENIG LEBEN handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern, die sich am College kennengelernt haben. Willem versucht als Schauspieler Fuß zu fassen; Malcolm, ein Architekt, will aus dem Schatten seines erfolgreichen Vaters treten; JB ist Künstler und derjenige, der ihren Zusammenhalt immer wieder auf die Probe stellt. Jude St. Francis aber, brillant und enigmatisch, ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe – ein aufopfernd liebender und zugleich innerlich zerbrochener Mensch. Wie in ein schwarzes Loch werden die Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten.
EIN WENIG LEBEN ist zugleich realistischer Roman und Märchen – ein rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und Erlösung, das sich an die dunkelsten Orte begibt, an die Literatur sich wagen kann, und dabei immer wieder zum hellen Licht durchbricht.
Hanser Berlin E-Book
Hanya Yanagihara
Ein wenig Leben
Roman
Aus dem Englischen von Stephan Kleiner
Hanser Berlin
Für Jared Hohlt in Freundschaft; voller Liebe
I Lispenard Street
II Der Postmann
III Maske und Kostüm
IV Das Gleichheitsaxiom
V Die glücklichen Jahre
VI Werter Genosse
VII Lispenard Street
I LISPENARD STREET
1
Die elfte Wohnung hatte nur einen einzigen Schrank, aber es gab eine gläserne Schiebetür, die auf einen kleinen Balkon führte, von dem aus er einen Mann im Haus gegenüber sehen konnte, der nur mit T-Shirt und kurzen Hosen bekleidet im Freien saß und eine Zigarette rauchte, obwohl es schon Oktober war. Willem hob eine Hand zum Gruß, aber der Mann winkte nicht zurück.
Im Schlafzimmer schob Jude die Schranktür auf und zu wie ein Akkordeonspieler, als Willem hereinkam. »Es gibt nur einen Schrank«, sagte er.
»Das macht nichts«, sagte Willem. »Ich habe sowieso nichts zum Reinhängen.«
»Ich auch nicht.« Sie lächelten einander an. Die Maklerin folgte ihnen langsam in den Raum. »Wir nehmen sie«, sagte Jude zu ihr.
Doch im Büro der Maklerin erfuhren sie, dass sie die Wohnung doch nicht mieten konnten. »Warum nicht?«, fragte Jude.
»Sie verdienen nicht genug, um sechs Monatsmieten zu bestreiten, und Sie haben keinerlei Ersparnisse«, sagte die Maklerin, plötzlich kurz angebunden. Sie hatte ihre Kreditwürdigkeit und ihre Bankkonten überprüft und war letztlich zu der Feststellung gekommen, dass etwas nicht stimmen konnte, wenn zwei Männer in ihren Zwanzigern, die kein Paar waren, eine Zweizimmerwohnung in einem faden (aber trotzdem teuren) Teil der 25th Street mieten wollten. »Gibt es irgendjemanden, der für Sie bürgen könnte? Ein Arbeitgeber? Eltern?«
»Unsere Eltern sind tot«, sagte Willem rasch.
Die Maklerin seufzte. »Dann sollten Sie vielleicht Ihre Erwartungen herunterschrauben. Niemand, der ein gut verwaltetes Haus besitzt, wird an Bewerber mit Ihrem finanziellen Profil vermieten.« Daraufhin erhob sie sich mit einer gewissen Endgültigkeit und blickte ostentativ zur Tür.
Doch als sie JB und Malcolm davon erzählten, verwandelten sie es in eine Komödie: Der Boden des Apartments war mit Mäusekot tätowiert, der Mann auf der anderen Straßenseite hatte sich beinahe entblößt, die Maklerin war verärgert gewesen, weil Willem ihre Flirtversuche ignoriert hatte.
»Wer will schon an der Ecke 25th Street und Second Avenue wohnen«, sagte JB. Sie saßen im Pho Viet Huong in Chinatown, wo sie sich zweimal im Monat zum Abendessen trafen. Das Pho Viet Huong war nicht besonders gut – die Pho-Suppe war merkwürdig süßlich, der Zitronensaft schmeckte nach Seife, und nach jedem Essen wurde mindestens einem von ihnen übel –, aber sie kamen immer wieder, sowohl aus Gewohnheit wie auch aus Bedürftigkeit. Im Pho Viet Huong konnte man für fünf Dollar eine Suppe oder ein Sandwich essen, oder man bestellte sich eines der Hauptgerichte, die acht Dollar kosteten, aber viel größer waren, sodass man die Hälfte aufheben konnte, um sie am Tag darauf oder als nächtlichen Snack zu essen. Malcolm war der Einzige, der seinen Hauptgang nie ganz aß, sich aber auch nie die andere Hälfte einpacken ließ; wenn er fertig war, stellte er seinen Teller in die Mitte des Tisches, damit Willem und JB – die immer am hungrigsten waren – den Rest essen konnten.
»Natürlich wollen wir nicht dort wohnen, JB«, sagte Willem geduldig, »aber wir können es uns nun mal nicht aussuchen. Wir haben kein Geld, falls du das vergessen hast.«
»Ich verstehe nicht, warum ihr nicht einfach bleibt, wo ihr seid«, sagte Malcolm, der gerade Pilze und Tofu auf seinem Teller umherschob – er aß immer das Gleiche, Austernpilze und geschmortes Tofu in einer süßlichen braunen Soße –, den Willem und JB schon ins Auge gefasst hatten.
»Na ja, ich kann nicht«, sagte Willem. »Erinnerst du dich?« Er musste Malcolm das in den letzten drei Monaten ein Dutzend Mal erklärt haben. »Merritts Freund zieht ein, also muss ich ausziehen.«
»Aber warum bist du derjenige, der ausziehen muss?«
»Weil Merritts Name im Mietvertrag steht, Malcolm!«, sagte JB.
»Ach so«, sagte Malcolm und verstummte. Er vergaß häufig Details, die er für unwichtig hielt, aber es schien ihm auch nichts auszumachen, wenn die Menschen um ihn herum deswegen die Geduld verloren. »Stimmt.« Er schob die Pilze zur Tischmitte. »Aber du, Jude –«
»Ich kann nicht für immer und ewig bei dir wohnen, Malcolm. Deine Eltern bringen mich irgendwann um.«
»Meine Eltern lieben dich.«
»Es ist nett, dass du das sagst. Aber sie werden es nicht mehr tun, wenn ich nicht bald ausziehe.«
Malcolm war der Einzige der vier, der noch zu Hause wohnte, und JB sagte immer, er würde auch noch zu Hause wohnen, wenn er so ein Zuhause wie Malcolm hätte. Es war gar kein besonders prachtvolles Haus – tatsächlich war es ziemlich heruntergekommen und knarrte an allen Ecken und Enden, und Willem hatte sich einmal ein Holzsplitter unter die Haut geschoben, als er nur mit der Hand am Treppengeländer entlanggefahren war –, aber es war groß: ein richtiges Stadthaus auf der Upper East Side. Malcolms drei Jahre ältere Schwester Flora war vor Kurzem aus der Kellerwohnung ausgezogen, und Jude hatte als Übergangslösung ihren Platz eingenommen. Irgendwann würden Malcolms Eltern den Raum zurückwollen, um ein Büro für die Literaturagentur seiner Mutter darin einzurichten, was bedeuten würde, dass Jude (dem die nach dort unten führende steile Treppe ohnehin Schwierigkeiten bereitete) sich nach etwas Eigenem würde umschauen müssen.
Und es war nur natürlich, dass er mit Willem zusammenwohnen würde; sie waren während ihrer gesamten College-Zeit Zimmergenossen gewesen. Der Wohnraum, den sie sich im ersten Jahr zu viert geteilt hatten, umfasste neben einem aus Betonschalstein errichteten Aufenthaltsraum, in dem ihre Schreibtische, Stühle und ein Sofa standen, das JBs Tanten in einem gemieteten Umzugswagen herangekarrt hatten, noch ein zweites, viel kleineres Zimmer, in das zwei Etagenbetten gestellt worden waren. Es war so schmal gewesen, dass Malcolm und Jude, die in den unteren Betten schliefen, die Arme ausstrecken und sich die Hände reichen konnten. Malcolm und JB hatten sich eines der Doppelstockbetten geteilt, Jude und Willem das andere.
»Schwarz gegen Weiß«, hatte JB immer gesagt.
»Jude ist nicht weiß«, hatte Willem geantwortet.
»Und ich bin nicht schwarz«, hatte Malcolm hinzugefügt, aber eher, um JB zu ärgern, als aus eigener Überzeugung.
»Tja«, sagte JB jetzt und benutzte die Zinken seiner Gabel, um den Teller mit den Pilzen zu sich heranzuziehen, »ich würde ja sagen, dass ihr beide bei mir wohnen könnt, aber ich glaube, es würde euch ankotzen.« JB bewohnte ein großes, schmutziges Loft in Little Italy voller merkwürdiger Gänge, die in ungenutzten, seltsam geschnittenen Sackgassen und halb fertiggestellten Zimmern endeten, deren Rigipsplatten mitten im Bau aufgegeben worden waren; es gehörte jemandem, mit dem sie auf dem College gewesen waren. Ezra war Künstler, ein schlechter Künstler, aber er musste auch nicht gut sein, da er, wie JB ihnen gern in Erinnerung rief, in seinem ganzen Leben niemals würde arbeiten müssen. Und nicht nur er würde nie arbeiten müssen, auch seine Kinder und Kindeskinder, ja selbst seine Kindeskindeskinder würden es nie tun müssen: Sie könnten über Generationen hinweg schlechte, unverkäufliche, wertlose Kunst produzieren und sich trotzdem nach Lust und Laune die besten Ölfarben kaufen und sich unpraktisch große Lofts im Zentrum von Manhattan zulegen, die sie mit ihren architektonischen Fehlentscheidungen ruinierten, und wenn sie des Künstlerlebens überdrüssig wären – wie es Ezra nach JBs Überzeugung früher oder später sein würde –, müssten sie nur ihre Treuhandanstalt anrufen und sich einen gigantischen Betrag auszahlen lassen, einen Geldhaufen, wie ihn die vier (von Malcolm vielleicht abgesehen) nie zu Gesicht bekommen würden. Doch in der Zwischenzeit war Ezra ein nützlicher Kontakt, nicht nur, weil er JB und einige weitere Freunde aus College-Tagen in seinem Apartment wohnen ließ – es hausten eigentlich zu jeder Zeit vier oder fünf Leute in verschiedenen Ecken des Lofts –, sondern weil er ein freundlicher und generell großzügiger Mensch war, der gern exzessive Partys gab, bei denen gewaltige Mengen von Nahrungsmitteln, Alkohol und Drogen zur freien Verfügung standen.
»Wartet mal«, sagte JB und legte die Gabel aus der Hand. »Mir fällt gerade ein, dass eine von der Zeitschrift jemanden für die Wohnung ihrer Tante sucht. Die liegt direkt an der Grenze zu Chinatown.«
»Wie hoch ist die Miete?«, fragte Willem.
»Wahrscheinlich extrem niedrig – sie wusste nicht mal, was sie dafür nehmen könnte. Und sie will jemanden drin haben, den sie kennt.«
»Meinst du, du könntest ein gutes Wort für uns einlegen?«
»Noch besser – ich mache euch mit ihr bekannt. Könnt ihr morgen im Büro vorbeikommen?«
Jude seufzte. »Ich werde nicht wegkommen.« Er sah Willem an.
»Kein Problem – ich schaffe es. Wie viel Uhr?«
»Am besten um die Mittagszeit. Eins?«
»Ich bin da.«
Willem hatte noch Hunger, aber er ließ JB den Rest der Pilze aufessen. Dann warteten sie alle ein wenig; manchmal bestellte Malcolm noch Jackfrucht-Eis – das einzige auf der Karte, das immer schmeckte –, aß zwei Bissen und hörte dann auf, sodass Willem und JB den Rest essen konnten. Aber diesmal bestellte er kein Eis, also ließen sie die Rechnung kommen, um sie gemeinsam zu inspizieren und auf den Dollar genau zu teilen.
*
Am Tag darauf besuchte Willem JB im Büro. JB arbeitete an der Rezeption einer kleinen, aber einflussreichen Zeitschrift, die in SoHo herausgegeben wurde und sich mit der Kunstszene in Downtown befasste. Er hatte die Stelle aus strategischen Gründen angenommen; sein Plan, den er Willem eines Nachts erklärt hatte, bestand darin, sich mit einem der Redakteure anzufreunden und diesen dann davon zu überzeugen, einen Artikel über seine Kunst in Auftrag zu geben. Nach seinen Berechnungen würde das etwa sechs Monate dauern, was bedeutete, dass er noch drei vor sich hatte.
An seinem Arbeitsplatz trug JB einen Ausdruck permanenter Verwunderung auf dem Gesicht; Verwunderung darüber, dass er überhaupt arbeiten musste, und darüber, dass noch niemand seine Genialität erkannt hatte. Er war kein guter Rezeptionist. Obwohl die Telefone mehr oder weniger durchgehend klingelten, hob er selten ab; wenn einer von ihnen mit ihm sprechen wollte, musste er einem Code folgen, der darin bestand, es zweimal klingeln zu lassen, aufzulegen und dann noch einmal anzurufen. Und selbst dann hob JB manchmal nicht ab – seine Hände waren damit beschäftigt, verworrene Haarsträhnen aus einer schwarzen Mülltüte zu ziehen, die zu seinen Füßen stand, und sie unter dem Schreibtisch zu kämmen und zu flechten.
JB durchlebte gerade, was er als seine Haarphase bezeichnete. Er hatte kürzlich beschlossen, eine Auszeit von der Malerei zu nehmen, um Skulpturen aus schwarzen Haaren zu fertigen. Jeder von ihnen hatte ein kraftraubendes Wochenende damit verbracht, JB in Queens, Brooklyn, der Bronx und Manhattan von Barbershop zu Schönheitssalon zu folgen und draußen zu warten, während JB hineinging, um die Besitzer nach zusammengefegten Haarresten zu fragen, und dann eine immer unhandlicher werdende Tüte voller Haare hinter ihm herzuschleppen. Zu seinen ersten Werken hatte The Mace gezählt, ein Tennisball, den er von seinem Flaum befreit, in der Mitte durchgeschnitten und mit Sand gefüllt hatte, bevor er ihn mit Kleber bestrich und immer wieder über einen Haarteppich rollte, sodass die borstigen Haare sich bewegten wie Algen unter Wasser, und The Kwotidien, wofür er unterschiedliche alltägliche Haushaltsgegenstände – einen Tacker, einen Pfannenwender, eine Teetasse – mit Haaren verkleidete. Jetzt arbeitete er an einem Großprojekt, über das er nur selten ein Wort verlor, für das aber offenbar viele Haarsträhnen gekämmt und zu einem scheinbar endlosen Seil aus sich kräuselndem schwarzen Haar verflochten werden mussten. Am vergangenen Freitag hatte er sie mit der Aussicht auf Pizza und Bier in seine Wohnung gelockt, wo sie ihm beim Flechten helfen sollten, doch nach vielen Stunden ermüdender Arbeit hatte ihnen gedämmert, dass es keine Pizza und kein Bier geben würde, und sie waren leicht verärgert, aber nicht sonderlich überrascht nach Hause gegangen.
Das Haarprojekt langweilte sie alle, auch wenn Jude – als Einziger – die Kunstwerke schön fand und davon überzeugt war, dass man sie eines Tages als wichtig betrachten würde. Zum Dank hatte JB Jude eine mit Haaren überzogene Haarbürste geschenkt, das Geschenk jedoch zurückgefordert, als es den Anschein machte, ein Freund von Ezras Vater sei daran interessiert, es zu kaufen (er tat es nicht, aber JB gab Jude die Bürste nie zurück). Das Haarprojekt war noch in anderer Hinsicht schwierig; als die drei an einem anderen Abend durch eine erneute List dazu gebracht worden waren, nach Little Italy zu kommen und Haare zu kämmen, hatte Malcolm angemerkt, die Haare stänken. Was sie taten: nicht nach irgendetwas Unappetitlichem, es war einfach der herbe, metallische Geruch ungewaschener Kopfhaut. Aber JB hatte sich in einen seiner sich emporschraubenden Wutanfälle hineingesteigert und Malcolm einen von Selbsthass besessenen Nigger genannt, einen Onkel Tom, einen Verräter an seiner Rasse, und Malcolm, der selten in Wut geriet, aber über Anschuldigungen wie diese schon, hatte seinen Wein in die nächstbeste Tüte mit Haaren geschüttet und war aufgestanden und nach draußen gestürmt. Jude war Malcolm, so gut er konnte, hinterhergeeilt, und Willem hatte versucht, JB in den Griff zu bekommen. Und auch wenn die beiden sich am Tag darauf wieder vertragen hatten, waren Willem und Jude (obwohl sie wussten, dass es unfair war) noch etwas wütender auf Malcolm als auf JB gewesen, denn am Wochenende darauf zogen sie wieder in Queens von Barbershop zu Barbershop, um die ruinierten Haare zu ersetzen.
»Wie ist das Leben auf dem schwarzen Planeten?«, fragte Willem jetzt JB.
»Schwarz«, sagte JB und stopfte die Haarsträhnen, die er gerade entwirrte, in die Tüte zurück. »Komm, lass uns gehen; ich habe Annika gesagt, dass wir um halb zwei da sind.« Das Telefon auf seinem Schreibtisch begann zu klingeln.
»Willst du nicht rangehen?«
»Die rufen schon wieder an.«
Während sie in Richtung Downtown liefen, beklagte sich JB. Bisher hatte er seine Verführungskünste hauptsächlich auf einen Redakteur namens Dean konzentriert, den sie alle DeeAnn nannten. Sie waren zu dritt auf einer Party gewesen, die in der Wohnung der Eltern eines der jungen Redaktionsassistenten stattgefunden hatte, wo sich ein kunstgeschmückter Raum an den anderen reihte. Während JB sich in der Küche mit seinen Kollegen unterhielt, waren Malcolm und Willem gemeinsam durch die Wohnung gestreift (wo war Jude an jenem Abend gewesen? Vermutlich hatte er gearbeitet), hatten eine Reihe von Edward Burtynskys betrachtet, die im Gästezimmer hingen, eine von Bernd und Hilla Becher fotografierte Serie von Wassertürmen, die in vier Reihen zu je fünf Abzügen über dem Schreibtisch im Arbeitszimmer hingen, einen riesenhaften Gursky, der in der Bibliothek über den halbhohen Bücherregalen schwebte, und eine ganze Wand voller Arbeiten von Diane Arbus, die deren Fläche so gründlich bedeckten, dass nur am oberen und am unteren Ende ein paar Zentimeter freiblieben. Sie hatten ein Bild von zwei niedlichen Mädchen mit Down-Syndrom bewundert, die für die Kamera in zu engen, zu kindischen Badeanzügen spielten, als Dean auf sie zugekommen war. Er war ein großer Mann, hatte aber ein kleines, erdhörnchenhaftes, pockennarbiges Gesicht, das ihm ein brutales und wenig vertrauenswürdiges Aussehen verlieh.
Sie stellten sich ihm vor, sagten, sie seien auf der Party, weil sie JBs Freunde seien. Dean sagte, er sei einer der Redakteure der Zeitschrift und für den gesamten Kunstteil zuständig.
»Ah«, sagte Willem und vermied es, Malcolm anzusehen, dem er nicht zutraute, sich nichts anmerken zu lassen. JB hatte ihnen gesagt, dass er den Kunstredakteur als Zielscheibe auserkoren hatte; das musste er sein.
»Habt ihr so was schon mal gesehen?«, fragte Dean sie und gestikulierte in Richtung der Arbus-Fotos.
»Noch nie«, sagte Willem. »Ich liebe Diane Arbus.«
Dean versteifte sich, und seine Züge schienen sich in der Mitte seines kleinen Gesichts zu ballen. »DeeAnn.«
»Was?«
»DeeAnn. Man spricht sie ›DeeAnn‹ aus.«
Sie hatten es kaum aus dem Zimmer geschafft, bevor sie in Gelächter ausgebrochen waren. »DeeAnn!«, hatte JB gesagt, als sie ihm die Geschichte später erzählt hatten. »Gott! Was für ein aufgeblasener kleiner Scheißtyp.«
»Aber er ist dein aufgeblasener kleiner Scheißtyp«, hatte Jude gesagt. Und fortan hatten sie Dean nur noch DeeAnn genannt.
Doch leider sah es so aus, als wäre JB, obwohl er DeeAnn unermüdlich bearbeitete, seinem Ziel kein Stück näher gekommen, als er es vor drei Monaten gewesen war. Er hatte sogar zugelassen, dass DeeAnn ihm im Dampfbad des Fitnessstudios einen blies, und trotzdem: nichts, kein Artikel über JB. Jeden Tag fand JB einen Vorwand, um zu den Büros der Redakteure und hinüber zum Schwarzen Brett zu gehen, an dem die Ideen für die Ausgaben der kommenden drei Monate auf weißen Karteikarten festgehalten wurden, und jeden Tag suchte er in dem Abschnitt, der für Nachwuchskünstler reserviert war, nach seinem Namen, und jeden Tag wurde er aufs Neue enttäuscht. Stattdessen sah er die Namen verschiedener talentloser und überschätzter Künstler; Leute, denen jemand einen Gefallen schuldete oder die jemanden kannten, dem jemand einen Gefallen schuldete.
»Wenn ich jemals Ezras Namen dort sehe, bringe ich mich um«, sagte JB ständig, worauf die anderen erwiderten: »Das wird nicht passieren, JB«, und: »Mach dir keine Gedanken, JB – eines Tages wird dein Name dort stehen«, und: »Wofür brauchst du die, JB? Du findest was anderes« – Aussagen, auf die JB antwortete: »Seid ihr sicher?« beziehungsweise »Ich habe da so meine Zweifel«, und: »Ich habe einen Arschvoll Zeit hier reingesteckt, drei beschissene Monate meines Scheißlebens, und wenn ich meinen Namen nicht an dieser Tafel sehe, war die ganze Scheiße hier eine einzige Zeitverschwendung, so wie alles andere auch«, womit er das weiterführende Studium, den Umzug zurück nach New York, den Haarzyklus oder das Leben an sich meinen konnte, je nachdem, wie nihilistisch er an dem jeweiligen Tag gerade gestimmt war.
Er jammerte noch immer, als sie in der Lispenard Street ankamen. Willem war noch nicht lange in der Stadt – erst seit einem Jahr – und hatte nie von der Straße gehört, die eher eine Gasse war, zwei Häuserblocks lang und einen Block südlich der Canal Street; aber auch JB, der in Brooklyn aufgewachsen war, war sie völlig unbekannt.
Sie fanden das Haus und drückten die Klingel mit der Aufschrift 5C. Ein Mädchen antwortete – durch die Gegensprechanlage klang ihre Stimme kratzig und hohl – und betätigte den Türöffner. Der Eingangsbereich war ein schmaler Raum mit hohen Decken, der in einem geronnenen, schimmernden Kackbraun gestrichen war, was ihnen das Gefühl gab, sich auf dem Boden eines Brunnens zu befinden.
Das Mädchen empfing sie an der Wohnungstür. »Hey, JB«, sagte es, sah dann Willem an und errötete.
»Annika, das ist mein Freund Willem«, sagte JB. »Willem, Annika arbeitet in der Grafik. Sie ist cool.«
In einer einzigen Bewegung senkte Annika den Blick und streckte die Hand aus. »Schön, dich kennenzulernen«, sagte sie zum Fußboden. JB trat Willem auf den Fuß und grinste. Willem ignorierte ihn.
»Ich freue mich auch, dich kennenzulernen.«
»Also, das ist die Wohnung? Sie gehört meiner Tante? Sie hat fünfzig Jahre lang hier gewohnt, ist aber kürzlich ins Altersheim gezogen?« Annika sprach sehr schnell und hatte offenbar beschlossen, die beste Strategie sei, Willem wie eine Sonnenfinsternis zu behandeln und ihn einfach gar nicht anzusehen. Sie redete immer schneller, über ihre Tante und darüber, wie die Gegend sich verändert habe, und dass sie selbst nie von der Lispenard Street gehört habe, bis sie nach Downtown gezogen sei, und dass es ihr leidtue, dass die Wohnung noch nicht gestrichen sei, aber ihre Tante sei gerade erst ausgezogen, wirklich ganz frisch, und sie konnten die Wohnung am vergangenen Wochenende nur schnell putzen. Ihr Blick wanderte überallhin außer zu Willem – zur Decke (gestanztes Blech), zum Boden (rissig, aber Parkett), zu den Wänden (an denen vor langer Zeit aufgehängte Bilderrahmen geisterhafte Schatten hinterlassen hatten) –, bis Willem sie schließlich behutsam unterbrechen musste, um zu fragen, ob er sich einmal den Rest der Wohnung ansehen dürfe.
»Oh, gerne«, sagte Annika, »ich lasse euch allein«, folgte ihnen aber dennoch und begann JB in rasch hervorsprudelnden Worten etwas über jemanden namens Jasper zu erzählen, der die Schrifttype Archer für alles benutzt habe, und ob JB nicht finde, dass sie für Fließtext ein wenig zu rund und sonderbar aussehe? Nun, da Willem ihr den Rücken zukehrte, starrte sie ihn unverhohlen an, während ihr Gerede immer nichtiger wurde.
JB betrachtete Annika dabei, wie sie Willem betrachtete. Er hatte sie noch nie so gesehen, so nervös und so mädchenhaft (normalerweise war sie mürrisch und schweigsam und im Büro sogar ein wenig gefürchtet, weil sie an der Wand über ihrem Schreibtisch eine kunstvolle Skulptur errichtet hatte: ein Herz, das nur aus Klingen von Präzisionsmessern bestand), aber er hatte viele Frauen gesehen, die sich in Willems Gesellschaft so benahmen. Jeder von ihnen kannte solche Szenen. Ihr Freund Lionel sagte immer, Willem müsse in einem früheren Leben Fischer gewesen sein, weil sich die Muschis nur so auf ihn stürzten. Und doch schien Willem die ihm entgegengebrachte Aufmerksamkeit meistens (wenn auch nicht immer) zu entgehen. JB hatte Malcolm einmal gefragt, woran das wohl liege, und Malcolm sagte, er glaube, Willem bemerke es eben einfach nicht. JB hatte als Antwort nur gegrunzt, aber gedacht hatte er, dass Malcolm der begriffsstutzigste Mensch war, den er kannte, und wenn selbst Malcolm aufgefallen war, wie Frauen auf Willem reagierten, dann war es schlicht unmöglich, dass Willem selbst es nicht wahrnahm. Später jedoch hatte Jude eine andere Interpretation angeboten: Er war der Meinung, dass Willem vorsätzlich nicht auf die Frauen reagierte, damit sich die Männer um ihn herum nicht durch ihn bedroht fühlten. Das klang sinnvoller; Willem war allseits beliebt und wollte nicht, dass sich irgendjemand in seiner Gesellschaft unwohl fühlte, und so war es durchaus möglich, dass er, und sei es unbewusst, den Unwissenden spielte. Dennoch war es faszinierend, und die drei wurden nie müde, Willem damit aufzuziehen, der meistens nur lächelte und schwieg.
»Ist der Aufzug gut in Schuss?«, fragte Willem und drehte sich abrupt um.
»Was?«, antwortete Annika erschrocken. »Ja, er fällt selten aus.« Sie verzog ihre blassen Lippen zu einem dünnen Lächeln, wobei JB klarwurde (es fuhr ihm in den Magen, so sehr schämte er sich für sie), dass sie versuchte, mit ihm zu flirten. Ach, Annika, dachte er. »Was wollt ihr meiner Tante denn in die Wohnung schleppen?«
»Unseren Freund«, antwortete er, bevor Willem es tun konnte. »Er tut sich mit Treppen schwer und ist auf einen Fahrstuhl angewiesen, der tatsächlich fährt.«
»Oh«, sagte sie, abermals errötend. Sie fixierte wieder den Boden. »Entschuldigung. Ja, er funktioniert.«
Die Wohnung war wenig eindrucksvoll. Es gab eine kleine Diele, kaum größer als eine Fußmatte, von der rechts eine Küche (ein warmer und fettiger kleiner Würfel) und links ein Esszimmer abzweigten, in dem allenfalls ein Kartentisch Platz finden würde. Eine halbhohe Wand teilte diesen Bereich von einem Wohnzimmer mit vier von Gitterbalken gekreuzten Fenstern ab, die nach Süden auf die mit Müll übersäte Straße hinausgingen; von dort führte ein kurzer Flur rechter Hand zu einem Badezimmer mit milchgläsernen Wandlampen und einer Badewanne aus abgenutzter Emaille; gegenüber lag das Schlafzimmer, das ein weiteres Fenster hatte und lang, aber schmal war; die hölzernen Rahmen zweier Doppelbetthälften waren parallel zueinander jeweils an die Wand gerückt. Auf einem der Rahmen lag bereits eine Futon-Matratze, ein klobiges, reizloses Ding, schwer wie ein totes Pferd.
»Die Matratze ist unbenutzt«, sagte Annika. Sie erzählte eine ausschweifende Geschichte darüber, dass sie eigentlich selbst habe einziehen wollen und schon die Matratze dafür gekauft habe, aber nicht dazu gekommen sei, sie zu benutzen, weil sie stattdessen bei ihrem Freund Clement eingezogen sei, der aber nicht ihr fester Freund sei, nur ein Freund, und Gott, wie bescheuert sich das anhöre. Jedenfalls würde sie, wenn Willem die Wohnung wolle, die Matratze gratis drauflegen.
Willem dankte ihr. »Was meinst du, JB?«, fragte er.
Was JB meinte? Dass es ein Dreckloch war. Natürlich wohnte er selbst in einem Dreckloch, aber er wohnte dort freiwillig, und es kostete ihn nichts, und das Geld für die Miete, das er sparte, konnte er in Farben, Lebensmittel, Drogen und hin und wieder eine Taxifahrt investieren. Aber sollte Ezra je beschließen, Miete von ihm zu verlangen, würde er auf keinen Fall dort bleiben. Seine Familie war vielleicht nicht so vermögend wie Ezras oder Malcolms, aber unter keinen Umständen würde sie zulassen, dass er sein Geld in so einem Dreckloch versenkte. Jemand würde etwas Besseres für ihn finden oder ihm mit einem kleinen monatlichen Betrag unter die Arme greifen. Willem und Jude dagegen hatten diese Möglichkeiten nicht. Sie mussten sich selbst finanzieren, und sie hatten kein Geld, und darum mussten sie in einem Dreckloch leben. Und wenn sie es schon mussten, dann war dies wahrscheinlich das Dreckloch der Wahl – es war billig, es war in Downtown, und ihre potenzielle Vermieterin war bereits in fünfzig Prozent von ihnen verknallt.
»Ich meine, sie ist perfekt«, sagte er daher zu Willem, der ihm zustimmte. Annika kreischte auf. Und eine hastige Unterredung später war es besiegelt: Annika hatte Mieter, und Willem und Jude hatten eine Wohnung – woraufhin JB Willem daran erinnern musste, dass er nichts dagegen hätte, wenn dieser ihm einen Teller Nudeln spendierte, bevor er zurück ins Büro musste.
*
JB neigte nicht zur Innenschau, aber als er am darauffolgenden Sonntag mit der Bahn zu seiner Mutter fuhr, empfand er einen gewissen Drang, sich selbst zu beglückwünschen, gepaart mit etwas, das an Dankbarkeit erinnerte, Dankbarkeit dafür, dass er das Leben und die Familie hatte, die er hatte.
Sein Vater, ein Emigrant aus Haiti, war gestorben, als JB drei Jahre alt war, und auch wenn JB glaubte, sich an sein Gesicht zu erinnern – sanft und freundlich, mit einem schmalen Schnurrbartstreifen und Wangen, die sich zu Pflaumen rundeten, wenn er lächelte –, wusste er doch nie ganz genau, ob er es sich nicht vielleicht nur einbildete, weil er unzählige Male das Foto betrachtet hatte, das auf dem Nachttisch seiner Mutter stand. Und doch war der Tod seines Vaters das Einzige gewesen, worüber er als Kind Traurigkeit empfunden hatte – und selbst diese Traurigkeit war eine gewesen, zu der er sich in gewisser Weise verpflichtet fühlte: Er war vaterlos, und er wusste, dass vaterlose Kinder diese Lücke in ihrem Leben betrauerten. Er jedoch hatte diese Sehnsucht nie empfunden. Nach dem Tod seines Vaters hatte die Mutter, eine Tochter haitischer Einwanderer, ihren Doktor in Pädagogik gemacht und währenddessen in der staatlichen Schule in ihrer Nachbarschaft unterrichtet, die sie als nicht gut genug für JB erachtet hatte. Während seiner Highschool-Jahre an einer teuren Privatschule, die beinahe eine Stunde von ihrer Wohnung in Brooklyn entfernt war und für die er ein Stipendium hatte, war sie bereits Rektorin einer Magnetschule in Manhattan und Lehrbeauftragte am Brooklyn College. Die New York Times hatte ihren innovativen Unterrichtsmethoden einen Artikel gewidmet, und obwohl er sich das seinen Freunden gegenüber nicht hatte anmerken lassen, war er stolz auf seine Mutter gewesen.
Während seiner Kindheit war sie pausenlos beschäftigt gewesen, aber er hatte sich nie vernachlässigt gefühlt, hatte nie das Gefühl gehabt, seine Mutter hätte ihre Schüler und Studenten lieber als ihn. Seine Großmutter war zu Hause bei ihm; sie kochte ihm, was er sich wünschte, und sang ihm auf Französisch vor, und es verging kein Tag, an dem sie ihm nicht sagte, was für ein Schatz er sei, was für ein Genie, der Mann ihres Lebens. Und dann waren da noch seine Tanten, die Schwester seiner Mutter, eine Kriminalbeamtin, die in Manhattan lebte, und ihre Lebensgefährtin, eine Apothekerin und ebenfalls Einwanderin in zweiter Generation (allerdings aus Puerto Rico, nicht Haiti), die keine Kinder hatten und ihn wie ihr eigenes behandelten. Die Schwester seiner Mutter war sportlich und brachte ihm bei, einen Ball zu fangen und zu werfen (etwas, woran er schon damals nur geringes Interesse hatte, das sich später aber als wichtige soziale Fertigkeit erwies), und ihre Freundin interessierte sich für Kunst; eine seiner frühesten Erinnerungen galt einem Besuch im Museum of Modern Art, und er wusste noch genau, wie er stumm vor Ehrfurcht Jackson Pollocks One: Number 31 angestarrt und seiner Tante kaum zugehört hatte, die erklärte, wie das Bild entstanden war.
Auf der Highschool, wo eine Prise persönlicher Revisionismus angebracht schien, um sich von den anderen abzuheben und insbesondere seinen reichen weißen Mitschülern etwas Angst einzujagen, verwischte er die Wahrheit über seine Abstammung ein wenig: Er wurde zu einem von so vielen vaterlosen schwarzen Jungen, dessen Mutter ihren Abschluss erst nach seiner Geburt gemacht hatte (er unterschlug, dass es sich um den Studienabschluss handelte, also gingen alle davon aus, dass er einen Highschool-Abschluss meinte) und dessen Tante auf der Straße arbeitete (als Prostituierte, nahmen sie an, nicht wissend, dass sie Polizistin war). Sein liebstes Familienfoto war von einem seiner Highschool-Freunde aufgenommen worden, einem Jungen namens Daniel, dem er die Wahrheit gesagt hatte, bevor er ihn hereinbat, um ihr Familienporträt zu fotografieren. Daniel hatte an einer Serie über Familien gearbeitet, die es, wie er es nannte, »nach oben geschafft hatten«, und JB musste ihn rasch darüber aufklären, dass seine Tante keine Bordsteinschwalbe und seine Mutter keine halbe Analphabetin war, bevor er seinen Freund mit ins Haus nahm. Daniel hatte den Mund geöffnet, ohne dass ein Ton herauskam, doch dann hatte JBs Mutter die Tür geöffnet und ihnen gesagt, sie sollten aus der Kälte hereinkommen, und Daniel musste gehorchen.
Noch immer sprachlos, hatte Daniel sie im Wohnzimmer postiert: Yvette, JBs Großmutter, saß in ihrem liebsten Lehnstuhl, eingerahmt von seiner Tante Christine und ihrer Freundin Silvia, die auf der einen Seite standen, und JB und seiner Mutter auf der anderen. Doch dann hatte Yvette, kurz bevor Daniel auf den Auslöser drücken konnte, darauf bestanden, dass JB ihren Platz einnähme. »Er ist der König des Hauses«, sagte sie unter dem Protest ihrer Töchter zu Daniel. »Jean-Baptiste! Setz dich hin!« Das tat er. Auf dem Foto umklammert er die Armlehnen zu beiden Seiten mit seinen fleischigen Händen (er war schon damals pummelig gewesen), während Frauen zu beiden Seiten strahlend auf ihn hinunterblicken. Er selbst, auf dem Stuhl sitzend, der für seine Großmutter bestimmt gewesen war, sieht mit einem breiten Lächeln direkt in die Kamera.
Der Glaube, den sie in ihn und seinen zu erwartenden Triumph gesetzt hatten, war auf geradezu beunruhigende Weise unerschütterlich. Sie waren davon überzeugt – auch wenn seine eigene Überzeugung so oft auf die Probe gestellt wurde, dass es schwierig wurde, sie stets aufs Neue heraufzubeschwören –, dass er eines Tages ein bedeutender Künstler sein würde, dass seine Arbeiten in wichtigen Museen hängen würden, dass die Leute, die ihm bisher noch keine Chance gegeben hatten, seine Begabung schlicht nicht erkannten. Manchmal glaubte er ihnen und ließ sich von ihrer Zuversicht anstecken. Dann wieder kamen ihm Zweifel – ihre Überzeugungen schienen denen der restlichen Welt diametral entgegengesetzt zu sein, und er fragte sich, ob sie gönnerhaft waren oder schlicht verrückt. Vielleicht hatten sie auch einfach keinen Geschmack. Wie konnte das Urteil vierer Frauen so maßgeblich von dem aller anderen Menschen abweichen? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihrer Einschätzung richtig lagen, konnte nicht besonders hoch sein.
Und doch fühlte er sich stets befreit, wenn er seine geheimen sonntäglichen Reisen nach Hause antrat, wo das Essen reichlich und kostenlos war, wo die Großmutter seine Wäsche wusch und wo jedes Wort, das er sprach, und jede Skizze, die er zeigte, aufgesogen und mit beifälligem Geraune quittiert wurden. Das Haus seiner Mutter war vertrautes Territorium, ein Ort, an dem man ihn immer verehren würde, an dem alle Bräuche und Traditionen auf ihn und seine speziellen Bedürfnisse abgestimmt zu sein schienen. An jedem Abend gab es einen Moment – nach dem Abendessen, vor dem Nachtisch, wenn sie alle im Wohnzimmer ruhten und fernsahen und die Katze seiner Mutter seinen Schoß wärmte –, in dem er seine Frauen ansah und etwas in sich aufsteigen fühlte. Dann dachte er an Malcolm mit seinem schonungslos intelligenten Vater und der liebevollen, aber zerstreuten Mutter und an Willem, dessen Eltern tot waren (JB hatte sie nur ein einziges Mal getroffen, an dem Wochenende, an dem Willem und er als Erstsemester von zu Hause ausgezogen waren, und war überrascht gewesen, wie wortkarg, wie formell, wie unwillemhaft sie gewesen waren), und schließlich, natürlich, an Jude mit seinen schlicht nichtexistenten Eltern (es war ein Rätsel – sie kannten Jude nun schon seit einem Jahrzehnt und wussten noch immer nicht genau, ob er überhaupt einmal Eltern gehabt hatte, nur dass irgendetwas im Argen lag und nicht darüber gesprochen werden durfte), und ihn durchfloss ein warmes Gefühl von Glück und Dankbarkeit, so als würde sich ein Ozean in seiner Brust ausbreiten. Ich habe Glück, dachte er in solchen Momenten, und dann, weil er kompetitiv dachte und sich laufend vergewisserte, wo er in allen Bereichen des Lebens im Verhältnis zu seinesgleichen stand: Ich habe von allen am meisten Glück. Aber er dachte nie, dass er es nicht verdiente oder dass er sich mehr Mühe geben sollte, seine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen; seine Familie war glücklich, wenn er glücklich war, und so bestand seine einzige Verpflichtung ihnen gegenüber darin, glücklich zu sein, genau das Leben zu leben, das er leben wollte, zu den Bedingungen, zu denen er es wollte.
»Man bekommt nicht die Familie, die man verdient«, hatte Willem einmal gesagt, als sie sehr bekifft gewesen waren. Natürlich hatte er Jude gemeint.
»Das stimmt«, hatte JB geantwortet. Und das dachte er wirklich. Keiner von ihnen – weder Willem noch Jude, nicht einmal Malcolm – hatte die Familie, die er verdiente. Doch insgeheim nahm er sich selbst davon aus: Er hatte die Familie, die er verdiente. Sie war wunderbar, wirklich wunderbar, und er wusste es. Und vor allem verdiente er sie wirklich.
»Da ist ja mein Wunderkind«, rief Yvette aus, wenn er das Haus betrat.
Er hatte nie in Zweifel gezogen, dass sie damit absolut richtig lag.
*
Am Tag des Umzugs gab der Fahrstuhl den Geist auf.
»Verdammter Mist«, sagte Willem. »Ich habe Annika extra danach gefragt. JB, hast du ihre Nummer?«
Aber JB hatte sie nicht. »Ach, was soll’s«, sagte Willem. Was hätte es schon gebracht, Annika zu schreiben? »Tut mir leid, Leute«, sagte er in die Runde, »wir müssen die Treppe nehmen.«
Das schien niemanden zu stören. Es war ein schöner Tag im Spätherbst, leicht kühl, trocken und windig, und sie waren zu acht – Willem, JB, Jude, Malcolm, JBs Freund Richard, Willems Freundin Carolina und zwei gemeinsame Freunde, die beide Henry Young hießen, aber zwecks Unterscheidbarkeit von allen asiatischer Henry Young und schwarzer Henry Young genannt wurden – und mussten nur wenige Kisten und eine Handvoll Möbelstücke hinaufschaffen.
Malcolm, der sich immer dann, wenn man es am wenigsten erwartete, als Organisationstalent entpuppte, verteilte die Aufgaben. Jude sollte hinauf zur Wohnung gehen, den Verkehr regeln und darauf achten, dass die Kisten in die richtigen Zimmer kamen. Zwischendurch würde er die größeren Gegenstände auspacken und anfangen, die Kartons zusammenzufalten. Carolina und der schwarze Henry Young, die beide klein, aber kräftig waren, würden die kompakten Bücherkisten tragen, Willem, JB und Richard die Möbel und der asiatische Henry Young und Malcolm selbst alles andere. Auf dem Weg nach unten sollte man die Kartons, die Jude zusammengelegt hatte, mitnehmen und sie in der Nähe der Mülltonnen auf dem Bürgersteig stapeln.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Willem Jude leise, während sich alle ihren Aufgaben entsprechend aufteilten.
»Nein«, antwortete er knapp, und Willem sah ihm zu, wie er in seiner stockenden, langsamen Gangart die steilen, hohen Stufen hinaufging, bis er aus seinem Blickfeld verschwand.
Es war ein einfacher Einzug, zügig und undramatisch, und nachdem sie alle ein wenig herumgesessen, Bücher ausgepackt und Pizza gegessen hatten, zogen die anderen zu Partys und Bars weiter, und Willem und Jude waren endlich allein in ihrer neuen Wohnung. Drinnen herrschte ein heilloses Durcheinander, aber der Gedanke daran, alles an seinen Platz zu räumen, war einfach zu ermüdend. Und so blieben sie einfach sitzen, überrascht darüber, dass sich der Nachmittag so schnell verdunkelt hatte und dass sie eine Wohnung hatten, eine Wohnung in Manhattan, eine Wohnung, die sie sich leisten konnten. Sie hatten beide die höfliche Ausdruckslosigkeit auf den Gesichtern ihrer Freunde bemerkt, als diese die Wohnung zum ersten Mal gesehen hatten (das Zimmer mit den beiden Doppelbetthälften – »wie in einer viktorianischen Irrenanstalt«, so hatte Willem es Jude beschrieben – hatte die meisten Kommentare geerntet), aber es machte ihnen nichts aus: Es war ihre Wohnung, sie hatten einen Vertrag für zwei Jahre, niemand konnte sie ihnen nehmen. Sie würden sogar ein wenig Geld sparen können, und was hätten sie überhaupt mit mehr Platz anfangen sollen? Natürlich sehnten sie sich beide nach Schönheit, aber das würde eben warten müssen. Oder besser gesagt, sie würden darauf warten müssen.
Sie unterhielten sich, aber Judes Augen waren geschlossen, und Willem wusste – er erkannte es an dem konstanten, kolibrihaften Flattern seiner Lider und der Art, wie er die Hand so fest zur Faust ballte, dass Willem das meergrüne Garn seiner Adern auf dem Handrücken hervortreten sah –, dass er Schmerzen hatte. Daran, wie starr Jude seine Beine hielt, erkannte er, dass es starke Schmerzen waren, und er wusste auch, dass er nichts für ihn tun konnte. Hätte er gesagt: »Komm, Jude, ich hole dir ein Aspirin«, hätte Jude gesagt: »Es geht schon, Willem, ich brauche nichts«, und hätte er gesagt: »Jude, leg dich doch hin«, hätte Jude gesagt: »Willem. Es geht schon. Hör auf, dir Gedanken zu machen.« Also tat er schließlich, was sie alle zu tun gelernt hatten, wenn Judes Beine ihm Schmerzen bereiteten: Er stand auf und verließ unter irgendeinem Vorwand den Raum, sodass Jude ohne jede Regung daliegen und darauf warten konnte, dass die Schmerzen nachließen, ohne sich unterhalten zu müssen oder Energie darauf zu verschwenden, so zu tun, als wäre alles in Ordnung und er wäre nur müde oder hätte einen Krampf oder welche fadenscheinige Ausrede auch immer ihm eingefallen wäre.
Im Schlafzimmer fand Willem den Müllsack mit ihrer Bettwäsche und bezog erst seine Matratze und dann Judes (die sie eine Woche zuvor Carolinas baldiger Exfreundin zu einem sehr geringen Preis abgekauft hatten). Er unterteilte seine Kleidung in Hemden, Hosen sowie Unterwäsche und Socken und legte die Stapel in (frisch von Büchern geleerte) Pappkartons, die er unter sein Bett schob. Judes Kleidung ließ er, wo sie war, und ging ins Bad, das er putzte und desinfizierte, bevor er Zahncreme, Seife, Rasierer und Shampoo ihren Besitzern zuordnete und verstaute. Ein oder zwei Mal unterbrach er seine Arbeit, um zum Wohnzimmer zu schleichen, wo Jude in unveränderter Haltung saß, die Augen noch immer geschlossen, die Hand noch immer zur Faust geballt, den Kopf zur Seite gedreht, sodass Willem sein Gesicht nicht sehen konnte.
Seine Gefühle für Jude waren komplizierter Natur. Er liebte ihn – das war der einfache Teil – und hatte Angst um ihn, und manchmal kam es ihm vor, als wäre er ebenso sehr sein älterer Brüder und Beschützer wie sein Freund. Ihm war bewusst, dass Jude in der Vergangenheit ohne ihn zurechtgekommen war und es auch weiterhin tun würde, aber manchmal nahm er Dinge an Jude wahr, die ihn verstörten und paradoxerweise dazu führten, dass er sich einerseits hilflos fühlte und andererseits noch entschlossener wurde, ihm zu helfen (auch wenn Jude selten um irgendeine Art von Hilfe bat). Sie alle liebten und bewunderten Jude, doch Willem hatte oft das Gefühl, dass Jude ihm ein wenig – nur ein klein wenig – mehr von sich gezeigt hatte als den anderen, und war sich nicht sicher, wie er mit diesem Wissen umgehen sollte.
Die Schmerzen in seinen Beinen etwa: So lange sie ihn kannten, so lange wussten sie, dass er Probleme mit den Beinen hatte. Natürlich war es auch schwer zu übersehen; während der gesamten College-Zeit hatte er einen Gehstock benutzt, und als er jünger gewesen war – als sie ihn kennengelernt hatten, war er so jung gewesen, ganze zwei Jahre jünger als sie, dass er noch wuchs –, hatte er nur mithilfe einer orthopädischen Krücke gehen können, und um seine Beine waren schienenartige Klammern geschnallt gewesen, deren in seine Knochen gebohrten äußere Bolzen ihn daran hinderten, die Knie zu beugen. Doch er hatte sich nie beklagt, nicht ein einziges Mal, und dabei doch immer Verständnis für das Gejammer der anderen gehabt; in ihrem zweiten College-Jahr war JB auf Glatteis ausgerutscht und hatte sich das Handgelenk gebrochen, und sie erinnerten sich alle an den Trubel, den das nach sich gezogen hatte, an JBs theatralisches Stöhnen und seine gequälten Schreie und daran, dass er sich noch eine Woche, nachdem der Gips angelegt worden war, weigerte, das Universitätsklinikum zu verlassen, und so viele Besucher empfing, dass die College-Zeitung einen Artikel über ihn brachte. Ein anderer Junge aus ihrem Studentenwohnheim, ein Fußballspieler mit Meniskusriss, hatte immer wieder gesagt, JB wisse gar nicht, was Schmerzen seien, aber wie Willem und Malcolm hatte auch Jude JB jeden Tag besucht und ihm das ersehnte Mitgefühl geschenkt.
Eines Nachts, kurz nachdem JB huldvoll seine Entlassung aus der Klinik gewährt hatte und ins Wohnheim zurückgekehrt war, um sich an der dortigen Aufmerksamkeit zu laben, war Willem aufgewacht, und das Zimmer war leer gewesen. Das war im Grunde nichts Ungewöhnliches: JB war bei seinem Freund, und Malcolm, der in dem Semester ein Astronomie-Seminar in Harvard belegt hatte, war im Labor, wo er jeden Dienstag und Donnerstag übernachtete. Willem war selbst oft unterwegs, meist bei seiner Freundin, aber weil sie die Grippe hatte, war er an jenem Abend zu Hause geblieben. Doch Jude war eigentlich immer da. Er hatte nie eine Freundin oder einen Freund gehabt und verbrachte jede Nacht auf dem Zimmer, seine Gegenwart unter Willems Bett so vertraut und konstant wie das Meer.
Er hätte nicht genau sagen können, was ihn dazu veranlasste, aus dem Bett zu steigen und eine Minute lang benommen in der Mitte des Zimmers zu stehen, sich umblickend, als könnte Jude wie eine Spinne an der Decke hängen. Dann aber bemerkte er, dass seine Krücke nicht da war, und er begann, nach ihm zu suchen, rief im Aufenthaltsraum leise seinen Namen und verließ, als keine Antwort kam, ihre Zimmerflucht, um den Korridor hinunter zum Gemeinschaftsbad zu gehen. Im Vergleich zum Dunkel ihres Zimmers war das Bad geradezu übelkeitserregend hell, die Leuchtstoffröhren gaben ihr schwaches, kontinuierliches Knistern von sich, und er war so orientierungslos, dass es ihn weniger überraschte, als es sollte, Judes Fuß unter der Tür der letzten Toilette hervorragen zu sehen, daneben die Spitze der Krücke.
Er klopfte an die Toilettentür und flüsterte: »Jude?«, und als er nichts hörte: »Ich komme rein.« Er zog die Tür auf. Jude lag bäuchlings auf dem Boden, ein Bein unter die Brust gezogen. Er hatte sich übergeben; ein Teil des Erbrochenen hatte auf dem Boden vor ihm eine Pfütze gebildet, der Rest war als getüpfelte, aprikosenfarbene Schicht an seinen Lippen und seinem Kinn angetrocknet. Seine Augen waren geschlossen, er schwitzte, und eine seiner Hände umklammerte das gebogene Ende der Krücke mit einer Intensität, die, wie Willem später herausfinden sollte, mit extremen Schmerzen einhergeht.
In jenem Moment aber war er verängstigt und verwirrt und begann, Jude eine Frage nach der anderen zu stellen, auf die er keine Antworten erhielt, und erst als er Jude auf die Füße zu stellen versuchte, stieß dieser einen Schrei aus, und Willem begriff, wie stark seine Schmerzen waren.
Irgendwie gelang es ihm, Jude halb in ihr Zimmer zu schleifen, halb zu tragen, ihn in sein Bett zu legen und provisorisch zu säubern. In der Zwischenzeit schienen die Schmerzen ein wenig nachgelassen zu haben, und als Willem ihn fragte, ob er einen Arzt holen solle, schüttelte Jude den Kopf.
»Aber Jude«, sagte Willem ruhig, »du hast Schmerzen. Du musst dir helfen lassen.«
»Dagegen hilft nichts«, antwortete er und schwieg einen Augenblick lang. »Ich muss es einfach aussitzen.« Seine Stimme war nur ein schwaches, fremd klingendes Flüstern.
»Was kann ich tun?«, fragte Willem.
»Nichts«, sagte Jude. Sie schwiegen. »Aber Willem – bleibst du noch kurz bei mir?«
»Natürlich«, sagte er. Neben ihm bebte und zitterte Jude, als wäre ihm kalt, und Willem nahm die Decke von seinem eigenen Bett und legte sie um ihn. Irgendwann schob er seine Hand unter die Decke, tastete nach Judes, öffnete seine Faust und ergriff seine feuchte, schwielige Hand. Es war lange her, dass er die Hand eines anderen Jungen gehalten hatte – das letzte Mal war bei einer Operation seines Bruders vor vielen Jahren gewesen –, und er war überrascht über die Stärke von Judes Griff, die Kraft seiner Finger. Noch Stunden zitterte Jude und klapperte mit den Zähnen, und schließlich legte Willem sich neben ihn und schlief ein.
Am nächsten Morgen wachte er in Judes Bett auf; seine Hand schmerzte, und als er sie inspizierte, fand er Blutergüsse, wo Judes Finger sich in seinen Handrücken gegraben hatten. Er erhob sich ein wenig wackelig und betrat den Gemeinschaftsraum, wo er Jude lesend an seinem Schreibtisch vorfand, die Gesichtszüge in der Helligkeit des spätmorgendlichen Lichts verborgen. Er hob den Blick und stand auf, und eine Zeit lang sahen sie sich einfach nur schweigend an.
»Willem, es tut mir so leid«, sagte Jude schließlich.
»Jude«, antwortete er, »es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest.« Und er meinte es ernst; es gab wirklich nichts.
Aber Jude wiederholte nur: »Es tut mir leid, Willem, es tut mir so leid«, und sosehr Willem es auch versuchte, er konnte ihn nicht beschwichtigen.
»Sag nur Malcolm und JB nichts davon, ja?«, bat er ihn.
»Werde ich nicht«, versprach Willem. Und er tat es nicht, auch wenn es letztlich keinen Unterschied machte, denn irgendwann wurden auch Malcolm und JB Zeugen seiner Schmerzattacken, wenn sie auch selten so ausgedehnt waren wie die, deren Zeuge Willem in jener Nacht geworden war.
Er hatte nie mit Jude darüber gesprochen, aber in den Jahren, die folgten, sah er ihn viele Arten von Schmerzen erleiden, starke und weniger starke, sah ihn zusammenzucken oder, wenn die Qual zu groß wurde, sich übergeben, auf dem Boden krümmen und so weit in sich zurückziehen, dass er kaum mehr ansprechbar war, so wie er es jetzt gerade in ihrem Wohnzimmer tat. Doch auch wenn er ein Mann war, der seine Versprechen hielt, war da etwas in Willem, das sich ständig fragte, warum er Jude nie darauf angesprochen hatte, ihn nie gefragt hatte, wie es sich anfühlte, nie zu tun gewagt hatte, was sein Instinkt ihm befahl: sich neben ihn zu setzen und seine Beine zu massieren, zu versuchen, die unkontrolliert feuernden Nervenenden wieder fügsam zu kneten. Stattdessen versteckte er sich im Badezimmer und flüchtete sich in stumpfsinnige Tätigkeiten, während wenige Meter entfernt einer seiner besten Freunde, allein auf einem ekelerregenden Sofa sitzend, die langsame, traurige, einsame Reise zurück ins Bewusstsein, ins Land der Lebenden antrat, ohne dass irgendjemand bei ihm war.
»Du bist ein Feigling«, sagte er zu seiner Reflexion im Badezimmerspiegel. Sein Gesicht erwiderte den Blick, müde vor Abscheu. Aus dem Wohnzimmer drang nichts als Stille, aber Willem ging hinüber, um sich ungesehen an die Schwelle zu stellen und darauf zu warten, dass Jude zu ihm zurückkehrte.
*
»Es ist ein Dreckloch«, hatte JB zu Malcolm gesagt, und auch wenn er nicht unrecht hatte – schon die Diele erzeugte ein Kribbeln auf der Haut –, kehrte Malcolm doch mit einem Gefühl der Melancholie nach Hause zurück und fragte sich einmal mehr, ob es wirklich besser war, weiterhin bei seinen Eltern zu wohnen als in einem Dreckloch eigener Wahl.
Rein logisch betrachtet, hätte er selbstverständlich bleiben sollen, wo er war. Er verdiente sehr wenig und arbeitete sehr viel, und das Haus seiner Eltern war so groß, dass er sie im Grunde niemals hätte zu Gesicht bekommen müssen, wenn er nicht gewollt hätte. Neben dem dritten Stockwerk, das er allein bewohnte (und das sich, wenn er ehrlich war, von einem Dreckloch nicht wesentlich unterschied, so schmutzig war es dort – seine Mutter hatte aufgehört, die Haushälterin zum Aufräumen nach oben zu schicken, nachdem Malcolm sie angeschrien hatte, Inez habe eines seiner Modellhäuser zerstört), konnte er die Küche und die Waschmaschine nutzen und alle Zeitungen und Zeitschriften lesen, die seine Eltern abonniert hatten, und einmal pro Woche warf er seine Wäsche in den schlaffen Stoffsack, den seine Mutter auf dem Weg ins Büro bei der Reinigung abgab und Inez tags darauf wieder abholte. Natürlich war er nicht stolz auf dieses Arrangement, ebenso wenig wie auf die Tatsache, dass er siebenundzwanzig Jahre alt war und seine Mutter ihn beim Bestellen der wöchentlichen Lebensmittellieferung noch immer im Büro anrief, um ihn zu fragen, ob er Erdbeeren essen würde, wenn sie welche bestellte, oder ob er zum Abendessen gern Saibling oder doch lieber Brasse hätte.
Allerdings wäre alles einfacher gewesen, hätten seine Eltern sich nur an dieselben räumlichen und zeitlichen Grenzen gehalten wie er. Nicht nur dass sie von ihm erwarteten, jeden Morgen mit ihnen zu frühstücken und jeden Sonntag mit ihnen zu brunchen, sie statteten seiner Etage auch regelmäßig Besuche ab, die sie lediglich durch ein Klopfen und gleichzeitiges Drehen des Türknaufs ankündigten, obwohl Malcolm ihnen wieder und wieder gesagt hatte, dass dies dem ureigentlichen Sinn des Klopfens zuwiderlief. Er wusste, dass es schrecklich görenhaft und undankbar war, so zu denken, doch allein wegen des Smalltalks, den er über sich würde ergehen lassen müssen, bevor er sich nach oben in sein Zimmer verdrücken könnte wie ein Teenager, grauste es ihm manchmal davor, nach Hause zu kommen. Und besonders grauste es ihm davor, ohne Jude in dem Haus zu leben; obwohl die Kellerwohnung mehr Privatsphäre bot als sein Stockwerk, hatten seine Eltern es sich zur Gewohnheit gemacht, auch dort fröhlich hereinzuschneien, wenn Jude da war, sodass manchmal, wenn Malcolm zu Jude hinunterging, sein Vater bereits dort saß und Jude irgendeinen langweiligen Vortrag hielt. Speziell sein Vater mochte Jude – er sagte oft zu Malcolm, im Gegensatz zu seinen anderen Freunden, die nichts weiter als Luftikusse seien, besitze Jude wahre intellektuelle Tiefe –, und nur wenn Jude nicht da war, bekam Malcolm seine komplizierten Geschichten über den Finanzmarkt, sich verschiebende globale Verhältnisse und andere Themen, die ihn nicht besonders interessierten, zu hören. Tatsächlich beschlich ihn manchmal der Verdacht, sein Vater hätte lieber Jude als Sohn gehabt. Die beiden hatten dieselbe juristische Fakultät besucht. Der Richter, dem Jude assistiert hatte, war in der ersten Kanzlei seines Vaters dessen Mentor gewesen. Und Jude war stellvertretender Staatsanwalt in der strafrechtlichen Abteilung des United States Attorney, ebendort, wo auch Malcolms Vater als junger Mann tätig gewesen war.
»Denkt an meine Worte: Dieser Junge wird es noch weit bringen«, oder: »Es ist etwas Besonderes, jemanden, der sich aus eigener Kraft an die Spitze setzen wird, zu treffen, wenn er noch am Beginn seiner Karriere steht«, sagte Malcolms Vater häufig zu ihm und seiner Mutter, nachdem er sich mit Jude unterhalten hatte, und schaute dabei so selbstzufrieden drein, als wäre er irgendwie für Judes Genialität verantwortlich, und in solchen Momenten musste Malcolm es vermeiden, seiner Mutter ins Gesicht zu sehen, auf dem, wie er wusste, ein tröstender Ausdruck lag.
Wäre Flora noch da gewesen, wäre alles etwas einfacher gewesen. Als sie sich auf ihren Auszug vorbereitete, hatte Malcolm vorzuschlagen versucht, dass er mit ihr zusammen in die neue Zweizimmerwohnung in der Bethune Street einziehen könnte, aber entweder hatte sie die zahlreichen Andeutungen wirklich nicht verstanden, oder sie hatte schlicht beschlossen, sie nicht zu verstehen. Flora schien es nichts auszumachen, dass ihre Eltern so exorbitant viel Zeit von ihnen einforderten, was bedeutete, dass er mehr Zeit in seinem Zimmer mit seinen Modellhäusern verbringen konnte und weniger damit, unten im Hobbyraum hibbelig einen der Yasujirō-Ozu-Filmmarathons seines Vaters abzusitzen. Als Kind war Malcolm verletzt und gekränkt gewesen, weil sein Vater Flora so offensichtlich bevorzugte, dass es selbst Freunden der Familie aufgefallen war. »Flora Fabelhaft«, hatte sein Vater sie genannt (oder, zu unterschiedlichen Zeiten ihrer Pubertät, »Flora Frechdachs«, »Flora Fürchterlich«, »Flora Fuchsteufelswild«, doch immer voller Anerkennung), und selbst heute fand er – obwohl Flora beinahe dreißig Jahre alt war – noch besonderen Gefallen an ihr. »Fabelhaft hat heute etwas so Kluges gesagt«, bemerkte er beim Abendessen, so als würden Malcolm und seine Mutter nicht auch regelmäßig mit ihr sprechen, oder, nach einem Brunch in der Nähe von Floras Wohnung in Downtown: »Warum musste Fabelhaft nur so weit weg ziehen?«, auch wenn es mit dem Auto nur fünfzehn Minuten waren. (Darüber ärgerte sich Malcolm besonders: Sein Vater hatte ihm immer brokatverzierte Geschichten davon erzählt, wie er als Kind von den Grenadinen nach Queens gezogen war und dass er sich danach immer wie ein Mann gefühlt habe, der zwischen zwei Ländern gefangen war, und dass auch Malcolm irgendwann einmal in einem anderen Land leben solle, weil es ihn als Mensch bereichern und seinen Horizont erweitern werde und so weiter und so fort. Doch hätte Flora es je gewagt, auch nur aus Manhattan wegzuziehen, geschweige denn in ein anderes Land, wäre er zweifellos am Boden zerstört gewesen.)
Malcolm selbst hatte keinen Kosenamen. Hin und wieder rief sein Vater ihn beim Nachnamen anderer, berühmter Malcolms – »X«, »McLaren«, »McDowell« oder auch »Muggeridge«, nach dem Malcolm angeblich benannt war –, aber es wirkte nie wie eine liebevolle Geste, eher wie eine Erinnerung daran, was Malcolm hätte sein sollen, aber ganz eindeutig nicht war.
Manchmal – oft – erschien es Malcolm albern, dass es ihn noch immer nicht beschäftigte, sogar bedrückte, dass sein Vater ihn offenbar nicht besonders mochte. Selbst seine Mutter sagte das. »Du weißt, dass Daddy es nicht so meint«, sagte sie, wenn sein Vater wieder einmal einen seiner Monologe über Floras Überlegenheit gehalten hatte. Malcolm – der ihr glauben wollte und zugleich verstört registrierte, dass sie seinen Vater noch immer als »Daddy« bezeichnete – brummte oder murmelte dann irgendetwas, um ihr zu bedeuten, dass es ihm völlig egal sei. Und manchmal – wiederum zunehmend häufig – ärgerte es ihn, dass er sich überhaupt so viel mit seinen Eltern beschäftigte. War das normal? War es nicht ein kleines bisschen erbärmlich? Schließlich war er siebenundzwanzig Jahre alt. Geschah das zwangsläufig, wenn man bei seinen Eltern lebte, oder ging es nur ihm so? Das war sicherlich das beste Argument für einen Auszug: Er würde endlich nicht mehr so ein Kind sein. Während seine Eltern abends in den Zimmern unter ihm ihrer täglichen Routine nachgingen, während sie sich, begleitet vom Klopfen der alten Rohre, die Gesichter wuschen oder mit einem dumpfen Geräusch, gefolgt von plötzlicher Stille, die Heizung im Wohnzimmer abdrehten, was präziser als jedes Uhrwerk signalisierte, dass es elf Uhr, halb zwölf, Mitternacht war, erstellte er Listen darüber, was er im kommenden Jahr, und zwar möglichst rasch, in Angriff nehmen müsse: seine Karriere (stagnierend), sein Liebesleben (nichtexistent), seine sexuelle Orientierung (unklar), seine Zukunft (ungewiss). Die vier Punkte auf der Liste waren stets dieselben, wenn sich ihre Prioritäten auch mitunter verschoben. Ebenfalls gleichbleibend war seine Fähigkeit, ihren Status exakt zu bestimmen, gepaart mit seiner völligen Unfähigkeit, Lösungen zu finden.
Am Morgen darauf erwachte er stets voller Tatendrang: Heute würde er ausziehen und seinen Eltern sagen, sie sollten ihn endlich in Ruhe lassen. Aber wenn er nach unten kam, stand dort seine Mutter, machte ihm Frühstück (sein Vater war schon lange zur Arbeit aufgebrochen) und sagte, er solle sich überlegen, wie viele Tage er zum jährlichen Familienurlaub nach St. Barts mitkommen würde, sie wolle die Tickets kaufen. (Seine Eltern zahlten noch immer für seine Urlaubsreisen. Er war nicht so dumm, das seinen Freunden gegenüber zu erwähnen.)
»Ja, Ma«, sagte er dann. Und aß sein Frühstück und ging aus dem Haus, trat hinaus in die Welt, in der ihn niemand kannte und er sein konnte, wer er wollte.
2
Um siebzehn Uhr an jedem Wochentag und um elf Uhr an den Wochenenden stieg JB in die U-Bahn und fuhr zu seinem Atelier in Long Island City. Die wochentägliche Reise war ihm lieber. Er stieg an der Canal Street ein und sah zu, wie der Wagen sich an jeder Station füllte und leerte und eine Mischung unterschiedlicher Völker und Ethnien sich alle zehn Häuserblocks zu neuen provokanten und unwahrscheinlichen Konstellationen zusammensetzte: Polen, Chinesen, Koreaner, Senegalesen; Senegalesen, Dominikaner, Inder, Pakistaner; Pakistaner, Iren, Salvadorianer, Mexikaner; Mexikaner, Sri Lanker, Nigerianer und Tibeter – vereint allein dadurch, dass sie noch nicht lange in Amerika waren und denselben erschöpften Ausdruck auf den Gesichtern trugen, diese Mischung aus Entschlossenheit und Resignation, die man nur bei Immigranten findet.
Manchmal empfand er in diesen Momenten Dankbarkeit für sein eigenes Glück und Sentimentalität dieser Stadt gegenüber. Er gehörte nicht zu denen, die ihre Heimatstadt als ein prächtiges Mosaik feierten, und er machte sich über jene lustig, die es taten. Aber er war beeindruckt – wie hätte er es nicht sein können? – von der Menge kollektiver Arbeit, echter Arbeit, die seine Mitreisenden an diesem Tag zweifellos geleistet hatten. Und dennoch verspürte er angesichts seiner eigenen relativen Trägheit keine Scham, sondern Erleichterung.
Der Einzige, mit dem er je über dieses Gefühl gesprochen hatte, wenn auch nur kursorisch, war der asiatische Henry Young. Sie fuhren gerade nach Long Island City – tatsächlich war Henry derjenige gewesen, der ihm einen Platz im Atelier besorgt hatte –, als ein schmaler, sehniger Chinese die Bahn bestieg; eine orange-rote Plastiktüte hing schwer vom letzten Fingerglied seines rechten Zeigefingers herab, so als verfügte er nicht mehr über die Stärke oder den Willen, sie auf eine entschlossenere Weise zu tragen. Der Mann ließ sich auf die Bank gegenüber von ihnen fallen, schlug die Beine übereinander, schlang die Arme um sich und war im selben Moment eingeschlafen. Henry, den JB seit der Highschool kannte, der wie er selbst ein Stipendium ergattert hatte und dessen Mutter in Chinatown als Näherin arbeitete, hatte JB angesehen und geflüstert: »Dieser Kelch ist an mir vorbeigegangen«, und JB hatte genau gewusst, welche Mischung aus Schuldbewusstsein und Freude er in diesem Moment empfand.
Was er an seinen abendlichen Fahrten noch liebte, war das Licht, die Art und Weise, wie es die Wagen füllte wie etwas Lebendiges, wenn die Bahn über die Brücke ratterte, wie es die Müdigkeit von den Gesichtern seiner Sitznachbarn wusch und sie so zeigte, wie sie gewesen waren, als sie in dieses Land gekommen waren, als sie jung waren und Amerika noch für bezwingbar hielten. Er sah diesem Licht dabei zu, wie es den Bahnwagen wie Sirup füllte, Stirnfalten fortwischte, graue Haare polierte, bis sie golden leuchteten, das aggressive Leuchten billiger Stoffe sanft auf einen feinen Schimmer reduzierte. Und dann trieb die Sonne davon, der Wagen ratterte gleichgültig von ihr fort, und die Welt nahm wieder ihre normalen traurigen Formen und Farben an, die Menschen ihren normalen traurigen Zustand, eine Veränderung, die sich so grob und abrupt vollzog, als wäre sie vom Zauberstab eines Magiers herbeigeführt worden.
Er redete sich gern ein, er sei einer von ihnen, doch er wusste, dass er es nicht war. Manchmal waren Haitianer in der Bahn, und während sein plötzlich geschärftes Gehör den schlürfenden Singsang ihrer Kreolsprache von dem Raunen schied, das ihn umgab, merkte er, dass er in ihre Richtung blickte, dass er die zwei Männer ansah, die runde Gesichter hatten wie sein Vater, oder die beiden Frauen, die weiche Stupsnasen hatten wie seine Mutter. Er hoffte jedes Mal, dass sich ein ganz natürlicher Grund ergäbe, sie anzusprechen – vielleicht würden sie darüber diskutieren, wie sie zu ihrem Ziel kämen, und er könnte sich einschalten und den richtigen Weg weisen –, doch das war nie der Fall. Manchmal ließen sie während ihrer Unterhaltung den Blick über die Sitzbänke schweifen, und er spannte sich an, machte sein Gesicht zum Lächeln bereit, aber sie schienen ihn nie als einen der Ihren zu erkennen.
Was er natürlich auch nicht war. Er wusste selbst, dass er mehr mit dem asiatischen Henry Young, mit Malcolm, mit Willem und sogar mit Jude gemein hatte als mit ihnen. Denn das passierte als Nächstes: Er stieg am Court Square aus und lief die drei Häuserblocks zu der ehemaligen Flaschenfabrik, wo er sich mit drei anderen Künstlern eine Atelierfläche teilte. Hatten echte Haitianer Ateliers? Würden echte