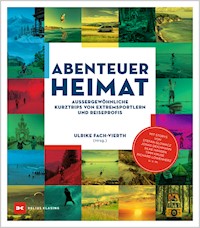
Abenteuer Heimat E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Vor der Tür beginnt das Abenteuer: Urlaub vom Alltag in Deutschland Die Wanderung durch den Wald nebenan, die Radtour über die Felder um die Ecke, der Kurztrip mit dem Auto in die Alpen oder an die Ostsee: Das Mikroabenteuer wartet gleich hinter der Haustür! Bekannte Magaziniker, Reiseblogger und Autoren erzählen von ihren Urlauben zu Hause, von aufregenden Outdoor-Aktivitäten und außergewöhnlichen Kurzabenteuern. Ihre Texte inspirieren zu Reisen, Wochenendtrips und Ausflügen, für die man die Heimat gar nicht verlassen muss. • Inspirierender Reiseführer für Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür • Anregungen für Wanderungen, Radreisen, SUP-Touren und Kurztrips in ganz Deutschland • Insider-Tipps für Freizeitaktivitäten und Wochenendreisen in der Heimat • Ideen für interessante und günstige Kurztrips im Inland • Ein ideales Geschenk für alle Reiselustigen, die ihre Heimat neu entdecken wollen Einfach raus! Praktische Tipps und ungewöhnliche Ideen für Mikroabenteuer und Auszeit Das Gute liegt oft so nah: Statt langer und umständlicher Anreise beginnt der Urlaub schon beim ersten Schritt aus der Tür. Neben Geschichten und Texten über die größten kleinen Abenteuer finden Sie in diesem besonderen Reisebuch auch spannende Insidertipps für jede Tour, die sich hervorragend zum selbst Ausprobieren eignen!. Ob Jahresurlaub, Wochenendreise oder Tagesausflug, ob zu Fuß, mit dem Rad, SUP, Boot, Auto oder Van – hier findet jeder einmalige Inspiration für seine nächste kleine Flucht aus dem Alltag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NACH EINER IDEE VON TIMM KRUSE
ABENTEUERHEIMAT
AUSSERGEWÖHNLICHE KURZTRIPS VON EXTREMSPORTLERN UND REISEPROFIS
ULRIKE FACH-VIERTH(Hrsg.)
Inhalt
Vorwort
von Ulrike Fach-Vierth
Sarah Bauer
Von lila Kühen, erschossenen Höhlen und einer Nacht am Strand
Martin Röhrig im Gespäch mit Ulrike Fach-Vierth
Eine Liebe auf vier Rädern – Vom Abenteuer Leidenschaft
Gunnar Fehlau
Trilogie mit Schlafsack – Mit dem Rad entlang der A7
Philipp Jordan
In einer klaren Nacht
Beate Egger im Gespäch mit Ulrike Fach-Vierth
Vom Glück der kleinen Dinge
Timm Kruse
Morgenstunds Geheimnis
Stefan Glowacz im Gespäch mit Ulrike Fach-Vierth
Erspüre deine Sehnsucht – Warum wir Träume wahr werden lassen sollten
Silke Hansen
Die Nacht im Sturm
Jonas Deichmann im Gespäch mit Ulrike Fach-Vierth
Eine Reise ins Ungewisse – Wenn keine Zeit für Zweifel bleibt
Richard Löwenherz
Über das Eis in eine andere Welt
Die Abenteurer
Egal, ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, mit dem Fahrrad, dem Bulli oder auf dem SUP – die eigene Heimat bietet viele Möglichkeiten für außergewöhnliche und abenteuerliche Trips!
Vorwort
»Ein außergewöhnliches, erregendes Erlebnis«, lautet die Definition von »Abenteuer« im Duden. Eine gefahrvolle Situation, die jemand zu bestehen hat. Wir erleben Abenteuer, suchen sie, lassen uns auf sie ein oder stürzen uns in sie hinein. Diese Verben stehen laut Duden in einer typischen Verbindung zu dem Begriff Abenteuer. Auch ein paar Adjektive: groß, verrückt, spannend und neu.
Die Lust auf Neues war eines der bedeutendsten Forschungsthemen des im August 2022 verstorbenen Neurologen Irving Biederman. Woher rührt diese Lust? Und wie wirkt das Neue auf uns? Zu diesen Fragen hat Biederman an der Universität von Südkalifornien in Los Angeles zahlreiche Studien durchgeführt und ist bei seiner Arbeit auf ein bahnbrechendes Ergebnis gestoßen: Wir haben einen angeborenen Hunger nach Neuem, weshalb unser Gehirn nach noch unbekannten Sinneseindrücken giert und uns mit einer Art Drogenrausch belohnt, wenn wir etwas Neues anschauen, hören oder fühlen. So werden jedes Mal, wenn unser Gehirn zum ersten Mal ein neues Bild sieht oder ein unbekanntes Geräusch hört, zahlreiche Verbindungen zwischen Nervenzellen aktiv und neue Verschaltungsmuster gebildet. Gleichzeitig kommt es zu einer verstärkten Ausschüttung von Endorphinen, körpereigenen Opiaten, die ein Hochgefühl auslösen.
Diesen Kick gibt es jedoch nur bei brandneuen Sinneseindrücken, wie der amerikanische Wissenschaftler in einem Experiment eindrucksvoll zeigen konnte. Dabei präsentierte er Probanden eine Abfolge von Bildern und beobachtete währenddessen ihre Gehirnaktivität in einem Magnetresonanztomografen (MRT). Tauchte ein Bild auf dem Bildschirm zum ersten Mal auf, wurden weite Teile des Gehirns gleichzeitig aktiv. Doch schon beim zweiten Mal war die Reaktion auf das gleiche Bild deutlich schwächer und ließ mit jeder weiteren Wiederholung ein Stückchen mehr nach. Jedes Mal also, wenn wir eine Stadt besichtigen, die wir nicht kennen, an einen Strand fahren, an dem wir zuvor noch nicht gewesen sind, oder auch nur in einem Restaurant speisen, in dem wir noch nie etwas gegessen haben, verjüngen wir unser Gehirn und füllen zugleich unsere Glücksdepots wieder auf. Biedermans Forscherfazit lautete: »Indem wir uns mit der leidenschaftlichen Lust auf Neues durch die Welt bewegen, fördern wir die Flexibilität des Gehirns und gewinnen innere Balance. Und dazu bedarf es manchmal nur eines Sonntagsausflugs.«
Ich bin vor einigen Jahren während meiner Recherche zu dem Thema Neugierde auf die Erkenntnisse des Neurologen gestoßen. Damals sollte ich für das Gesundheitsmagazin Good Health eine Geschichte mit dem Titel Lust auf Neues schreiben, und Biedermans neurologische Erklärung für diese Lust hat mich nachhaltig beeindruckt. So waren es auch meine Gedanken an seine Forschung, die mich schließlich dazu bewogen haben, an dem Buchprojekt Abenteuer Heimat mitzuwirken. Ich bin nämlich keine Abenteurerin im klassischen Sinne und fragte mich deshalb zunächst, was das Thema eigentlich mit mir zu tun hätte. Meine Heimatstadt Hamburg habe ich nie länger als für einen Urlaub verlassen, ich arbeite seit 30 Jahren als Redakteurin für denselben Hamburger Zeitschriftenverlag und habe grundsätzlich nur auf der Skipiste meine Schwünge vollzogen, obwohl ich über das fahrerische Können verfügte, das in viel aufregenderem, nicht präpariertem Gelände abverlangt wird. Auf gefahrvolle Situationen, die es zu bestehen gilt, konnte ich also immer gut verzichten. Das Außergewöhnliche, das Neue, hat mich hingegen zu allen Zeiten interessiert, manchmal nur kleine Momente jenseits der Routine. Mal ein neues Kochrezept, mal ein Spaziergang durch einen Hamburger Stadtteil, der mir nicht so vertraut ist, oder tatsächlich ein Sonntagsausflug, bei dem ich mit meinem Hund einen mir bis dahin fremden Park besuche. Und dabei andere Menschen sehe, andere Hunde, andere Bäume.
»Indem wir uns mit der leidenschaftlichen Lust auf Neues durch die Welt bewegen, fördern wir die Flexibilität des Gehirns und gewinnen innere Balance. Und dazu bedarf es manchmal nur eines Sonntagsausflugs.«
Das sind die besagten Abenteuer vor der Haustür oder eben sogar in der eigenen Küche, die mich tatsächlich mit großer Freude erfüllen und die mir dabei besonders im Gedächtnis bleiben. Auch hierfür gibt es eine Erklärung aus der Hirnforschung: Unser Gehirn speichert nämlich alles, was neu ist, viel besser ab, packt jedes noch so kleine Abenteuer in die Schatzkiste ganz besonderer Erinnerungen. Einfach, weil es eben bei neuen Sinneseindrücken hellwach ist und hochaktiv. Ganz gleich, ob wir etwas Neues anschauen, hören oder fühlen. Und diese auch mir angeborene Lust auf Neues ist der Grund dafür, warum das Thema »Abenteuer Heimat« dann doch eine Menge mit mir zu tun hat. Denn dabei geht es um genau diese kleinen Fluchten, um den Urlaub vom Alltag. Und das Mikroabenteuer kann an jeder Ecke auf uns warten, bei einem Ausflug oder einem Wochenendtrip begleitet es uns sowieso. Dafür müssen wir unsere Heimat nicht verlassen, dafür langt es meist schon, die Perspektive zu wechseln sowie den Blick auf Neues einzuüben. Und die Freude daran zu feiern. Abenteuer sind keine Frage der Größe, sondern eine Frage der Wahrnehmung und der Haltung.
Das haben auch wahrhaftige Abenteurer, Grenzgänger und Entdecker erlebt, wagemutige Frauen und Männer, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe oder die hier eigene Texte über ihre persönlichen Heimat-Abenteuer veröffentlichen. Egal, ob sie bekannte Extremsportler, Autoren, Reiseblogger oder Magaziniker sind, ob sie mit dem Fahrrad, dem SUP oder zu Fuß unterwegs waren, zu zweit oder allein, im Gebirge, auf der Autobahn oder am Meer – sie alle berichten von unvorhergesehenen Momenten, durch die jede vermeintlich unspektakuläre Unternehmung zu einem Abenteuer wird. So macht doch das Unvorhergesehene das Neue aus. Das kann eine Begegnung sein, eine rettende Idee, eine helfende Hand oder einfach Glück im Unglück. Das kann ein neuer Blick auf Altbekanntes sein, eine überraschende Erfahrung mit der Natur oder auch nur mit den eigenen Kräften. Was es auch immer gewesen sein mag, was die Heimat für die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Buches zu einem Abenteuer gemacht hat, es geschah unerwartet, sorgte für Spannung, entzündete Freude und bleibt wahrscheinlich für immer unvergessen. Wie auch uns die zehn hier zusammengestellten Geschichten wohlmöglich nicht so schnell wieder aus dem Kopf gehen werden. Denn dafür sind sie einfach zu abenteuerlich.
Endlich der Blick auf Schloss Neuschwanstein im Sonnenaufgang, nachdem die Begegnung mit der Kuhherde überwunden ist.
Von lila Kühen, erschossenen Höhlen und einer Nacht am Strand
Sarah Bauer
Es ist kurz nach 4 Uhr morgens, als ich mit meiner Kamera in der Hand eine dunkle, nasse Wiese hinaufschleiche. Rechts und links von mir liegen große, braune Fellhaufen in der Dämmerung. Kühe. Dezent verwundert, was Mensch um diese infernalische Uhrzeit hier will. Ich bin Mensch, und ich will das Schloss Neuschwanstein im Sonnenaufgang fotografieren. Noch während ich mich über das laute Scheppern einer Kuhglocke direkt neben mir erschrecke und mich beunruhigt frage, ob Kühe wirklich nur Gras oder vielleicht doch Fleisch fressen – besonders um kurz nach vier –, rutsche ich beinahe auf einem noch warmen Fladen auf dem Boden aus. Große Kacke.
Das ist auch der Begriff, mit dem sich das Jahr 2020 ziemlich gut beschreiben lässt. Ein Jahr, das wirklich nichts ausgelassen hat und am besten verboten oder wenigstens mit einer Unvergnügungssteuer belegt werden sollte. Dennoch hat mich genau dieses Jahr auf eine große und wundersame Reise durch Deutschland geführt. 4.000 Kilometer und einen Monat lang bin ich allein unterwegs. Von meiner Hood – den Ruhrgebietshalden – in die Alpen und von einer Sommernacht in Dresden zur Strandnacht auf Rügen.
Nicht, dass irgendetwas davon geplant gewesen wäre. Eigentlich würde ich nämlich jetzt mit meinem Partner, der Amerikaner ist und in den Vereinigten Staaten lebt, auf seiner Terrasse im nördlichen US-Bundesstaat Wyoming sitzen und heißen Kakao mit Marshmallows trinken. Doch die Grenzen sind dicht wegen der internationalen Reisebeschränkungen durch Corona. Familienangehörige und Partner fallen meist in die Kategorie »nicht essenzieller Tourismus« und sind damit von der Einreise ausgeschlossen.
Ich habe meinen Lebensgefährten nun schon vier Monate lang nicht sehen dürfen und drehe fast am Schlappen. Und weil meine Auftragslage als freiberufliche Texterin mit Schwerpunkt in der Tourismusbranche gerade überschaubarer ist als das Angebot von Klopapier bei Aldi, beschließe ich, die freie Zeit mit dem zu verbringen, was seit dem ersten Lockdown total en vogue geworden ist: Entdecke deine Heimat neu.
Nach drei Tagen Dauerregen in Bayern – Erinnerungen an schauerliche Sommerferien als Kind am Chiemsee kochen hoch – zeigt sich endlich das Sonnenmoppet am Himmel. Aber nur der frühe Vogel fängt das morgendliche Alpenglühen am Schloss Neuschwanstein, das etwa eine Stunde Fahrtzeit von meiner äußerst bayrischen Unterkunft mit den roten Geranien in den hölzernen Balkonkästen entfernt liegt. Deswegen habe ich mir für 3 Uhr nachts einen sanften Simon-&-Garfunkel-Weckton auf meinem Handy eingestellt. The Sound of Silence. Als der Wecker losdudelt, fliege ich trotzdem fast aus dem Bett.
Memo an andere Reisende: Mitte Juni ist die dämlichste Zeit, um Sonnenaufgänge zu fotografieren, denn dann geht das Mistding schon um kurz nach Mitternacht auf. Wenigstens ist es im Sommer warm. Denke ich.
Draußen liegt eisiger Nebel über den noch farblosen Tälern. Ich gehe noch einmal rein, um meine Winterjacke zu holen. Dann tuckere ich los. Gestern Nachmittag habe ich extra von Weitem einen Fotospot an einem Berghang ausgespäht, von dem aus man das Schloss und die dahinterliegende Bergkulisse perfekt sehen kann.
Dort angekommen, ist es überraschenderweise viel dunkler als gestern Nachmittag. Ich quetsche mich durch ein Drehkreuz und folge in der Finsternis einem Wanderpfad, der mitten durch eine offene Kuhweide führt. Dann muht es neben mir. Laut, tief und irgendwo im Gebüsch. Wenn in Dortmund ein Motorrad mit 80 Sachen an mir vorbeiknattert, drehe ich mich nicht einmal um, aber wenn hier draußen in der Dämmerung eine Kuh muht, mache ich mir fast in die Hose. Das ist doch albern. An einer Hecke liegen fünf weitere Kühe. Ihre Glocken klingen hohl und warm in der kühlen Morgenluft. Ich überlege, die Taschenlampe einzuschalten, um zu sehen, ob sie lila sind. Stadtmenschen machen so was. Dann gehe ich schnell weiter, weil es wieder muht. Entdecke deine Heimat neu.
Ich stapfe unbeirrt weiter, manövriere um die im fahlen Licht des neuen Tages glitschig schimmernden Kuhfladen auf der Weide herum und komme schließlich etwas verschwitzt oben am Hang bei meinem anvisierten Fotospot heraus. Natürlich ist noch keine Spur vom Sonnenaufgang zu sehen. Wer auf keinen Fall zu spät sein will, ist meist auf jeden Fall zu früh.
Weil mir von der Kuh-Flucht so heiß ist und das hohe Gras um mich herum nass vom Tau ist, ziehe ich meine Winterjacke aus und setze mich auf den Stoff.
Dann lausche ich dem Wind, der durch die grauen Gräser mit den geschlossenen Blütenkelchen streift. Als wäre es ein magischer Zauber, der gemeinsam mit den ersten Sonnenstrahlen die Natur und die Farben aus dem Schlaf holt. Vögel zwitschern in den schwarzen Tannen, fliegen auf und hinterlassen die weich aussehenden Zweige mit den spitzen Nadeln schwingend. Ein violettes Silber überschreibt langsam den dunkelblauen Himmel und wischt die Sterne aus wie Buchstaben auf einer Tafel. Das Schloss und die mächtigen, zerklüfteten Bergkämme im Hintergrund lösen sich aus dem Schatten der Nacht. Ganz langsam beginnen die Kanten der Gipfel zu glühen. Wie der Rand eines Papiers, an das jemand ein Feuerzeug hält. Und so plötzlich, wie das leichte Glimmen am Papier in eine lodernde Flamme umschlägt, so gewaltig ergießt sich pinkes Licht über Felsspitzen und Schneereste.
Einfach mal loslassen und etwas machen, das man noch nie gemacht hat.
Ich stehe auf und schieße Fotos wie ein Japaner. Außer, dass ausgerechnet in diesem Moment, in diesem Jahr, kein einziger Japaner am Schloss Neuschwanstein sein wird. Wegen Corona und der weltweiten Reisebeschränkungen. Doch während sich das Glühen von strahlendem Pink in leuchtendes Orange verwandelt und das Licht so unaufhaltsam wie Lava von den Berggipfeln ins Tal strömt, denke ich an tausend Dinge, nur nicht an Corona.
Unsere Welt ist unfassbar schön, und sie dreht sich, egal, was mit uns Menschen ist. Jeden Tag geht die Sonne auf. Manchmal so wie heute, pink und orange, wie ein Feuerwerk, das nicht am Abschluss, sondern am Beginn eines großartigen Tages steht. Manchmal hinter Wolken oder versteckt zwischen Regen und Schnee. Ob ich ihn fotografiere – einen von Millionen Sonnenaufgängen, den die Erde schon gesehen hat – oder nicht, ist im Grunde unbedeutend. Ein Gedanke, der erschreckend sein kann, aber auch unheimlich befreiend. Wenn wir nur ein winziger Flügelschlag im großen Geschehen sind, dann können wir auch einfach losfliegen.
Stundenlanger Starkregen beim Aufstieg zur Schellenberger Eishöhle mit eisigen Temperaturen.
Im Eingang zur Schellenberger Eishöhle liegt Schnee, die Pfade sind schmal, und im Inneren schwindet das Licht schnell.
Nach der Ankunft ein wohlverdientes kurzes Aufwärmen in der Toni-Lenz-Hütte mit Filzdecke und Kakao mit »Schuss«.
Zur Sicherheit in der Eishöhle tragen alle Besucher einen Helm – das sieht gleich ziemlich professionell aus!
Fast so hoch wie fliegen fühlt sich der nächste Ausflug auf meinem Roadtrip an. Ich bin von der Gegend um Schloss Neuschwanstein nach Marktschellenberg im Südosten des Landes weitergereist, von wo aus ich den Aufstieg zur Schellenberger Eishöhle wagen will. Der einzigen erschlossenen Eishöhle in Deutschland. Zuerst lese ich „erschossen“ und frage mich, was da oben wohl abgeht. Da denkt man immer, in der Schule lernt man nichts, und dann erscheint die Fähigkeit, richtig lesen zu können, doch nicht ganz unerheblich. Nachdem ich meine Sorge über wilde Schießereien durch nochmaliges, eingehendes Studieren der Website beseitigt habe, informiere ich mich über den Rest: Die Höhle liegt im Untersberg auf 1.570 Metern Höhe. Die Wanderung über die Toni-Lenz-Hütte dauert rund drei Stunden, und man überwindet dabei 1.000 Höhenmeter. Da haben mich meine Eltern mal als Kind hochgeschleift, also wird das ja wohl zu machen sein.
Ich sitze in prasselndem Starkregen im Auto auf dem Wanderparkplatz. Vielleicht nicht der ideale Tag für 1.000 Höhenmeter und eine Eishöhle. Allerdings hat es auch an den Tagen davor geschüttet, was sich laut Wetterfrosch in den kommenden Äonen nicht ändern wird. Also entweder jetzt trotzdem oder einfach nie. Ich hülle mich in meine Regenjacke und Regenhose, packe meinen Rucksack in einen Regenschutz und stecke mir ein Regenbutterbrot ein. Kann losgehen. Frohgemut stampfe ich los. Weil ich so schnell und enthusiastisch gehe – unter anderem, weil es nicht nur nass, sondern auch saumäßig kalt ist – bin ich relativ schnell aus der Puste. Zum Glück sehe ich ebenfalls relativ schnell ein kleines Schild. »100 Meter«. Boah, 100 Höhenmeter habe ich schon gemacht. Nur noch 900 to go. Ha, das ist ja fast nichts! Da ist das Glas nicht nur halb voll, sondern schäumt geradezu über vor Optimismus.
Als ich nach einer längeren Weile endlich das 200-Meter-Schild sehe, kann ich meine laufende Nase nicht mehr vom rinnenden Regen auf meinem Gesicht unterscheiden, und als ich bei 400 Metern ankomme, mein Gesicht nicht mehr von einem Eisklotz. Müsste diese bescheuerte Eishöhle nicht viel tiefer liegen bei der enormen Kälte an diesem verdammten Berg? Je höher ich steige, desto stärker kübelt es. Normalerweise hätte man wahrscheinlich einen tollen Ausblick. Ich bin froh, wenn ich im Nebel die nächste Serpentine ausmachen kann.
Meine Knie rufen nach einer Prothese, und meine Regenjacke scheint nicht ganz dicht zu sein. Jedenfalls ist sie auch von innen feucht. Bei 600 Höhenmetern setze ich mich auf einen nassen Stein mit nassem Moos und packe mein Regenbutterbrot aus. Das ist der Moment, in dem mir bewusst wird, dass es in meiner Jacke nicht geregnet hat, sondern dass ich schwitze wie ein Iltis. Wie habe ich diese Tour damals als Kind bloß überlebt? Hatte ich irgendwelche übernatürlichen Kräfte, die man verliert, sobald man erwachsen wird? Ich blicke in die weißen Wolken vor meinen Augen, die kaum den Blick auf die gegenüberliegende Felswand zulassen. Jeder wäre gern auf Wolke sieben, aber niemand sagt einem, wie sehr es da schüttet …
Nach fast 900 Höhenmetern tauchen schemenhaft die Umrisse einer Holzhütte auf. Ich gehe am Stock. Wenn das nicht die lang ersehnte Toni-Lenz-Hütte ist, wenn sie nicht geöffnet hat oder wenn es da drinnen keine Heizung gibt, werfe ich mich den Abhang runter. Die Hütte ist echt, sie hat geöffnet, und sie hat eine Heizung. Sie hat sogar eine Extra-Heizung für die nassen Klamotten verrückter Wanderer. Neben mir sind noch fünf andere Irre hier oben. Ich schäle mich aus meinen triefenden Schichten und wickele mich in eine rote Filzdecke, die auf einer Bank ausliegt. Dann bestelle ich einen Kakao.
Die Hüttenwirtin fragt mich etwas Unverständliches und ich nicke und grinse. Bayrisch verstehe ich schon nicht bei Sonnenschein im Tal und erst recht nicht in endzeitlicher Sintflut bei gleichzeitig hereinbrechender Eiszeit in der Nordwand des K2. Wenige Minuten später halte ich ein heißes Getränk in meinen abgestorbenen Händen. Ich nehme einen tiefen Zug. Heiliger Kuhmist, was ist denn da drin? Rum? Nach einigem Nachdenken und weiteren Zügen reime ich mir zusammen, dass die Frage der Wirtin wohl »mit Schuss?« gewesen sein muss. Die einzige erschossene Eishöhle in Deutschland – ich wusste es doch!
Am liebsten würde ich für immer in der Hütte sitzen bleiben. Doch jetzt sind es nur noch weitere 100 Höhenmeter bis zur Eishöhle. Der rüstige, bärtige Höhlenführer ist auch schon da. »Wer möchte denn gleich mit zur Höhlentour?«, fragt er. Ich und drei weitere junge Frauen heben vorsichtig die Hand. »Na dann. Los geht’s!«
Leicht beschwipst ziehe ich mir meine Iltis-Jacke wieder an, die nur einen semi-zufriedenstellenden Trocknungsgrad erreicht hat. Gemeinsam verlassen wir das Everest-Basecamp und machen uns auf den Weg zum Endgegner. Kurz vor der Höhle reicht uns der Guide Helme. »Zur Sicherheit. Falls was runterfällt.«
Ich ziehe mir die Sicherheitsmontur an und mache ein Selfie. Ich sehe aus wie ein Grubenmännchen. Dann marschieren wir in die Höhle. Schneehaufen liegen im weit offenen Eingangsschlund, in dem der Boden aus bis zu 30 Meter dickem Eis besteht. Im Winter ist die Höhle manchmal komplett eingeschneit.
Über schmale Stufen stiefeln wir entlang von angebrachten Seilen hinab. Wir haben Karbidlampen dabei – das sind Gaslaternen, in denen Calciumcarbid mit Wasser reagiert. Ansonsten ist es in der Höhle ziemlich dunkel. Bislang sind etwa 3,6 Kilometer erforscht und 500 Meter zugänglich. Es gibt keine Laser-Show oder kunstvolle Beleuchtung, wie man es von manchen großen Tropfsteinhöhlen kennt. Doch wenn das helle Licht der Laterne die Wände streift, leuchtet blaues, massives Eis auf. Die Stufen werden immer schmaler, die Eismassen kommen immer näher. Ab und zu sehen wir Gebilde, die aussehen wie riesige Zuckerwürfel oder Mini-Stalagmiten. Auf einmal reißt unser Höhlenführer eine Magnesiumfackel an. Das gleißende Licht erhellt die eisige Finsternis für einen Augenblick wie Flutlicht. In den blauen Wänden leuchten feine Schichten verschiedener Nuancen auf. Weiß, hellgrau, dunkelblau. Ein einziges Glitzern und Funkeln. Bis die Fackel wieder erlischt.
Es ist eine unwirkliche Welt an einem unwirklichen Ort. Es gibt keinen anderen Weg hierher als wandern. Mühe. Regen. Kälte. Knieprothesen. Doch dann ist da dieser Moment, in dem man begreift, was man erreicht hat. Aus eigener Kraft. Weil man es unbedingt wollte und weil man einfach nicht aufgegeben hat. Es ist ein Moment, der alle Schmerzen, Flüche und Regenbutterbrote auf die Ersatzbank der Emotionen verweist. Ist es nicht seltsam, wie klein die großen Entbehrungen, das zwischenzeitliche Scheitern und die inneren Kämpfe im Leben werden, sobald man sie hinter sich lässt? Wie sie auf einmal nur noch ein nichtiger Anhang in einem überschwänglichen Erlebnisbericht sind, der den Betreff enthält: Ich habe es geschafft!
Die Skyline von Dresden an der Elbe – eine Sommernacht mit rar gewordenem Kulturevent.
Viele Sitze sind aufgrund der Abstandsbestimmungen abgesperrt – egal, Hauptsache, mal wieder etwas sehen!
Der Abstieg erscheint auf einmal wie ein Spaziergang. Der Regen hat nachgelassen, und für einige Sekunden sehe ich sogar das Tal durch die Wolken. Winzige Häuser, Straßen wie Bindfäden. Als ich abends erschöpft in meiner Ferienwohnung sitze und auf mein Handy schaue, sehe ich auf Facebook, wie sich jemand über geschlossene Fitnessstudios beschwert. Natürlich hat nicht jeder mal eben einen Berg vor der Haustür oder kann sich ins Auto setzen und zu einem hinfahren – aber es müssen ja auch gar nicht die Alpen und Eishöhlen sein, die einen in Bewegung bringen. Dieser Tag hat mir gezeigt, was alles dort draußen und was alles körperlich und mental möglich ist, wenn wir nur mal die Füße in die Hand nehmen, die Tür aufmachen und loslaufen.
Von Bayern aus zieht es mich in den Osten Deutschlands. Einerseits weil ich mir noch nie die Zeit genommen habe, mir das malerische Elbsandsteingebirge näher anzusehen, andererseits aufgrund einer sehr persönlichen Verbindung nach Dresden. Dort habe ich nämlich einen Brieffreund. Dominic. Schon seit über zehn Jahren. Klingt schrullig, aber so etwas gibt’s echt noch. Gesehen haben wir uns erst einmal. Doch das macht nichts. Es gibt diese Menschen, mit denen man manchmal ganz lange nicht spricht und die man nur ganz selten sieht, aber wenn einer den Faden wieder aufnimmt, ist es, als wäre es gestern gewesen. Und was ist ein besserer Faden als ein fetter Roadtrip durch Deutschland? Also schreibe ich Dominic eine Nachricht, dass ich mal wieder eine verrückte Reiseidee habe. Nicht Aruba, nicht Japan, sondern Dresden. Er macht die Gästeschlafstätte fertig und freut sich. So einfach kann es gehen.
Es ist heiß und schwül, als ich von einer scheinbar unendlichen Fahrt vom südlichen Zipfel der Republik in Dresden ankomme. Unterwegs habe ich etwas Raststättenromantik genossen. Wie früher. An einem ungemütlichen Steintisch sitzend, während eine Armada von Wespen den Mülleimer umkreist und der Krach vorbeischießender Lastwagen wie Hunderte Raketenstarts in Cape Canaveral klingt.
Dominic hat etwas ganz Besonderes vor. Er hat Tickets für die Filmnächte am Elbufer besorgt. Klingt jetzt erst einmal nicht nach einer noch nie da gewesenen explorativen U-Boot-Fahrt auf den Grund des Marianengrabens, doch im Jahr 2020 fühlt sich eine simple Karte für ein Open-Air-Kino fast genauso an. Wahnsinn, eine Kulturveranstaltung, ich raste aus!
Es ist immer noch so heiß wie in der Wüste Gobi, als wir im Abendlicht am Elbufer längs laufen, während die künstliche Illumination der Skyline am gegenüberliegenden Ufer stetig heller wird.
Passend zu unserem gemeinsamen Musik- und Filmgeschmack läuft heute Abend bei den Filmnächten das biografische Drama Bohemian Rhapsody, das das Leben Freddie Mercurys von Queen nachzeichnet.
Ich umschiffe ein paar abgesperrte Sitze – mind the gap between you und dem verseuchten Zuschauer-Nachbarn –, und dann sitzen wir tatsächlich auf unseren Plätzen mit Panoramablick auf die riesige Leinwand und die inzwischen hell erleuchtete Frauenkirche am anderen Ufer. Alles scheint wie ein Sommernachtstraum. Menschen spazieren mit Bierbechern hin und her und lachen. Irgendwo spielt leise Musik, und es riecht nach Bratwurst. All das war bis vor Kurzem nichts Ungewöhnliches. Dann kam der Lockdown. Wie oft wir auf Konzerte und Festivals, über die Kirmes, in die Oper oder ins Stadion gegangen sind, ohne je darüber nachzudenken, dass all das auf einmal nicht mehr möglich sein könnte. Noch nie habe ich einen Kinofilm, den ich zum wiederholten Mal sehe, einen blauen Plastikstuhl und eine blöde Cola für 500 Flocken so sehr genossen wie heute. Dieser dumme Spruch, dass man Dinge erst vermisst, wenn sie nicht mehr da sind – er stimmt.





























