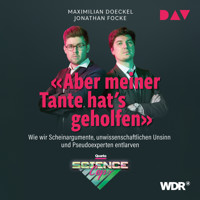14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Wissenschaftsjournalisten und Quarks Science Cops Maximilian Doeckel und Jonathan Focke entlarven in ihrem Buch die schmutzigen Tricks und manipulativen Techniken, mit denen Wundermittelhersteller, selbst erklärte «Heiler» und andere Geschäftemacher versuchen, Profit aus der Gutgläubigkeit der Menschen zu schlagen. Deren Methoden sind nämlich ziemlich perfide und z. B. darauf ausgelegt, emotionale (Not-)Situationen auszunutzen. Die Autoren helfen uns dabei, wissenschaftliche Falschaussagen zu erkennen, zeigen, wie wir Pseudoexpertenvon echten unterscheiden können und aufgeklärter durchs Leben gehen. Nach der Lektüre des Buches wissen wir, wo und wie in Deutschland unwissenschaftlicher Unfug erzählt wird. Ob Medizin, Politik, Ernährung, Parawissenschaften – die Quarks Science Cops ermitteln in jedem Lebensbereich und vermitteln Sachinformationen und konkrete Argumentationshilfen für den nächsten WhatsApp-Familenchat mit einer guten Prise Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Maximilian Doeckel • Jonathan Focke
Aber meiner Tante hat’s geholfen
Wie wir Scheinargumente, unwissenschaftlichen Unsinn und Pseudoexperten entlarven
Über dieses Buch
Deutschland stellt sich gerne als Land der Aufklärung und Wissenschaft dar, doch der Schein trügt: Ignoranz, Unkenntnis und Wissenschaftsablehnung durchziehen alle Gesellschaftsschichten und führen zu Falschinformationen bis hin zur gesellschaftlichen Spaltung. Hier kommen die Quarks Science Cops des WDR ins Spiel: Die Wissenschaftsjournalisten Maximilian Doeckel und Jonathan Focke entlarven in ihrem Buch die schmutzigen Tricks und manipulativen Techniken, mit denen Wundermittelhersteller, selbst erklärte «Heiler» und andere Geschäftemacher versuchen, Profit aus der Gutgläubigkeit der Menschen zu schlagen. Die Autoren helfen uns dabei, wissenschaftliche Falschaussagen zu erkennen, zeigen, wie wir Pseudoexperten von echten unterscheiden können und aufgeklärter durchs Leben gehen. Nach der Lektüre des Buches wissen wir also, wo und wie in Deutschland unwissenschaftlicher Unfug erzählt wird. Neben vielen Sachinformationen und konkreten Argumentationshilfen sorgt eine Prise Humor für eine unterhaltsame Lektüre − denn wer Spaß hat, lernt besser.
Vita
Maximilian Doeckel ist Wissenschaftsjournalist und arbeitete als freier Journalist für verschiedene Sendungen des WDR, vor allem für Wissenschafts- und Unterhaltungsformate. Seit 2017 ist er fest angestellter Redakteur in der Quarks-Redaktion.
Jonathan Focke ist Wissenschaftsjournalist und hat als Redakteur für die Sendung Quarks & Co und die Wissenschaftsredaktion im WDR-Hörfunk gearbeitet. Seit 2016 verantwortet er als Redakteur verschiedene Formate und Angebote im Digitalteam von Quarks.
Beide Autoren sind Hosts des erfolgreichen Podcasts Quarks Science Cops.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Marvin Ruppert
ISBN 978-3-644-02094-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Jasper, Christian, Sucharit, Zara, Jörg, Roland, Carina, Anthony, Marcus, Johann, Rudolf, Palina.
Ohne euch hätte es dieses Buch nie gegeben.
Vorwort
Fast hätte es dieses Buch nie gegeben. Und wenn es dieses Buch nie gegeben hätte, dann würden wir jetzt in unseren prachtvollen neuen Villen sitzen, in der Karibik oder an der Côte d’Azur, mit Blick aufs türkisblaue Meer. Wir würden Champagner trinken, ein paar Bahnen im Pool ziehen und zwischendurch mal checken, ob das schicke neue Motorboot mit dem glänzenden Holzdeck und den weißen Ledersitzen noch fest am Privatsteg vertäut ist. Kurzum: Wir würden uns den lieben langen Tag in unserem Reichtum sonnen. Und das Einzige, was wir dafür hätten tun müssen: das Wissen über die Tricks und Machenschaften, wie man mit pseudowissenschaftlichem Unsinn Menschen über den Tisch zieht und dabei richtig reich wird, nicht in diesem Buch zu sammeln, sondern es selber anzuwenden!
Seit 2020 recherchieren wir für unseren Podcast «Quarks Science Cops», mit welchen Methoden Influencer, Politiker und Unternehmen unwissenschaftlichen Unfug verbreiten. Wie sie mit Scheinargumenten wissenschaftliche Erkenntnisse untergraben und sogar verleugnen oder wie sie andersrum Wissenschaftlichkeit vortäuschen, um ihr «neues», «revolutionäres» Heilmittel unter die Leute zu bringen. Kleine Kapseln, die das Körperfett dahinschmelzen lassen, ohne dass man Sport oder eine Diät machen müsste. Boxen aus Metall, die das Leitungswasser «beleben» und dadurch die Gesundheit fördern, auch die der Haustiere. Oder rein pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel, die einen vor dem sicheren Krebstod bewahren. Alles zum Schnäppchenpreis von wenigen Hundert Euro. Und noch wichtiger: Die Wirkung ist garantiert wissenschaftlich belegt! Durch Studien. Oder von hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bestätigt. Bei genauerem Hingucken stellt sich jedoch heraus, dass das alles völliger Mist ist. Es sind perfide Lügen, um gutgläubige oder verzweifelte Menschen abzuzocken. Wenn wir diese Machenschaften aufdecken und Menschen vor ihnen schützen können, ist das immer ein erhabenes Gefühl – als Verteidiger der Wissenschaft, die Lügen mit Aufklärung schlagen. Na ja, oder so ähnlich.
Doch bei fast jeder Recherche gibt es diese dunklen Stunden, in denen wir uns den Kopf über eine Studie zerbrechen, die der Hersteller des Wundermittels als ultimativen Beweis für die Wirksamkeit seiner neuen Pille anführt. Wir prüfen jede Studie ergebnisoffen, und manchmal sieht die Studie auf den ersten Blick gut gemacht und seriös aus. Ist vielleicht doch etwas dran an der revolutionären Wirkung? Aber da die Versprechen des Herstellers zu gut klingen, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich, dass mit der Studie etwas nicht stimmt. Nur was? Wo verdammt noch mal ist der Haken? Wie wird hier getrickst? Was haben wir übersehen? Irgendwann finden wir den Haken immer. Aber oft grübeln wir quälend lang darüber und fühlen uns am Ende, als hätte unser Hirn längere Zeit in einem Kochtopf verbracht. Es sind diese Momente, in denen wir uns fragen: Warum tun wir uns das eigentlich an? Die ganze harte Recherchearbeit, nur um am Ende festzustellen, dass diese Leute ihre Produkte ja trotzdem weiter verkaufen? Es reicht schließlich ein Blick auf Instagram, um zu sehen, dass sich das Geschäft mit unwissenschaftlichem Unfug offenbar lohnt. Denn da protzen die Pillenproduzenten mit ihren Traumreisen nach Bali und Südafrika oder mit ihren Schlössern auf dem Land, während wir in unserem kargen, den Charme eines Finanzamts versprühenden WDR-Büro hocken und im kalten Licht der Neonröhren stapelweise wissenschaftliche Studien wälzen. Wir geben es offen zu: In diesen Momenten ist die Versuchung groß, einfach die Seiten zu wechseln. Karibik, Côte d’Azur, türkisblaues Meer …
Und es wäre so einfach! Nach vielen Jahren intensiver Recherche zu den Praktiken wissenschaftlicher Scharlatane kennen wir mittlerweile auch den letzten Kniff und die verwegenste Strategie, um ein völlig wirkungsloses Produkt mit derart viel wissenschaftlichem Glanz zu versehen, dass potenzielle Kunden Wetten darauf abschließen würden, dass dieses Wundermittel innerhalb von höchstens drei Jahren mit einem Nobelpreis bedacht wird.
Ein konkretes Produkt, das wir innerhalb kurzer Zeit auf den Markt bringen könnten, haben wir uns sogar schon ausgedacht. Selbstverständlich verraten wir hier keine Details. Man weiß ja nie. Nur so viel: Produktionskosten nahe null, Wirksamkeit garantiert null. Das Konzept ist mehr oder weniger fertig. Wir müssten nur noch produzieren. Und dann warten, bis die satten Gewinne unsere Konten füllen. Schöner Nebeneffekt: Sich ein pseudowissenschaftliches Produkt auszudenken, macht richtig Spaß!
Aber mal Spaß beiseite: Am Ende hat bislang immer unser Gewissen gesiegt. Weil es uns dann doch näherliegt, Menschen über die betrügerischen Strategien und Argumentationsmuster von pseudowissenschaftlichen Abzockern aufzuklären, als selbst zu solchen skrupellosen Geschäftemachern zu werden. Das Sportmotorboot mit den weißen Ledersitzen an der Côte d’Azur wird wohl erst mal warten müssen – aber die vielen positiven Rückmeldungen unserer Podcasthörerinnen und -hörer entschädigen uns.
Bevor es nun gleich richtig losgeht, möchten wir euch noch zwei Dinge erklären. Erstens: Ihr werdet in diesem Buch immer wieder Fußnoten finden, in denen wir den eigentlichen Text zusätzlich kommentieren. Wenn ihr an einer (halbwegs) sachlichen Abhandlung interessiert seid, dann empfehlen wir euch, diese Fußnoten zu ignorieren. Wenn ihr aber vor Abschweifungen, flachen Witzchen und zynischen Kommentaren nicht zurückschreckt oder sie sogar zu schätzen wisst, dann lest die Fußnoten gerne mit.[1] Manchmal ist das Ganze nämlich nur mit Galgenhumor zu ertragen.
Zweitens: Ihr werdet in diesem Buch vereinzelt Geschichten finden, die aus der Ich-Perspektive geschrieben sind. Es handelt sich hierbei nicht um wahre Geschichten, sondern um eine wilde Mixtur aus persönlichen Erlebnissen, Gesprächen und bekannten Argumentationsmustern, die uns zwar nicht genau so passiert sind. Aber sowohl uns als euch jederzeit passieren könnten. Und mit einer davon fangen wir jetzt an.
Der Fall Rheinkiesel
Es ist ein warmer Abend im Sommer, und ich bin auf dem Weg zu einer Grillparty. Okay, Party ist etwas zu viel gesagt, es ist eher ein nettes Zusammensein im Garten eines Freundes. Es gibt was zu essen, Getränke, es wird gequatscht und gelacht. Obwohl ich die meisten der eingeladenen Gäste nur oberflächlich kenne, denke ich vorher, dass das bestimmt ein schöner Abend wird.
Ich bin noch keine halbe Stunde da, da kommt Gastgeber Markus auf mich zu, verdreht etwas die Augen und sagt: «Pass auf, Philipp wollte gleich auch noch kommen und mit dir über die Quarks Science Cops sprechen. Er hat da irgendeine Idee, die er dir erzählen will.»
Warum nicht?, denke ich. Klar, das hier ist privat – aber ich freue mich immer, wenn sich jemand für unseren Podcast interessiert.
Später am Abend kommt Philipp dann tatsächlich auf mich zu. Er wartet ab, bis der Platz neben mir auf der Bierbank leer ist und lässt sich hinplumpsen.
Seine Gesprächseröffnung ist zwar aufgrund der starken Alkoholfahne olfaktorisch anspruchsvoll, inhaltlich aber durchaus schmeichelhaft.
«Mein Lieblings-Science-Cop», sagt er und klopft mir dabei kurz auf die Schulter.
«Hi», antworte ich und grinse ihn an, «cool, dass du die Quarks Science Cops hörst!»
«Na ja, nicht alle Folgen. Ich höre das im Auto und auch nur die Folgen, die mich interessieren. Oft sind mir die Themen zu eindeutig. Da weiß man ja sofort, dass das ausgemachter Blödsinn ist, und ihr redet trotzdem ’ne Stunde darüber. Ich höre, wenn überhaupt, auf doppelter Geschwindigkeit. Sonst seid ihr mir echt zu langatmig.»
Okay, denke ich mir. Das ist schon weniger schmeichelhaft. Aber fair enough, für Kritik bin ich offen.
«Da hast du dann vielleicht einfach ein sehr gutes Gespür. Nicht jeder sieht sofort, ob an einem Thema was dran ist oder nicht. Außerdem wollen wir ja nicht nur sagen, dass etwas unwissenschaftlicher Unsinn ist, sondern auch, warum! Und dafür müssen wir zum Teil etwas ausholen: Wenn ich zum Beispiel erkläre, warum ein Epigenetik-Coaching aller Wahrscheinlichkeit nach rausgeworfenes Geld ist, dann reicht es aus unserer Sicht nicht, die Hörerinnen und Hörer vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu sagen: ‹Das ist Unsinn, gebt euer Geld nicht dafür aus.› Vielmehr wollen wir erklären, warum es Unsinn ist und wo die Probleme liegen. Und dafür muss ich erklären, was Epigenetik ist und was man heute gesichert darüber weiß – nur dann kann man ja wirklich verstehen, ob, und wenn ja, wo Unsinn erzählt wird.»
Meine Worte scheinen nicht besonders überzeugend zu sein, Philipp quittiert sie lediglich mit einem Schulterzucken. Offenbar ist das für ihn eh nur Nebensache, und er wittert die Chance, über sein eigentliches Anliegen zu sprechen.
«Besonders gefallen mir die Folgen, in denen ihr darüber sprecht, wie Menschen überzeugt werden können, die pseudowissenschaftlichen Produkte zu kaufen. Da kann man wirklich superviel bei lernen»[2], fährt er lobend fort, «ich habe mir mit einem Kumpel sogar schon ein eigenes Produkt ausgedacht.»
«Ahh, sehr gut», sage ich und lache, «wir auch. Bei unserer Show in Frankfurt haben wir sogar ein Coaching angeboten, wie man selbst zum Verkäufer von unwissenschaftlichem Unfug wird.»
«Echt?», fragt er sichtlich interessiert nach. «Schade, dass ich da nicht dabei sein konnte.»[3]
«Absolut!», sage ich und bin jetzt voll in meinem Element. «Erzähl mal, was du dir ausgedacht hast.»
Philipp lässt sich nicht lange bitten und legt los.
«Kieselsteine», sagt er, «aber nicht irgendwelche Kieselsteine, sondern besondere Rheinuferkieselsteine. Über Jahrzehnte lagen diese Steine am und im Wasser des Rheins und wurden von den wirbelnden Uferströmungen mit positiver Naturenergie aufgeladen. Wenn du die bei mir kaufst, dann kannst du sie für dein eigenes Wohlbefinden einsetzen. Du kannst sie zum Beispiel in ein Glas Wasser legen. Da geben sie dann die Naturenergie des wilden Flusses wieder ab – und dein Wasser ist dann quasi belebt!»
«Nicht schlecht, das könnte funktionieren», kommentiere ich, und er fährt fort: «Das Beste ist ja, dass ich quasi keine Kosten habe. Ich kann einfach zum Rhein laufen, da die Kiesel einsammeln und sie dann im Internet über einen Onlineshop verkaufen. Vielleicht dichte ich den verschiedenen Farben und Formen noch bestimmte Wirkungen an. Das zieht bestimmt!»
«Kann ich mir leider auch gut vorstellen. Der Markt wäre bestimmt da.»
«Ja, eben. Und dann packe ich den Firmensitz in die Schweiz, und man kriegt nicht mal raus, dass ich dahinterstecke.»
Es ist dieser Moment, in dem mir das erste Mal ein leiser Verdacht kommt,[4] der sich keine zehn Sekunden später bestätigt, als Philipp in seine Tasche greift, sein Handy herausfischt, kurz darauf tippt und es mir dann unter die Nase hält. Auf dem Bildschirm sehe ich das unfertige Gerippe eines Onlineshops. Ein paar Reiter sind schon angelegt: «Produkte», «Impressum», «Zahlweise» – und dazwischen immer wieder ein paar Platzhalterbilder.
«Die Seite hat ein Kumpel von mir angelegt, der kennt sich gut mit so IT-Zeug aus. Ich muss jetzt eigentlich nur noch ein paar Produktbilder machen, und dann geht’s los.»
«Aha.»
«Gut, okay. Die Firma muss ich auch noch anmelden, klar. Aber das geht ja schnell.»
«…»
«Dann nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und lege Werbung drauf. Man muss halt auch ein bisschen was investieren, wenn man Geld verdienen möchte.»
Mir wird immer klarer: Das hier ist kein lockerer Witz. Der meint das ernst.
«Und wenn ich Geld übrig habe, kaufe ich noch positive Bewertungen. Ein paar kann ich auch einfach selbst schreiben. Aber es soll ja überzeugend wirken. Da müssen es schon über hundert sein. Macht heutzutage eh jede Firma so.»
«Zumindest die Firmen mit fragwürdigen Geschäftspraktiken …», entgegne ich und unterbreche ihn dadurch in seinem Redefluss. Er stoppt und schaut mich fragend an.
«Willst du das echt machen?», frage ich ihn, mich innerlich daran klammernd, dass alles vielleicht doch nur ein Scherz war.
«Klar», sagt er, «warum nicht?»
«Weil das, keine Ahnung, echt daneben wäre?!»
«Warum?»
«Na ja, weil du die Leute verarschst», sage ich ungläubig.
«Das ist nicht mein Problem. Ich kann ja nichts dafür, dass die Leute so dumm sind und darauf reinfallen. Sie wollen doch so Eso-Scheiß haben, also kriegen sie Eso-Scheiß. Angebot und Nachfrage. Es gibt da draußen ’ne Menge Leute, die solche Produkte verkaufen. Warum sollte ich mir da nicht auch einen Teil vom Kuchen holen?»
Von einer solchen Dreistigkeit überwältigt, dauert es einen Moment, bis ich meine Sprache wiedergefunden habe. Obwohl ich innerlich koche, versuche ich, ruhig zu bleiben.
«Ich glaube nicht, dass die Leute dumm sind … Vielleicht sind sie einfach gerade in emotionalen Extremsituationen und klammern sich dann an jede Hoffnung, so abwegig sie auch erscheinen mag. Oder sie wissen es einfach nicht besser.»
«Dann hätten sie in der Schule besser aufpassen sollen.»
«Hast du in der Schule gelernt, Studien zu lesen und nicht auf manipulative Tricks reinzufallen?»
«Nee.»
«Eben.»
«Aber hätten halt besser in Naturwissenschaften aufpassen können.»
«Ganz viel, über das wir sprechen, ist Stoff der Oberstufe – und längst nicht jeder und jede hat Abi gemacht oder gar studiert.»
«Ist ja nicht mein Problem. Hätten sie mal besser.»
Er hat mich. Es ist vorbei mit der Geduld und Ruhe – und freundlich bin ich auch nicht mehr.
«Ganz im Ernst, ich finde das einfach nur daneben. Das, was du da machen willst, ist einfach nur assi.»
Philipp steht mittlerweile und spricht auch deutlich lauter: «Die Leute sind selber schuld!»
Den Rest der Diskussion erspare ich euch. Selbst, dass andere Gäste in den Streit eingriffen und ihm mangelnde Integrität vorwarfen, war für Philipp kein Grund, von seinem Plan abzurücken. Ob das am Ende nur noch Trotz war? Möglich. Den Webshop habe ich jedenfalls nicht mehr online gefunden. Ob es Philipp am Ende an Lust und Zeit gemangelt hat oder wir ihn doch zum Umdenken gebracht haben, kann ich bis heute nicht sagen.[5]
Über dieses Buch
Warum starten wir unser Buch mit dieser Geschichte? Weil wir gleich zu Beginn eine Sache sehr klarmachen wollen: Dieses Buch dient nicht dazu, sich über Menschen lustig zu machen oder sich in irgendeiner Form über Menschen zu erheben, die auf unwissenschaftlichen Unfug reinfallen.
Falls ihr schon mal bunte Kinesio-Tapes auf eure Schulter geklebt habt, in der Hoffnung, sie würden euch von eurer Verspannung erlösen, wenn ihr schon mal große Vitaminpackungen in der Apotheke gekauft habt, um euer Immunsystem zu boosten, oder wenn ihr gedacht habt, das mit dem Klimawandel, das könne so schlimm nicht sein, immerhin war der Winter wirklich kalt – dann halten wir euch deswegen nicht für dumm. Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder darauf hereinfallen kann, ganz unabhängig von Intelligenz oder Bildungshintergrund – selbst Nobelpreisträger.
Denn die Methoden, mit denen Wundermittelverkäufer, politische Parteien, esoterische Lehrerinnen oder Populisten versuchen, euch von ihrem Produkt, ihrer Weltanschauung oder ihren «alternativen Fakten» zu überzeugen, sind zum Teil perfide und äußerst manipulativ. Da werden wissenschaftliche Erkenntnisse verdreht, selektiv dargestellt oder einfach direkt weggelassen. Es wird mit methodisch zweifelhaften Studien hantiert oder mit Begriffen wie «Signifikanz» und anderen Fachwörtern um sich geschmissen, die man als Laie gar nicht einordnen kann. Wenn das alles nichts hilft, gibt man einfach seine eigenen Studien in Auftrag – gerne, ohne das nach außen ersichtlich zu machen. Alles, um zu suggerieren, dass man sich auf dem Boden wissenschaftlicher Praxis und logischen Denkens bewegt.
Man muss sich schon gut im Wissenschaftssystem auskennen, wissen, wie wissenschaftliche Studien aufgebaut sind und wo mögliche Fallstricke versteckt sind, um diese Tricks und Manipulationen zu durchschauen.
Hinzu kommt, dass wir alle nur Menschen sind. Das bedeutet, dass unser Gehirn und unsere Psyche empfänglich sind für Manipulationen und wir manchmal eben nur das sehen, was wir auch sehen wollen. Es gibt eine Reihe sogenannter kognitiver Verzerrungen, die unsere Wahrnehmung, unser Erinnern und unsere Urteilsfähigkeit beeinflussen – oft, ohne dass wir uns darüber überhaupt im Klaren sind. Andersherum ist es manchmal wirklich schmerzhaft, sich dieser Verzerrungen bewusst zu werden und uns selbst und anderen gegenüber einzugestehen, dass wir falschlagen. Wir vermeiden es darum lieber. Wer gibt schon gerne zu, dass er oder sie auf die Verkaufsmaschen einer österreichischen Firma hereingefallen ist und sich für mehrere Tausend Euro ein Gerät an die Wasserleitung hat schrauben lassen, das angeblich das Wasser beleben soll, obwohl das Gerät genau … nichts bewirkt? Dass wir das so ungern zugeben, ist übrigens auch wieder eine kognitive Verzerrung.[6]
Diese kognitiven Verzerrungen werden von manchen Tricksern sehr bewusst angesteuert und ausgenutzt, um uns zu manipulieren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die, die euch zum Beispiel ein Medikament oder eine Therapie verkaufen wollen, selbst von diesen kognitiven Verzerrungen betroffen sind und wissenschaftliche Erkenntnisse unwissentlich so auslegen, dass sie ihr eigenes Weltbild stützen.
Unser Ziel als Quarks Science Cops ist es also nicht, uns über euch lustig zu machen, sondern euch vor den manipulativen Techniken, aber auch vor euren eigenen kognitiven Verzerrungen zu schützen.
Was bedeutet das für euch und dieses Buch? Erst mal nur, dass ihr euch aufregen werdet. Über die miesen Tricks und Machenschaften, mit denen Wundermittelverkäufer euch ihre Produkte verkaufen wollen, oder über die Techniken, mit denen Parteien und Lobbyverbände versuchen, ihre Interessen durchzudrücken.
Eventuell werdet ihr euch aber auch über uns aufregen. Dann nämlich, wenn es um die kognitiven Verzerrungen geht. Vielleicht seid ihr ja selbst Fans von Alternativmedizin oder Esoterik. Dann werden wir euer Weltbild herausfordern. Bevor ihr das Buch aber erbost in die nächste Ecke werft, atmet einmal durch. Und vielleicht könnt ihr euch dann ja doch auf unsere Argumente und Erläuterungen einlassen. Solltet ihr das Buch gelesen und immer noch das Gefühl haben, dass wir Mist geschrieben haben, dann meldet euch gerne bei uns und teilt uns eure Kritik mit.
Wer wir sind
Ihr sagt euch jetzt vielleicht: Schön und gut – aber was qualifiziert eigentlich gerade euch dazu, zu beurteilen, ob etwas unwissenschaftlicher Unsinn ist oder nicht?[7] Und das auch noch bei so vielen unterschiedlichen Themen: Epigenetik, Atomkraft, Homöopathie, Ernährung, Windenergie, Krebsmedizin, Quantenphysik und so weiter. Die Frage ist berechtigt: Es ist völlig unmöglich, in allen Bereichen gleichzeitig Experte zu sein.
Wir sind weder Mediziner noch Chemiker. Und auch keine Atomphysiker. Aber wir sind ausgebildete Wissenschaftsjournalisten. Das bedeutet: Unsere Expertise besteht genau darin, dass wir uns schnell in verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen einarbeiten und zu unterschiedlichsten Themen recherchieren können. Wir wissen, wie wir uns einen fundierten Überblick über die Strukturen eines Forschungsgebiets verschaffen und wo wir hochklassige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finden, die uns auch komplexe Fragen zur Quantenphysik oder Epigenetik beantworten. Dazu gehört es, die Relevanz von Forschungsergebnissen einzuordnen, zu analysieren, ob eine Studie methodisch sauber durchgeführt wurde, und zu bewerten, ob deren Ergebnisse belastbar sind. Wir können wissenschaftliche Argumentationen hinterfragen und komplizierte Zusammenhänge so erklären, dass auch Laien sie verstehen. Hoffen wir zumindest. Und wir sind Experten darin, echte Fachleute von Pseudoexpertinnen und gute Wissenschaft von Schrott zu unterscheiden.
Dass man dieses Wissen heutzutage ziemlich oft braucht, wurde uns zum ersten Mal richtig klar, als wir vor ein paar Jahren bei Instagram immer häufiger Posts von Kanälen wie «Faktastisch» oder «Faktglaublich» in die Timeline gespült bekamen. Da stand dann zum Beispiel: «Wissenschaftler fanden in einem Experiment mit Ratten heraus, dass Oreo-Kekse süchtiger machen als Heroin.» Oha! Oder: «Laut einer Studie sind ältere Geschwister schlechtere Autofahrer.»[8] Schon ein sehr oberflächlicher Blick in die angeblichen «Studien» reichte meist aus, um festzustellen, dass die knackigen Aussagen in den Instagram-Posts vorne und hinten nicht stimmten. Trotzdem wurden und werden sie und andere dieser Art bis heute regelmäßig mit Hunderttausenden Likes belohnt, und Accounts wie sie haben Millionen von Followern. Schrott-Wissenschaft kommt offensichtlich gut an. Und auch wenn die Falschmeldungen über Schokokekse und Autofahrer eher harmlos wirken, so sind sie am Ende eben genau das: wissenschaftliche Desinformation, täglich bei Instagram. Und kaum jemand widerspricht.
Während der Coronapandemie traten dann plötzlich Akteure in der Öffentlichkeit auf, die noch viel fragwürdigere Thesen von sich gaben. Dass nämlich nicht das Coronavirus die Menschen auf die Intensivstationen bringen würde, sondern die «krank machenden Masken» oder die von «den Medien» verbreitete Panik. Dass man mit den PCR-Tests das Coronavirus gar nicht nachweisen könne, stattdessen aber schon mit ein paar Tropfen Cola ein positives Testergebnis erhalte. Und dass die Coronaimpfstoffe innerhalb weniger Monate Hunderttausende Menschen umbringen würden. Als Kronzeugen für diese mutigen Behauptungen dienten allerlei «Experten», erstaunlich oft Professoren im Ruhestand, und längst nicht immer mit medizinischem Hintergrund. Schnell präsentierten sie Studien, um etwa die tödliche Gefahr von Masken für Kinder wissenschaftlich zu untermauern. Alsbald gesellten sich weitere interessante «Experten» dazu. Die fielen weniger durch die Verharmlosung von Covid-19 auf, dafür aber mit ihren wirklich spannenden Ideen, wie man sich vor dem Virus schützen oder es bekämpfen könne: zum Beispiel mit einfachen Vitaminkapseln aus dem Drogeriemarkt oder einem Entwurmungsmittel für Pferde. Und das alles – selbstverständlich – durch angeblich erstklassige Forschung belegt.
Mit der Zeit entdeckten wir, dass diese Strategien, wissenschaftliche Fakten so lange zu verdrehen, zu manipulieren oder sogar zu leugnen, bis sie ins eigene Weltbild passen, auch außerhalb der Coronadebatte äußerst beliebt sind. Bei Verfechtern alternativmedizinischer Heilmethoden ebenso wie bei den Verkäuferinnen von Nahrungsergänzungsmitteln oder dubiosen Geräten zur «Quantenheilung». Bürgerinitiativen nutzen diese Strategien, um den Bau von Windrädern oder Mobilfunkmasten zu verhindern. Und Parteien oder auch die Industrie picken sich Studien und Experten gezielt so raus, dass in der Öffentlichkeit Zweifel an aus wissenschaftlicher Sicht längst geklärten Sachverhalten aufkommt und stattdessen ihre kruden Theorien Gehör finden. Etwa, wenn es um die Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen geht oder den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Die Motive mögen unterschiedlich sein, die Methoden wissenschaftlicher Trickserei bis hin zur Wissenschaftsleugnung hingegen sind oft erschreckend ähnlich.
Für dieses Buch haben wir die verschiedenen Strategien der Manipulation analysiert und systematisch zusammengetragen:
In Kapitel 1 steigen wir mit dem wohl meistgehörten Argument ein, dass sich die Verkäufer von Wundermitteln wie Globuli, Abnehmpillen oder Heilwässern zunutze machen, um euch ihre Produkte zu verticken: dem Verweis auf die vielen positiven Erfahrungen, die bisherige Kunden schon gemacht haben. Der Tante hat es schließlich geholfen … Wir erklären euch, warum die persönliche Erfahrung manchmal ein ganz schön schlechter Ratgeber ist und welche Fragen ihr euch immer wieder stellen solltet, um nicht auf diese Art der Argumentation reinzufallen.
In Kapitel 2 unternehmen wir einen kleinen Abstecher in die Geschichte und zeigen, dass schon vor langer Zeit Menschen auf die Idee gekommen sind, dass die menschliche Erfahrung manchmal so ihre Tücken hat. Diese Personen haben sich etwas Tolles ausgedacht, um die fehlerhaften Rückschlüsse aus der individuellen Erfahrung möglichst zu tilgen: Wissenschaft.
In Kapitel 3 schauen wir uns an, wie ein Zerrbild dieser Wissenschaft heute von Wundermittelanbietern genutzt wird, um Produkte zu verkaufen. Wir zeigen, wie sich diese Leute eine Art Wissenschaftskostüm anziehen, indem sie komplizierte Begriffe verwenden und sich mit den Namen von Professorinnen, Nobelpreisträgern und Instituten schmücken.
In Kapitel 4 gehen wir noch einen Schritt weiter: Um ihrem Produkt einen wissenschaftlichen Anstrich zu verpassen, präsentieren Scharlatane besonders gerne Studien. Wir entlarven für euch die üblen Tricks, mit denen man euch Studien unterjubeln will, die bei genauerem Hinsehen wertlos, übertrieben oder sogar manipuliert sind.
In Kapitel 5 geht es um die Argumente, die auf den Tisch kommen, wenn wissenschaftliche Fakten gleich ganz abgelehnt werden. «In der Wissenschaft gab es immer schon Außenseitermeinungen», heißt es dann, oder: «Die Wissenschaft kann auch nicht alles erklären!» Wir zeigen, warum es sich dabei meistens um Scheinargumente und logische Fehlschlüsse handelt und warum man so leicht darauf reinfällt.
In Kapitel 6 verlassen wir die Welt der Wunderheilerinnen und Pseudowissenschaftler und widmen uns der organisierten Wissenschaftsleugnung. Wir zeigen, wie Großkonzerne, politische Parteien und Lobbygruppen die gleichen Strategien benutzen, um Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen aufkommen zu lassen, die ihr Geschäftsmodell oder ihre politische Agenda bedrohen.
In Kapitel 7 schließen wir[9] dann mit unseren Thesen dazu, was sich ändern muss, damit es Wunderheiler und Wissenschaftsleugner nicht mehr so leicht haben. Und wir – ganz pathetisch gesprochen – uns zu einer aufgeklärteren Gesellschaft hin entwickeln.
In der Quarks Science Cops Academy am Ende des Buches haben wir für euch kompakt zusammengefasst, wie ihr gute von schlechten wissenschaftlichen Quellen unterscheiden könnt. Zum Nachschlagen, wenn es mal schnell gehen muss.
Und noch einmal, weil es uns wirklich wichtig ist: Wir alle können jederzeit auf unwissenschaftlichen Unfug hereinfallen. Fällt man darauf rein, dann ist man nicht selbst schuld daran. Genauso wenig wie man schuld daran ist, wenn bei einem zu Hause eingebrochen wird. Aber genauso, wie man sich vor einem Einbruch ein Stück weit schützen kann, durch ein Sicherheitsschloss zum Beispiel, kann man sich auch gegen unwissenschaftlichen Unsinn absichern. Und genau das soll dieses Buch idealerweise für euch sein: eine Art Sicherheitsschloss für euren Kopf, das Wunderheilerinnen, Pseudowissenschaftler und andere Wissenschaftsleugner davon abhält, euch abzuzocken.
Los geht’s.
In diesem Buch wird es an vielen Stellen um medizinische Themen gehen, denn leider kursiert auf diesem Gebiet besonders viel unwissenschaftlicher Unsinn, der von Wunderheilern angepriesen und verkauft wird. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Unterschied zwischen der sogenannten Schulmedizin und der Alternativ- oder auch Komplementärmedizin aufgemacht. Zu diesen Begrifflichkeiten möchten wir ein paar Gedanken vorwegschicken, um keine Irritationen heraufzubeschwören.
Den Begriff Schulmedizin versuchen wir sehr bewusst nicht zu verwenden, es sei denn, wir zitieren andere. Einerseits, weil der Begriff durch die andauernde Nutzung von Kritikern mittlerweile eine eindeutig abwertende Konnotation beinhaltet, andererseits, weil er zur Zeit des deutschen Nationalsozialismus darüber hinaus eine antisemitische Komponente bekommen hat. Die Nazis sprachen von einer «verjudeten Schulmedizin».
In diesem Buch sprechen wir deswegen, wenn wir die Medizin meinen, die an deutschen Universitäten im regulären Medizinstudium gelehrt wird, in Anlehnung an ein Positionspapier der Bundesärztekammer von der «wissenschaftlich orientierten Medizin». «Wissenschaftlich orientiert» deswegen, weil Wissenschaftlichkeit zwar das Ideal ist, aber in der Praxis nicht immer erreicht wird.
Wir werden in diesem Buch außerdem die Begriffe Alternativ- und Komplementärmedzin nutzen. Einige Verfechter der wissenschaftlich orientierten Medizin fordern, diese Begriffe nicht zu nutzen, da sie implizieren, dass es sich dabei um ernsthafte medizinische Alternativen handeln würde – und das wäre ja nachweislich nicht der Fall. Der Alternativmedizinforscher Edzard Ernst schlug einst den Begriff «So-Called Alternative Medicine» vor, der sich als SCAM abkürzen lässt (was dem deutschen Wort «Betrug» entspricht). Andere fordern, in diesem Zusammenhang nur von «Pseudomedizin» zu sprechen.
Wir haben lange darüber nachgedacht, welche Begrifflichkeit wir in diesem Buch verwenden. Letztlich haben wir uns – trotz aller berechtigter Kritik – dazu entschieden, einfach bei der Alternativmedizin zu bleiben. Einerseits aus Verständlichkeit – jeder und jede von euch weiß vermutlich sofort, was damit gemeint ist. Andererseits aber auch, weil wir nach Möglichkeit mit diesem Buch einige von euch davon überzeugen wollen, dass es sich bei der Alternativmedizin eben nicht um eine wirkliche Alternative handelt – und zu diesem Zwecke wäre es aus unserer Sicht nicht besonders förderlich, schon mit der Begrifflichkeit sämtliche Brücken abzubrennen und abwertend zu werden.
Wir werden in diesem Buch sehr viel über «Wissenschaft» schreiben, klar. Nun gibt es natürlich jede Menge verschiedene «Wissenschaften» bzw. wissenschaftliche Disziplinen, von der Physik über die Soziologie bis hin zur Kunstgeschichte. Die Tricks und Strategien des unwissenschaftlichen Unfugs, von denen wir euch in den nächsten Kapiteln berichten, haben vor allem mit Naturwissenschaften und Medizin zu tun. Darum beziehen wir uns in erster Linie auf diese Wissenschaften, wenn wir allgemein von «Wissenschaft» sprechen.
Kapitel 1«Aber meiner Tante hat’s geholfen!» – Norbert74 –oder Die Fehler der menschlichen Wahrnehmung
Weihnachten. Die ganze Familie samt Anhang hat sich bei meinen Eltern zum großen Festessen versammelt. Es schmeckt vorzüglich, und ich haue richtig rein. Eventuell ein bisschen zu sehr, denn nachdem wir alle aufgegessen haben und nur noch die blank geleckten Schüsselchen des Nachtischs vor uns stehen, kann ich mich kaum noch bewegen.
«Boah, bin ich voll, ich platze gleich», sage ich und rutsche mit dem Rücken ein Stück weit die Lehne des Stuhls herab. Meine Mutter beäugt mich kritisch: «Geht’s dir gut?» «Jaja», antworte ich, «brauche nur mal kurz ’ne Pause.»
«Ich hab da eventuell etwas, was dir helfen könnte», mischt sich die neue Freundin meines Bruders ein. Sie und ich, wir kennen uns noch nicht so gut, mein Bruder arbeitet nicht in derselben Stadt. Ganz offensichtlich hat er ihr nicht erzählt, was ich beruflich mache, denn sie fischt aus ihrer Handtasche ein kleines Mäppchen mit Reißverschluss. Als sie es öffnet, kommt darin eine Ansammlung kleiner Plastikröhrchen zum Vorschein, alle mit Etiketten sauber beschriftet. An denen fährt sie mit dem Finger entlang und murmelt: «Völlegefühl, hm …»
Ich sehe sofort, dass es sich um Globuli handelt, und seufze. Mein Bruder beginnt, etwas unentspannt auf seinem Stuhl herumzuruckeln, und wirft mir Blicke zu, die ganz offensichtlich sagen sollen: «Sei nett und mach hier jetzt keinen Aufstand. Es ist Weihnachten.» Ich nicke ihm leicht zu und will seiner Freundin sehr freundlich sagen, dass ich keine Globuli brauche, da findet sie offenbar, was sie gesucht hat, und zieht eines der Röhrchen aus der Lasche.
«Mach mal die Hand auf», sagt sie und beugt sich voller Elan zu mir herüber.
Als ich die Hand nicht öffne, ist sie sichtlich irritiert.
Ich atme tief aus und sage: «Du, ich glaube nicht, dass ich das brauche.» So schnell lässt sie sich allerdings nicht von ihrem Vorhaben abbringen. «Komm, stell dich nicht so an, schmeiß mal drei Stück hiervon ein. Die helfen dir bestimmt.»
«Danke, aber ich hatte heute schon genug Zucker», sage ich und kann mir ein zugegebenermaßen etwas selbstgefälliges Lächeln nicht verkneifen.
Sie lächelt aus Höflichkeit zurück, nimmt die Hand mit den Globuli aber nicht runter. Mein Lächeln schwindet langsam. «Sorry», sage ich achselzuckend, «aber ich glaube einfach nicht an Homöopathie.»
«Daran muss man doch nicht glauben. Ich habe die letztens meiner Tante gegeben und der hat es auch super geholfen.»
«Oh, bitte», beginne ich, und sehe, wie mein Bruder verzweifelt das Gesicht in die Hände sinken lässt … Das wird eine lange Diskussion.
Kommt euch diese Situation bekannt vor? Vielleicht, weil ihr selbst in der Familie oder im Freundeskreis Homöopathiefans habt, mit denen ihr immer wieder über Sinn und Unsinn der Kügelchen diskutiert? Oder seid ihr selbst überzeugt von der Homöopathie und versteht nicht, warum man sich gegen diese Erfahrungen zur Wehr setzt? Immerhin haben euch die Globuli doch wirklich geholfen. Und dann kommt da irgendjemand an (im Zweifelsfall wir Quarks Science Cops) und will euch mit angelesenem Wissen und irgendwelchen Studien erzählen, dass eure Wahrnehmung falsch ist. Das kann doch wohl nicht unser Ernst sein!
Doch, es ist unser Ernst, aber keine Sorge, das hier wird keine Abhandlung über die Wirkung oder Nichtwirkung der Homöopathie. Sie ist schlicht ein gutes Beispiel für die dahinterliegende Argumentation.
«Viele Menschen vertrauen der Homöopathie, weil sie offensichtlich gute Erfahrungen damit gemacht haben», sagte zum Beispiel Manfred Lucha, Gesundheitsminister der Grünen in Baden-Württemberg. Wir wollen uns an dieser Stelle auf den zweiten Teil des Satzes konzentrieren. Gute Erfahrungen mit etwas gemacht zu haben ist ja erst mal … gut. Ganz unabhängig davon, ob es um Homöopathie geht. Denn auch wenn ihr persönlich vielleicht nichts von Homöopathie haltet – ihr habt bestimmt irgendwelche Mittelchen und Rituale, auf die ihr vertraut. Wenn ihr zum Beispiel erkältet seid, dann trinkt ihr Tee, nehmt ein heißes Bad oder schluckt Vitamine. Entweder, weil ihr selbst die Erfahrung gemacht habt, dass es euch hilft, oder weil ihr das von anderen schon mal gehört habt.
Warum solltet ihr es auch nicht tun? Probieren geht bekanntlich über Studieren. Wer etwas nicht selbst ausprobiert hat, kann doch auch gar nicht sagen, ob es nicht vielleicht doch hilft. Auf diese Art preisen dann auch viele Wundermittelverkäufer, selbst ernannte Heilerinnen und Anhänger der Alternativmedizin ihre Produkte und Methoden im Internet an: Verlasse dich auf deine eigene Erfahrung – warum das Produkt also nicht einfach mal ausprobieren? Es gibt auch eine dreißigtägige Geld-zurück-Garantie! Ganz ohne Risiko also! Und wen das nicht überzeugt, für den werden auf der Shop-Website noch die Erfahrungsberichte von begeisterten Anwendern des Wundermittels präsentiert. Mal als Text, mal als tränenreiche, mit pathetischer Musik unterlegte Videos, in denen Menschen erzählen, wie ihnen das Mittel geholfen hat.
Die eigene Erfahrung und die Erfahrungsberichte anderer: eine super Sache, auf die man sich also verlassen kann – oder etwa nicht?
Warum ihr eurem Gehirn misstrauen solltet
Wir haben euch im Vorwort schon vorgewarnt, dass wir euch in diesem Buch eventuell dazu bringen werden, eure Sichtweise auf die Welt zu hinterfragen. Und damit geht es jetzt los.
Eure Wahrnehmung, Erfahrung und Intuition sind meist eine super Sache, können euch aber auch heftig aufs Glatteis führen.
Das glaubt ihr nicht? Dann schaut mal auf die Abbildung auf der nächsten Seite: Welche der beiden dicken schwarzen Linien ist länger?
Ihr glaubt vermutlich, die linke Linie sei länger. Stimmt aber nicht. Beide Linien haben exakt dieselbe Länge.
Und wisst ihr, was das wirklich Hinterhältige ist? Selbst wenn ihr nachgemessen habt und wisst, dass die Linien gleich lang sind – eure Augen täuschen euch weiter.
Ihr könnt nichts dagegen tun. Irgendetwas läuft da bei der Informationsverarbeitung in unseren Gehirnen schief, das wir nicht willentlich beeinflussen können. Das gilt nicht nur für optische Täuschungen. Auch in anderen Situationen macht unser Gehirn Fehler – und damit sind wir bei den kognitiven Verzerrungen angelangt, von denen ihr weiter vorne schon gelesen habt.
Kognitive Verzerrungen entstehen durch die Art und Weise, wie unsere Signalverarbeitung und unser Denken funktionieren: nämlich meistens intuitiv, automatisch – und ziemlich schnell. Das ist erst mal total gut. Stellt euch vor, es wäre nicht so, und ihr müsstet über alle Dinge, die um euch herum passieren, die ganze Zeit bewusst, aufmerksam und sorgfältig nachdenken: «Ah, da draußen singt gerade ein Vogel, jetzt ein lauter werdendes Geräusch, vermutlich ein Auto. Die Uhr tickt, das heißt, eine Sekunde ist verstrichen, und jetzt noch eine und noch eine. Gleich ist die Seite zu Ende, also werde ich umblättern müssen. Der Fußboden ist weiter von mir entfernt als das Buch, das ich in den Händen halte …» und so weiter. Ihr würdet nach kürzester Zeit wahnsinnig werden und ziemlich sicher einfach umkippen. Zum Glück arbeitet unser Gehirn in Wirklichkeit anders. Ein großer Teil unseres Denkens und wie unser Gehirn unsere Sinneseindrücke verarbeitet, geschieht intuitiv und unbewusst. Wenn wir zum Beispiel einen einfachen Satz lesen, dann erkennen wir die Wörter meist intuitiv und sofort, ohne dass wir bewusst über sie nachdenken müssen. Das sihet man acuh daarn, dsas ncoh nciht mal die Butacsbhen ilrehannb eiens Wotres in der rgheictin Rfgleeinhoe setehn messün. Euer Girhen kann deiesn Staz auch so sher sehncll eeafsrsn. Das Gleiche gilt, wenn wir ein Auto eine leere Straße entlangsteuern. Auch da müssen wir nicht permanent aktiv überlegen, was als Nächstes zu tun ist.[10] Auch den Gesichtsausdruck eines anderen Menschen bewerten wir intuitiv und schlussfolgern daraus zum Beispiel, ob er gerade zornig oder amüsiert ist.
Der Psychologe Daniel Kahneman hat sich in seiner jahrzehntelangen Forschung intensiv mit Wahrnehmungsfehlern beschäftigt und unterscheidet zwei Systeme des menschlichen Denkens:
Ein automatisches System, das schnell, intuitiv, mühelos und ohne willentliche Steuerung arbeitet.
Ein willentliches System, das die Aufmerksamkeit bewusst auf anstrengende mentale Aktivitäten lenkt und langsamer agiert.
Das automatische System ist permanent aktiv, es erzeugt unsere Eindrücke und Gefühle, stellt Verknüpfungen zu vorangegangenen Erfahrungen her und ermöglicht uns so, Informationen schnell zu verarbeiten und intuitiv Entscheidungen zu treffen. Die so erzeugten Eindrücke und Gefühle sind die Hauptquellen für die bewussten Entscheidungen und Gedanken des willentlichen Systems. Letzteres kommt immer dann zum Zug, wenn die Angelegenheiten etwas komplexer werden. Zum Beispiel bei einer Rechenaufgabe, die – solange sie nicht 1 + 1, sondern 37 × 19 lautet – nur durch echtes Nachdenken gelöst werden kann. Unser bewusstes Denksystem ist auch für das schrittweise, logische und rationale Denken zuständig und erfordert bewusste Aufmerksamkeit und mentale Anstrengung. Genau da liegt schon das erste Problem, denn mit der Anstrengung ist das ja so eine Sache. Unser Gehirn versucht eher, sie zu vermeiden, denn Anstrengung bedeutet Energieverbrauch. Blöderweise besteht eine Hauptfunktion des willentlichen Systems darin, die vom intuitiven System vorgeschlagenen Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen zu überwachen, zu kontrollieren und gegebenenfalls auch anzuzweifeln. Dass das immer wieder notwendig ist, sehen wir am Beispiel der optischen Täuschungen. Schaut euch noch mal das Bild mit den beiden dicken Linien an. Intuitiv halten wir die linke dicke Linie für länger als die rechte, weil unser automatisches System das Bild sofort als dreidimensionalen Raum interpretiert, in welchem der linke Balken tatsächlich länger wäre als der rechte. Erst wenn wir uns das Bild ganz aufmerksam anschauen und bewusst entscheiden, die Linien mal nachzumessen, können wir unseren ursprünglichen intuitiven Eindruck, die Linien seien unterschiedlich lang, als falsch verwerfen.
Meistens liefert uns das intuitive System aber relativ präzise Urteile und Interpretationen von dem, was uns und was um uns herum passiert. Klar, permanente Fehleinschätzungen («Das von rechts heranrasende Auto wird sicher noch bremsen!») würden sich eher ungünstig auf unser Überleben auswirken. Würden wir andererseits mit unserem bewussten Denken jeden Eindruck oder Gedanken hinterfragen und kontrollieren, wären wir so gut wie nicht mehr lebensfähig, weil wir gar nicht hinterherkämen, alle Eindrücke um uns herum bewusst zu verarbeiten und außerdem alles so lange abwägen und zergrübeln würden, dass wir zu keinen Entscheidungen mehr kommen würden.
Unser intuitives Denken ist also insgesamt eine ziemlich großartige Sache, und wir können uns in der Regel auf die schnellen Urteile, die es uns liefert, verlassen. Deshalb übernehmen wir sie bei unseren bewussten Gedanken und Entscheidungen meist und hinterfragen sie nicht unbedingt. Aber genau das ist der springende Punkt: Damit das intuitive System überhaupt so schnell arbeiten kann, greift es auf vereinfachende Annahmen zurück, die jedoch zu Denkfehlern führen können und dazu, dass wir die Realität verzerrt wahrnehmen.
Was unser intuitives System zum Beispiel nicht beherrscht, ist statistisches Denken, wie der amerikanische Psychologe Paul Slovic und seine Forschungsgruppe bereits in den 1970er Jahren in Experimenten eindrucksvoll zeigen konnten: Gefragt danach, ob es wahrscheinlicher ist, durch einen Unfall zu sterben oder durch einen Schlaganfall, gaben die meisten Menschen «Unfall» an, obwohl es in Wirklichkeit andersrum ist. Die Bilder und Vorstellungen von schrecklichen Unfällen sind durch die Medienberichterstattung in unserem assoziativen Gedächtnis, auf das das intuitive Denken zurückgreift, schneller verfügbar als Vorstellungen von Schlaganfalltoten. Über die wird selten in den Medien berichtet. Wenn man also nicht gerade zufällig die Todesursachenstatistik auswendig kennt oder sehr aufmerksam über die Frage nachdenkt, ersetzt unser intuitives Denken die schwierige Frage nach der Wahrscheinlichkeit durch die einfachere Frage, wie schnell einem Beispiele zu beiden Antwortmöglichkeiten einfallen. Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit werden durch Verfügbarkeit ersetzt, weshalb man in der Kognitionspsychologie auch von der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik spricht. Eine Heuristik ist dabei eine schnelle, überschlägige Denkweise unseres automatischen Systems, um auch bei wenigen Informationen zu einem Urteil zu kommen. Von solchen Heuristiken gibt es eine ganze Menge; einige sind schon recht gut erforscht, bei anderen streiten sich Kognitionspsychologen noch darüber, wie genau sie funktionieren. Wir müssen an dieser Stelle aber gar nicht tiefer in den Dschungel der kognitiven Verzerrungen vordringen. Um zu begreifen, warum uns unsere Wahrnehmung gerade dann in die Irre führen kann, wenn es um die Wirksamkeit irgendwelcher Heilmittel geht, müssen wir nur ein Merkmal unseres intuitiven Denkens genauer verstehen: seine Leidenschaft für Ursachen!
Das intuitive Denksystem ist auf der ständigen Suche nach kausalen Verknüpfungen, also nach Ursachen für Veränderungen, die wir wahrnehmen. Eine Hauptaufgabe des automatisches Denksystems besteht nämlich darin, unser Überleben zu sichern: Wie ist die Lage? Alles in Ordnung? Droht Gefahr? Sollte ich vielleicht wegrennen? Dazu überprüft das intuitive System unsere Umwelt permanent auf relevante Veränderungen und Anomalien: Der Strauch da drüben hat sich gerade bewegt. Könnte das vielleicht ein Löwe sein? Oder war es nur ein Wildschwein?[11] Was ist die Ursache?