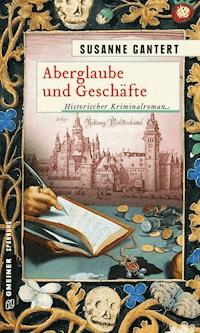
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jurist Konrad von Velten
- Sprache: Deutsch
Winter 1582/1583. Leichenfunde in den Wäldern um Wolfenbüttel und im Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar geben dem jungen Juristen Konrad von Velten Rätsel auf. Während sich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel Ruhe in seinem Herzogtum wünscht, da ein wichtiges Kolloquium zur Einigung von lutherischen Theologen und Fürsten bevorsteht und ein Handelsabkommen geschlossen werden soll, wecken höhnische Gedichte einen unglaublichen Verdacht. Und wieder einmal scheint Konrad von Velten den Ereignissen - auch im privaten Bereich - hinterherzulaufen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Susanne Gantert
Aberglaube und Geschäfte
Historischer Kriminalroman
Zum Buch
Gereimte Intrige Winter 1582/1583. Konrad von Velten vergnügt sich auf der Hochzeitsfeier seiner Mutter, als Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel nach ihm schickt, um ihm einen neuen Fall zu übertragen. Der Herzog braucht für seine kirchenpolitischen Ziele Ruhe im Land, und die droht durch wieder aufflackernden Aberglauben gestört zu werden. Denn im Wald wurde eine grausam zugerichtete Säuglingsleiche gefunden, und ein Mann, der sich vom Teufel verfolgt wähnte, ist unter mysteriösen Umständen gestorben. Zwei weitere Leichenfunde, einer davon in einem Stollen des Erzbergwerks Rammelsberg im Harz, bringen Konrad, der auch privat in Schwierigkeiten steckt, in Handlungszwang. Zum Glück stehen ihm auch bei diesem Fall sein Onkel Andreas Riebestahl und der Rest seiner Familie zur Seite. Laura von Kaltenburg, Konrads Schutzbefohlene, die nun bei seiner Mutter lebt, ist indes mit den Sorgen um ihre eigene Zukunft beschäftigt, die in ihren Träumen nicht wenig mit Konrad zu tun hat.
Susanne Gantert, wurde in Salzgitter als Pfarrerstochter geboren. Die Mutter von drei Kindern lebt heute mit ihrem zweiten Mann in ihrer Wahlheimat Wolfenbüttel und arbeitet als Theologin. Die interessante (Kirchen-)Geschichte des Braunschweiger Landes, die sie im Rahmen einer populärwissenschaftlichen Auftragsarbeit genauer kennenlernte, dient ihr als Grundlage für ihre historischen Romane. Nach »Das Fürstenlied« und »Der Mädchenreigen« ist »Aberglaube und Geschäfte« der dritte Band ihrer Konrad-von-Velten Reihe. Sie veröffentlicht (unter dem Namen Susanne Diestelmann) auch gemeinsam mit ihrem Lebenspartner.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Der Mädchenreigen (2016)
Das Fürstenlied (2015)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Dominika Sobecki
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung der Bilder von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinus_van_Reymerswaele_(Follower_of)_-_The_Money_Changers_-_Google_Art_Project.jpg und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decorated_Initial_D_-_Google_Art_Project_(6821879).jpg und
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braunschweig_Lüneburg_(Merian)_336.jpg
ISBN 978-3-8392-5744-9
Prolog Dezember 1582
Der Mann, der sich im begrenzten Lichtkegel eines blakenden Talglichtes dicht über eines der vielen Papiere beugte, die auf dem Schreibtisch wild durcheinander lagen, gab erzürnte Laute von sich, schlug immer wieder mit der flachen Hand auf die Schrift und raufte sich zwischendurch die Haare.
Ein eingeschüchterter Dienstbote, der es nicht wagte, sich zu Bett zu begeben, bevor der Herr es ihm ausdrücklich gestattet hatte, lugte vorsichtig in das Arbeitszimmer und gab ein leises Hüsteln von sich.
»Darf ich Euch noch etwas bringen, Herr?«, versuchte er den Erzürnten auf sich aufmerksam zu machen, doch er hatte keinen Erfolg.
Ohne ihn wirklich wahrzunehmen, starrte sein Herr ihn an, wies dann mit dem Finger auf ihn, als wenn er ihn einer Untat bezichtigen wollte, und rief:
»Bei meiner unsterblichen Seel, das ist tiefster Calvinismus! Er kann es doch nicht wagen, dieses durchzusetzen und unsere reine Lehre so zu verwässern!«
Der Diener, der solche Anwandlungen seines Herrn kannte und gewohnt war, seufzte tief und beschwichtigte:
»Gewiss, gewiss, Herr Pfarrer, aber das Problem wird heute nicht mehr zu lösen sein. Tatsächlich hat sogar der neue Tag begonnen, eben schlug es zwölf! Bedenkt, Herr Pfarrer, dass Ihr in wenigen Stunden auf der Kanzel zu stehen habt. Da ist es gewiss besser, Ihr begebt Euch jetzt zur Ruhe!«
Als wenn er die Worte seines Dieners nicht gehört hätte, fuhr der Pfarrer fort: »Man wird sich gegen solche Unart in unserem Herzogtum stählen müssen – ein eisiger Wind wird sonst die reine Lehre, die unser Herr Martinus uns hinterlassen hat, verwässern und schließlich ertränken! Ich muss unseren Herrn Julius sofort warnen und ermuntern, seinen Groll gegen den Herrn Chemnitius zu begraben. Tut er es, besteht noch Hoffnung, tut er es nicht, so Gnade uns Gott.«
Der Diener, ein schlichter, aber sehr frommer Mann, erschauerte bei den Worten seines Pfarrherrn. Er verstand nie so recht, worum es in den sehr gelehrten Streitigkeiten ging, in die sein Herr sich regelmäßig vertiefte. Der Verlust der reinen Lehre des Herrn Martinus – das wusste er – würde Auswirkungen auf alle einfachen Seelen im Herzogtum haben. War selbige erst so spät für die Untertanen erstritten worden. Undenkbar, dass der Trost, den das einfache Volk durch die Predigten der lutherischen Pfarrer und das endlich unter beiderlei Gestalt empfangene Altarsakrament seit etwas mehr als zehn Jahren erhielt, von einer wie auch immer gearteten Verwässerung gefährdet sein sollte. Wörter wie »Calvinismus«, »Zwinglianismus« und »Philippisten« waren in diesem Haus bedrohliche Schimpfwörter, ohne dass der Diener verstand, was genau sie bedeuteten. Nichtsdestoweniger bebte er bei ihrem Klang, so wie er um seinen Pfarrherren fürchtete, wenn dieser sie zornsprühend in den Raum schleuderte.
Jetzt schien der Pfarrer zu erkennen, wem er seine Worte entgegengeschleudert hatte. Sein Blick wurde milder, sein Ton weicher. »Ach, Walter, gewiss, es ist spät, und ich muss dir nicht zu dieser Stunde predigen, was du in wenigen Stunden von meiner Kanzel hören kannst. Geh zu Bett, ich bedarf deiner nicht mehr. Und in der Tat werde ich das auch bald tun, denn es bedarf eines wachen, frischen Geistes, um seine Schafe in der rechten Art zu weiden.«
Erleichtert zog sich der Diener zurück, ließ aber die Tür zum Amtszimmer des Pfarrers als Mahnung, dass dieser ihm wirklich bald folgen solle, offen stehen und begab sich zu Bett.
Erstaunt stellte der Diener am nächsten Morgen, als er den Pfarrherrn wecken wollte, fest, dass dieser sich offensichtlich doch nicht zur Ruhe begeben hatte. Doch war dies nicht das erste Mal, dass so etwas passiert war, und so erwartete Walter, als er die Treppe zum Amtszimmer seines Herrn hinunter beschritt, dass dieser an seinem Schreibtisch über seinen Schriften eingeschlafen war.
Die Tür stand genau den gleichen Spalt weit offen, wie er sie hinterlassen hatte. Ein unangenehmer, kalter Luftzug drang aus dem Raum. Der Diener unterdrückte ein Schaudern, das nicht nur allein dem Luftzug geschuldet war, sondern einer seltsamen Ahnung, die ihn anwehte. Er stieß die Tür ganz auf und gab einen erstaunten Laut von sich.
Sein Pfarrherr saß am Schreibtisch, wie er ihn verlassen hatte. Einen Augenblick lang dachte Walter, dass den alten Pastor der Schlag getroffen hatte, denn er saß zusammengesunken, den Blick starr auf das weit geöffnete Fenster gerichtet. Doch als er ihn vorsichtig an der Schulter berührte, kam ein wenig Bewegung in den Mann, der halb erfroren zu sein schien.
»Die Sünde der Väter sucht sie heim bis ins dritte und vierte Glied«, flüsterte er und schien dabei den Blick auf irgendein fernes Grauen zu richten.
Kapitel 1
Konrad von Velten reichte seiner entzückend erröteten Mutter den Brautstrauß zurück. Woran keiner mehr so recht geglaubt hatte, sie hatte es tatsächlich getan: Sie hatte Pastor Paul Wegener aus Fümmelse ihr Jawort gegeben. Fast zwei Jahre hatte ihr innerer Kampf mit ungewissem Ausgang gedauert. Nicht etwa, dass sie dem stattlichen Mann abgeneigt gewesen wäre. Das Gegenteil war der Fall: Sie, die eigentlich mit dem Ehedasein nach dem Tod ihres innig geliebten ersten Ehemannes abgeschlossen hatte und sich vollkommen auf ihren Beruf als Leiterin einer höheren Mädchenschule und auf die Erziehung ihrer fünf minderjährigen Kinder konzentriert hatte, erfuhr unter dem sanften, aber beharrlichen Werben dieses dunklen, ernsten Mannes das Aufwallen des Blutes und das Sehnen aller Sinne erneut, vertraut und doch anders als vor ihrer ersten Ehe.
Paul Wegener war kein typischer Vertreter seines Standes, wenn es so etwas überhaupt gab. Seine hoch aufgerichtete, breitschultrige Gestalt, die dunkle Haut, das ungebärdige schwarze Lockenhaar und nicht zuletzt die riesige rote Narbe, die sein Gesicht von der rechten Schläfe, knapp am Auge vorbei, bis zur linken Seite des Kinns durchlief, passten eher zu dem Aussehen eines wilden Landsknechtes. Unwillkürlich suchte man in seinem Gesicht nach kämpferisch funkelnden schwarzen Augen und traf stattdessen auf rehbraune mit sanftem, grüblerischem Blick. Sein Amt als Pfarrer des Dorfes Fümmelse versah er seit drei Jahren, und sein Leben davor war eine lange Geschichte voller Irrungen und Wirrungen gewesen, die Agnes bisher nur in Bruchstücken in Erfahrung hatte bringen können. Sie wusste so viel, dass sie ihm aus tiefstem Herzen vertraute. Sie konnte nicht anders, denn vom ersten Augenblick an war er ihr mit einer Wärme und Sanftmütigkeit begegnet, die sein Aussehen in jeder Hinsicht Lügen straften.
Nein, nein, es hatte nicht an ihm gelegen, dass sie so lang gezögert hatte. Es hatte daran gelegen, dass sie fürchtete, aufgeben zu müssen, was einen Großteil ihres bisherigen Lebens und Strebens ausmachte, um seine Ehefrau sein zu können. Konnte eine Pfarrfrau im Braunschweiger Land weiterhin Schulleiterin sein? – Undenkbar! Konnte sie, die sie selbst Tochter und Schwester von Pastoren war, sich vorstellen, ein Leben, wie ihre Mutter und dann ihre Stiefmutter es geführt hatten und ihre Schwägerin es jetzt noch führte, zu leben? – Fast genauso undenkbar!
Von Anfang an hatte Paul ihre Bedenken und Zweifel verstanden und mitgetragen. Er hatte Agnes in ihrer Funktion als Schulleiterin kennengelernt, als er seine eigene Tochter aus seiner kurzen ersten Ehe an Agnes’ Schule in der Heinrichstadt angemeldet hatte. Vor sich hatte er eine kleine, kerzengerade blonde Frau gesehen. Erste graue Haare, kaum erkennbar in dem hellen Blond, wiesen unmissverständlich darauf hin, dass diese Frau nicht mehr ganz jung war, doch ihr zartes Gesicht mit den riesengroßen blauen Augen zeigte nur wenige Fältchen in den Augenwinkeln. Die Falten an den Mundwinkeln jedoch zeugten von erlittenen Sorgen und von Trauer und gaben dem Gesicht eine ernsthafte Reife, die im Gegensatz zu der mädchenhaften Figur und den flinken Bewegungen zu stehen schien. Paul Wegener hatte noch nie eine Frau gesehen, die er so wenig einordnen konnte, und war vom ersten Augenblick fasziniert von Agnes.
Tatsächlich wussten beide nicht, wie sich ihr zukünftiges gemeinsames Leben gestalten würde. Zunächst hatte Agnes die Verwaltung und Führung der Schule kommissarisch in die Hände ihrer langjährigen Mitarbeiterin und Stellvertreterin Luise Steibach gelegt und ihren turbulenten Haushalt in der Krummen Straße in der Heinrichstadt aufgelöst. Fümmelse lag nahe genug an der Heinrichstadt, dass ihre drei Mädchen und ihre Pflegetochter Laura zusammen mit ihrer neuen Stiefschwester Regina die Schule würden besuchen können. Das neue Pfarrhaus bot genug Platz für eine große Familie, sogar Agnes’ drei Söhne würden Aufnahme finden können. Konrad hatte eine eigene kleine Hofbeamtenwohnung in der Heinrichstadt und die Zwillinge Julius und Nicolaus weilten meistens an der Universität Helmstedt, wo der eine Medizin, der andere Jura studierte.
Ein Tuscheln und Kichern lenkte Konrads Blick von dem Gesicht seiner Mutter ab, und er versuchte, eine strenge, mahnende Maske anzulegen, ehe er sich nach hinten zu der blumenbekränzten Mädchenschar wandte. Aus überwiegend blauen Augen blickten ihn fünf Mädchen, die aufgereiht wie Orgelpfeifen standen, gespielt unschuldig an. Nur die Kleinste, Käte, seine sechsjährige jüngste Schwester, hatte ihre Züge nicht rechtzeitig im Griff und auf ihnen war alles zu lesen, was hier vor sich gegangen war.
In Konrads Mundwinkeln zuckte es leicht, was das breite Grinsen auf dem Gesicht seiner Schwester unmittelbar vertiefte. Schnell ließ er seinen Blick zu den anderen Mädchen schweifen. Über Elisabeth und Adelheid, die sich an den Händen gefasst hatten, wie sie es oft seit ihrer frühesten Kindheit taten, denn sie waren im Alter nur ein knappes Jahr auseinander, zu Regina, seiner neuen Schwester, die mit ihrem tiefschwarzen Haar und ihren grünen Augen einen erstaunlichen Kontrast zu all den blonden Mädchen darstellte und mit ihren elf Jahren fast einen Kopf größer war als die beiden älteren.
Den Abschluss der Reihe bildete Laura, und bei ihr traf er nicht auf einen unschuldigen, sondern auf einen höchst herausfordernden Blick. Erstaunt stellte Konrad fest, dass dieser Blick zu einer Laura gehörte, die er noch nicht wahrgenommen hatte. Er hatte Laura vor einigen Tagen in Begleitung von Agnes auf dem Markt getroffen und ein bisschen mit ihr herumgeschäkert. Er hatte die hübschen Zopfschnecken über ihren Ohren bewundert und schelmisch betont, wie viel besser ihm diese gefielen als die Knabenfrisur, die sie sich vor zwei Jahren auf der Flucht vor ihrem Bruder hatte schneiden müssen. Da war sie tief errötet und hatte kaum ein Wort erwidert.
Laura war genauso groß wie Regina, im Gegensatz zu deren linkischer Unbeholfenheit eines Kindes kurz vor dem Erwachsenwerden hatte sie eine zierliche, aber wohl gerundete Figur. Sie hatte jede Ähnlichkeit mit der Laura verloren, die er vor zwei Jahren erst als verschmutzten Stallburschen, dann als verstörtes Opfer ihres skrupellosen Bruders kennengelernt hatte.
Diese Laura hier, ebenso blond und blauäugig wie seine Schwestern, rief in diesem Moment alles andere als brüderliche Gefühle in ihm hervor. Verlegen wandte er seinen Blick von ihr ab und versuchte, sich auf das Geschehen der Trauung zu konzentrieren.
Pastor Thomas Riebestahl, Bruder der Braut und Konrads jüngster Onkel, beendete den Traugottesdienst, und von der kleinen neuen Orgel der Fümmelser Kirche erschollen ungewohnt virtuose Klänge, denn nicht der Opfermann betätigte diese heute. Barbara Riebestahl, Konrads Tante, hatte es sich nicht nehmen lassen, diese am heutigen Tage für ihre Ziehschwester und Schwägerin erklingen zu lassen.
Die fröhliche Festgemeinde quoll hinter dem Brautpaar aus der kleinen Kirche, vor der sofort von der Dorfjugend einiger Schabernack initiiert wurde, wie dies bei Trauungen üblich war. Heute schienen sie durch die Tatsache, dass es ihr Pastor war, der eine neue Frau heimgeführt hatte, zu besonderen Leistungen angetrieben.
Da sich das Pfarrhaus gleich neben der Kirche befand, schloss sich an die Zeremonie kein großer Brautzug an, sondern die geladene Gesellschaft betrat in fröhlicher Ausgelassenheit die unteren Räume: die Amts- und Wohnstube sowie im hinteren Teil Küche und Essstube. Heute waren alle Möbel aus den Räumen entfernt und stattdessen lange Bretter zu Tafeln aufgebockt worden, an denen auf einfachen Bänken und Schemeln die ganze große Familie Riebestahl und die wenigen Dorfbewohner, die ihre Scheu überwunden hatten und der großzügigen Einladung ihres Pastors gefolgt waren, Platz fanden.
Hauseigene und ausgeliehene Mägde wuselten hin und her und trugen von »Ahs« und »Ohs« der Gäste begleitet dampfende Schüsseln mit dem Hochzeitsmahl auf. Andreas Riebestahl, der Zwillingsbruder der Braut, stand am Kopfende der langen Tafel, hielt einen Humpen in der Hand und hob an, eine Rede zu halten. Aufmerksame Stille senkte sich über die Hochzeitsgesellschaft.
»Meine liebe Schwester Agnes, mein lieber neuer Schwager Paul, nachdem mein kleiner Bruder heute das erste Wort haben durfte und euch in der Kirche getraut hat, habe ich das zweite Wort an euch. Beide wisst ihr bereits, was die Ehe bedeutet, beide habt ihr schmerzlichen Verlust erleben müssen. Ihr habt euch füreinander entschieden, weil ihr es wolltet, keiner konnte euch zwingen …«
Konrad ließ es gegen seine Gewohnheit zu, dass seine Gedanken von der Rede seines Onkels abschweiften. Er wusste, was gesagt werden würde und gesagt werden musste, und die Seite des Zweiflers und Grüblers in ihm konnte die Oberhand gewinnen.
Gewiss, der neue Ehemann seiner Mutter war ein famoser Kerl und es war nichts Schlechtes an ihm zu finden, seine Mutter ging jedoch ein hohes Risiko mit dieser Ehe ein. Sie gab für das Ehefrauendasein die Sicherheit eines geordneten und für eine Frau außergewöhnlich selbstständigen Lebens auf. Sie war noch nicht aus dem gebärfähigen Alter heraus, hatte bereits sechs Kinder, und die Gefahr, dass sie in einem neuen Kindbett sterben könnte, war nicht von der Hand zu weisen. Als Pfarrfrau würde man ihr nicht allzu viel Gelegenheit lassen, ihren gelehrten Vorlieben und organisatorischen Aufgaben in der Schule nachzukommen. War es das wert?
Konrads Blick schweifte zu Barbara, die ihren kleinen Sohn Maximilian auf dem Schoß hielt und deren Blick seit dem jähen Tod des Zwillingsbruders von Maximilian den Schalk verloren hatte. Der Junge war vor ein paar Monaten an der sporadisch neu aufgeflackerten Pest gestorben.
Ist nicht jede Eheschließung, jede Familiengründung der Anfang einer Reise, auf der in jedem Winkel das Gespenst des Verlustes lauert?, dachte er schaudernd.
Er selbst wäre vor mehr als zwei Jahren nur zu bereit gewesen, sich auf diese Reise zu begeben, aber ihm war die Erwählte auf brutalste Art und Weise genommen worden, bevor es zu einer Hochzeit hatte kommen können. In den Monaten nach diesem tragischen Erlebnis hatte er diesen Umstand unbewusst als eine Art Strafe für seine eigene unwürdige Geburt akzeptiert. Niemand ahnte etwas davon, weil er sich jeder Anteilnahme und allen gut gemeinten Gesprächsangeboten systematisch verschlossen hatte. Er hatte sich in die Rolle des Beobachters von Freud und Leid zurückgezogen und begab sich nur in flüchtige Beziehungen zum anderen Geschlecht.
Derzeit hielt er eine lockere Beziehung zu einer zehn Jahre älteren Kaufmannsgattin aufrecht. Gerade gestern hatte die ihm aber erbittert Dinge an den Kopf geworfen, die in ihm den Entschluss hatten reifen lassen, die Beziehung zu beenden, zumal die Gefahr einer peinlichen Entdeckung mit jedem Treffen stieg.
Gewiss, er schämte sich nicht wenig, denn sein Gewissen hielt ihm immer wieder vor, was für ein lockerer Vogel er sei. Was war an ihm besser als an seinem leiblichen Vater, der ihn in Unehre gezeugt hatte? Trotzig dachte er, dass der Apfel eben nicht weit vom Stamm falle und dass es nun einmal sein Schicksal sei, Frauen zu lieben, aber nicht wirklich lieben zu dürfen.
Der Trinkspruch, den sein Onkel ausrief, riss Konrad aus seinen düsteren Gedanken, er blickte auf, und zum zweiten Mal an diesem Tag begegnete er dem herausfordernden, stolzen Blick Lauras.
Kapitel 2
Mit in tiefe Faltengelegter Stirn las Herzog Julius ein weiteres Mal den Brief, den er in Händen hielt. Die Unterzeichner, die ehrwürdigen Professoren der Universität in Helmstedt Tilemann Heshusius und Basilius Sattler, hatten in ernsten Worten dargelegt, dass mit der Einladung zu einem Colloquium in Quedlinburg dem Ernst der Sache wahrhaftig noch nicht Genüge getan sei. Zwar würden sie das Einlenken der Kurfürsten begrüßen, aber die Einladung zu diesem Colloquium könne nicht die geforderte Einberufung einer rechten Synode ersetzen.
Der Herzog seufzte schwer. Er war hin- und hergerissen zwischen dem Eingeständnis, dass er selbst nicht wusste, warum er sich der endgültigen Zustimmung zu diesem gewaltigen Einigungswerk so vehement verwehrte, und der tief empfundenen Überzeugung, dass er als Landesvater dieses Herzogtums eine enorme Verantwortung für die Reinerhaltung der Lehre in den Kirchen trug. Er versuchte, sich das eigentliche Problem zu vergegenwärtigen: Es ging um nichts weniger als die »Formula Concordiae«, die Formel der Eintracht der wahren, unverwässerten lutherischen Lehre. Eine Formel, die er, einer der lutherischsten Fürsten des Reiches, wahrhaft zu fördern und zu unterschreiben hätte, um den lutherischen Landen ein Bollwerk gegen die calvinistischen Angriffe auf die reine Lehre zu bauen. Und es war nicht so, dass der Wille dazu nicht da wäre.
Seine Gedanken wanderten zurück in die glorreichen Jahre, da sein erstes Werk als neuer Landesvater die endgültige Einführung der Reformation ins Braunschweiger Land gewesen war. In einer gewaltigen Anstrengung hatte er das Land mit der Hilfe der hervorragenden Theologen Chemnitius und Andreae mit Kirchenvisitationen überzogen, hatte jeden Pfarrer und Kaplan auf Herz und Nieren überprüfen und strenge Examinationen durchführen lassen; diesen im Amt belassen, jenen abgesetzt und neue Pfarrer aus anderen, bereits seit Jahrzehnten lutherischen, Fürstentümern abgeworben.
»Verdammter Chemnitius!«, entfuhr es ihm grollend aus tiefster Brust, während sich mit einem bitteren Aufstoßen sein Magen meldete. Was hatte sich dieser Pfaffe einzumischen, wenn es um hohe Politik ging? War es denn nicht so, dass Diplomatie und Staatsräson andere Maßnahmen erforderten, als es den weltfernen Theologis recht sein wollte? Es gab Kompromisse, die in der Politik machbar und erforderlich waren, die keineswegs die reine Gesinnung infrage stellten!
Allein aus politischen Gründen hatte er 1566 zugestimmt, dass sein damals zweijähriger Sohn Heinrich Julius vom Halberstädter Domkapitel zum Bischof gewählt wurde. Es war eine Übereinkunft zu beiderseitigem Nutzen gewesen. Er hatte damit sichergestellt, dass dieses wichtige Territorium unter seinem Einfluss blieb. Und die Halberstädter konnten in ihren Interna schalten und walten, wie sie wollten, da festgelegt wurde, dass bis zur Mündigkeit des Zweijährigen das Domkapitel allein die Administration des Stifts innehatte.
Natürlich gab es pro forma die Bestimmung, dass der Prinz katholisch zu erziehen sei, doch diese Forderung wusste der Herzog konsequent zu umgehen. Im Gegenteil hatte er für eine im höchsten Maße lutherische Erziehung durch den Theologen Andreae und den Hofmeister Curt von Schwicheldt gesorgt. Übrig geblieben war allein die Forderung nach der Tonsur bei der Einsetzungszeremonie des Prinzen als Bischof. Bis zum Schluss hatte er, Julius, darum gekämpft, dass die Tonsur, dieses kirchenrechtliche Zeichen der Zugehörigkeit zum Klerus, das einzige Zugeständnis blieb. Selbst die Entbindung von der Teilnahme des neuen Bischofs an der katholischen Messe hatte er erreichen können.
Also, was wollte dieser vermaledeite Chemnitius? Wie hatte wegen so einer Sache aus dem Freund und Weggenossen ein Gegner werden können? Wie hatte es geschehen können, dass er, der rechtschaffene Kämpfer für die Sache der Konkordie, wegen solch zänkischen, rechthaberischen Theologengebarens in Misskredit bei den anderen Fürsten geriet? Nur der gute Andreae hatte durch seine unermüdlichen Bemühungen erreicht, dass man keine faulen Eier nach ihm warf, sondern ihn endlich wieder in den Kreis der Streiter für das Konkordienwerk aufnahm. Aber in den entscheidenden Momenten hatte der Herzog außerhalb des Informationsflusses gestanden, ob von Chemnitius beabsichtigt oder nicht.
An dem Entwurf der wichtigen Vorrede zur »Formula« waren er und Heshusius, Sattler und die anderen Helmstedter Theologen nicht beteiligt gewesen, sodass er sich gezwungen gesehen hatte, sie mit einer eigenen Vorrede zu beauftragen. Deren Einwände und Vorschläge waren jedoch nicht berücksichtigt worden. Mühsam waren die Schritte zu einer Einigung erkämpft worden, man hatte sich hier ein Stück von der einen Seite, dort von der anderen Seite aufeinander zubewegt. Endlich war Julius so weit gewesen, der Vorrede zuzustimmen, unter dem Vorbehalt, sie auslegen zu dürfen, wie es seine Theologen ausgehandelt hatten, und den Rest des Herzogtums dazu aufzufordern, dies auch zu tun. Dann musste er jedoch feststellen, dass alle anderen, vor allem die vermaledeiten Braunschweiger mit Chemnitius, längst vorgeprescht waren und ihn wie einen dummen Hansel hatten dastehen lassen.
Sei’s drum, die Einigung schien erzielt worden zu sein, und der Stolz gebot es, neben die sächsische, magdeburgische und tübingsche Ausgabe des Einigungswerkes eine niedersächsische zu setzen. Noch vor der Drucklegung hatten die Helmstedter Theologen festgestellt, dass die bisher offiziell in den anderen Fürstentümern gedruckte Version wesentliche Abweichungen von der Version enthalten hatte, an der Julius, vor der ganzen Streiterei mit Chemnitius, beteiligt gewesen war und die an der Universität als Handschrift hinterlegt war. Die Theologen hatten ihrem Fürsten dann geraten, seine Unterschrift für das Konkordienwerk vorläufig auszusetzen.
Dass man über ihn und seine Theologen mit der Verteidigungsschrift für die Formel gegen die Calvinisten hinweggegangen war, hatte der Sache die Krone aufgesetzt. Und wieder war Chemnitius im Spiel gewesen. Wesentliche Einwände seines Helmstedter Mannes Heshusius waren als »nicht wichtig« abgetan, ein klärendes Treffen war aus nichtigen Gründen abgesagt worden. Chemnitius hatte wohl die anderen beteiligten Theologen dazu gebracht, Heshusius zu übergehen, um die eigene lichtscheue Arbeit ungestört fortsetzen zu können. Mit solchen hoffärtigen, neidischen Köpfen konnte man doch keine Kirche bauen!
Nun durfte man sich, um der Sache willen, den weiteren Schritten nicht verwehren. Der Forderung einer Generalsynode der lutherischen Stände war zwar mit dieser Einladung zum Quedlinburger Gespräch immer noch nicht Genüge getan, aber zumindest sollten hier die Helmstedter Einwände gegen Vorrede und Verteidigungsschrift der Formel ernst genommen und beraten werden.
Herzog Julius wurde sich durch ein diskretes Klopfen an der Tür seiner Umwelt bewusst, richtete sich in seinem Lehnsessel auf, straffte sich und bot dem eintretenden Diener ein Bild tatkräftiger Entschlossenheit, das von den eben gehegten verzagten Gedanken nichts ahnen ließ.
»Eure fürstliche Gnaden, Kanzler Mutzeltin ist auf Euer Geheiß soeben eingetroffen und bittet, eintreten zu dürfen.«
»Trefflich, trefflich. Er soll hereinkommen!«
Julius erhob sich ein wenig schwerfällig aus dem Sessel und versuchte, die steifen Glieder zu entkrampfen. Er verbot sich, insbesondere jetzt im tiefen Winter, einen Gedanken an die Beschwerden des Alters zu verschwenden, und begegnete seinem kränklichen Kanzler mit der Würde und Gelassenheit, die man von ihm als Landesvater gewohnt war.
»Mein guter Mutzeltin, ich ließ Euch rufen, damit Ihr zu diesem Briefe meiner werten Helmstedter Stellung nehmt und diese anschließend schriftlich fixiert.« Julius überreichte dem Kanzler den Brief und wies angesichts der heute besonders ins Auge stechenden Hinfälligkeit des um einige Jahre älteren Mannes auf einen der beiden Sessel, die nahe dem wärmespendenden Kaminfeuer einander gegenüberstanden.
Der Kanzler nahm die Weisung dankbar an und vertiefte sich sofort in das Schreiben.
Mit der in dem Brief verhandelten Materie war er genauso vertraut wie sein Herzog und die Theologen, so erwiderte er nach kurzem Nachdenken: »Folgende Punkte werden zu berücksichtigen sein: Erstens: Es muss weiter über die Synode verhandelt werden! Zweitens: Die gefährlichen Änderungen in der ›Formula Concordiae‹ gegenüber der Wolfenbütteler Handschrift müssen dringend verhandelt werden. Drittens: Diejenigen, die irrige Lehren geführt haben, müssen gemeldet werden. Viertens: Über die Lehre von der Allgegenwart Christi muss weiter verhandelt werden. Fünftens: ebenso über die unbequemen Lehren Luthers. Sechstens: über den Prozess, der in der heutigen Zeit insgesamt der Sachen der Religion halber geführt wird.«
Jeden der sechs genannten Punkte unterstrich der Kanzler mit einem mahnenden Zeigefinger.
»Gut, gut, mein Lieber! Legt dies bitte in einem förmlichen Brief an mich nieder, damit ich mich darauf als Wegleitung in der weiteren Weisung berufen kann.«
»Eure fürstliche Gnaden, so unbedingt die Forderungen in dieser Sache sein mögen, ist darauf zu achten, dass sich keine weitere Verwirrung aus der Theologen Streiterei ergibt, sondern dass bitter bis zu greifbaren Ergebnissen gehandelt wird. Das Einigungswerk bedarf keines weiteren Aufschubs aufgrund zänkischer Sophisterei!«
Kapitel 3
Voll Grauen blickte der Mann zurück über seine Schulter, während er den abschüssigen Weg mehr hinunterschlitterte als -lief. Eigentlich wollte er nicht sehen, wonach er sich umblickte. Er wollte sehen, dass da nichts war, dass es sich in Luft aufgelöst hatte, dass es nur ein zufälliges Gebilde seiner Fantasie in dieser eiskalten, dunklen Nacht gewesen war. Schmerzerfüllt schrie er auf, als er mit der Schulter den Stamm einer Fichte rammte, weil er nicht nach vorn geschaut hatte.
Konnte es sein, dass der Leibhaftige sich in dieser Eiswelt herumtrieb, statt sich an seinem Höllenfeuer zu fläzen? Dann musste er auf ganz andere Beute aus sein als auf ihn, einen kleinen Schreiberling, der nichts Unrechteres in seinem Leben getan hatte als hier und da eine kleine Schummelei in eigener Sache in der Schreibstube. Selbst wenn Gerhard bemerkt haben sollte, dass er hier einen Pfennig weniger eingetragen hatte oder dort die Angaben aus der Küche ein wenig größer hatte ausfallen lassen, um die Differenz in den Ausgaben selbst einzustecken, hatte der ihn nicht beim Teufel, sondern höchstens beim Haushofmeister anzeigen können.
Er blieb stehen. Er musste stehen bleiben, denn das klopfende Herz drohte, ihm die Brust zu sprengen, und die Stiche in der Seite lähmten ihm die Beine. Wimmernd beugte er sich nach vorn, warf aber immer wieder panische Blicke nach hinten.
Wenn es der Leibhaftige war, dann hatte er sich ihn in seinen schlimmsten Träumen nicht so schrecklich ausgemalt. Gewiss, er hatte gehört, dass der Teufel viele Gestalten annehmen konnte, sogar in der Gestalt von unschuldigen Kindern sollte er gesehen worden sein.
Einmal hatte er bei einem Auftrag, den er in der Bibliothek des Herzogs hatte ausführen müssen, neugierig in ein Buch geblickt, das aufgeschlagen auf einem der Schreibpulte gelegen hatte. Dort hatte er fasziniert die Abbildung des Teufels als einer Art Drache betrachtet. Der Bibliothekar war herangetreten und hatte ihm erklärt, dass dies ein Stich von einem Mann namens Albrecht Dürer sei, den man dank der modernen Buchdruckkunst beliebig oft vervielfältigen konnte.
Der Drache hatte zwar unheimlich ausgesehen, aber eher wie ein gefährliches Tier, nicht wie diese Bestie in Menschengestalt.
Warum nur hatte er heute Nacht diesen Weg aus dem Wirtshaus in Groß Stöckheim genommen – wo er mit seinem Bruder gezecht hatte –, um zu seinem kleinen Haus hinter der Mühle in der Heinrichstadt zu gelangen? Gewiss war der Weg kürzer, aber hier im Wäldchen sehr dunkel und stark vereist um diese Jahreszeit. Warum war er nicht, so schnell er konnte, durch das Wäldchen geeilt, sondern hatte bei den Tannen angehalten, um in seinem Mantelsack nach der wohlverstauten kleinen Flasche zu tasten, die ihm heute die Kräutersuse für ein paar Pfennige zugesteckt hatte? Warum hatte er sich heute Nacht in die Schreibstube schleichen müssen, um die Spuren seiner Betrügereien zu verwischen?
Während er den Kopf tief in den Nacken gelegt hatte, um einen kräftigen Schluck des hervorragenden Kräuterschnapses in sich hineinzukippen, hatte er ein leises Knirschen wie von einem Tritt durch den vereisten Schnee gehört. Er hatte die Flasche abgesetzt und in die Richtung geblickt, aus der das Geräusch gekommen war. Und da, da hatte er ihn gesehen: den Leibhaftigen. Er stand zwischen zwei Tannen – wie verschmolzen mit ihren dunklen Armen – und sah ihm ins Gesicht. Drei Beine hatte er und einen verkrümmten Leib. Über den schiefen Schultern, unter einem Schlapphut mit einer schwarzen Feder, war kein Menschenantlitz, sondern eine Fratze ohne Ohren, Nase und Lippen. Nur zwei Reihen großer Zähne in wulstigem rosa Fleisch ließen ahnen, wo das Maul des Teufels war. Wie Feenfinger wehten lange weiße Strähnen von der einen Seite dieses schrecklichen Dinges, das ein Kopf sein sollte, die andere Seite war kahl. Und dann verzog sich die grässliche Fratze wie zu einem Grinsen und ein Arm streckte sich ihm entgegen, an dem keine Hand saß, sondern eine Klaue wie aus Eisen mit Krallen aus geschliffenen Klingen.
Geistesgegenwärtig, er wusste nicht, wie er das geschafft hatte, hatte er mit Wucht dem Teufel seine Schnapsflasche entgegengeschleudert, auf dem Absatz kehrtgemacht und war gelaufen, was seine Beine hergaben.
Als sich das Rasen in seiner Brust ein wenig beruhigt hatte und die Stiche in der Seite allmählich nachließen, warf er einen letzten Blick über die Schulter und lief weiter. Aber da wurde er plötzlich am Fuß gepackt und schlug der Länge nach hin. Ihm blieb nur ein letzter lichter Moment, in dem er Gott anflehte, ihn aufzunehmen in sein himmlisches Reich, ihn, der doch durch die Taufe und seinen Glauben gerechtfertigt sein sollte. Er betete zum Allmächtigen, den Teufel an seinen Platz zu verweisen, den er nach gutem lutherischen Glauben nur mit den Ungetauften und Ungläubigen zu teilen hatte, dann umfing ihn Dunkelheit und Stille.
Als er aufwachte, konnte er es beinahe nicht fassen, doch Gott hatte offensichtlich sein Gebet erhört. Er lebte und fand sich unbehelligt. Gewiss, fast erfroren, aber das war allemal besser, als die Hitze des Teufels zu spüren. An seinem Kopf fand er eine dicke Beule und neben sich eine vereiste Baumwurzel, auf die er wohl aufgeschlagen war. Jetzt erkannte er, dass es nicht der Gehörnte gewesen war, der ihn am Fuß festgehalten und zu Fall gebracht hatte, sondern ein zusammengerolltes Bündel. Vorsichtig fasste er danach und zog die Stofffetzen auseinander. Im gleichen Moment fuhr er mit einem Schrei zurück und wünschte sich, dass er das nicht getan hätte, denn nun wusste er, dass seine Begegnung mit dem Teufel nicht zu Ende war. Nun grinste ihn das zu einer Maske des Grauens verzerrte Gesicht, das er vorhin gesehen hatte, in einer Miniaturausgabe an.
Er vermochte später nicht zu sagen, wie es ihm gelungen war, sich aufzurappeln und den Weg hinaus aus dem Wäldchen zu finden. Zu sehr war er bemüht, ein Heulen und Klappern auszublenden, das ihn verfolgte und mit jedem weiteren Schritt, den er tat, lauter wurde. Als er endlich durch das geöffnete Tor bei der Mühle ankam, wurde er gewahr, dass er selbst Verursacher der Geräusche war, denen er zu entkommen versucht hatte: In einem unglaublichen Tempo schlugen seine beiden Zahnreihen mit den nicht allzu vielen verbliebenen Zähnen aufeinander und seiner Brust entrang sich ein Getöse, das er bei sich noch nie gehört hatte.
In dem Häuschen an der Mühle öffnete sich ein Fensterladen im Obergeschoss und Trine, die Frau des Müllers, reckte den von einer Kerze in ihrer Hand erleuchteten Kopf heraus:
»Krösmann, du bist das! Hast du schon wieder zu viel gesoffen, um nach Hause zu finden? Heul doch deiner Minna was vor und lass rechtschaffene Leute zu ihrer wohlverdienten Nachtruhe kommen!«
Der Schreiber blieb stehen, reckte eine Hand in die Richtung, aus der er gekommen war, und versuchte, das Klappern seiner Zähne in den Griff zu bekommen, um etwas zu sagen. Mühsam stieß er ein paar Silben hervor, die aber fast sofort von den unfreiwillig zusammenklappernden Kiefern unterbrochen wurden. Da packte der Teufel sein Herz, riss es in zwei Stücke und der Schreiber Hans Krösmann fiel wie ein Klotz vor die Haustür des Müllers.
Trine Müller und ihr Mann, die nur einen Wimpernschlag später vor ihr Haus traten und den vermeintlich bewusstlosen Betrunkenen, um ihm zu helfen, auf den Rücken drehten, fuhren mit einem Entsetzensschrei zurück. Denn sie blickten in eine vom plötzlichen Tod grausam verzerrte Maske mit beinah aus den Höhlen quellenden Augen.
»Wir müssen das im Schloss anzeigen«, jammerte die Müllerin.
»Das hat bis morgen Zeit. Den hat doch nur der Schlag getroffen. Ich geh heute nicht mehr in die Dammburg. Komm, fass an, Mädel, wir bringen ihn rüber zur Minna.«
»Er wollte etwas sagen, und er hat auf den Wald gezeigt!«, insistierte die Frau.
»Und, was kann das schon gewesen sein? Wahrscheinlich war der alte Narr auf der Flucht vor einem streunenden Hund oder so was!«
Der Müller holte aus einem Verschlag die Schubkarre, mit der er seine Mehlsäcke zu transportieren pflegte, hob den alten Schreiber hoch, als wenn er ein Kind wäre, und legte ihn behutsam in die Karre. Dann machten sich die beiden Leute auf den Weg zu der nur wenige Schritte entfernten Kate des Schreibers und klopften dessen Frau hinaus. Den Schatten, der sich aus dem Mühlentor löste, ihnen bis zu der Kate folgte und hinter ihnen vorbeihuschte, als sie dort eingelassen wurden, bemerkten sie nicht.
Hätte der Schreiber jemandem von seinen Erlebnissen berichten können und wäre dieser Mensch zu der Stelle gegangen, an der Krösmann in seinen tödlichen Schrecken versetzt worden war, hätte er dort nichts vorgefunden als weißen, scheinbar unberührten Schnee und junge, schneebestäubte Tännchen. Den kleinen Hügel aus Schnee, der aussah wie eine Verwehung, hätte wahrscheinlich niemand bemerkt.
Kapitel 4
Leise quietschend öffnete sich die kleine Pforte im Tor des Spitals »Zum Großen Heiligen Kreuz«. Der schwache Lichtschein, der sich hinausstahl und der den frisch gefallenen Schnee wie eine Verheißung glitzern ließ, wurde von zwei Schatten geschwärzt und gleich darauf lag die Straße in der Dunkelheit der tiefen Nacht. Vor ein paar Minuten hatte der Nachtwächter mit der Laterne den Hohen Weg erleuchtet, den Schemen, der sich hinter einen Häuservorsprung geduckt hatte, hätte er nur entdecken können, hätte das Mondlicht just in diesem Moment eine Lücke in der dicken Wolkendecke über der Stadt Goslar gefunden.
Dem spöttisch klingenden »Gott zum Gruß«, das dem alten Pförtner des Spitals zugesäuselt wurde, entgegnete dieser nur ein barsches Brummen, während er eilends davonschlurfte, um endlich auf seinem Lager die verdiente Nachtruhe finden zu können.
Der eine Schatten, den er eingelassen hatte, bewegte sich in einem seltsamen Schaukelgang flink durch die Reihen der Pritschen, auf denen die Siechen und Armen der Stadt von einem besseren und gerechteren Leben träumten und dabei vor sich hin furzten, röchelten oder wirre Sätze brabbelten. Der andere Schatten schlich geduckt, als wenn er aus irgendeiner Richtung einen Schlag befürchtete, zu einer Pritsche in der Nähe der Tür und legte sich, ohne sich auszukleiden, darauf.
Am Ende des großen Saales schloss sich der Vorhang vor der Bettnische, die der Pförtner sein Eigen nennen durfte, und deutlich war das Plumpsen zu vernehmen, mit dem der Mann sich auf sein Lager fallen ließ. Vor seinem Refugium hatte er die Kerze, mit der er den Weg zwischen den Bettreihen schwach erleuchtet hatte, in eine Nische gestellt, wo sie rußig flackerte.
Der flinke Schatten bewegte sich an der Nische vorbei zu einer Tür in der rückwärtigen Wand. Im schwachen Licht blitzte etwas Metallisches auf, das sich mit einem leisen Klirren über den Türknauf legte und diesen drehte.
»Warum kommst du erst heute?«
Der Schatten trat ein, schloss leise die Tür hinter sich, drehte sich um und griff mit der eisernen Klaue, die an der Stelle saß, wo sich normalerweise die rechte Hand befand, nach dem Hut, der auf seinem Kopf saß.
»Dir auch einen guten Abend, herzallerliebste Annabelle!«, ertönte seine samtweiche Stimme.
Die fette Frau, deren Leibesmasse die polsterbezogenen Armlehnen ihres Lehnstuhles auseinanderzusprengen drohte, zuckte nicht beim Anblick des Mannes zusammen, der ihr gegenüberstand. Sie kannte jeden Zentimeter seines zerstörten Körpers nur zu genau, denn sie hatte diesen Körper zusammengeflickt und in einem mühsamen, Monate andauernden Kampf dem lange sehr präsenten Tod abgerungen.
Täglich grübelte sie darüber, ob sich dieser Kampf gelohnt hatte. Gewiss, in einer Hinsicht auf jeden Fall. Denn als er zu Kräften gekommen war, hatte es der Mann verstanden, ihrem zu diesen Zeiten von fast jedem Mann verschmähten Körper Lust zu verschaffen, die sie nicht missen wollte. Ihr machte es nichts aus, ihn dabei anzuschauen. Denn was waren Schönheit oder Hässlichkeit, wenn Berührungen in Körpern Flammen entfachen konnten, die dann meisterlich zu ihren höchsten Gipfeln gepeitscht wurden, bis sie schließlich in eine schwelende Glut zusammenfielen, die noch Stunden danach das Innerste erwärmte?
Das andere, das dieser Mann mit sich gebracht hatte, begann ihr über den Kopf zu wachsen. Es war zu groß geworden, zu schwer zu fassen.
»Habt ihr ihn getroffen?«, fragte die Frau, deren Kinnfalten, die von einigen langen schwarzen Barthaaren geschmückt waren, bei jedem Wort wabbelten, glänzend von dem Speck, den sie vor ein paar Minuten in sich hineingestopft hatte.
»Ja, aber der alte Narr hätte unsere Pläne beinahe zum Scheitern gebracht!«
Aus der Stimme ihres Gegenübers war der spöttische Ton verschwunden. Sie klang müde, und müde sah der Mann auch aus, als er sich mit der Klauenhand eine Strähne des dünnen weißen Haares, das nur auf einer Seite seines Schädels wuchs, aus dem Gesicht strich.
Annabelles Blick saugte sich an der Stelle seines Gesichtes fest, die unbeschadet aus dem Höllenfeuer, das diesen Mann fast verzehrt hatte, hervorgegangen war. Sie vermutete, dass diese Stelle wohl von seiner Hand geschützt worden war, da sie genau die Größe und Form einer Hand hatte und sich von der rechten Stirnseite über das rechte Auge bis hinunter zum rechten Mundwinkel zog.
Die unvernarbte Stelle ließ ahnen, was für ein Mann er gewesen war. Seine zerschlagenen und halb verbrannten Glieder, die sie gerichtet, gesalbt und verbunden hatte, waren lang und schlank gewesen, die Muskeln ausgeprägt. Verbrannte Sehnen und zerschmetterte, verwachsene Knochen hatten sie gekrümmt und verkürzt. Den linken Arm hatte sie ihm zwar retten können, aber Sehnen und Muskeln waren derart zerrissen gewesen, dass er ihm weitgehend unbrauchbar an der Seite herabhing. Wunderbarerweise wusste er drei Finger dieses Armes recht geschickt zu gebrauchen, wenn man den Arm dorthin leitete, wo die Finger ihren Dienst tun sollten.
Der rechte Arm war in seiner Gesamtheit besser dran gewesen. Hier hatte sie allerdings die Hand abnehmen müssen, die im Sturz sein Gesicht geschützt hatte. An dem Armstumpf befestigte er jeden Morgen die Kralle, die er vom Schmied nach genauen Angaben hatte herstellen lassen.
Das unverletzte rechte Auge – das linke hatte sie ihm aus der zerstörten Höhle als verkohlten Klumpen entfernt – konnte sowohl vor Wut als auch vor Mutwillen und Spott eisblau funkeln. Die unverbrannte Seite der Lippen kräuselte sich, wenn er zu scherzen beliebte, in höchst anziehender Weise.
War er immer so ein Teufel gewesen wie heute, oder hatte sein Unfall ihn dazu gemacht?
Annabelle, die nie wirklich eine »schöne Anna« gewesen war, kannte die Hoffart, mit der sich schöne Menschen oft schmückten. Sie wusste um deren Unvermögen, sich in die Schmach hineinzudenken, die es hässlichen Menschen bereitete, entweder abfällig behandelt oder sogar übersehen zu werden. Er jedoch hatte sich mit dem grausamen Schicksal arrangiert, aus einem schönen Menschen zu einem hässlichen geworden zu sein. Als sie ihn einmal nach einem neckischen Tumult im Bett gefragt hatte, wie er dieses Schicksal zu ertragen vermochte, hatte er nur spöttisch gelacht und einen seiner kleinen, spontan gedichteten Verse angefügt:
»Dem Teufel ist’s gar einerlei,
in welch’ Gestalt er Teufel sei!«
»Was ist denn passiert?«, verlangte sie zu wissen.
»Eigentlich hätte alles reibungslos gehen müssen. Ich habe ihn zum Fenster seiner Studierstube gelockt, wo er sich gerade über seiner Predigt für den Sonntag ereiferte. Er öffnete es eher widerwillig, als ich ihm den Bankert zeigte, doch er öffnete es. Er wollte jedoch nicht mitkommen, sondern verwies mich mit harschen Worten auf den nächsten Morgen. Ich sollte mit dem Kind in die Kirche kommen, es sei sicher früh genug, wenn es dann getauft würde. Meine Worte, dass es dem Kinde schlecht gehe und es einer Nottaufe bedürfe, überzeugten ihn nicht. Da gab ich Eike, der sich neben mir an die Mauer gedrückt hatte, ein vorher vereinbartes Zeichen, nach dem er ein wenig nachhelfen sollte, falls meine Überzeugungsworte allein nicht ihre Wirkung tun sollten. Eike machte seine Sache bestens. Aber der Alte wehrte sich nicht sehr, sei es aus Überraschung, sei es, weil er erkannte, dass man ihn hier nur zur Ausübung seiner ureigensten Pflicht nötigte. In der Kutsche verrutschte dann meine Kapuze. Ich merkte es erst an dem Schrecken, mit dem er mich ansah. Dummerweise schien in diesem Augenblick das Mondlicht hell durch die Wolken. Ich versuchte, die Kapuze zu richten, und da glitt mir der Bankert aus dem Mantel. Der Alte erkannte sofort, dass das Balg tot war, und das nicht erst seit ein paar Minuten. Er fing an zu jammern und zu nörgeln, dass man ihn schleunigst zurückbringen solle.«
»Und da hast du ihn umgebracht? Gab es keine anderen Mittel?«





























