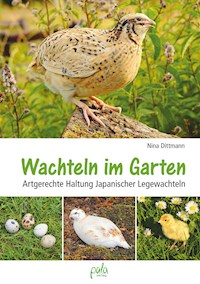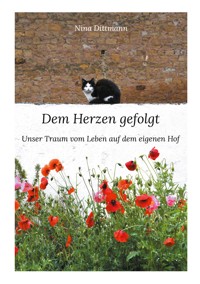Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mai 1914. Henning und Isabell Richard besteigen das hochmoderne Dampfschiff 'Kigoma' der Hamburger Woermann-Reederei mit Ziel Swakopmund. Sie hoffen auf eine erfüllte Zukunft als Arzt und Krankenschwester in Deutsch-Südwestafrika. Das koloniale Leben unter der Sonne Afrikas zeigt sich ihnen zunächst aufregend und eigentümlich bekannt, aber auch zutiefst widersprüchlich. Ihr Weg führt sie nach Goanikontes, ein grünes Tal mitten in der Namibwüste, das ihnen wie ein kleines Paradies erscheint. Schon fühlen sie sich angekommen, als das Abenteuer Auswanderung durch den Ersten Weltkrieg und das Ende der Kolonie dramatisch gestoppt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dies ist ein historischer Roman. Er basiert im Wesentlichen auf zwei Büchern, die mein Urgroßvater zwischen 1914 und 1919 als Zeitzeuge in Deutsch-Südwestafrika verfasst hat. Die Geschichte von Henning und Isabell Richard jedoch ist fiktiv. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden, so dass Fakten und Fiktion eine untrennbare künstlerische Einheit bilden.
Bei vier Recherchereisen nach Namibia haben mein Mann und ich die Orte des Geschehens besucht, akribisch nach familiären und zeitgeschichtlichen Spuren gesucht und dem Roman so die nötige Authentizität gegeben.
Inhaltsverzeichnis
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
EINS
„Komm Schatz, wir machen das“, rief Henning begeistert aus und hatte dabei wieder dieses aufgeregte Funkeln in den Augen, das ich inzwischen schon zu gut kannte.
„Ich sehe es schon genau: Du und ich, weit weg von diesem Schietwetter in Afrika und mit einer Aufgabe, die uns wirklich erfüllt. Es gibt so viele neue Siedler, da braucht man dringend Ärzte, gerade Chirurgen. Wir können da echte Aufbauarbeit leisten, wir Zwei, das weiß ich!“
„Aha“, murmelte ich, während ich über das Waschbecken gebeugt Salatblätter wusch. Es war ein langer Arbeitstag gewesen. Ich freute mich auf ein leichtes Abendbrot und auf mein Bett.
„Gestern bei der Versammlung hat Herr Winter von der Kolonialgesellschaft wieder auf den eklatanten Ärztemangel in Südwest hingewiesen. Es gibt ein paar Ärzte an den Militärstützpunkten, das war’s dann aber auch. Für die Zivilbevölkerung ist niemand zuständig, erst recht nicht im Inland. Wir beide haben es in der Hand, das zu ändern!“
Wie so oft bei diesem Thema redete sich Henning regelrecht in Fahrt vor Tatendrang. Seine Wangen begannen zu glühen, und er musste mehrfach schlucken vor Aufregung.
„Und außerdem hat er gesagt, dass es für deutsche Ärzte eigenes Land zu Vorzugspreisen gibt. Das ist unsere Chance, Liebling, ehrlich. Du wolltest doch immer Abenteuer, jetzt kannst du’s haben!“
Erwartungsfroh strahlte er mich mit seinen ausdrucksvollen Augen an. Milde lächelte ich zurück. Die Idee, nach Afrika auszuwandern, begeisterte meinen Mann schon länger. Seit Monaten redete er von nichts anderem mehr und beschäftigte sich in jeder freien Minute mit dem Leben in den deutschen Kolonien südlich des Äquators. Er besuchte Werbeveranstaltungen der Kolonialgesellschaft und ließ sich die ‚Kolonialzeitung‘ ins Haus schicken, die regelmäßig erschien und blumig beschrieb, wie das Leben in den fernen Dependancen des Deutschen Reichs aussah.
‚Südwest‘ war noch nicht lange Reichskolonie. Erst spät, als die anderen Kolonialmächte Europas schon große Teile der Erde für sich beansprucht hatten, war das Deutsche Reich in den internationalen Wettbewerb um den Besitz der vermeintlich letzten unverteilten Gebiete eingetreten. Erhoffte wertvolle Rohstoffe für die rasch voranschreitende Industrialisierung und viel Platz in den fremden Ländern trieben nun auch die Deutschen an, unter ihnen viele Kaufleute, die gute Geschäfte witterten.
1884 hatte der Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz durch seinen erst 21jährigen Gesandten Heinrich Vogelsang den in Südwestafrika unter anderem ansässigen Namas zielstrebig ein großes Stück Land abkaufen lassen und einen Handelsposten eröffnet. Er besaß damit den Küstenabschnitt nördlich des Oranje auf einer Länge von 150 km und schaffte Tatsachen. Plötzlich gab es deutsches Territorium am südlichen Zipfel Afrikas. In der Welle ehrgeiziger Kolonialisierungspläne schaffte er es damit, dass Reichskanzler Bismarck eine Schutzerklärung für das Land abgab. Sechs weitere deutsche Kolonien sollten bis zum Jahr 1900 folgen: Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika, Neuguinea, Kiautschou in China sowie zuletzt Samoa und einige kleinere Inseln in der Südsee. Innerhalb weniger Jahre beanspruchte das Deutsche Reich zusätzliche Gebiete auf der ganzen Welt verteilt und war wie seine europäischen Nachbarn zur Kolonialmacht geworden.
Ich weiß gar nicht mehr so recht, wie es eigentlich angefangen hatte mit Hennings Begeisterung für ein Leben in Afrika. Ich denke, dass es der regelmäßige Kontakt zu seinem alten Schulfreund Uwe war, der ihn überhaupt auf die Idee gebracht hatte. Uwe war vor noch nicht allzu langer Zeit ausgewandert. Er war Tierpfleger und kümmerte sich um Strauße, die auf einer Farm irgendwo in der Namib gehalten wurden. Der bekannte Hamburger Zoobesitzer Karl Hagenbeck hatte in Südwest ein ehrgeiziges Projekt gestartet: Er züchtete die großen Vögel für den Fleisch- und Federexport nach Europa. Zuchttiere dazu führte er extra aus Deutschland ein, begleitet und versorgt von deutschen Tierpflegern. Uwe hatte zuvor mehrere Jahre im Zoo von Hagenbeck gearbeitet. Er war ungebunden und so kam es ihm sehr entgegen, als ihm von seinem Chef persönlich die Stelle in Südwest angeboten worden war. Ohne zu zögern griff er zu und begleitete bereits einige Wochen später ein halbes Dutzend Strauße zurück in ihre ursprüngliche Heimat.
Er und Henning kannten sich seit frühester Kindheit. Sie waren seit jeher eng befreundet und standen seit Uwes Auswanderung in regem Briefkontakt. Spannend beschrieb er jedes Mal seine Erlebnisse im fernen Afrika, und mit jeder Nachricht, die uns in zerknitterten und schmutzigen Briefumschlägen über tausende von Kilometer erreichte, wurde mein Mann sich sicherer: Dorthin wollte er auch. Henning hatte gerade seine Facharztausbildung zum Chirurgen beendet und suchte nun nach einer beruflichen Herausforderung. Noch waren wir beiden am Universitätsklinikum Eppendorf angestellt, ich als Krankenschwester, er als chirurgischer Unterarzt.
Uns beiden machte die Arbeit Spaß, aber wir waren uns sicher, dass da noch etwas anderes kommen musste.
Zu abenteuerlustig und zu freiheitsliebend waren wir beide, als dass wir uns vorstellen konnten, unser gesamtes Arbeitsleben in einem Krankenhaus im Schichtdienst und mit immer den gleichen Abläufen zu verbringen. Henning hatte den Traum eines Landarztes, am liebsten weit entfernt von jeglichen Zwängen der preußischen Bürokratie. Von der gab es im Deutschen Reich schon vor dem Krieg mehr als genug. Alles war organisiert, alles war geregelt. Henning dagegen suchte das Neue, das Ungeregelte, um sich nach seinen Vorstellungen und ohne bürokratische Hindernisse etwas aufzubauen, das den Menschen vor Ort wirklich half. In Deutsch-Südwestafrika, weit weg von Berlin, gab es zwar auch deutsche Krankenhäuser, aber keine niedergelassenen Ärzte. Zu dünn besiedelt war die Kolonie, als dass sich eine Praxis gelohnt hätte. Das wollte Henning ändern, zur Not mit einem zweiten beruflichen Standbein.
Mit der Zeit hatte ich mich von seiner Begeisterung anstecken lassen. Auch mir war Deutschland mit all seinen gesellschaftlichen Regeln und Verpflichtungen inzwischen einfach zu eng. Ich wünschte mir ein spannendes und abwechslungsreiches Leben an der Seite meines Mannes, in dem wir Dinge sahen und taten, die sich auch für mich als Frau außerhalb von Küche, Kindern und Kirche abspielten. Kurz gesagt, ich suchte genauso wie mein Mann das Abenteuer und die Freiheit.
Wir waren erst seit Kurzem verheiratet und sehr glücklich miteinander. Von Anfang an waren wir ein perfektes Team. Kennengelernt hatten wir uns in der Ambulanz, in der ich seit dem Ende meiner Krankenschwesterausbildung arbeitete. Während eines ruhigen Spätdienstes ohne Notfall hatte ich die Zeit genutzt und die Verbandsmittelbestände auf der Station geordnet. Ich war allein und hing zufrieden meinen Gedanken nach, die sich um einen ausgesprochen schönen Ausflug mit meinen Freundinnen drehten. Ein paar Tage zuvor waren wir an der Ostsee gewesen. Die Eltern einer meiner Freundinnen hatten dort ein Ferienhaus direkt am Strand. Das Wetter war traumhaft gewesen und selten hatten wir so viel gelacht. Ich war dankbar und zufrieden, so lange und intensive Freundschaften zu haben. Wir alle kannten uns schon aus der Schule und hatten uns trotz unterschiedlicher weiterer Lebenswege nicht aus den Augen verloren. Wie früher waren wir über den Strand getobt, hatten uns in die Brandung geworfen und danach faul im Sand von der warmen Sonne trocknen lassen. Abends erzählten wir uns Geschichten, bei denen die anderen raten mussten, ob sie wahr oder falsch waren. Alles war so herrlich unbeschwert!
Als ich so meinen Gedanken nachhing, flog plötzlich die Tür auf.
„So, dann wollen wir mal…“, platzte Henning als diensthabender Assistenzarzt routinemäßig heraus, noch bevor er den Raum richtig betreten hatte.
„Wollen wir was genau?“, antwortete ich keck, denn die Unbeschwertheit des vergangenen Wochenendes beflügelte mich immer noch. Langsam drehte ich mich zu ihm um, aber sein Anblick ließ mich jäh verstummen. Groß und souverän stand er da in seinem weißen Arztkittel, mit etwas widerspenstigen blonden Haaren und spitzbübischen Gesichtszügen, die in interessantem Kontrast zu seiner würdevollen Erscheinung standen. Um seinen Hals hing ärztetypisch ein Stethoskop, das ihm eine gewisse Autorität verlieh, auch wenn seine Hosenbeine eine Spur zu kurz waren. Perplex starrte ich ihn an. Wir waren uns im Krankenhaus bisher noch nicht begegnet, und ihm erging es offenbar ähnlich. Eine gefühlte Ewigkeit sprach keiner von uns, dann räusperte er sich und bemühte sich um einen professionellen Ton:
„Ich dachte, die frisch eingelieferte Knöchelfraktur würde hier sehnsüchtig auf ärztlichen Beistand warten. Ist sie schon wieder fortgehumpelt?“
An kleinen Fältchen um die Augen erkannte ich, dass dieser Mann viel und gerne lachte. Ich beschloss spontan, ihm trotz unseres Standesunterschieds auf Augenhöhe entgegenzutreten.
„Ja, sie hat vergessen, dass sie noch Essen auf dem Herd hat und musste schleunigst los“, witzelte ich und hätte mir postwendend auf die Zunge beißen können für so eine flache, respektlose Erwiderung. Betreten drehte ich mich zurück zu meinen Verbandsstoffen. Wahrscheinlich war ich über das Ziel hinausgeschossen. Wie hatten wir in der Schwesternschule gelernt? Immer schön höflich sein zu den Ärzten.
„Jawoll, aber wenn sie den Herd ausgestellt hat, kommt sie zurück, oder?“, nahm er den Faden wieder auf und lachte dabei jungenhaft und schelmisch. Das Eis war gebrochen. Lächelnd drehte ich mich zu ihm zurück.
„Nein, nein, sie ist in Zimmer 2 und wartet tatsächlich. Hier fand bis eben eine Herz-Kreislauf-Überwachung statt, der Raum war nicht schnell genug frei.“
Irrte ich mich, oder entdeckte ich eine Spur Enttäuschung in seinem Blick, dass er den Raum so schnell wieder verlassen und seiner ärztlichen Pflicht nachkommen musste?
Ich jedenfalls war in dem Moment froh, dass er nicht mein Herz abhören sollte, so schnell wie es klopfte.
Am nächsten Tag hatten wir gemeinsam Nachdienst. Es war eine ruhige Nacht, nur wenige Notfälle wurden eingeliefert. Zeit genug für unkomplizierte Unterhaltungen. Ich war verblüfft, wie vertraut Henning mir von Anfang an war und wie selbstverständlich wir miteinander arbeiteten. Zum Schichtende hin nahm er erkennbar seinen Mut zusammen:
„Morgen ist das Wetter so wunderbar angesagt, haben Sie Lust auf einen Spaziergang an der Alster?“
Von da an war jeder Tag ohne den anderen ein verlorener Tag. Schon nach drei Monaten heirateten wir an einem stürmischen Tag in Kiel und wussten beide, dass auch unsere Ehe gut gegen Wind und Wetter geschützt sein würde.
Nach der Hochzeit lebten wir zunächst in einem möblierten Zimmer in einer herrschaftlichen Villa an der Alster zur Untermiete. Das Haus gehörte einer älteren Witwe, deren Mann als Reeder um die Jahrhundertwende sehr viel Geld verdient hatte. Frau Finke hatte es eigentlich nicht nötig, zu vermieten, aber ganz offensichtlich wollte sie nicht allein in ihrem riesigen Anwesen leben und nahm daher nur eine verhältnismäßig geringe Miete. Gut bezahlbar für einen jungen Unterarzt und eine Krankenschwester am Anfang ihrer beruflichen Karriere. Im Gegenzug erwartete sie etwas Gesellschaft in Form eines gemeinsamen Kaffeetrinkens am Sonntagnachmittag und dann und wann eine Unterhaltung.
Wir hatten es nicht schlecht bei Frau Finke. Das Haus war wunderschön gelegen und hatte einen parkähnlichen Garten, den wir mitbenutzen konnten. Für Haushalt und Garten gab es Personal. In Abständen leisteten wir Frau Finke in ihrem Salon bei einer Tasse Tee mit einem hanseatisch ordentlichen Schuss Rum Gesellschaft und plauderten über das Wetter und die aktuellen Ereignisse aus der Umgebung. An unseren Lebensumständen gab eigentlich nichts zu beanstanden, zumal unsere Vermieterin eine weitgereiste und eloquente Dame war. Unsere Freunde beneideten uns um unsere feudale Wohnung, die ganz und gar nicht unserem Geldbeutel entsprach, denn wenn wir müde aus dem Krankenhaus kamen, war unser Zimmer warm und in der Küche fand sich immer etwas zum Essen.
Und dennoch, und ohne zunächst explizit darüber geredet zu haben, wussten wir beide, dass dieses Domizil nur eine Übergangslösung sein würde. In der Villa war trotz einer emsigen Putzfrau alles irgendwie eingestaubt: Die wertvollen Teppiche, die schweren Gardinen, ja sogar die Erscheinung unserer Vermieterin. Die Zeit schien dort stehengeblieben zu sein vor vielen, vielen Jahren. Trotz der Großzügigkeit um uns herum fühlten wir uns merkwürdig eingeengt und gehemmt in unserer Lebensführung. Wir sehnten uns damals nach absoluter Freiheit und Leichtfüßigkeit.
Regelmäßig zum Beispiel war es ein schwieriges Unterfangen, sich über die knarrenden Treppenstufen an Frau Finke vorbei zu schummeln, wenn wir abends oder am Wochenende länger ausgegangen waren. Viel zu sehr war sie an Neuigkeiten ‚von draußen‘ interessiert. Immer stand sie erwartungsvoll in ihrem geblümten Bademantel in der Empfangshalle, musterte uns und unsere Bekleidung dezent und fing ein vermeintlich unkompliziertes Gespräch an:
„Ach, Sie waren aus?!“, bemerkte sie mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks, woraufhin Henning nicht weniger stereotyp antwortete:
„Wissen sie, Frau Funke, heute ist ein besonderer Tag. Heute war es eine Ausnahme, dass wir aus waren.“
Wie und warum der Tag besonders war, ließ er dabei jedes Mal offen und Frau Finke wagte nicht zu fragen, dazu war sie zu sehr von der alten Schule. Irgendwann musste ich innerlich schon grinsen, wenn ich den geblümten Bademantel nur erahnte, denn die nachfolgende Unterhaltung verlief jedes Mal exakt nach dem gleichen Muster. Meist grinste Henning mich im Anschluss triumphierend an, und beschwingt nahmen wir die letzten Stufen zu unserem altmodisch eingerichteten Zimmer im Obergeschoss mit Toilette auf halber Höhe des Treppenhauses.
Etwa ein Jahr lebten wir bei Frau Finke. Für unsere erste gemeinsame Wohnung nach der Hochzeit war die Bleibe ein Glückstreffer. Unser echtes Zuhause aber würden wir irgendwo anders finden, da waren wir sicher. Damals wussten wir nur noch nicht, wo.
Eines Sonntags spazierten wir wieder einmal den
Petersenkai am Hamburger Baakenhafen entlang und ließen das emsige Treiben auf uns wirken. Wie Ende jeden Monats sollte ein Schiff der Woermann-Linie in Kürze ablegen. Dieses Mal war es die ‚Professor-Woermann‘, ein moderner, stattlicher Dampfer. Auf dem etwa einen Kilometer langen Kai, der von der Reederei exklusiv für seine Afrika-Linien angemietet worden war, herrschte eine Art Volksfeststimmung. Viele Menschen hatten sich eingefunden. Eine kleine Musikkapelle spielte, geschäftig wurden Koffer, Kisten und Proviant für die nächsten Wochen verladen. Die Reisenden verabschiedeten sich mehr oder weniger tränenreich von ihren Verwandten. Überall spürte man die Aufregung der Auswanderer, die der Start in ein neues Leben mit sich brachte.
Schon seit den 1880er Jahren bestanden regelmäßige Verbindungen nach Afrika. Die Woermann-Flotte war eine der größten Reedereien der Welt und führend bei Afrikafahrten. Bis Togo war man etwa 14 Tage unterwegs, bis Südwest 26 Tage. Die Verbindung nach Deutsch-Ostafrika lief durch das Mittelmeer und den Suez-kanal. Wir liebten diese spannungsgeladene Geschäftigkeit und dieses ‚Endlich-geht-es-los-Gefühl‘. Sofort ergriff uns wieder das Fernweh.
So kam es, dass wir zum Ende des Jahres 1913 mit konkreten Planungen für unsere Auswanderung begannen. Üblicherweise gingen die Ehemänner zunächst allein in die Kolonien, bauten die Existenz auf und holten ihre Familien nach, wenn die Lebensumstände gesichert waren. Das jedoch wäre für uns nicht zu ertragen gewesen.
Einmal hatte Henning einen halbherzigen Versuch unternommen, mich zunächst in Hamburg zu lassen. Er tat es aus reiner Fürsorge für mich, und schon beim ersten Satz bemerkte ich, dass sein Herz ganz anderer Meinung war als das, was er mir zu erklären versuchte:
„Weißt du, Schatz, wir wissen doch gar nicht, was uns dort erwartet. Es wird seinen Grund haben, dass so viele Männer allein in die Kolonien gehen, und ich kann ja nicht immer auf dich aufpassen. Was meinst du, willst du nicht lieber erstmal bei deinen Eltern bleiben und ich baue uns ein schönes Nest?“ Verkrampft versuchte er, mich möglichst unbeteiligt anzusehen, was ihm aber gänzlich misslang.
„Kommt ja wohl überhaupt nicht in Frage“, wetterte ich. „Meinst du wirklich, ich lasse mir auch nur einen Tag unseres Abenteuers entgehen? Nein, nein, egal wie gefährlich und entbehrungsreich die nächsten Jahre auch sein werden, ich will mit. Du kennst mich doch, im Schaukelstuhl herumzusitzen und zu warten ist nichts für mich. Das war ich noch nie und das werde ich nie sein. Wir sind beide kräftig und gesund und können zusammen unschlagbar gut anpacken, das weißt du. “
Emsig nickte Henning. Er wusste nur zu genau, was für ein eingespieltes Team wir beruflich und privat waren.
„Und außerdem hältst du es ja sowieso nicht mehr als ein paar Stunden ohne mich aus“, fügte ich schelmisch hinzu und legte meine Hand behutsam auf seine Wange. Dankbar neigte er den Kopf und drückte sie zwischen Schulter und Kopf.
„Klar weiß ich das, und du kennst mich halt auch zu gut“, gab er erleichtert zu. „Ich wollte es ja auch nur mal vorschlagen. Weißt du, ich höre immer wieder, dass es verantwortungslos ist, junge Frauen nach Afrika zu bringen, aber wahrscheinlich ist das ja der pure Neid derjenigen, die allein gehen müssen.“
Noch etwas besorgt blickte er mich an, aber ich hielt seinem Blick unbeirrt stand. Jede weitere Argumentation war zwecklos, das wusste er, und meine Vehemenz kam ihm in diesem Fall mehr als entgegen. Die Sache war geklärt.
„Aber sag hinterher nicht, ich hätte dich mitgeschleppt!“ Zufrieden lächelnd nahm er mich in den Arm, hob mich einige Zentimeter vom Boden ab und drehte sich mit mir sachte im Kreis.
Händeringend wurden damals Ärzte und Schwestern für die Lazarette der Schutztruppe gesucht. Es wäre der einfachste Weg gewesen: Eine Offizierskarriere beim Militär als Stabsarzt mit regelmäßigem Gehalt aus Berlin, festen Arbeitszeiten und geregeltem Urlaub. Alles preußisch organisiert und sicher. Genau das aber wollten Henning und ich nicht, darüber waren wir uns einig, zumindest nicht auf Dauer. Andererseits waren wir auch nicht so wagemutig und blauäugig, als dass wir wie Glücksritter auf ihrer Suche nach Gold einfach mal so aufbrachen. Wir brauchten einen Einstieg, einen Anfangspunkt, von dem aus wir unser Leben wie auch immer gestalten konnten. Dieser Einstieg bot sich uns in Form einer Urlaubsvertretung in einem Krankenhaus in Swakopmund. Dort gab es ein Lazarett mit angegliedertem Krankenhaus für die Zivilbevölkerung. Die dortigen Ärzte wurden überwiegend durch das Militär gestellt. Oftmals sparten sie sich ihren gesetzlich zugesicherten Urlaub auf, um für einige Wochen nach Europa zurückzukehren. In diesem Zeitraum konnten die Patienten natürlich nicht unversorgt gelassen werden, so dass immer wieder ‚Springer‘ benötigt wurden, die die ärztlichen Behandlungen fortführten. Das sollte unser Einstieg werden! Henning bewarb sich in Berlin beim kaiserlichen Hauptquartier des Heeres für eine befristete Urlaubsvertretung in Deutsch-Südwestafrika.
Einige Wochen warteten wir auf eine Antwort aus Berlin und wurden immer nervöser. Wir hatten den Entschluss zum Auswandern getroffen, nun sollte es auch losgehen. Was, wenn Henning nicht benötigt werden würde, weil er nicht ausreichend für einen Einsatz in den Tropen ausgebildet war? Was, wenn eine militärische Grundausbildung Voraussetzung für einen Arbeitsvertrag war? Henning hatte sein Studium direkt nach dem Abitur begonnen und war während dieser Zeit nicht einmal Mitglied in einer Studentenverbindung gewesen. Er hasste jede Art von Uniformierung. Die Stelle als Vertretungsarzt sollte Mittel zum Zweck sein, erste Schritte in Deutsch-Südwest machen zu können. Nicht mehr und nicht weniger. Hatte er das gegenüber den Herren des Heereshauptquartiers angemessen verstecken können?
Als wir schon anfingen, uns eine Alternative für unseren beruflichen Einstieg zu überlegen, ließ es sich Frau Finke eines Abends nicht nehmen, uns das förmliche Schreiben persönlich zu überbringen. Beiläufig fing sie uns auf dem Weg ins Obergeschoss ab, dieses Mal nicht im typischen geblümten Bademantel und sichtbar aufgeregt:
„Ach, Herr Richard, das ist aber gut, dass wir uns zufällig sehen. Heute ist ein Brief für Sie aus Berlin gekommen. Was gibt es denn so Wichtiges, das in unserer Hauptstadt entschieden werden muss?“
„Wissen Sie, Frau Finke, wir haben da ein Forschungsprojekt im Krankenhaus, bei dem wir in Kontakt mit Berlin stehen“, flunkerte Henning. Von der Seite bemerkte ich, dass er leicht errötete. Er war ein schlechter Lügner, aber wir waren übereingekommen, möglichst wenig über unsere Pläne zu reden, bevor nichts in den berühmten trockenen Tüchern war. Uns stand nicht der Sinn danach, ständig angesprochen zu werden, wann wir denn gingen.
„So, so, Forschungsprojekt…“, murmelte unsere Vermieterin mit schiefgelegtem Kopf. Ganz offensichtlich nahm sie ihm die Geschichte nicht ab. Henning beschloss, sich nicht tiefer in die Sache hineinzureiten.
„Ja, dann nehmen wir den Brief jetzt mal mit nach oben, morgen ist auch noch ein Tag, sich damit zu beschäftigen“, sagte er und drehte sich abrupt zur Treppe.
Verblüfft blieb Frau Finke zurück. So wortkarg kannte sie ihren Untermieter nicht. Skeptisch blickte sie uns nach.
Kaum dass wir unsere Zimmertür hinter uns geschlossen hatten, riss Henning das Kuvert auf.
„Puuh, lange kann ich diese Geheimnistuerei nicht mehr aushalten!“
„Ich auch nicht, wir sind offenbar einfach zu anständig für diese Welt. Hoffentlich wissen wir jetzt endlich mal, wann wir unsere Koffer packen können!“
„Ja, das hoffe ich auch sehr. Gerade liegt unsere Zukunft in diesem Brief!“.
Hektisch zog er das dünne Stück Papier aus dem Umschlag, überflog den Inhalt und grinste mich breit an.
„Also, dann, fang schon mal mit Packen an, mein Liebling! Sie haben uns genommen! Ich soll eine Urlaubsvertretung im Swakopmunder Krankenhaus übernehmen und du wirst Hilfspflegerin im zivilen Bereich. Ist das nicht großartig? Das Abenteuer beginnt!“
ZWEI
„Was wollt ihr? Seid ihr wahnsinnig?“, rief meine Mutter entgeistert, als wir meinen Eltern Weihnachten 1913 erstmals von unserem Vorhaben berichteten.
„Aber da gibt’s doch nur Hottentotten und wilde Tiere, da kann man doch nicht leben!“
Entsetzt blickte sie in die Runde und dann zu meinem Vater. Der saß scheinbar ungerührt an der festlich geschmückten Tafel und schnitt weiter Fleisch von seiner Gänsekeule, während meine Mutter hektische rote Flecken am Hals bekam und mit einem lauten Klappern das Besteck fallen ließ.
„Kind, ich kann es nicht glauben! So weit weg von uns und mitten im Busch? Das kannst du nicht machen! Wie stellst du dir das denn vor?“
Die Flecken breiteten sich aus, und ich bemerkte, dass ihre Stimme zunehmend schriller wurde.
„Ja, Mama, das weiß ich noch nicht so genau, aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind jung, gut ausgebildet und außerdem nicht allein in Südwest. Da wohnen schon einige tausend Leute und mit jedem Schiff der Woermann-Linie werden es mehr. Alles in Ordnung, hier, guck mal!“
Ich war auf ihre Reaktion vorbereitet und hatte vorausschauend die letzten Ausgaben der ‚Kolonialzeitung‘ mitgebracht. Darin fand sich alles Wissenswerte: Reiseberichte, Inserate und viele Fotos unserer neuen Heimat. Sofort ergriff mich wieder die Vorfreude.
Mein Vater war immer noch erstaunlich ruhig. Genüsslich nahm er einen großen Bissen Knödel mit Soße und kaute ausgiebig, gerade so als habe er nicht gehört, was seine einzige Tochter für abenteuerliche Pläne hatte. Lange Zeit sagte er nichts, sondern blickte nachdenklich auf seinen Teller.
„Also, ich finde es gut“, sagte er schließlich und erteilte uns damit so etwas wie eine Absolution. Ich war sehr dankbar über diesen einen Satz, denn ich wusste, dass mein Vater nie ein vorschnelles Urteil von sich gab. Er würde meine Mutter über kurz oder lang überzeugen, auch wenn es dazu sicher einiger Sätze mehr bedurfte.
Mit befristeten Arbeitsverträgen und dem ‚Segen‘ meiner Eltern kümmerten wir uns als nächstes um unsere Abreise. Die Deutsche Ostafrika-Linie der Hamburger Woermann-Gesellschaft hatte gerade einen neuen Reichspostdampfer in Betrieb genommen, der seine Jungfernfahrt um Helgoland mit Bravour gemeistert hatte. Ein Schiff mit modernster Technik, gebaut für über 300 Passagiere. Nun sollte sie zu ihrer ersten großen Afrikafahrt in See stechen. Durch unsere Arbeitsverträge wurden uns vom Heereshauptquartier zwei verbilligte Fahrkarten für die Erste Klasse zur Verfügung gestellt. Günstig waren die Überfahrten nicht, die einfachsten Kabinenplätze kosteten schon 500 Reichsmark. Wer sich mit dem Zwischendeck zufrieden gab, konnte für ‚nur‘ 200 Reichsmark bis nach Südafrika kommen. So kurz nach unserer Berufsausbildung waren Tickets für die Erste Klasse also nicht gerade angemessen für uns, dennoch nahm ich die Möglichkeit einer luxuriösen Überfahrt gerne an. Das Zwischendeck, das oft nachträglich in Schiffe eingebaut wurde, um zusätzliche Passagiere transportieren zu können, war eine gesundheitliche Herausforderung. Kein Tageslicht, keine Rückzugsmöglichkeiten und eine Enge, die das Immunsystem auf eine harte Probe stellte. Oft genug hatten wir im Krankenhaus Passagiere aus dem Zwischendeck, die an Durchfallerkrankungen oder Tropenkrankheiten litten, mit denen sie sich bei Mitreisenden angesteckt hatten und die unterwegs nicht auskuriert werden konnten. Wir wussten, dass wir auf uns aufpassen mussten, wenn wir unsere Kräfte für unseren Start in das neue Leben behalten wollten.
Unsere Abreise stand also fest, nun war es an der Zeit, Freunde und Verwandte zu informieren. Mir war mulmig dabei, denn unsere Liebsten zurückzulassen, war die Kehrseite der Medaille. Meine Freundinnen, meine Eltern, lieb gewonnene Arbeitskollegen, viele von ihnen würde ich vielleicht nie wieder sehen. Hennings Eltern waren früh verstorben, schon bevor wir uns kennengelernt hatten, und Geschwister hatten wir beide nicht. Ich wusste, dass ich gerade meinen Eltern wehtat mit meinem Weggang, aber immer, wenn der Kloß in meinem Hals zu dick wurde, dachte ich an die Sonne Afrikas und unsere spannende Zukunft und schluckte ihn herunter. Auch die Südwester machten schließlich Urlaub, und die Verbindungen von uns nach Europa wurden immer besser. Wir würden sie alle regelmäßig besuchen, wenn wir in unserer neuen Heimat erstmal Fuß gefasst hätten. Das nahmen wir uns fest vor!
Wie erwartet kullerten dicke Tränen bei meinen Freundinnen und erstaunlicherweise auch bei vielen Bekannten und Kollegen. „Das könnt ihr doch nicht machen“, war auch hier der allgemeine Tenor, und sogar Frau Finke fiel aus allen Wolken, als wir unser Zimmer kündigten.
„Also doch kein Forschungsprojekt, jedenfalls keins im Auftrag des Krankenhauses“, meinte sie resigniert. „Schade, schade, ich hatte mich gerade an frischen Wind in diesen alten Mauern gewöhnt. Aber gut, der Sog der Kolonien ist so stark, dass ich verstehe, wenn junge Menschen sich hineinziehen lassen. Das Leben dort soll ja prächtige Möglichkeiten bieten! Wäre ich nicht so alt, würde ich auch noch mein Köfferchen packen! Kommen Sie, wir trinken einen Tee mit einem besonders ordentlichen Schuss Rum zum Abschied und dann nehme ich Ihnen das Versprechen ab, mir mindestens einmal im Monat zu schreiben!“
Und so saßen wir ein letztes Mal im mondänen Salon mit den wertvollen Teppichen und den schweren Gardinen. Es tat mir leid für Frau Finke, dass sie nun vielleicht wieder in einen Zustand der Eintönigkeit verfallen würde und nahm mir fest vor, ihr tatsächlich regelmäßig Briefe zu schicken.
Unser weniges Hab und Gut lagerten wir bei meinen Eltern ein oder verschenkten es an ein Frauenhaus in der festen Überzeugung, es nie wieder brauchen zu müssen. Zu Beginn unseres neuen Lebens passte unser Besitz in zwei große Kisten.
Der Tag der Abreise rückte näher, und wir wurden immer aufgeregter. Noch einmal trafen wir uns mit allen, die uns wichtig waren, konnten aber schwer mit ihrer Trauer umgehen. Sie waren diejenigen, die zurückblieben, deren Leben sich nicht drastisch ändern würde in der nächsten Zeit und die teilweise selbst haderten mit ihrer Unentschlossenheit, neue Wege zu gehen. Wir konnten ihnen schlecht helfen, denn natürlich waren wir es, die gingen und natürlich musste jeder die Entscheidungen für sein eigenes Leben treffen. Aus dieser Sicht heraus waren wir froh, als es etwa zwei Wochen später endlich losging.
Das Schiff übertraf in punkto Bequemlichkeit unsere kühnsten Erwartungen: Die großen, elegant eingerichteten Gesellschaftsräume der Ersten Klasse waren mit Marmorvertäfelung ausgestattet und bestanden aus Speisezimmer, Halle, Wohnzimmer und einem Rauchsalon. Für die kleinen Passagiere gab es mehrere Kinderzimmer, eins auf dem Hauptdeck und eins auf dem Bootsdeck. Dort war auch eine Turnhalle mit Sportgeräten, in der sogar kleinere Wettkämpfe für die Gäste geplant waren. Vorn erlaubten Promenadendecks mit Glasscheiben den Passagieren einen angenehmen Aufenthalt auf Deck auch bei nordeuropäischem Nieselregen.
Unser persönlicher Steward begleitete uns zur Kabine. Auch sie bot ungeahnten Luxus für ein Schiff und erst recht für uns, wo wir doch beide aus Mittelschichtsfamilien stammten und Luxus erst bei Frau Finke kennengelernt hatten. Die Einrichtung war äußerst geschmackvoll und solide. Wir fühlten uns wie in einem Hotelzimmer der Spitzenklasse. Alles war auf dem neuesten Stand. Unser Gepäck wurde in große, bequem zugängliche Gepäckräume verladen, so dass wir nicht einmal beengt durch unsere Koffer waren. Es war unglaublich, Henning und ich fanden vor Staunen kaum Worte für so viel Eleganz.
„Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auf diesem herausragenden Schiff der Woermann-Linie auf unserer Fahrt nach Deutsch-Südwestafrika“, begann der Kapitän seine Ansprache mit sichtlichem Stolz.
„Was Sie hier vorfinden, entspricht dem modernsten Stand der Technik. Die Reederei fühlt sich verpflichtet, in besonderem Maße für ihr persönliches Wohl verantwortlich zu sein. Dies gilt natürlich auch und besonders für ihr leibliches Wohlergehen. Ich darf Ihnen mitteilen…“, und dabei schob er seinen Brustkorb stolzgeschwellt noch einige Zentimeter vor in Richtung seiner Zuhörerschaft, „dass das Schiff über mehrere Kühlräume verfügt, die durch eine mit Kohlensäure betriebene Anlage gekühlt werden. Es wird Ihnen kulinarisch an nichts fehlen in den drei Wochen der Überfahrt, darauf erhalten Sie mein Wort. Und auch technisch sind wir auf dem modernsten Stand und auf jede Situation vorbereitet. Unser Schiff verfügt über drei Dynamomaschinen zur Stromerzeugung für Beleuchtung und Ventilation, modernste sanitäre Einrichtungen und natürlich über drahtlose Telegraphie, so dass wichtige Nachrichten jederzeit ausgetauscht werden können. Sie können sicher sein, zu keiner Zeit vom Geschehen in unserem Mutterland abgeschnitten zu sein.“
Er machte eine kurze Pause, um diese Information auf seine Passagiere wirken zu lassen.
„Toll“, raunte ich, „dann verfolgt uns der Hamburger Klatsch und Tratsch ja immer weiter. Und ich dachte, wir hätten ihn in Frau Finkes Salon zurückgelassen.
Amüsiert stupste Henning mich in die Seite.
„Psst, das hier ist ein wichtiger Moment, etwas mehr Respekt dem Kapitän gegenüber, bitte, er platzt ja gerade vor Stolz“, flüsterte er zurück.
„Und selbstverständlich ist auch für Ihre körperliche Unversehrtheit bestens vorgesorgt“, fuhr der Kapitän fort.
„Sollte es mal zu einer Gefahrensituation kommen, wovon wir alle natürlich nicht ausgehen, verfügt unser Schiff über hochmoderne Unterschallsignale, Fernmelde- und Löschanlagen. Sie müssen sich also keinesfalls um eine sichere Überfahrt sorgen, dafür gebe ich ihnen hier und jetzt mein Ehrenwort.“
Der Auftritt war schon etwas theatralisch, und wir hatten Mühe, während der weiteren, ausschweifenden Ausführungen über die Vorzüge dieses neuen Schmuckstücks der Woermann-Linie konzentriert zuzuhören, gönnten dem Kapitän aber seinen beruflichen Erfolg einer ersten großen Fahrt auf einem nagelneuen Schiff. Sicher hatte er sich diesen Posten verdient, und so nickten wir immer mal wieder anerkennend und applaudierten höflich, als er seine Ansprache beendet hatte.
Mitte/Ende Mai 1914 verließ die ‚Kigoma‘ den Hamburger Hafen. Wie so oft nieselte es ununterbrochen. Ein kalter Wind trieb dunkle Wolken vor sich her. Das Meer war mäßig aufgewühlt mit kleinen grauen Schaumkronen, die zu Tausenden auf den Wellen schaukelten. Zitternd vor Kälte hielten wir uns an der feuchten Reling fest und sahen den Hamburger Hafen Stück für Stück verschwinden in kalten Schwaden aus Gischt, Nebel und Dampf aus unserem riesigen Schornstein.
Das Wetter machte uns den Abschied leicht, aber noch lange heftete ich meinen Blick auf die beiden Gestalten meiner Eltern, die wie kleine Punkte verloren auf dem Dock standen. Meine Mutter hatte es geschafft, nicht zu weinen, aber ich mochte nicht daran denken, wie sie sich fühlen würde, wenn sie nach Hause zurückgekehrt war und sich die Aufregung unserer Abreise gelegt hatte. Hoffentlich würden wir uns eines nicht zu weit entfernten Tages wiedersehen und uns gegenseitig davon überzeugen können, dass es allen gut ging!
Als die Nebelschwaden auch das letzte Fitzelchen Land verschluckt hatten, kehrten wir durchgefroren unter Deck zurück und weinten dem norddeutschen Wetter keine Träne nach.
Was für eine Betriebsamkeit herrschte an Bord! Überall wuselten Reisende und Personal, es waren immerhin über 400 Menschen. Beim ersten fürstlichen Abendessen waren alle Passagiere aufgeregt, lachten und suchten Kontakt zu ihren Mitreisenden. Man fühlte sich verbunden auf dem gemeinsamen Weg ins Ungewisse, und wir bildeten da keine Ausnahme. Ich konnte kaum auf meinem Stuhl sitzen vor Nervosität und hatte eigentlich gar keinen Hunger. Gespannt sog ich alles in mich auf: Die feine Einrichtung mit dem edlen Geschirr, die mit Hussen überzogenen Stühle, Mobiliar im feinsten Jugendstil und vor allem die herausgeputzten Gäste, die sich und den Mitreisenden mehr oder weniger gekonnt demonstrierten, dass sie ‚dazugehörten‘ zu den vermögenden Neubürgern von Deutsch-Südwest.
Mit uns am Tisch saß ein exzellent gekleideter Geschäftsmann mittleren Alters. Man sah ihm seinen beruflichen Erfolg unzweifelhaft und nicht unbedingt nur positiv an. Er konnte kaum an den Tisch reichen, so feist und rund war er. Frisur und Bart waren tadellos hergerichtet, und er blickte mit selbstsicherer Gelassenheit unbeeindruckt von der Aufregung um ihn herum in die Weinkarte. Aus jeder Pore verströmte er Selbstherrlichkeit, Dekadenz und die Macht des Geldes. Er trug Ringe an beiden Händen, seine Weste war aus feinstem Stoff und seine plumpen Füße steckten in maßgefertigten Schuhen.
„Guten Abend, gestatten Sie, dass wir uns zu Ihnen setzen“, begann Henning galant die Konversation, obwohl uns die Plätze ja zugewiesen worden waren.
„Natürlich, natürlich, nehmen Sie Platz“, antwortete unser Gegenüber gnädig und deutete auf die beiden leeren Stühle an seinem Tisch. Es folgte höfliches Schweigen.
„Sind Sie das erste Mal auf der Reise nach Südwest?“, nahm Henning die Unterhaltung wieder auf. „Wissen Sie, für uns ist alles hier neu, aber wir sind begeistert von dem Schiff und der Professionalität der Besatzung. Unsere Einschiffung war eine logistische Meisterleistung, und die Überfahrt verspricht sehr angenehm zu werden.“
Wieder einmal war ich angetan von der Konversationsfähigkeit meines Mannes. Er hatte die Gabe, sich blitzschnell auf seinen Gesprächspartner einzustellen und ihm in angepasster Haltung und Wortwahl gegenüberzutreten. Tatsächlich blickte dieser interessiert von der Weinkarte auf und musterte Henning und mich aus kleinen, prüfenden Augen inmitten seines feisten Gesichts. Was er sah, schien ihm zuzusagen, er nickte unmerklich.
„Ja, der Woermann-Konzern versteht es, seine Gäste bei Laune zu halten. Kein Wunder, dass sie ihre Flotte immer weiter ausbauen können. Und ich denke, wir sind noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten mit unserer neuen Kolonie. Es steckt so viel Potential in Afrika. Wenn wir es klug anstellen, werden wir an die Erfolge von Frankreich und England anknüpfen können. Auch Deutschland wird aufblühen als Kolonialmacht!“
Erfolge? Aufblühen? Bisher hatte ich den Aspekt des internationalen Wettlaufs der europäischen Staaten um Handel, Vormachtstellungen und Rohstoffe in fremden Ländern schlichtweg ignoriert. Mit wirtschaftlichen Interessen hatte ich mich nie beschäftigt, sie hatten mich einfach nicht interessiert. Henning und mir ging es um die Menschen, um alle Menschen, und wie wir ihnen gesundheitlich helfen können. Wir wollten unsere medizinischen Kenntnisse nach Deutsch-Südwest bringen, nichts dort herausholen.
Sicher war es sehr idealistisch und naiv, aber spätestens seit Beginn unserer Berufsausbildungen war uns Geben wichtiger als Nehmen. An diesem Tisch stießen wir auf die Welt der Wirtschaft, der Geschäfte und des Geldes. Ich war irritiert und überließ Henning die weitere Konversation.
„Sind Sie auch geschäftlich unterwegs?“
„Sehr richtig. Ich bin im Karakulgeschäft tätig, und das sehr erfolgreich.“ Selbstverliebt strich er sich über seinen prallen Bauch.
„Kennen Sie Persianer? Das ist mein Metier.“
„Persianer? Was sind Persianer?“, fragte ich unsicher.
„Persianer sind Mäntel, die aus gelocktem Lammfell hergestellt sind. Das Fell ist ganz weich, die Frauen sind verrückt danach. Exquisite Kleidungsstücke lassen sich daraus schneidern. Mäntel, Westen, Stolas, der Markt boomt.“
Selbstgefällig lehnte er sich zurück.
„Ich möchte nicht verhehlen, dass mir meine Beziehungen zu Schaffarmern in Südwest zu einem gewissen Wohlstand verholfen haben, denn unter Wert werden die Felle selbstredend nicht abgegeben.“
Ja, offenbar waren für Herrn Vogt, wie er sich vorgestellt hatte, schon etliche Krümel vom kolonialen Kuchen abgefallen, und er ließ es sich nicht nehmen, seinen Reichtum unangenehm zur Schau zu stellen.
Auf der einen Seite war es vielversprechend für uns, sofort jemanden kennengelernt zu haben, der bereits sein Glück in der Kolonie gemacht hatte, auf der anderen Seite war ich mir ganz und gar nicht sicher, ob ich mit dieser Art Mensch zurechtkommen würde. Selbstgefälligkeit lag mir nicht, und als Henning mir später im stillen Kämmerchen erzählte, dass für die Karakulfelle Lämmer direkt nach ihrer Geburt getötet wurden, weil nur dann ihr Fell so weich und sauber war, dass es den hohen Anforderungen europäischer Käuferinnen genügte, beschloss ich, einen höflichen Abstand zu wahren. Geld und Macht öffnen eben doch nicht automatisch alle Türen…
Wir genossen den ersten Abend an Bord in vollen Zügen mit frischer Nordseescholle, Kartoffelsalat und einem guten Weißwein. Man feierte mit den anderen Gästen bis tief in die Nacht. Aufbruch in ein neues Leben, das wollte begossen werden. Der Alkohol floss reichlich, und einige Herren im Speisesaal vergaßen schon am Anfang der Reise ihre preußische Kinderstube. Mir taten die alleinreisenden jungen Frauen leid, die an diesem ersten Abend teils fluchtartig den Speisesaal verließen. Viele waren auf dem Weg zu ihren neuen Arbeitsplätzen als Lehrerinnen oder Hauswirtschafterinnen auf den Farmen. Sie würden einiges Durchsetzungsvermögen benötigen in den nächsten Wochen, denn ganz offensichtlich hofften einige Einwanderer schon hier ihre Begleiterin für das neue Leben zu finden.
Unser erstes Ziel waren die Kanarischen Inseln. Wir liefen Teneriffa an und erhielten den ersten Eindruck südlicher Lebensart und Vegetation. Diese Farben und Gerüche! Blühende Bougainvilleas, Palmen, Oleander in allen erdenklichen Rotschattierungen, dazu eine strahlende Sonne am tiefblauen Himmel. Wie sehr hatten uns Licht und leuchtende Farben gefehlt im trüben norddeutschen Winter!
Für die Passagiere wurde ein Landgang organisiert, während frische Vorräte und Wasser geladen und Wartungsarbeiten an unserem Dampfer durchgeführt wurden.
Der Ausflug war es wert: Santa Cruz bezauberte uns mit malerischen Gassen und einer herrschaftlichen Kathedrale. Auf dem Markt gab es riesige Mengen tropischer Früchte, die wir oft noch nie gesehen hatten. Ein Händler hielt uns mit einer langen Holzzange eine kleine braune, glänzende Frucht entgegen, die unglaublich süß war und wie ein Bonbon im Mund zerging. „Uuuah, wie lecker“, nuschelte Henning, während er sich bemühte, Reste des klebrigen Fruchtbreis mit Zunge und Fingern aus seinen Zähnen zu pulen. „Schatz, ich esse nie wieder was anderes, ich schwöre es!“ So begeistert war mein Mann, dass er stante pede eine große Schachtel der saftig-süßen Datteln kaufte.
Es war wie ein Urlaubstag, und Henning und ich sparten nicht, uns trotz der gesicherten Verpflegung an Bord mit noch vielen anderen Leckereien einzudecken. Feigen und Mandelkekse, Nüsse und Oliven wanderten über die ausladenden, übervollen Obst- und Gemüsestände in unsere Taschen. Wir konnten uns kaum sattsehen, -riechen und -schmecken.
Leider ertönte zu bald die Schiffsglocke zum Ablegen, es war noch eine weite Reise bis an die südwestliche Spitze Afrikas.
Auf offener See verlief das Leben an Bord in ruhigen Bahnen. Tagein, tagaus schoben uns die beiden Expansionsmaschinen mit gleichmäßiger Geschwindigkeit durch die Wellen. Um uns herum war nur Wasser, Wasser und Himmel.Die einzigen Abwechslungen boten Schulen verspielter Delfine, die ein Stück mit dem Schiff zogen, und dann und wann fliegende Fische, die wie Schwalben über die Wasseroberfläche segelten. Manchmal sah man einen Mast am Horizont, aber meist waren die Schiffe zu weit entfernt, um auch nur Einzelheiten an Deck zu erkennen.
Langeweile machte sich breit. Es war alles gesagt und getan. Essen konnte man auch nicht ununterbrochen, erst recht nicht bei rauerer See mit einem Anflug von Übelkeit. Wie gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, was wirklicher Seegang bedeutete!
Die räumliche Enge auf dem Schiff mit seinen knapp 140 Metern Länge und 17 Meter Breite tat ihr Übriges, bald kannten wir jeden Schäkel und jede Öse. Über Stunden spielten wir Karten oder versuchten zu lesen, was bei dem ständigen Auf und Ab sehr ermüdend war. Immer wieder nickte ich tagsüber ein und konnte dafür nachts nicht schlafen. Was für eine unglaubliche Eintönigkeit! Zwar wurden an Bord regelmäßig Freizeitaktivitäten wie Doppelkopfturniere oder musikalische Abende organisiert, alle Veranstaltungen waren aber irgendwie ruhig und ‚gesetzt‘ und damit nur eine dürftige Ablenkung für mich als bewegungshungrigen Menschen. Ich drehte Runde um Runde auf dem Panoramadeck wie ein Wildtier in Gefangenschaft. Oftmals ging ich auch in die Turnhalle und machte einige Gymnastikübungen, aber auch das war bei den steigenden Temperaturen kein echtes Vergnügen.
Mit jedem Breitengrad wurde es heißer. Erbarmungslos heizte die Tropensonne das Schiff schon morgens um acht auf. In den Kabinen stand die Luft, trotz der elektrisch angetriebenen Fächer, die überall installiert waren. Die Fenster waren Tag und Nacht geöffnet, aber der Fahrtwind brachte keine ausreichende Abkühlung. Der Schiffsbauch war wie ein Backofen.
Frischwasser war rationiert und eine Erfrischung mit Meerwasser verbat sich von selbst. Das Salz trocknet die Haut aus und entzieht dem Körper Wasser, die kurzzeitige Abkühlung schadet insgesamt mehr, als dass sie hilft.
Sehr schnell war es nicht mehr möglich, tagsüber mehr als nur einen Augenblick an Deck zu bleiben. Die Tropensonne zeigte schmerzhaft ihre volle Energie. Binnen kürzester Zeit waren wir lichtentwöhnten Nordeuropäer rotverbrannt wie gekochte Hummer. Henning hatte eines Nachmittags im Fahrtwind seinen Hut verloren und bekam prompt die Quittung. Nacken, Nase und Ohren waren puterrot und geschwollen.
Er hatte zunächst gar nicht bemerkt, wie lange er sich tatsächlich auf dem Oberdeck in der prallen Sonne aufgehalten hatte, denn er hatte ein intensives Gespräch mit einem Mitreisenden geführt, und der Wind hatte ihn die Hitze vergessen lassen. Umso schlimmer war die Erkenntnis gegen Abend.
„Oooh, Isa“, gab er kleinlaut zu, „ich glaube, das war ein Tick zu viel Sonne heute. Mein Gesicht fühlt sich ein wenig heiß an.“
Mitleidig musterte ich meinen puterroten Ehemann.
„Zeit für kalte Umschläge, würde ich sagen“, gab ich ein versiertes Urteil als Krankenschwester ab.
„Da hilft nur Omas Rezept!“
Wir besorgten uns Quark aus der Kombüse und versuchten die betroffenen Stellen zu kühlen, so gut es ging. Zum Glück hatte er keinen Hitzschlag erlitten. Dennoch war sein Wohlbefinden erstmals empfindlich gestört, was er mit einer gewissen Wehleidigkeit auch deutlich zum Ausdruck brachte.
„Das juckt so, das juckt so unendlich“, hörte ich in regelmäßigen Abständen, abwechselnd mit „autsch, tut das weh“, sobald die Quarkmaske getrocknet war und bröckelte.
„Sicher ist das noch genauso, wenn wir da sind, was soll ich nur machen?“
So souverän mein Mann im Umgang mit Kranken und Verletzten war, so wenig kam er mit eigenen Blessuren zurecht. Ich kannte ihn schon gut genug, um zu wissen, wann ich mir ernsthaft Sorgen um ihn machen musste und wann eine Spur Selbstmitleid nicht zu leugnen war. Die Verbrennung war kräftig, aber nicht ernsthaft. Zwar tat er mir aufrichtig leid, dennoch konnte ich mir kaum ein Grinsen bei dem skurrilen Anblick verkneifen, den mein gebeutelter Mann bot, während er mit dicker Quarkmaske im Gesicht vor dem geöffneten Bullauge saß, an das er sich in der Hoffnung auf Kühlung einen Hocker geschoben hatte.