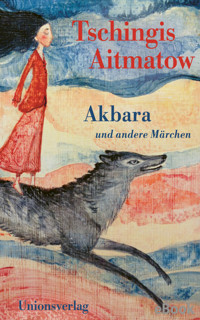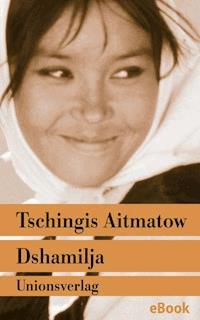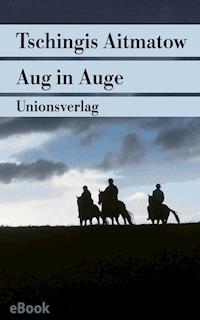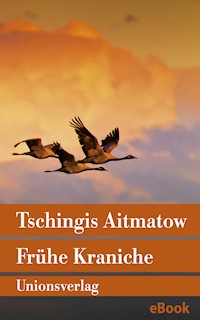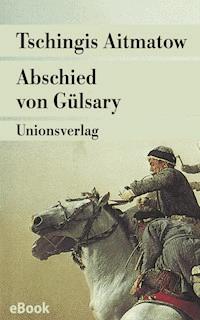
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Tanabai ist mit seinem Hengst Gülsary auf dem nächtlichen Heimweg in die kirgisischen Berge. Nach einem stürmischen Leben wird dies ihr letzter Gang. Beide sind müde geworden. Wie an Stationen eines Kreuzwegs brechen die Bilder der Vergangenheit hervor, die hitzigen Jahre des Aufbaus und des Weltkriegs, als die Steppe urbar gemacht und aus den Trümmern eine neue Welt aufgebaut wurde. Erinnerungen an ihre Feste, an die Reiterspiele, in denen sie gemeinsam siegten, an ihre großen und kleinen Romanzen. Und dann die Stationen des Abstiegs, der Enttäuschungen. Aitmatow hat in diesem Roman der Kraft, der Klage und Sehnsucht des Individuums Sprache verliehen, das den Gang der Geschichte in seine Hand nimmt und wieder ihr Opfer wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der alte Tanabai ist mit seinem Hengst Gülsary auf dem nächtlichen Heimweg in die kirgisischen Berge. Nach einem stürmischen Leben wird dies ihr letzter Gang. Beide sind müde geworden. Wie an Stationen eines Kreuzwegs brechen die Bilder der Vergangenheit hervor.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Abschied von Gülsary
Roman
Aus dem Russischen von Leo Hornung
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die russische Originalausgabe erschien 1967 unter dem Titel Proščaj, Gul’sary.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1968 im Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin.
Originaltitel: Proscaj Gul’sary!
© by Tschingis Aitmatow 1967
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: R. und S. Michaud
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30743-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 00:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ABSCHIED VON GÜLSARY
1 – Der alte Mann fuhr auf einem alten Wagen …2 – Zum ersten Mal waren sie sich nach dem …3 – Langsam ratterten die Räder des alten Wagens über …4 – In dem Jahr, als Gülsary zugeritten wurde …5 – Es war eine schöne Zeit für Tanabai und …6 – Es ging auf Mitternacht. Gülsary konnte nicht mehr …7 – Der Winter war vergangen, für eine Zeit lang …8 – Tanabais Freude war groß, als er eines Morgens …9 – Es war ein heller, sonniger Tag. Der Frühling …10 – Nacht. Tiefe Nacht. Der alte Mann und das …11 – Zwei Wochen später begann eine neue Wanderung …12 – Im Herbst trat eine unerwartete Änderung in Tanabai …13 – Gegen Abend war die Konferenz zu Ende …14 – Immer noch hält die Nacht die beiden fest …15 – In den Bergen war der Oktober trocken und …16 – Am nächsten Tag ritt Tanabai wieder in die …17 – Zwei Reiter sprengten aus dem Ail und schlugen …18 – Die hohen Berge standen grau im Nebel …19 – Am dritten Tag nach diesem außerordentlichen Ereignis trat …20 – Zu später Stunde, als Tanabai noch unterwegs in …21 – Als Tanabai nach Hause kam, war es Nacht …22 – Am Nachmittag trugen sie Tschoro zu Grabe …23 – Es wurde hell. Tanabai saß neben dem sterbenden …24 – Gülsary lag unbeweglich am Lagerfeuer, sein Kopf war …25 – Der Morgen brach an. Die Berge erhoben sich …Mehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Tier
Zum Thema Russland
Zum Thema Revolution
Zum Thema Asien
1
Der alte Mann fuhr auf einem alten Wagen. Auch der falbe Passgänger Gülsary war alt, sehr alt.
Der Weg zum Plateau war lang und mühsam. Im Winter wirbelte zwischen den kahlen grauen Hügeln der Schnee zuhauf, und im Sommer lag über ihnen eine Höllenhitze.
Für Tanabai war dieser Aufstieg immer eine Plage. Er mochte das langsame Fahren nicht, konnte es nicht ertragen. In seiner Jugend hatte er oft zum Kreiszentrum kutschieren müssen, und auf dem Rückweg nahm er dann den Berg jedes Mal im Galopp. Mitleidlos ließ er das Pferd unter der Peitsche gehen. Fuhr er mit dem Ochsengespann und hatte er Begleiter, sprang er vom Wagen und lief zu Fuß. Wütend stürmte er bergan, wie zu einem Angriff, und machte erst auf dem Plateau halt. Dort sog er die Luft tief in die Lungen und wartete auf das heraufkriechende Gespann. Sein Herz hämmerte und stach in der Brust. Aber so war es besser, als wenn er sich von den Ochsen hätte ziehen lassen.
Der verstorbene Tschoro hatte sich oft über diese Absonderlichkeit seines Freundes lustig gemacht. »Weißt du, Tanabai, warum du kein Glück hast? Wegen deiner Ungeduld. Glaub mir. Nichts kann dir rasch genug gehen. Auf zur Weltrevolution! Ach, was heißt zur Revolution, ein gewöhnlicher Weg, der Aufstieg von Alexandrowka, selbst der geht dir auf die Nerven. Alle fahren ruhig, wie es sich gehört, du aber springst ab und rennst den Berg hinauf, als wären Wölfe hinter dir her. Und was hast du davon? Nichts. Hockst dort oben und wartest auf die andern. Auch in die Weltrevolution wirst du allein nicht springen; du musst warten, bis alle so weit sind.«
Doch das war lange her, sehr lange.
Heute hatte Tanabai überhaupt nicht gemerkt, wie er die Anhöhe hinter sich gebracht hatte. Er war alt geworden und fuhr jetzt weder schnell noch langsam. Er fuhr halt, so gut es ging. Jetzt war er stets allein unterwegs. Von der fröhlichen Schar, die in den Dreißigerjahren mit ihm diesen Weg zog, war kaum einer übrig geblieben. Viele waren gefallen, viele gestorben, die anderen lebten zu Haus ihre Tage zu Ende. Die Jugend fuhr mit Autos. Sie mochte nicht mehr in solch armseligen Karren dahinkriechen.
Die Räder ratterten über den alten Weg. Tanabai hatte noch weit zu fahren. Vor ihm lag die Steppe, und dort, hinter dem Kanal, dehnte sich das Vorgebirge.
Seit Langem schon wusste er, dass das Pferd schwächer wurde. Aber er machte sich keine Sorgen darum und hing seinen Gedanken nach. War es denn so ein großes Unglück, wenn ein Pferd unterwegs ermüdete? Das kam alle Tage vor. Es würde es schon schaffen.
Tanabai konnte nicht wissen, dass der alte Passgänger Gülsary, der diesen Namen seiner hellgelben Mähne verdankte, zum letzten Mal die Anhöhe von Alexandrowka überwand und seine letzten Werst zurücklegte. Das Pferd lief wie betäubt. Vor seinen trüben Augen tanzten bunte Kreise, und die Erde wankte.
Der vor ihm liegende Weg verschwamm in rötlichen Nebelschwaden. Lange schon ging von dem überanstrengten Herzen ein dumpfer, ziehender Schmerz aus, das Atmen im Kummet wurde immer schwerer. Das verrutschte Geschirr schnitt ins Kreuz, und auf der linken Seite stach dauernd etwas Spitzes in die Schulter. Vermutlich war eine Niete durch den Filzbelag des Kummets gebrochen. Auf der alten verhornten Quetschung an der Schulter hatte sich eine kleine Wunde geöffnet, die unerträglich pochte und brannte. Die Hufe wurden immer schwerer, als stapften sie über nassen Ackerboden.
Aber das alte Pferd zottelte trotzdem weiter. Ab und zu zerrte Tanabai am Zügel, trieb das Tier an. Dabei hing er seinen Gedanken nach. Da war so viel, über das er nachzudenken hatte.
Die Räder ratterten über den alten Weg. Immer noch, seit er zum ersten Mal ängstlich zitternd auf eigenen Beinen gestanden hatte, ging Gülsary den gewohnten Passgang, seit damals, als er auf der Wiese hinter der Mutter, der großen, langmähnigen Stute, hergelaufen war.
Gülsary war Passgänger von Geblüt, und sein herrlicher Passgang hatte ihm viele gute und bittere Tage eingebracht. Früher wäre es niemandem eingefallen, ihn anzuspannen. Das wäre einer Schändung gleichgekommen. Aber in der Not trinkt ein Pferd auch mit Zaumzeug, wie man so sagt, und in der Not durchwatet ein Mann auch in Stiefeln die Furt.
All das lag weit zurück. Jetzt lief der Passgänger mit letzter Kraft zum letzten Mal dem Ziel entgegen. Noch nie war er ihm so langsam entgegengelaufen. Und doch hatte er sich ihm noch nie so rasch genähert.
Bis zum Ziel war es nur noch ein Schritt.
Die Räder ratterten über den alten Weg.
Das Gefühl, weichen Boden unter den Hufen zu haben, ließ in dem erlöschenden Gedächtnis des Pferdes dunkel längst vergangene Sommertage erstehen, nasse Bergwiesen, die wunderbare Märchenwelt, wo die Sonne wiehernd über die Gipfel galoppierte und er, ein dummes Fohlen noch, ihr nachgejagt war über die Wiese, durch den Bach und durch die Büsche, bis der Hengst der Herde ihn mit zornig angelegten Ohren eingeholt und zurückgebracht hatte. Damals, in jenen längst vergangenen Tagen, war ihm die Mutter, die große, langmähnige Stute, eine warme Milchwolke gewesen. Er liebte die Augenblicke, wenn die Mutter sich plötzlich in eine zärtlich schnaubende Wolke verwandelte: Ihre Zitzen wurden straff, die Milch schäumte auf den Lippen, und sie floss so reichlich und war so süß, dass er sich vor Gier verschluckte. Er liebte es, den Kopf unter den Bauch seiner großen, langmähnigen Mutter zu stecken. Was war das doch für eine berauschende Milch gewesen! Die ganze Welt, die Sonne, die Erde, die Mutter lebten in so einem Schluck Milch. Und man konnte immer noch ein bisschen trinken, selbst wenn man schon satt war.
Aber ach, das währte nur kurze Zeit, sehr kurze Zeit. Bald änderte sich alles. Die Sonne am Himmel hörte auf, wiehernd über die Berge zu galoppieren, sie ging streng im Osten auf und unbeirrt im Westen unter, die zerstampfte Wiese unter den Hufen schmatzte und wurde dunkel, und die Steine am Bach bekamen Risse. Die große, langmähnige Stute ward zur strengen Mutter und biss ihn schmerzhaft in den Rist, wenn er sie zu sehr belästigte. Die Milch reichte nicht mehr. Gras musste er fressen. Jenes Leben begann, das lange Jahre dauerte und dessen Ende nun nahte.
Nie mehr war der Passgänger in jenen für immer vergangenen Sommer zurückgekehrt. Unter dem Sattel vieler Reiter war er viele endlose Wege gezogen. Und erst jetzt, unter der Sonne, mit der wankenden Erde unter den Hufen, da alles vor seinen Augen flimmerte und verschwamm, tauchte jener Sommer vor ihm auf, der so lange nicht wiedergekehrt war – die Berge, die nasse Wiese, die Herden und die große, langmähnige Stute.
Gülsary streckte sich, tappelte heftig mit den Hufen, um dem Kummet und der Gabeldeichsel zu entrinnen, um in die vergangene, sich ihm plötzlich wieder auftuende Welt hineinzutraben. Aber das Trugbild entrückte immer wieder, und das war qualvoll. Die Mutter lockte ihn, wie in der Kindheit, mit leisem Wiehern. Die Herden zogen vorüber, wie in der Kindheit, und streiften ihn mit ihren Flanken und Schweifen. Doch ihm fehlte die Kraft, den Dunstflimmer des Schneesturms zu durchdringen, der immer stärker wurde und ihm die Flocken in Augen und Nüstern peitschte. Heiß brach ihm der Schweiß aus den Poren, und er zitterte vor Kälte. Still versank jene unerreichbare Welt. Berge, Wiese und Bach verschwanden, die Herden jagten davon, und in dunklen Umrissen tauchte der Schatten der Mutter, der großen, langmähnigen Stute, vor ihm auf. Sie ließ ihn nicht im Stich. Sie rief ihn. Schluchzend wieherte er aus ganzer Kraft; aber es war nichts zu hören. Und alles verschwand, auch das Schneegestöber. Die Räder standen still. Die Wunde unter dem Kummet schmerzte nicht mehr. Der Passgänger war stehen geblieben und wankte.
Die Augen taten ihm weh. In seinem Kopf hämmerte es dumpf.
Tanabai hängte die Zügel vorn über den Wagen, stieg schwerfällig ab, vertrat sich die steif gewordenen Beine und ging zu dem Pferd. »Bei dir stimmts wohl nicht!«, schimpfte er.
Der Passgänger stand da, sein großer Kopf auf dem langen schmalen Hals ragte weit über das Kummet. Die Rippen hoben und senkten sich und spannten die Haut über den mageren, schlaffen Flanken. Einst hellgelb, golden, war sie jetzt graubraun vor Schweiß und Schmutz. Graublaue Schweißbäche rannen in schaumigen Streifen von der knochigen Kruppe über Bauch, Beine und Hufe.
»Ich werd ihn doch nicht zu sehr getrieben haben«, murmelte Tanabai und wurde unruhig. Er lockerte den Bauchgurt, löste den Kummetriemen und zäumte das Pferd ab. Heißer, klebriger Speichel war am Gebiss. Mit dem Ärmel wischte er dem Pferd Maul und Hals. Dann raffte er hastig den Rest Heu vom Wagen und warf ihn dem Tier vor. Aber das stand zitternd und rührte das Futter nicht an.
Tanabai hielt ihm ein Büschel vor die Nase. »Da, friss! Was hast du nur?«
Die Lippen des Passgängers bewegten sich, konnten jedoch das Heu nicht fassen. Tanabai blickte ihm in die Augen und wurde ernst. Sie waren tief eingesunken, halb verdeckt von den kahlen Lidfalten, und er konnte nichts darin erkennen. Sie waren erloschen und leer, wie die Fenster eines verlassenen Hauses.
Betroffen sah sich Tanabai um. In der Ferne die Berge, rings öde Steppe. Zu dieser Jahreszeit war hier selten jemand unterwegs.
Das alte Pferd und der alte Mann waren allein.
Das war Ende Februar. In den Ebenen war der Schnee bereits abgetaut; nur in den Erdspalten und Mulden hatte der Winter noch seine letzten verborgenen Höhlen, lagen noch die Wolfsgerippe der letzten Schneewehen. Der Wind trug den schwachen Geruch alten Harsches herüber, die Erde war noch gefroren, graublau und leblos. Unwirtlich und trostlos ist die steinige Steppe am Ende des Winters. Ihr bloßer Anblick machte Tanabai frieren.
Er hob das Kinn mit dem zerzausten aschgrauen Bart und blickte unter seinem struppigen Pelzärmel lange gen Westen. Die Sonne hing zwischen Wolken am Ende der Welt. Schon kroch der milchige Schein der Abendröte über den Horizont. Nichts schien auf schlechtes Wetter hinzudeuten. Und doch war es kalt und unheimlich.
Wär ich nur nicht losgefahren, dachte Tanabai bekümmert. Jetzt lieg ich hier auf offenem Feld und richte umsonst das Pferd zugrunde.
Eigentlich hätte er erst morgen früh aufbrechen müssen. Wäre ihm am Tag etwas passiert, dann wäre sicherlich jemand vorbeigekommen. Aber er war schon heute Nachmittag losgefahren.
Tanabai erklomm einen Hügel, um nach einem Auto Ausschau zu halten. Doch nach beiden Richtungen hin war der Weg leer. Langsam kehrte er zum Wagen zurück.
Unüberlegt war das, dachte Tanabai wieder und machte sich Vorwürfe wegen seiner Unrast. Er ärgerte sich über sich selbst und über die Gründe, die ihn dazu getrieben hatten, sich mit der Abfahrt vom Hause des Sohnes zu beeilen. Er hätte über Nacht bleiben und dem Pferd eine Ruhepause gönnen müssen.
Tanabai machte eine zornige Handbewegung. Nein, auf keinen Fall hätte er bleiben können. Auch zu Fuß wäre ich aufgebrochen, rechtfertigte er sich. Man kann doch nicht so mit dem Schwiegervater sprechen! Immerhin bin ich der Vater, auch wenn sie solchen Unsinn erzählt, dass ich nicht in die Partei hätte einzutreten brauchen, wenn ich mein ganzes Leben nichts als Schaf- und Pferdehirt hätte werden wollen, sodass sie mich im Alter rausschmeißen könnten. Der Sohn, der ist auch gut. Schweigt und schlägt die Augen nieder. Verlangt sie von ihm: Sag dich von deinem Vater los, dann tut er es. Ein Waschlappen ist er, will aber den Vorgesetzten spielen. Ach, es lohnt nicht, darüber nachzudenken! Das ist nicht mehr unsere Generation.
Tanabai wurde heiß. Er öffnete den Hemdkragen und begann, schwer atmend den Wagen zu umkreisen, dabei vergaß er das Pferd, den Weg und die hereinbrechende Nacht. Er konnte sich nicht beruhigen. Im Hause des Sohnes hatte er an sich gehalten, er hatte es unter seiner Würde gefunden, mit der Schwiegertochter zu streiten. Aber jetzt kochte es in ihm, jetzt würde er ihr alles, worüber er unterwegs nachgedacht hatte, sagen: Nicht du hast mich in die Partei aufgenommen, und nicht du hast mich ausgeschlossen. Woher willst du wissen, was damals war? Jetzt ist es leicht, über alles zu urteilen. Jetzt sind alle gescheit, jeder wird geachtet und geehrt. Uns aber hat man zur Verantwortung gezogen. Für Vater, Mutter, Freund und Feind, für uns selbst, für den Hund des Nachbarn, für alles auf der Welt waren wir verantwortlich. Und dass sie mich ausgeschlossen haben, das geht dich nichts an! Das ist mein Kummer, Schwiegertochter. Das geht dich nichts an!
»Das geht dich nichts an!«, wiederholte er laut. »Das geht dich nichts an!«
Am meisten wurmte und demütigte ihn, dass er außer diesem »Das geht dich nichts an« offensichtlich nichts zu sagen hatte.
Er ging noch immer um den Wagen herum, bis er schließlich daran dachte, dass er hier nicht die ganze Nacht bleiben könne.
Gülsary stand unbeweglich unterm Kummet, teilnahmslos und mit hängendem Kopf, die Beine eng beieinander, starr wie eine Statue.
»Was ist mit dir?« Tanabai trat zu dem Pferd und hörte sein lang gezogenes leises Stöhnen. »Schläfst du? Ist dir schlecht, mein Alter?« Hastig befühlte er die kalten Ohren des Passgängers und schob die Hand in die Mähne. Dort war es auch kalt und feucht. Am meisten ängstigte ihn, dass er die gewohnte Schwere der Mähne nicht spürte. Er ist alt geworden, die Mähne ist gelichtet, leicht wie Flaum. Wir werden alle alt, wir enden alle auf die gleiche Weise, dachte er bitter. Er stand unschlüssig und wusste nicht, was er tun sollte … Wenn er das Pferd mit dem Wagen allein ließ und zu Fuß weiterging, würde er gegen Mitternacht in seinem Wächterhäuschen in der Schlucht, in seinem Zuhause, sein. Er lebte dort mit seiner Frau. Sein Nachbar war der Wasserwart, der anderthalb Werst weiter oben am Bach wohnte. Im Sommer überwachte Tanabai die Heuernte und im Winter die Schober, damit die Schäfer das Heu nicht fortschleppten und es vor der Zeit aufbrauchten.
Im vorigen Herbst hatte er mal in der Verwaltung zu tun gehabt. Da hatte ihm der neue Brigadier, ein junger Agronom von den Zugezogenen, gesagt: »Bitte, Aksakal, gehen Sie mal in den Stall. Wir haben Ihnen ein neues Pferd ausgesucht. Es ist schon etwas alt; aber für Ihre Arbeit genügts.«
»Was soll das?«, hatte Tanabai misstrauisch gefragt. »Wieder ein alter Klepper?«
»Sehen Sies sich nur an. Ein Falbe ists. Sie müssen ihn kennen, man sagt, Sie hätten ihn schon mal geritten.«
Tanabai ging zum Stall. Als er den Passgänger sah, zog sich ihm das Herz zusammen. »So sehen wir uns wieder«, sagte er zu dem alten, abgeklapperten Pferd. Er konnte es nicht ablehnen. So nahm er es mit.
Zu Hause erkannte seine Frau den Passgänger kaum wieder.
»Ist das tatsächlich der Gülsary, Tanabai?«, fragte sie.
»Er ists, was hast du nur«, brummte Tanabai, bemüht, den Blicken der Frau auszuweichen.
Es war für sie beide nicht gut, in Erinnerungen zu schwelgen, die mit dem Passgänger verbunden waren. Da war Tanabais Jugendsünde. Und um eine unerfreuliche Wendung des Gesprächs zu vermeiden, sagte er barsch: »Was stehst du herum? Mach uns was zu essen, ich bin hungrig wie ein Wolf.«
»Wie doch das Alter so ein Tier verändert«, antwortete sie. »Hättest du mir nicht gesagt, dass es Gülsary ist, ich hätte ihn nicht wiedererkannt.«
»Was wunderst du dich? Glaubst du, wir sehen besser aus? Alles hat seine Zeit.«
»Das stimmt wohl.« Nachdenklich nickte sie und fügte gütig lächelnd hinzu: »Vielleicht möchtest du auf deinem Gülsary wieder Nachtausflüge machen? Ich hab nichts dagegen.«
»Wohin denn?«, sagte er verlegen abwehrend und drehte seiner Frau den Rücken zu. Auf einen Spaß hätte man mit einem Spaß antworten können, er aber verkroch sich verwirrt auf den Heuboden. Lange blieb er dort. So lange hatte er geglaubt, sie habe alles vergessen. Und jetzt das!
Aus dem Schornstein quoll Rauch; die Frau wärmte das Essen auf, er aber blieb im Heu, bis sie rief: »Komm runter, sonst wird das Essen kalt.«
Sie sprach dann nicht mehr über die Vergangenheit. Wozu auch?
Den ganzen Herbst und Winter über pflegte Tanabai Gülsary, fütterte ihn mit warmer Kleie und Rübenschnitzeln. Mit Gülsarys Zähnen ging es zu Ende, nur Stümpfe waren noch übrig.
Gülsary war wieder auf die Beine gekommen, und jetzt musste das passieren. Was sollte er mit ihm machen?
Nein, er konnte das Pferd nicht verlassen.
»Na, was ist, Gülsary, bleiben wir hier stehen?« Tanabai gab dem Passgänger einen Klaps. Der schwankte und trat von einem Fuß auf den anderen. »Warte, ich hab was.«
Tanabai langte mit dem Peitschenstiel in den Wagen nach einem leeren Sack, in dem er der Schwiegertochter Kartoffeln gebracht hatte, und zog ein Bündelchen hervor. Seine Frau hatte ihm für unterwegs einen Fladen gebacken, und er hatte ihn vergessen. Ihm war nicht nach Essen zumute gewesen. Er brach ihn in zwei Hälften, zerkleinerte eine davon im Schoß seines Mantels und brachte dem Pferd die Krümel. Schnaubend atmete Gülsary den Duft des Brotes ein. Aber er konnte nichts fressen. Da fütterte Tanabai ihn aus der Hand. Er schob ihm ein paar Stückchen ins Maul, und das Pferd begann zu kauen.
»Friss, friss, vielleicht schaffen wirs!« Tanabai fasste Mut. »Immer langsam, Schritt vor Schritt, bis wir zu Haus sind. Was meinst du? Da hilft uns dann die Alte, und wir pflegen dich gesund.«
Dem Pferd troff der Speichel von den Lippen, rann Tanabai über die zitternden Hände, und er freute sich, dass der Speichel wärmer wurde.
Dann nahm er den Zügel und zog den Passgänger hinter sich her. »So, nun komm! Wir können nicht länger hier herumstehen. Los!«, sagte er gebieterisch.
Der Passgänger folgte ihm, der Wagen knirschte, und die Räder ratterten langsam über den Weg. So zogen sie langsam weiter, der alte Mann und das alte Pferd.
Er ist ganz von Kräften gekommen, dachte Tanabai. Wie alt bist du, Gülsary? Zwanzig, oder noch ein paar Jährchen mehr?
2
Zum ersten Mal waren sie sich nach dem Kriege begegnet.
Der Gefreite Tanabai Bakassow war an der West- und an der Ostfront gewesen und wurde nach der Kapitulation der Kwantung-Armee demobilisiert. Sechs Jahre hatte er auf den Heerstraßen zugebracht. Und er war durchgekommen, dank Gottes Hilfe, nur einmal, beim Nachschub, war er verschüttet worden. Dann war ihm ein Splitter in die Brust gedrungen. Zwei Monate hatte er im Lazarett gelegen, bis er wieder zu seinem Truppenteil zurückkehren konnte.
Auf der Heimfahrt nannten ihn die Marktweiber auf den Stationen »Alter«, aber wohl mehr scherzhaft. Tanabai war ihnen nicht gram. Gewiss, er war nicht mehr der Jüngste; aber er war auch noch nicht alt. Der Krieg hatte ihn ziemlich grau gemacht. Im Schnurrbart schimmerten graue Borsten. Aber an Körper und Geist war er noch stark. Nach einem Jahr gebar ihm seine Frau eine Tochter, dann eine zweite. Beide sind jetzt schon verheiratet und haben Kinder. Im Sommer kommen sie oft zu Besuch. Der Mann der älteren ist Kraftfahrer. Er lädt alle auf den Lastwagen, und fort gehts in die Berge, zu den Alten. Töchter und Schwiegersöhne sind in Ordnung; aber der Sohn ist missraten. Doch das ist eine andere Geschichte.
Damals, auf der Heimfahrt nach dem Sieg, schien es, als finge das Leben erst an. Ihm war so wohl ums Herz. Auf den großen Bahnhöfen wurden die Soldaten mit Blasorchestern empfangen. Zu Hause wartete die Frau, das Söhnchen wurde acht Jahre und kam zur Schule. Er fühlte sich wie neugeboren, ihm war, als zähle alles, was bisher gewesen war, nicht mehr. Alles sollte vergessen sein, nur der Zukunft galten die Gedanken. Sie schien klar und einfach: Kinder großziehen, den Haushalt einrichten, ein Haus bauen. Leben. Nichts durfte dem im Weg stehen: jetzt mit dem wirklichen Leben zu beginnen, dem Leben, auf das man die ganze Zeit gehofft hatte, für das im Krieg gestorben und gesiegt worden war.
Aber es zeigte sich, dass Tanabai es zu eilig gehabt hatte, dass er zu ungeduldig gewesen war. Denn für die Zukunft musste noch ein Jahr nach dem anderen geopfert werden.
Zuerst arbeitete er in der Schmiede als Zuschläger. Nachdem er einige Übung hatte, prasselten seine Schläge von morgens bis abends so auf den Amboss, dass der Schmied Mühe hatte, das glühende Stück Eisen zu wenden. Manchmal ist ihm auch jetzt noch das Dröhnen der Schmiede in den Ohren, das alle Unruhe und Sorgen erstickte. Es fehlte am täglichen Brot, an Kleidung, die Frauen gingen barfuß in Galoschen, die Kinder kannten keinen Zucker, der Kolchos war verschuldet, die Konten waren gesperrt. Er hämmerte sich über all das hinweg. Der Amboss sang, die Funken stoben, hau rein, hau rein, so ging sein Atem. Der Hammer hob und senkte sich, und er dachte: Alles wird sich finden, die Hauptsache, wir haben gesiegt! Und der Hammer wiederholte: haben gesiegt, gesiegt. Damals lebte er wie alle vom Glanz des Sieges wie vom täglichen Brot.
Dann wurde Tanabai Pferdehirt und ging in die Berge. Tschoro hatte ihn überredet. Der verstorbene Tschoro war damals Vorsitzender. Er hatte den Kolchos während des ganzen Krieges geleitet. Man hatte ihn nicht eingezogen, weil er herzkrank war. Aber trotzdem war er ziemlich gealtert. Tanabai sah das sofort, als er zurückkehrte.
Einem anderen wäre es kaum gelungen, ihn zu überreden, die Schmiede mit einer Pferdeherde zu vertauschen. Aber Tschoro war sein alter Freund. Zusammen hatten sie einst als Komsomolzen für den Kolchos agitiert, und zusammen hatten sie gegen die Kulaken gestanden. Er, Tanabai, war dabei besonders eifrig gewesen. Schonungslos hatte er sich gegen die gewandt, die auf die Enteignungsliste gesetzt worden waren.
Tschoro war zu ihm in die Schmiede gekommen und hatte ihn überredet. »Und ich hab schon Angst gehabt, du wärst nicht mehr vom Amboss wegzukriegen«, hatte er lächelnd gesagt.
Tschoro sah krank und abgezehrt aus in seiner Strickjacke, in der er auch im Sommer ging; sein Hals war lang geworden, Falten furchten die eingefallenen Wangen.
Sie hockten am Bewässerungsgraben nahe der Schmiede und plauderten. Tanabai dachte an den jungen Tschoro. Damals war er der Gebildetste im Ail gewesen und ein stattlicher Bursche. Die Leute hatten sein ruhiges, gütiges Wesen geschätzt. Tanabai gefiel seine Gutmütigkeit nicht. So manches Mal war er auf Versammlungen aufgesprungen und über Tschoro wegen dessen Weichlichkeit im Klassenkampf hergefallen. Das hatte nicht schlecht geklungen, was er sagte, beinahe wie die Artikel in der Zeitung. Alles, was ihm von den Zeitungsschauen im Gedächtnis geblieben war, hatte er wiederholt. Dabei war es ihm passiert, dass er vor seinen eigenen Worten Angst bekam. Aber seine Worte waren auch manchmal gewaltig.
»Ich war vor drei Tagen in den Bergen«, erzählte Tschoro. »Die Alten haben gefragt: ›Sind alle Soldaten zurück?‹ – ›Alle, die noch leben, sind zurück‹, habe ich gesagt. ›Und wann wollen sie an die Arbeit gehen?‹ – ›Sie arbeiten schon‹, sage ich, ›auf dem Feld, auf dem Bau und sonst wo.‹ – ›Und wer hütet die Herden? Wollt ihr warten, bis wir tot sind? Das dauert so lange nicht mehr!‹ Ich schämte mich, verstehst du? Im Krieg haben wir die Alten als Pferdehirten in die Berge geschickt. Seither sind sie dort. Das ist nichts für alte Leute, dir brauche ich es nicht zu erklären. Immer im Sattel, Tag und Nacht keine Ruhe. Und die Winternächte! Denk an Derbischbai, der im Sattel erfroren ist. Sie haben Pferde zugeritten; die Armee brauchte sie. Lass dich mal mit siebzig Jahren von so einem Satansgaul über Berg und Tal tragen. Da spürst du jeden Knochen im Leib. Wir müssen dankbar sein, dass sie durchgehalten haben. Und die Frontkämpfer, kaum zurückgekehrt, rümpfen die Nase, haben was von Kultur im Ausland gesehen, und schon steht ihnen der Sinn nicht mehr nach Pferdehüten. Warum, fragen sie, müssen wir uns in den Bergen herumtreiben? Du lässt mich doch nicht im Stich, Tanabai? Wenn du gehst, dann folgen dir auch noch andere.«
»Gut, Tschoro, ich wills versuchen. Ich werde mit meiner Frau sprechen«, antwortete Tanabai. Und er dachte bei sich: Was hast du nicht alles auf dem Buckel gehabt, Tschoro, und trotzdem bist du derselbe geblieben. Dabei vergehst du vor Gutmütigkeit. Vielleicht ist es gut so. Wir haben im Krieg so viel gesehen, dass wir alle gütiger sein sollten. Vielleicht ist es das einzig Wahre im Leben?
Sie trennten sich. Tanabai war schon auf dem Weg zur Schmiede, als Tschoro ihm nachrief: »Warte, Tanabai!«
Er ritt nahe heran, beugte sich über den Pferdehals und sah ihm in die Augen. »Du bist doch nicht beleidigt?«, fragte er leise. »Glaub mir, ich habe keine freie Minute. Ich würde gern mit dir zusammensitzen und schwatzen, wie früher. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen! Ich habe mir immer vorgestellt, wenn der Krieg vorbei ist, dann wird alles besser. Aber die Sorgen sind nicht kleiner geworden. Manchmal kann ich kein Auge zutun, alle möglichen Gedanken gehen mir durch den Kopf. Wie soll man die Wirtschaft voranbringen, die Leute satt machen und die Pläne erfüllen? Die Menschen sind nicht mehr dieselben, sie wollen besser leben.«
Sie waren nie mehr dazu gekommen, sich auszusprechen und zusammenzusitzen.
Tanabai ging in die Berge, und damals sah er in der Herde des alten Torgoi zum ersten Mal den anderthalbjährigen falben Hengst. »Und was vermachst du mir noch, Aksakal? Die Herde ist nicht besonders«, stichelte Tanabai, nachdem die Pferde aus der Koppel getrieben und gezählt worden waren.
Torgoi war ein dürres Männchen ohne eine einzige Stoppel im runzligen Gesicht. Die große, zottige Pelzmütze saß wie ein Pilz auf seinem Kopf. Meistens sind solche Alten schnell aufgebracht und händelsüchtig.
Aber Torgoi blieb ruhig. »So wie sie ist, ist sie. Herde bleibt Herde«, sagte er gelassen. »Ich kann mit nichts prahlen, hüte sie, und du wirst sehen.«
»Ich habs nicht bös gemeint«, lenkte Tanabai ein.
»Einen hab ich!« Torgoi schob die Pelzmütze aus dem Gesicht, reckte sich in den Steigbügeln und hob den Peitschenstiel. »Den jungen falben Hengst dort, der auf der rechten Seite weidet. Der wirds weit bringen.«
»Welcher, der kugelrunde? Ist ein bisschen gedrungen, hat ein zu kurzes Kreuz.«
»Ein Spätling. Er wird sich noch rausmachen.«
»Was ist denn Besonderes an ihm?«
»Passgänger von Geburt.«
»Na und?«
»So einen sieht man selten. Früher wäre er unbezahlbar gewesen. Für so einen haben bei Reiterkämpfen manche ihren Kopf aufs Spiel gesetzt.«
»Sehen wir ihn uns mal an«, schlug Tanabai vor.
Sie gaben den Pferden die Sporen, umritten die Herde, drängten den Falben zur Seite und jagten ihn vor sich her. Dem jungen Hengst machte das Laufen Spaß. Er schüttelte fröhlich die Mähne, schnaubte und beschrieb in reinem und schnellem Passgang einen großen Halbkreis, um zur Herde zurückzukehren Von seinem Gang begeistert, rief Tanabai: »Sieh nur, wie er geht! Wunderbar!«
»Was dachtest du!«, sagte großspurig der alte Pferdehirt.
Sie ritten in scharfem Trab hinter dem Passgänger her und schrien wie die Kinder beim Räuberritt. Ihre Stimmen spornten den jungen Hengst an, sein Gang wurde immer schneller, fast mühelos, ohne auch nur einmal in Galopp zu verfallen, flog er dahin.
Sie mussten galoppieren, und er ging weiter im Rhythmus des Passgängers.
»Siehst du, Tanabai!«, schrie Torgoi und schwenkte die Pelzmütze. »Er reagiert so scharf auf die Stimme wie ein Messer unter der Hand, pass auf, wie er davonschnellt. Ait, ait, aita-a-ai!«
Als der falbe Hengst zur Herde zurückgekehrt war, ließen sie ihn in Frieden. Doch konnten sie sich lang nicht beruhigen, während sie die erhitzten Pferde hin und her ritten. »Ein gutes Pferd hast du gezogen, Torgoi-ake. Mir ist ganz wohl ums Herz.«
»Ein gutes«, sagte der Alte. »Aber pass auf«, fuhr er mit ernster Stimme fort und kratzte sich am Hinterkopf. »Schütz ihn vor dem bösen Blick. Und bring ihn nicht zu früh ins Gerede. Ein guter Passgänger findet, wie ein schönes Mädchen, viele Jäger. Gerät so ein Mädchen in gute Hände, blüht es auf, wird es eine Augenweide, gerät es in schlechte Hände, kanns einen jammern bei seinem Anblick. Helfen kannst du dann nicht mehr. So ist es auch mit einem guten Pferd. Es wird zugrunde gerichtet und fällt in vollem Trab.«
»Mach dir keine Sorgen, Aksakal, ich versteh was davon. Bin nicht von gestern.«
»Das glaub ich dir. Er heißt übrigens Gülsary. Merk es dir.«
»Gülsary?«
»Ja. Meine Enkelin hat mich im vorigen Sommer besucht. Sie hat ihn so getauft. Sie war verliebt in ihn. Damals war er einjährig, und wir hatten ihm die Mähne beschnitten. Vergiss es nicht: Gülsary.«
Er war sehr redselig, der alte Torgoi. Die ganze Nacht über gab er Anweisungen. Tanabai hörte ihm geduldig zu.
Er begleitete Torgoi und dessen Frau ein gutes Stück des Wegs. Die Jurte war nun frei für ihn und seine Familie. In die zweite sollte sein Gehilfe einziehen. Der war aber noch nicht gefunden. Noch war er allein.
Beim Abschied ermahnte ihn Torgoi noch einmal. »Den Falben lass noch in Ruhe. Vertrau ihn niemandem an. Reite ihn im Frühjahr selber zu. Aber vorsichtig. Wenn er unter dem Sattel geht, nicht zu sehr fordern. Wird er abgehetzt, kommt er aus dem Passgang, und du verdirbst ihn. Und dann achte darauf, dass er nicht zu viel säuft, wenn er erhitzt ist. Das Wasser schlägt auf die Beine, und er kriegt die Mauke. Und solltest du mal ausreiten, zeig ihn mir, wenn ich noch lebe.«
Dann zog Torgoi mit seiner Alten und dem mit Habseligkeiten voll beladenen Kamel fort und ließ die Herde, die Jurte und die Berge zurück.
Gülsary wusste nicht, wie viel über ihn gesprochen worden war, wie viel man noch über ihn sprechen und wozu das alles führen würde.
Er tollte in der Herde herum. Nichts hatte sich geändert: dieselben Berge, dieselben Weiden und Bäche. Nur trieb sie jetzt an Stelle des alten ein neuer Herr, im grauen Mantel und mit einer Soldatenmütze auf dem Kopf. Seine Stimme war heiser, aber laut und gebieterisch. Die Herde gewöhnte sich rasch an ihn. Sollte er doch um sie herumreiten, wenn es ihm Spaß machte.
Dann fiel Schnee. Er fiel dicht und lag lange. Die Pferde wühlten ihn mit den Hufen auf, um ans Gras zu gelangen. Das Gesicht des Hirten färbte sich dunkel, und die Winde machten seine Hände rau. Er ging in Filzstiefeln und hüllte sich in einen großen Pelz. Gülsary wuchs ein dichtes Fell. Trotzdem fror er, besonders nachts. In den Frostnächten drängte sich die Herde an einem windgeschützten Ort zusammen und wartete, reifbedeckt, bis die Sonne aufging. Der Hirt ritt um die Herde herum, schlug die Fäustlinge gegeneinander und rieb sich das Gesicht. Manchmal verschwand er, tauchte aber immer wieder auf. Besser war es, wenn er da war. Ein Zuruf, ein Räuspern, und die Herde warf die Köpfe hoch und spitzte die Ohren. Sie merkte, dass der Hirt bei ihr war, und döste beim Sausen und Pfeifen des Windes weiter. Seit jenem Winter behielt Gülsary Tanabais Stimme für immer im Gedächtnis.
Eines Nachts schneite die Herde in den Bergen ein. Die stechenden Schneekristalle setzten sich in die Mähnen, machten die Schwänze schwer und verklebten die Augen. Die Herde war unruhig. Die Pferde drängten sich aneinander und zitterten. Die alten Stuten schnaubten erregt und trieben die Fohlen in die Mitte. Sie drängten Gülsary an den Rand, und es wollte ihm nicht gelingen, in den Haufen einzudringen. Er begann auszuschlagen, die anderen zu stoßen, und schließlich stand er allein da. Jetzt bekam er es mit dem Leithengst zu tun. Der zog schon lange tiefe Furchen durch den Schnee und umkreiste die Herde, um sie immer enger zusammenzutreiben. Hin und wieder jagte er in die Dunkelheit hinaus, den Kopf gesenkt und die Ohren angelegt, nur sein Schnauben war noch zu hören. Dann kehrte er wieder zurück, zornig und drohend. Als er den abgesonderten Gülsary bemerkte, stieß er ihn mit der Brust zur Seite, drehte sich um und versetzte ihm mit der Hinterhand einen mörderischen Schlag in die Flanke. Gülsary blieb die Luft weg vor Schmerz. In seinem Innern riss etwas, er schrie und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Nun gab er es auf, eigenmächtig zu handeln. Friedlich stand er am Rand der Herde, quälenden Schmerz in der Flanke und tief gekränkt. Die Pferde beruhigten sich.
Da ertönte lang gezogenes Heulen. Gülsary hatte noch nie einen Wolf heulen hören, und er fühlte, wie alles in ihm erstarrte. Die Herde geriet in Bewegung, eine schier unerträgliche Spannung überkam sie. Sie horchte. Es wurde still. Aber das war eine trügerische Stille. Immer noch fiel dichter Schnee, der Gülsary am Maul kleben blieb. Wo steckte der Hirt, jetzt, wo er so nötig war? Wenn sie wenigstens seine Stimme hätten hören, den Rauchgeruch seines Pelzes hätten einatmen können! Doch er war nicht da. Gülsary wagte einen Seitenblick und erbebte vor Furcht. Ein dunkler Schatten huschte durch den Schnee. Gülsary prallte zurück, und die ganze Herde stürzte blindlings in die finstere Nacht hinaus. Es gab keine Kraft, die diese wild schnaubende und wiehernde Lawine hätte aufhalten können. Die Pferde warfen sich mit ganzer Kraft vorwärts, eines riss das andere mit, wie Steine, die einen Steilhang hinunterdonnern. Gülsary begriff nichts mehr, er stürmte nur noch in rasendem Lauf dahin. Da fiel ein Schuss, dann noch einer, und die Tiere hörten die wutverzerrte Stimme des Hirten. Zuerst kam sie von der Seite, dann von vorn. Sie folgten dem Ruf und holten ihren Herrn ein. Jetzt war er wieder bei ihnen. Er ritt vor der Herde her, jeden Augenblick konnte er in eine Spalte oder eine Schlucht stürzen. Seine Stimme wurde schwächer, dann heiser; aber der Ruf »Kait, kait, kaita-a-ait!« erscholl weiter. Sie jagten ihm nach und entgingen dem Verfolger.
Gegen Morgen trieb Tanabai zum alten Weideplatz. Hier erst beruhigten sich die Pferde. In dichten Schwaden stieg der Dampf über ihnen auf, die Flanken flogen, sie zitterten. Sie fraßen Schnee. Auch Tanabai aß Schnee. Er hatte sich hingesetzt und schob mit der hohlen Hand Schneeklümpchen in den Mund. Lange blieb er unbeweglich sitzen, das Gesicht in den Händen vergraben. Dichter Schnee fiel vom Himmel. Auf den erhitzten Pferderücken taute er im Nu und tropfte trüb und mattgelb zu Boden.
Der tiefe Schnee schmolz, das Gras grünte, und Gülsary machte sich rasch heraus. Die Herde haarte sich, das neue Fell glänzte. Winter und Futternot waren vergessen. Nur Tanabai dachte noch daran: an die Kälte, an die Wolfsnächte, wie er im Sattel erstarrt war und sich auf die Lippen gebissen hatte, um nicht zu weinen, als er am Lagerfeuer die steifen Hände und Füße wärmte, an das Glatteis im Frühjahr, wie er damals, als die schwachen Pferde eingegangen waren, ohne aufzublicken in der Kolchosverwaltung das Protokoll über den Tod der Tiere unterschrieben hatte und wie es dann aus ihm herausgebrochen war, er beim Vorsitzenden mit der Faust auf den Tisch geschlagen und geschrien hatte: »Sieh mich nicht so an. Ich bin kein Faschist. Wo sind die Schutzhütten für die Herden, wo ist das Futter, der Hafer, das Salz? Nur Wind hatten wir. Woher kommt die Anordnung, so zu wirtschaften? Sieh dir an, in was für Lumpen wir herumlaufen! Sieh dir unsere Jurten an, schau, wie ich lebe! Wir haben nicht mal das tägliche Brot. An der Front war es hundertmal besser. Du siehst mich an, als hätte ich die Pferde umgebracht!«
Er musste an das schreckliche Schweigen des Vorsitzenden denken, an sein grau gewordenes Gesicht. Er hatte sich seiner Worte geschämt und sich mit stockender Stimme entschuldigt: »Bitte verzeih mir, ich bin in Hitze geraten.«
»Du musst mir verzeihen«, hatte Tschoro ihm geantwortet. Er wäre vor Scham beinahe vergangen, als der Vorsitzende die Lagerverwalterin gerufen und angeordnet hatte: »Gib ihm fünf Kilo Mehl.«
»Und was wird mit der Kinderkrippe?«
»Was für eine Kinderkrippe? Du bringst immer alles durcheinander. Gib das Mehl heraus«, hatte Tschoro in scharfem Ton gesagt.
Tanabai hatte zuerst ablehnen wollen; denn bald konnte gemolken werden, und dann würde es Kumys geben, aber nachdem er den Vorsitzenden angesehen und dessen bitteren Irrtum erkannt hatte, war er in Schweigen verfallen. Jedes Mal, wenn er Nudelsuppe aus diesem Mehl aß, verbrühte er sich und warf den Löffel hin. »Du willst mich wohl umbringen, was?«
»Blas doch, du bist doch kein Kind mehr«, antwortete dann seine Frau ruhig.
Alles erstand vor seinen Augen, alles.
Dann war Mai geworden. Die Hengste wieherten, rannten einander spielerisch um und trieben die jungen Stuten aus den fremden Herden. Auch die Hirten wurden verwegener. Sie jagten die Raufbolde auseinander, beschimpften sich gegenseitig, und manchmal gerieten sie mit den Reitpeitschen aneinander. Gülsary kümmerte das alles wenig. Sonnenschein wechselte mit Regen, und das Gras wuchs unter den Hufen. Die Wiesen leuchteten in sattem Grün, und die Berge schimmerten blendend weiß. Damals begann für den falben Passgänger die schöne Jugendzeit. Aus dem flauschigen, stutzschwänzigen Anderthalbjährigen war ein stattlicher junger Hengst geworden. Er hatte sich gestreckt, sein Körper hatte die weichen Linien verloren und nahm die Form eines Dreiecks an – breite Brust und schmales Hinterteil. Sein Kopf zeigte schon die Züge des echten Passgängers: Schmalheit, gebogene Nüstern, weit auseinanderliegende Augen und zusammengezogene, geschmeidige Lippen. Er hatte vorerst nur eine Leidenschaft, die seinem Herrn genug Scherereien einbrachte, die Leidenschaft zu rennen. Seine Altersgenossen mit sich reißend, zog er wie ein gelber Komet vor ihnen her. Eine unausschöpfbare Kraft schien ihn ohne Rast und Ruh die Berge hinauf und die Hänge hinab, am steinigen Ufer entlang, über gewundene Pfade, durch Bäche und Hohlwege zu treiben. Und selbst in tiefer Nacht, wenn er unter den Sternen schlummerte, träumte ihm, wie die Erde unter den hell klingenden Hufen dahinflog, wie der Wind durch die Mähne pfiff.