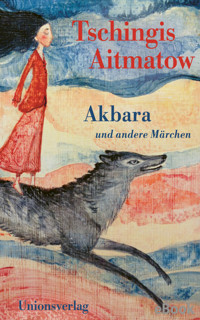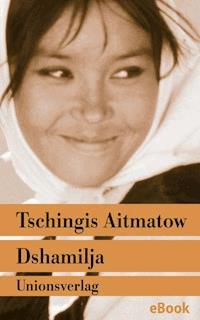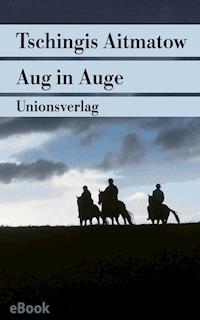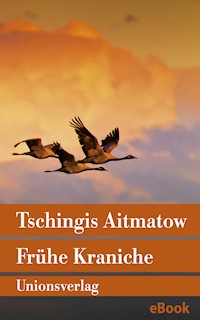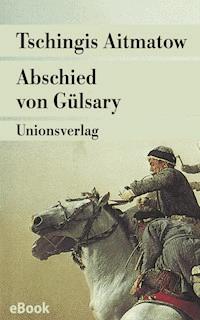7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Wir fliegen, schwingen uns höher und höher. Öde und leer ist alles ringsum – nur unsere Erdkugel wiegt sich sacht, zieht durchs endlose All wie ein Kameljunges, das sich in der Steppe verirrt hat und die Mutter sucht. Wie der Kopf eines verwaisten Kindes wiegt sie sich – so schutzlos, so verletzlich.« Diese frühen Erzählungen von Tschingis Aitmatow stammen aus den Jahren 1953 bis 1965. Sie dokumentieren den literarischen Weg eines Autors, der zunächst noch unter dem Einfluss der Literatur des »sozialistischen Aufbaus« stand, aber schon bald seinen eigenen Ton und seine Motive fand und zum Erneuerer einer erstarrten Literatur wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Diese frühen Erzählungen von Tschingis Aitmatow stammen aus den Jahren 1953 bis 1965. Sie dokumentieren den literarischen Weg eines Autors, der zunächst noch unter dem Einfluss der Literatur des »sozialistischen Aufbaus« stand, aber schon bald seinen eigenen Ton und seine Motive fand und zum Erneuerer einer erstarrten Literatur wurde.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Charlotte Kossuth (1925–2014) war Russisch-Lektorin in Halle/Saale und fast dreißig Jahre lang Verlagslektorin für russische und sowjetische Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Charlotte Kossuth.
Halina Wiegershausen ist Übersetzerin aus dem Russischen und Polnischen, darunter auch Kinderbücher.
Zur Webseite von Halina Wiegershausen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Die Klage des Zugvogels
Frühe Erzählungen
Aus dem Russischen von Charlotte Kossuth und Halina Wiegershausen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Erzählung Das Kamelauge übersetzte Halina Wiegershausen, alle anderen Charlotte Kossuth.
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Verlags Volk und Welt, Berlin
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: João Avelino Marques
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30751-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.06.2024, 23:29h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE KLAGE DES ZUGVOGELS
Die Klage des ZugvogelsDer SoldatenjungeDas Wiedersehen mit dem SohnDer rote ApfelDas Kamelauge1 – Kaum hatte ich einen halben Eimer Wasser aus …2 – Am nächsten Tag stand ich im Morgengrauen auf …3 – Gleich am ersten Tag begann unser Zweikampf4 – In unserem Leben waren einige Veränderungen eingetreten …5 – Die Sonne brannte von Tag zu Tag stärker …Am Fluss Baidamtal1 – Urplötzlich begann ein Wolkenbruch. Im Nu schossen trübe …2 – Kein Penizillin mehr da, was machen wir nur?« …3 – An einem Vorfrühlingstag war Nurbek aus dem Werktor …4 – Der Frühling kam spät in die Berge …5 – Der Frühling lässt in den Bergen bisweilen lange …6 – Nurbek war völlig erschöpft, als er den Pass …7 – Nach einigen Tagen verließ Nurbek zum ersten Mal …8 – Nacht. Schwarze Finsternis herrschte in der Felsschlucht …9 – Früh am Morgen stand Assylbai auf, ging über …Rivalen1 – Kanymgul hielt ihren zweijährigen Sohn Tokon auf dem …2 – An diesem Tag hatte sich Karatai zur Beratung …3 – Die erste Nachthälfte war dunkel, wie in all …4 – Nachts ging eine Frau einen schmalen Pfad zwischen …Weißer RegenDer SypaitschiWorterklärungenNachweisAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Charlotte Kossuth
Über Halina Wiegershausen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema Asien
Zum Thema Natur
Die Klage des Zugvogels
Jagdhunde freuen sich, wenn eine Reiterschar den Ail verlässt. Im Trubel des Aufbruchs gesellen sie sich hinzu, dann treibt keiner sie mehr zurück, da hilft kein Befehl, kein Drohen – sie folgen dichtauf, traben störrisch nebenher. Sonderbare Geschöpfe sind das – ständig zieht es sie hinaus aufs Feld, ins Freie, und je größer der Lärm, je dichter das Menschengetümmel, desto besser! Schließlich sind es Jagdhunde.
Eleman musste seinem Hund bis zum See nachlaufen. Während er dem Bruder Turman half, mit dem Lasso einen Jungbullen einzufangen, den dieser im Zug der Frauen und alten Männer zur Beerdigung mitführen wollte, um ihn für das Totenmahl zu schlachten, hatte sich der Jagdhund Utschar bereits der Menge angeschlossen, als gehörte er dazu: Er stöberte herum, schnupperte, sprang durch Gestrüpp und bellte ungeduldig, damit die Menschen sich schneller bewegten. Eleman konnte ihn rufen und locken, soviel er wollte – es war vergebens. Wie sollte der Hund auch begreifen, dass dies keine Jagdgesellschaft war, sondern ein Trauerzug auf dem bedrückenden Weg in einen anderen Ail, wo unerwartet die Schwester von Almasch, ein siebzehnjähriges Mädchen, gestorben war, und dass sich unter denen, die da auf Stuten und Ochsen saßen, kein einziger junger Dshigit auf nur halbwegs feurigem Ross befand! Woher sollte er wissen, dass alle Kirgisen aus der Umgebung des Issyk-Kul, die eine Waffe tragen konnten, an diesem Tag mit ihren besten Pferden weit hinter den Bergen, einen Dreitagesritt entfernt im Tal des Taltschu, bereitstanden, um den anrückenden Horden der Dsungaren eine Schlacht zu liefern. Den fünften Tag schon waren sie fort, aber noch immer hatte der Ail keine Kunde vom Taltschu. Dummer, dummer Hund – wem hätte in solch einem Augenblick, da ungewiss war, wie sich das Schicksal eines ganzen Volkes entscheiden würde, der Sinn nach der Jagd gestanden?
Doch warum soll einen Hund menschliches Leid anrühren, was kümmern ihn Krieg, Trennung, Tod, Sorgen und überhaupt der Lebensinhalt der Menschen – ausgenommen die Jagd, sei es auf Füchse oder Hasen, bei der die Menschen auf ihren Pferden zu ebenso grimmigen, unermüdlichen Verfolgern werden wie Hunde.
Utschar winselte vor Ungeduld, bald lief er voraus, kläffte und flehte die Leute mit seiner ganzen Erscheinung, mit Blicken und Sprüngen an, sich doch zu beeilen, seinem Beispiel zu folgen, bald umkreiste er die Menge, jedenfalls ließ er sich von Eleman nicht einfangen. Ach, wie sehnlich wünschte sich der schwarze Jagdhund, dass die Rosse ihm nachsprengten, dass die Menschen, in den Steigbügeln aufgerichtet, sie mit gellenden Rufen anfeuerten, dass alle zu einem sprudelnden Strom verschmolzen im Wettlauf, im Stimmengewirr, im schneidenden, pfeifenden Gegenwind. Er rief sie und rief …
Aber nein! Diese Menschen, die alten Männer und Frauen, die da aus verwandtschaftlichem Pflichtgefühl schweigsam und niedergedrückt Sengirbais untröstliche Schwiegertochter umgaben, nahmen ihn gar nicht wahr, den schwarzen Jagdhund Utschar. Anderes bewegte sie. In dieser unruhigen, gefährlichen Zeit begaben sie sich nur schweren Herzens zur Beerdigung, und weniger Almaschs wegen – wer war sie schon, diese Min, dieses Mädchen, das erst vor einem halben Jahr von Sengirbais Familie aufgenommen worden war – als vielmehr aus Achtung vor ihrem Mann, Koitschuman, der jetzt am Taltschu kämpfte, vor allem aber aus Achtung vor Sengirbai, dem großen Jurtenbaumeister, dem Stolz der kleinen und armen Sippe der Boso. Den dritten Tag schon lag der alte Sengirbai, von einem Anfall niedergeworfen, in seiner Zimmermannsjurte. Seit Langem klagte er über sein Herz. Dennoch: Als von den Schwägern die Kunde kam, dass die jüngere Schwester seiner Schwiegertochter, die siebzehnjährige Uulkan, plötzlich tot zusammengebrochen sei, da wollte der Jurtenbaumeister Sengirbai, wie es die Pflicht und der Brauch unter Schwägern gebieten, sogleich zum Begräbnis aufbrechen. Schon hatte er den Pelz übergezogen, schon stand sein Pferd gesattelt vor der Jurte, und die halbwüchsigen Söhne Turman und Eleman fassten ihn unter die Arme, um ihn in den Sattel zu heben – da griff er sich ans Herz und bekam den Fuß nicht mehr in den Steigbügel. Aufstöhnend klammerte er sich an die Mähne des Pferdes, taumelte, und nur mit letzter Kraft hielt er sich auf den Beinen.
Nun nahm, wie sie es des Öfteren auch früher schon getan hatte, Kertolgo-saiip alles in ihre Hände. Sie verstand es, entschlossen zu handeln, wenn es erforderlich war. Zusammen mit den Söhnen trug sie Sengirbai in seine Zimmermannsjurtc, entkleidete ihn und bettete ihn behände auf sein Lager. Dann sagte sie: »Usta, Gott wird dir verzeihen, dir fehlt doch die Kraft, zu den Schwägern zur Beerdigung zu reiten. Überlass das mir. Nach dir bin ich der Aksakal dieser Familie, so wie es mir auch zukommt, die Altmutter unserer Boso-Sippe zu sein. Es wird die Schwäger schon nicht kränken, wenn ich unsere Leute zur Totenklage führe. Wer denkt jetzt auch an Kränkungen, wo Gott allein weiß, was am Taltschu geschieht, wie es dort unseren Söhnen ergeht – ob sie siegen oder sterben. Du siehst es ja selbst: Solange jede Kunde fehlt, schweben alle in tausend Ängsten. Bete du um deine Genesung, denke an jene, die dort auf dem Schlachtfeld sind! Schone dich, du zählst als großer Mann in unserer Sippe, für mich aber bist du, Vater meiner Kinder, der Allergrößte. Erlaube mir, diese bittere Pflicht zu erfüllen. Rühre dich nicht vom Lager. Eleman bleibt bei dir, wir anderen brechen auf.«
So lauteten ihre Worte, und es erwiderte der Jurtenbaumeister, in die Kissen gesunken, bleich, kalten Schweiß auf der Stirn, mit matter Stimme: »Recht hast du, Frau. Da ich es nicht kann, reite du. Versammle alle aus unserer Sippe, damit Almasch nicht allein vor die Ihren treten muss. Beginnt schon von fern zu wehklagen, damit im weiten Umkreis zu hören ist, dass unsere gesamte Sippe trauert, wehklagt so laut, dass ihr mit euern Stimmen auch die Abwesenden ersetzt – ihren Schwiegersohn Koitschuman und mich, ihren kranken Schwager. Wissen soll sie: Mag der Krieg auch noch so nahe sein, unsere Toten werden wir bestatten und beweinen, solange wir Menschen sind.«
So brachen sie denn zum Begräbnis auf: die Mütter mit ihren Kindern, die alten Männer und Frauen aus der kleinen Sippe der Boso. Sie brachen auf, bangend um den Ausgang der Schlacht mit den Dsungaren, und keinen gab es in jenen Tagen, der nicht laut oder stumm gedacht hätte: Wie mag es dort stehen, im Tal des Taltschu? Warum kommt keine Kunde? Warum nur wissen wir nichts? Sie brachen lediglich auf, um dem Brauch Genüge zu tun und die Ehre der Sippe zu wahren. Sie verließen ihren Ail finster, in tiefer Sorge.
Eleman kostete es viel Schweiß, ehe es ihm gelang, Utschar einzufangen und ihm den Gürtelriemen um den Hals zu legen – der Hund hätte sich sonst nicht von der Menge getrennt. Nun zerrte er am Riemen, suchte Eleman wieder zu entwischen. Doch der durfte ihn unter keinen Umständen ziehen lassen, in dem fremden Ail würden die dortigen Hunde über Utschar herfallen. Da gab es keinen Zweifel.
Den Jagdhund fest am Riemen haltend, blieb Eleman stehen; er wusste nicht, wie er sich in dieser Situation verhalten, was er den zum Begräbnis Reitenden sagen sollte. Guten Weg konnte er ihnen doch wohl nicht wünschen. Verwirrt stand er da, als sich seine Mutter, die Zügel straffend, im Sattel umwandte.
»Geh schnell nach Hause, steh hier nicht herum«, sagte sie streng. »Und kümmere dich um den Vater! Weiche keinen Schritt von seiner Seite, hörst du?«
Eleman nickte. Natürlich würde er tun, was sie ihm befahl. Während er der Mutter zuhörte, betrachtete er ihr alterndes, von braunen Fältchen durchfurchtes, gesammeltes Gesicht – so bekümmert hatte er sie noch nie gesehen – und dachte: Reite nur, wenn es sich nun mal so gefügt hat. Sorge dich nicht um uns, ich bin ja nicht mehr klein. Ich mache alles, wie du sagst, weiche dem Vater keinen Schritt von der Seite. Hauptsache, unser Koitschuman kommt mit dem Fuß im Steigbügel zurück und nicht über den Sattel geworfen. Alle Dshigiten sollen aufrecht im Sattel heimkehren, nicht draufgepackt. Um Vater und mich sei unbesorgt. Ich mache alles, wie du befiehlst, Mama.
Nur für einen kurzen Augenblick hatte Kertolgo-saiip die Zügel angezogen, doch während sie ihren Sohn anblickte, ihren Jüngsten, der da mit dem schwarzen Jagdhund auf dem Pfad zurückblieb, verspürte sie im Herzen jäh einen schneidenden Schmerz: Was wird aus ihm, er ist doch noch ein kleiner Junge, wie mag es dem Ältesten ergehen, lebt er noch, oder ist er vielleicht schon von Oiratenspeeren durchbohrt, was harrt ihrer aller morgen, was wird aus ihnen, was wird aus dem Volk?
Und um diese schrecklichen Gedanken nicht laut werden zu lassen, murmelte sie: »Lauf in den Ail, Söhnchen, ich gebe dich und deinen Vater in Gott Tengris Hand.« Schon wollte sie weiterreiten, da hielt sie noch einmal inne: »Sowie du nach Hause kommst, bereite dem Vater einen Aufguss von diesem Kraut …«
»Klar, das mach ich«, versicherte Eleman.
Die Mutter aber erklärte ihm genau, wie er den Heiltrunk bereiten müsse: zunächst das Kraut mit siedend heißem Wasser überbrühen, dann den Aufguss zugedeckt ziehen lassen und, nachdem er etwas abgekühlt ist, dem Vater davon zu trinken geben, bis ihm der Schweiß ausbricht, denn wenn er alles ausgeschwitzt hat, wird die Brust freier …
»Hörst du auch zu, hast du verstanden?«, forschte Kertolgo-saiip. Und als sie sich vergewissert hatte, dass alles hinreichend erläutert war, setzte sie ihren Gefährten nach, die sich allmählich am Seeufer entlang entfernten. Doch nach einem Blick in die Runde hielt sie abermals inne und stieg aus dem Sattel.
»Eleman, komm her zu mir!«, rief sie. »Halt die Zügel, ich möchte zum See beten. Komm.«
Mit diesen Worten wandte sie sich um und schritt langsam und feierlich auf den See zu. Sie ging über seinen rötlichen Ufersand, den bei stürmischen Winden Sturzwellen angespült hatten. Mit dem schneeweißen Turbantuch auf dem Haupt, das streng und fest gebunden war und mit seinen weißen Falten ihr Gesicht umrahmte, sah sie schön aus, obwohl sie merklich gealtert war und an den Schläfen graue Strähnen hervorquollen. Ihr Körper war noch straff, ja wohlgestalt und kräftig, hatte sie doch, bis die Schwiegertochter Almasch ins Haus kam, die ganze Wirtschaft allein bewältigen müssen, eine Wirtschaft mit vier Männern: drei Söhnen und dem Ehemann – und man weiß ja, was die in der Tretmühle des Alltags für Nutzen bringen.
Gesammelt, den täglichen Sorgen und Gedanken bereits entrückt, schritt sie über den Sand zum See; von hohen Gedanken bewegt, blickte sie auf die unergründliche blaue Wasserfläche, auf die dahinter in fliederfarbener, unwirklicher Ferne aufragenden unwirklichen Gipfel der schneebedeckten Berge und auf die unwirklichen Wolken darüber. Das war der sichtbare und fassbare Weltenraum, in dem der Mensch lebte und von dem er abhing, das war die mächtige und gleich Gott Leben spendende Welt, die irdische Verkörperung Gottes.
Kertolgo-saiip verhielt auf den Kieselsteinen am Ufersaum, fast unmittelbar am Rande der schäumenden Brandung. Hierher war ihr auch Eleman gefolgt – mit dem Pferd am Zügel und dem Hund am Riemen.
Kertolgo-saiip fiel auf die Knie, der Sohn tat es ihr gleich, und sie flehte, nicht laut und nicht leise, mit gedämpfter Stimme: »O Issyk-Kul, du Auge der Erde, immerdar blickst du in den Himmel. An dich wende ich mich, ewiger, nie zufrierender Issyk-Kul, auf dass mich der Gott des Himmels, der Lenker der Geschicke, Tengri, erhöre, wenn er von hoch droben in deine Tiefen schaut.
O Tengri, in der Stunde des Schreckens und der Gefahr gib du uns die Kraft, den feindlichen Oiraten standzuhalten. Beschütze unser aus sechs Geschlechtern hervorgegangenes kirgisisches Volk, das – da es auf Wiesen und Triften das Vieh weidet – in deinen Bergen von deinen Gaben lebt. Lass nicht zu, dass die Hufe von Oiratenpferden unsere Heimaterde zerstampfen. Sei gerecht – versage uns nicht den Sieg im ehrenhaften Kampf. Was geschieht nur dort, hinter jenen Bergen, im Tal des Taltschu? Was hat sich dort ereignet? Keine Kunde, kein Bote kommt vom Schlachtfeld – die Augen haben wir uns schon ausgesehn, erschöpft sind unsere Herzen von der Ungewissheit. Was geschieht dort? Was harrt unser morgen? Beschütze sie alle, die in den Kampf gezogen sind, o Tengri. Gib, dass wir sie in den Sätteln wiedersehn, bewahre uns davor, sie auf Kamele gepackt zurückzubekommen. Erhöre mein Flehen, Tengri, Mutter bin ich von drei Söhnen … «
Eleman kniete zwischen dem Jagdhund Utschar und der langmähnigen Fuchsstute, die er an der Leine hielt. Er blickte auf den dunklen Buckel des Sees, auf die Wölbung des großen Wassers, das da atmete, sich hob und senkte wie ein lebendiger Rücken. Der See war ruhig zu dieser Stunde, flimmerte nur sanft gekräuselt. Ausgangs eines langen Winters, zu Frühlingsbeginn, waren die Ufer des Issyk-Kul kahl und öde, die angrenzenden Wälder noch unbelaubt, die Wiesen gelb und dürr, nirgends sah man Rauch über Ailen, nirgends dahinsprengende Reiter, Nomadenkarawanen oder weidende Herden.
Dafür kreisten bereits Zugvögel, die am Issyk-Kul überwintert hatten, im Vorgefühl des Frühlings und ihres baldigen Abflugs in andere Breiten scharenweise über dem See, übten sich, zu Schwärmen vereinigt, mit kräftigen Flügelschlägen im schnellen Flug, am Fuße der Berge entlang. Durch die strahlende Frühlingsluft klangen weithin ihre erregten Schreie und Rufe.
Ganz nah rauschte ein Zug rotfüßiger Graugänse an Kertolgo-saiip und ihrem Sohn vorbei. Laut und ausgelassen kreischend, mit schrillem Geschnatter, jagten sie über ihre Köpfe hinweg – so tief, dass man das Pfeifen ihrer Flügelschläge hörte. Der Junge unterschied über dem See mehrere Zugvogelschwärme. Ob es freilich auch Gänse waren, Enten, Schwäne oder langbeinige rosafarbene Flamingos, hätte er nicht sagen können. Zu fern und zu hoch flogen diese Vögel. Nur ihre Stimmen drangen herüber – bald klar, bald undeutlich. Also werden sie heute oder morgen abfliegen, sagte er sich.
Die Mutter aber betete immer noch heiß und inbrünstig; alles, was ihr auf der Seele brannte, legte sie Gott Tengri dar. Das Schicksal möge ihrem Mann, dem großen Jurtenbaumeister Sengirbai, gnädig sein, bat sie, ballten sich doch über ihm die dunklen Wolken einer Brustkrankheit, nicht einmal sein Pferd habe er heute besteigen können.
»Behüte unseren Vater, den kunstfertigen Meister, o Tengri. Keine Jurte gibt es weit und breit, die nicht ein Werk seiner Hände wäre. Unzählbar sind die Wohnstätten, die er errichtet hat! Jeder braucht schließlich ein Dach überm Kopf: das Kind und der Greis, der Arme und der Reiche, der Schafhirt und der Stutenmelker.«
Dann betete sie, es möge ihm vergönnt sein, Enkel zu wiegen. Sie betete und betete … Hat der Mensch etwa wenig Kümmernisse?
Der große blaue See aber, dessen Auge inmitten schneebedeckter Felsgipfel zum Himmel aufsah, wälzte seine Wasser in finsteren Tiefen und spielte wie ein Lebewesen mit seinen prallen Muskeln – großen, trägen Wellen, die ziellos entstehen und ziellos vergehen. Es war, als rekle sich der See, als sammle er Kraft, um nachts loszutoben. Einstweilen schwärmten hoch über der hellen und klaren, von Frühlingssonne übergossenen Wasserfläche schreiend, im Vorgefühl des baldigen gemeinsamen Aufbruchs zu einer neuen Weltreise, die Zugvögel.
Noch immer betete die Mutter, sie betete inbrünstig und leidenschaftlich: »Ich beschwöre dich bei meiner weißen Muttermilch, erhöre mich, Tengri! Wir sind hierhergekommen, zu deinem irdischen Auge, zum heiligen Issyk-Kul, um uns an dich zu wenden, großer Lenker der Geschicke, himmlischer Tengri. Hier siehst du mich und neben mir meinen Sohn Eleman – er ist mein letztes Kind, weitere werde ich nicht mehr empfangen, weder einen guten noch einen schlechten Menschen werde ich noch gebären, um eins nur bitte ich dich, verleihe meinem Jüngsten die Gabe des Vaters, die Meisterschaft Sengirbais, ihn selbst zieht es schon zu diesem Handwerk. Er aber hat noch einen Wunsch, mein Sohn Eleman, er möchte ein Manas-Sänger werden wie sein Bruder Koitschuman. Verwehre ihm das nicht, schenke ihm vor allem die Kraft des uralten Liedes, lass es wie einen Baum Wurzeln schlagen in seinem Herzen, auf dass er dieses uns von Vorvätern und Vätern überkommene Lied bewahre für seine Kinder und Enkel, gib ihm eine solche Kraft, einen solchen Geist, dass sein Gedächtnis das Lied unserer Vorfahren aufnimmt, überliefert seit der Zeit, da sie Kirgisen geworden sind.
Ich bin Mutter dreier Söhne, Tengri, erhöre mein Flehen. Mit uns bitten dich der Sprache nicht mächtige Geschöpfe, die des Menschen Gefährten sind – unser Jagdhund Utschar, der zur Rechten meines Sohnes steht, er holt jede Beute ein, und die langmähnige Fuchsstute zur Linken meines Sohnes, die bislang noch jedes Jahr gefohlt hat. «
Obwohl die Mutter leise, mit gedämpfter Stimme betete, schien es Eleman, als flögen ihre Worte über den ganzen See und breiteten sich aus wie ein heißer, beschwörender Ruf, den die umliegenden Berge mit einem erregten, teilnahmsvollen Echo beantworteten: »Erhöre mich, Tengri, erhöre, erhöre.«
Als sie schließlich das Pferd bestieg und ihren Gefährten nacheilte, deren kleine Schar sich am Seeufer entfernte, blieb er noch lange stehen, den Jagdhund Utschar an der Leine. Zu jung war er, um zu ahnen, dass er viele Male an diesen Tag, an die Stunde, da die Mutter am See gebetet hatte, zurückdenken und bei der Erinnerung Tränen des Glücks und der Bitternis vergießen würde, dankbar, dass die Mutter für ihn von Tengri die Gabe eines großen Manas-Sängers erfleht hatte. Später sollte ihn das Volk Stimmgewaltiger Manastsehi Eleman nennen; noch aber konnte er nicht wissen, dass seine jungen Jahre von der schweren Zeit der Oiratenüberfälle überschattet sein und dass die Menschen das Lied von Manas nur bei heimlichen Zusammenkünften in abgelegenen Felsenschluchten hören würden, noch konnte er nicht wissen, dass ihn der Prolog des Manas stets an das Gebet seiner Mutter am See erinnern würde, seiner Mutter, die längst von den Oiraten getötet worden war, weil sie ihren Sohn, den Sänger, verborgen gehalten hatte, und dass er in dem prophetischen Sinn des Prologs sowohl Trost finden würde als auch eine Quelle für die Erkenntnis der Größe, der Schönheit und des gedanklichen Reichtums dieses Liedes, das von der Unsterblichkeit ihres Volkes kündete. Noch konnte er nicht wissen, dass gerade ihm bestimmt war, den verschreckten Menschen den Manas in die Erinnerung zu rufen:
»O Kirgisen, hört die Kunde von Manas, dem größten Sohn, den jemals unser Volk besaß.
Die Tage seither sind verronnen wie Sand, die zahllosen Nächte sind unwiederbringlich dahin, Jahre und Jahrhunderte sind, einer Karawane gleich, in spurloser Ferne entschwunden. Seit seinen Tagen lebten so viele Menschen auf dieser Welt, wie es Steine gibt auf Erden, vielleicht sogar mehr. Berühmte Leute waren darunter und unbekannte, gute und böse, hünenhafte und tigergleiche, weise und kunstfertige. Große Völker gab es, an die längst nur noch die Namen erinnern.
Was gestern war, ist heute vorbei. In dieser Welt ist alles im Kommen und Gehen. Allein die Sterne sind ewig, die ihre Bahn ziehen unter dem ewigen Mond, allein die ewige Sonne geht tagaus, tagein im Osten auf, allein die schwarzbrüstige Erde bleibt an ihrem ewigen Platz. Auf Erden aber lebt nur das menschliche Gedächtnis lange, dem Menschen selbst ist ein kurzer Weg beschieden – kurz wie der Abstand zwischen seinen Brauen. Allein der Gedanke ist unsterblich, den der Mensch dem Menschen überliefert, ewig ist das Wort, das ein Nachfahre dem andern weitergibt.
Viele Male seither hat die Erde ihr Antlitz verändert. Wo vorher keine Berge gewesen waren, wuchsen gewaltige Berge empor. Wo vorher Berge gestanden hatten, breiteten sich kahle Flächen aus. Schluchten ebneten sich ein, als verliefen sie durch Teig. Flussufer verschmolzen. Inzwischen schnitten Regengüsse neue Gräben und neue Abgründe in die Erde. Wo aber seit der Erschaffung der Welt blaue Meere gewogt hatten, lagen nun Sandwüsten in schweigender Weite. Städte wurden gebaut, Städte wurden zerstört, und über alten Mauern erhoben sich neue …
Doch seither gebar ein Wort ein neues Wort, gebar ein Gedanke einen neuen Gedanken, knüpfte Lied sich an Lied, erwuchs aus Begebenheiten die Legende. So erreichte uns die Sage von Manas und seinem Sohn Semetej, die zum Bollwerk der kirgisischen Stämme geworden sind, zu ihrem Schutz und Schirm vor vielen Feinden.
In dieser Sage erwecken wir die Stimmen der Väter und Vorväter, erleben wir den Vogelzug, der längst entschwunden, den Hufschlag, der längst verstummt ist, die Rufe von Recken, die sich im Zweikampf gegenübergestanden haben, Totenklage und Siegesgeschrei. Aufs Neue ersteht in diesem Lied vergangenes Leben: für die Lebenden und zum Ruhme der Lebenden.
Beginnen wir also unser Epos von dem großen, dem einzigartigen Manas und seinem heldenmütigen Sohn Semetej, lassen wir es erklingen zum Ruhme der Lebenden!«
Wie sollte der Junge schon wissen, dass ihm dank Gottes Gnade bestimmt war, ein Künder des Volkswortes zu werden in den Tagen der Not und der schweren Prüfungen unterm Dsungarenjoch, wie sollte er wissen, dass die Feinde tausend edle Rosse auf seinen Kopf setzen würden und dass er, verraten, gemartert, mit ausgestochenen Augen, unter der glühenden kasachischen Steppensonne umkommen würde! Dass er sich in seinen letzten Augenblicken, verblutend, verdurstend, dieses Tages erinnern würde, dieser Stunde, dieses Sees, vor dem sich seine Mutter verneigte, und dieser Vögel, die bald in fremde Lande fliegen würden, und dass er, dieses Bild vor Augen, als wäre es Wirklichkeit, sterben würde, den Ruf »Mutter!« auf den Lippen.
All das lag für ihn noch in der Zukunft – Ruhm, Kampf und Tod.
Jetzt aber stand er einfach am Ufer des Issyk-Kul, dort, wo die Mutter gebetet hatte, und hielt den Jagdhund Utschar fest an der Leine, damit er sich nicht unversehens losriss und der Menge nachsetzte, die dem Blick bereits entschwand. Dann besann er sich, erinnerte sich des kranken Vaters.
»Komm, Utschar, komm!«, rief er streng und eilte durch das schmale Tal zwischen den Uferbergen zum Ail. Während er sich vom See entfernte, hörte er in seinem Rücken noch lange das Stimmengewirr, die Schreie der schwärmenden Vögel.
In jener Nacht, als schon der Morgen graute, entschlief vor den Augen seines jüngsten Sohnes Eleman der große Jurtenbaumeister Sengirbai. Die letzten Worte, die der Vater sagte, röchelnd, nach Luft ringend, mit schwerer Zunge, waren kaum noch zu verstehen. Aber Eleman, der sich zitternd über ihn geneigt hatte und bei der flackernden Flamme des offenen Feuers in den Zuckungen seiner erstarrenden Lippen las, erriet, was er sagen wollte. Zwei Wörter hatte er erhascht: »Was … Taltschu.«
Da konnte er die Tränen der Verzweiflung nicht länger zurückhalten, ob er sich auch auf die Lippen biss, und er rief, laut aufschluchzend: »Nein, Vater, noch gibt es keine Kunde. Ich will dich nicht betrügen. Nichts wissen wir. Ich bin hier allein. Hörst du? Ich habe Angst. Stirb nicht, Vater, stirb nicht. Bald kommt Mutter zurück …«
Erreichten die Worte den sterbenden Vater? Wer weiß es? Er verschied im selben Moment mit offenen Augen. Und als das geschehen war, als der Schatten des Todes das Antlitz des Vaters blitzartig fremd und schrecklich gemacht hatte, stürzte der Knabe entsetzt aus der Jurte, rannte er besinnungslos, voller Furcht davon. Schreiend und schluchzend lief er, ohne zu wissen, wohin; hinterdrein sprang, den Schwanz erschrocken eingeklemmt, der Jagdhund Utschar. Erst am tosenden Gestade des Sees kam Eleman zur Besinnung. Erstarrt blieb er stehen. Der Issyk-Kul wütete in jener Nacht, wogte und brodelte unter schäumenden Brechern. Doch von oben drangen ganz andere Laute an Elemans Ohr – ein unaufhörliches Stimmengewirr. Er hob den Kopf, da war der grauende Himmel, so weit er sehen konnte, voller Vögel. In weiten Kreisen stiegen sie hoch über den See, um die Bergrücken zu überwinden. Noch ein letzter Kreis, dann formierten sie sich zu einem riesigen Strom, schwangen sich höher und höher und nahmen schließlich Kurs auf die Boom-Schlucht, über den Pass hinweg, in Richtung des Taltschu. Eleman begriff, dass sie einen weiten Flug vor sich hatten und für lange Zeit wegzogen, dass auf ihrem Weg in unbekannte ferne Gegenden das Tal des Taltschu lag; er nahm alle Kraft zusammen und schrie, so laut er konnte: »Unser Vater ist tot! Sagt es meinem Bruder Koitschuman – unser Vater ist tot, tooot!«
Wir flogen lange über Berge dahin. An einem Pass trieb heftiger Wind schiefergraue Wolkenballen auf uns zu. Erst gerieten wir in Regen, dann schlug uns eisiger Schnee entgegen, und unsere durchnässten Federn begannen zu erstarren, schwerer und schwerer fiel uns das Fliegen. Unser Schwarm kehrte um, die anderen folgten uns, erneut kreisten wir schreiend über dem See, gewannen dabei noch mehr an Höhe und begaben uns erneut auf die Reise, diesmal hoch über den Bergen und über den Wolken. Als uns die Strahlen der Morgensonne einholten, hatten wir den Pass bereits überwunden, und unter uns dehnte sich weithin das Tal des Taltschu. O Segen spendendes Tal, tief reicht es hinein in die großen Steppen; so weit wir blicken konnten, war es von Sonnenlicht übergossen, schon grünte das Land, und die Bäume standen voller Knospen – prall wie die Leiber trächtiger Stuten.
Silberglänzend schlängelte sich der Fluss Taltschu durchs Tal, und ebendiesen Fluss entlang führte uns die Reise. Mit sehnsüchtigen Rufen grüßten wir das Tal, und allmählich näherten wir uns wieder der Erde, denn vor uns, den Taltschu abwärts, auf weitem, schilfbewachsenem Schwemmland, harrte unser die erste Rast auf dem langen, ewig gleichen Weg der Vogelkarawanen. Hier wollten wir ausruhen, wollten Futter suchen, um danach die Reise mit neuer Kraft fortzusetzen. Doch diesmal verwehrte uns das Schicksal den gewohnten Rastplatz.
Mit Flügeln und Schwanzfedern den Flug drosselnd, näherten sich unsere Schwärme der vertrauten Flussniederung, da erblickten wir unter uns jäh ein menschliches Schlachtfeld. Es war ein schreckliches Schauspiel. Zahllose Menschen, Tausende und Abertausende, beritten und zu Fuß, waren hier, auf unserem Schwemmland, aneinandergeraten. Die Luft war erfüllt von Getöse und Gebrüll, von Winseln und Stöhnen, von Wiehern und Schnauben. So weit wir sehen konnten, vernichteten die Menschen einander in blutiger Schlacht. Bald stürmten sie in großen Scharen, unter furchterregenden Schreien und mit gefällten Lanzen aufeinander los, stießen sich gegenseitig zu Boden, zerstampften die Gestürzten mit den Hufen der Pferde, bald wieder liefen sie auseinander; und wo die einen flohen, setzten ihnen die anderen nach. Manche kämpften im Schilf mit Messern und Säbeln, schnitten einander die Kehlen durch, schlitzten Bäuche auf. Menschenleichen und Pferdekadaver türmten sich, viele Erschlagene lagen im Wasser, auf überschwemmtem Grund, behinderten die Strömung, und das Wasser, bedeckt mit Blasen und von dunklem Blutschleim durchzogen, rann nach allen Seiten, wurde unter den Hufen der Pferde zu blutigem Brei.
Unsere Schwärme stockten ratlos, ein Höllenlärm erhob sich in den Lüften, unsere Reihen gerieten durcheinander, und so kreisten wir nun am Himmel – eine brodelnde Wolke verschreckter Vögel. Lange konnten wir uns nicht fassen, lange flogen wir über den unglücklichen Menschen, die einander töteten, lange sammelten wir unsere Scharen, lange fanden wir keine Ruhe. Es gelang uns nicht, dort Rast zu machen, wir mussten diesen verfluchten Ort verlassen und weiterfliegen.
Verzeiht, ihr Zugvögel! Verzeiht, was war, verzeiht, was noch kommen wird. Ich kann euch nicht erklären, und ihr werdet nie verstehen, warum das menschliche Leben so eingerichtet ist, warum auf Erden so viele getötet wurden und weiterhin getötet werden. Verzeiht um Gottes willen, verzeiht, ihr Vögel am Himmel, die ihr in klarer Weite eure Bahn zieht … Nach der Schlacht prassten dort die Aasgeier, schlugen sich die Wänste voll bis zum Erbrechen, bis sie keinen Flügel mehr bewegen konnten. Schakale fraßen bis zum Umfallen, bis sie kaum noch kriechen konnten. Fliegt, fliegt weit weg von dieser grausigen Gegend!
So ist es seit Urbeginn: Sobald ihre Zeit gekommen ist, nicht früher und nicht später, begeben sich die Vögel auf die weite Reise. Sie fliegen unbedingt, unwandelbar, auf immer denselben Wegen, die nur sie kennen, fliegen vom einen bis ans andere Ende der Welt. Sie fliegen durch Gewitter und Sturm, bei Tag und bei Nacht, unermüdlich schlagen sie mit den Flügeln, sie schlafen sogar im Flug. So will es die Natur. Nach dem Norden, zu den großen Strömen fliegt die gefiederte Schar, um auf angestammten Nistplätzen die nächste Brut aufzuziehen. Im Herbst aber brechen sie samt ihrer inzwischen gekräftigten Nachkommenschaft gen Süden auf, und so geht es ohne Ende.
Nun fliegen wir schon viele, viele Tage. In dieser unirdischen, eisigen Höhe tost der Wind gleich einem endlosen Strom, oder ist es die Zeit selbst, die im unermesslichen All unsichtbar dahinströmt, wer weiß wohin?
Unsere Hälse gleichen Pfeilen, unsere Körper aber gleichen Herzen, angestrengten und unermüdlichen Herzen. Noch lange müssen wir fliegen – Flügelschlag um Flügelschlag.
Wir fliegen, schwingen uns höher und höher. So hoch, dass die Berge flach werden, dann gänzlich verschwinden und die Erde, immer weiter entfernt, ihre Umrisse verliert: Wo ist da noch Asien, wo Europa? Wo sind die Ozeane, wo die Kontinente? Öde und leer ist alles ringsum – nur unsere Erdkugel wiegt sich sacht, zieht durchs endlose All wie ein Kameljunges, das sich in der Steppe verirrt hat und die Mutter sucht. Wo aber ist sie, die Kamelmutter – wo ist die Mutter der Erde? Kein Laut! Nur der Höhenwind tost, und die Erde, nicht größer als eine Faust, wiegt sich und zieht durchs All. Wie der Kopf eines verwaisten Kindes wiegt sie sich – so schutzlos, so verletzlich. Findet auf ihr wirklich so viel Gutes Platz, werden auf ihr wirklich so viele Übeltaten verziehn? Nein, ihr dürft nicht verzeihn, ich bitte euch, tut es nicht, ihr, die ihr dem Feuer gebietet, die ihr die Welt erkennt, die ihr des Schicksals Lauf lenkt.
Nur ein Vogel bin ich in diesem fliegenden Schwarm. Ich fliege mit den Kranichen und bin selbst ein Kranich. Auch ich orientiere mich nachts nach den Sternen, tags nach den Fluren und Städten. Und ich mache mir meine Gedanken.
Ich fliege und weine, fliege und weine, fliege und weine.
Ich beschwöre Menschen und Götter:
Bedenkt, was ihr tut,
dass ihr unbedacht nicht die Erde vernichtet!
Gewiss doch, ihr Menschen:
Wenn Kranichtränen euch netzen –
was kümmert es euch? Wischt sie weg!
Und dennoch, ja, dennoch:
Behüt euch der Himmel
vor Leid, das kein Mensch mehr erträgt,
vor Feuersbrünsten, die keiner mehr löscht,
vor blutigen Kriegen, die keiner aufhält,
vor Taten, die keiner mehr gutmacht.
Behüt euch der Himmel
vor Leid, das kein Mensch mehr erträgt.
Der Schwarm entschwindet in der Ferne dem Blick. Nicht mehr auszumachen sind die Flügelschläge. Eben noch wirkte der Vogelzug wie ein Pünktchen am Himmel, nun hat auch das sich verloren.
Doch die Zeit geht ins Land: Wieder ist Frühling, und wieder ertönen Kranichschreie hoch droben …
Der Soldatenjunge
Das erste Mal sah er seinen Vater im Film. Da war er ein Knirps von etwa fünfJahren.
Als Kino diente der große weiße Stall, in dem jedes Jahr die Schafe geschoren wurden. Dieser schiefergedeckte Schafstall steht heute noch hinter der Sowchossiedlung, kurz vorm Berg, an der Straße.
Dorthin war er mit der Mutter gegangen. Seine Mutter Dshejengul, Telefonistin im Sowchospostamt, arbeitete jeden Sommer als Hilfskraft auf dem Scherplatz. Dafür nahm sie ihren Urlaub, verlängert durch das »Abbummeln« ganzer Wochenenden und Nächte, die sie während der Aussaat und der Lammung am Schaltbrett zugebracht hatte. Sie blieb, bis das letzte Schaf geschoren war. Beim Scheren wurde nach Leistung bezahlt, da konnte man ganz gut verdienen. Und sie, die Soldatenwitwe, rechnete mit jeder Kopeke. Zwar bestand die Familie nur aus ihr und dem Sohn, aber Familie bleibt Familie, da muss man Brennstoff für den Winter beschaffen, muss Mehl kaufen, bevor es auf dem Basar teurer wird, muss für Kleidung und Schuhe sorgen und noch für vieles andere.
Zu Haus gab es niemanden, der nach dem Sohn hätte sehen können, und so nahm sie ihn mit zur Arbeit. Tagelang lief er schmutzverschmiert und glücklich zwischen den Scherenden, den Schäfern und den zottigen Hunden herum.
Als der Landfilmwagen in den Hof einfuhr, erblickte er ihn zuerst, und sofort stürzte er davon, um allen dieses höchst erfreuliche Ereignis mitzuteilen.
»Das Kino ist gekommen! Das Kino!«
Die Vorführung begann nach der Arbeit, als es schon dunkel war. Bis dahin verging er fast vor Ungeduld. Doch seine Qualen wurden belohnt. Es war ein Kriegsfilm. Auf der weißen Leinwand, die zwischen zwei Pfosten hinten im Schafstall gespannt war, entbrannte eine Schlacht: Abschüsse dröhnten, pfeifend stiegen Leuchtkugeln hoch, zerrissen mit grellem Weiß die lärmdurchtoste Dunkelheit, strahlten die zur Erde geduckten Aufklärer an. Die Leuchtkugeln erloschen, und die Aufklärer stürzten wieder vorwärts. Maschinengewehre feuerten inmitten der Nacht, dass es dem Jungen den Atem verschlug. Wenn das nicht Krieg war!
Die Mutter hatte sich mit ihm auf Wollballen niedergelassen, hinter den anderen. Von da sah man besser. Er hätte freilich lieber in der ersten Reihe gesessen, dort, wo es sich die Kinder aus dem Sowchos bequem gemacht hatten. Er wollte gleich zu ihnen flitzen, doch die Mutter hielt ihn zurück.
»Nun reichts aber, von früh bis spät tobst du rum, jetzt bleib mal bei mir.« Und sie nahm ihn auf den Schoß.
Der Filmapparat surrte, der Krieg ging weiter. Die Zuschauer wandten kein Auge von der Leinwand. Die Mutter seufzte; manchmal, wenn ein Panzer direkt auf sie zielte, fuhr sie erschrocken zusammen und presste den Sohn fester an sich. Eine Frau, die neben ihnen auf den Ballen saß, schnalzte kummervoll mit der Zunge und murmelte: »Mein Gott, was geht da vor, mein Gott!«
Er aber fand es gar nicht so schrecklich; im Gegenteil, wenn die Faschisten fielen, war es sogar recht lustig. Fielen aber Sowjetsoldaten, dann meinte er, sie müssten gleich wieder aufstehen.
Überhaupt ist es komisch, wie die Menschen im Krieg fallen. Haargenau wie Kinder beim Kriegspielen. Er kann auch so fallen, mitten aus dem Lauf heraus, als hätte ihm jemand ein Bein gestellt. Weh tut es ja, wenn man so hinschlägt, doch was machts, man steht wieder auf, der Angriff geht weiter, und vergessen ist der Schmerz. Diese hier aber stehen nicht mehr auf, sie bleiben als unbewegliche dunkle Hügel liegen. Er kann auch anders fallen, so wie die Soldaten nach einem Bauchschuss. Die fallen nicht sofort, sie greifen sich erst an den Leib, krümmen sich und lassen sich langsam ins Gras sinken, während ihnen die Waffe aus der Hand gleitet. Er verkündet danach immer, er sei gar nicht tot, und kämpft weiter. Diese hier aber standen nicht wieder auf.
Der Krieg ging weiter. Der Filmapparat surrte. Jetzt erschienen auf der Leinwand Artilleristen. Unter starkem Feuer, inmitten von Explosionen und Rauch, brachten sie eine Pak für den direkten Beschuss in Stellung. Sie schoben das Geschütz eine steile Böschung hinauf. Der Hang war hoch und breit, reichte fast bis an den Himmel. Und auf diesem hohen und breiten Hang, der unter den schwarzen Spritzern der Explosionen beinahe barst, arbeitete sich das Häuflein Artilleristen vor. In ihren Bewegungen, in ihrem Äußeren war etwas, was einem das Herz höher schlagen ließ und die Brust mit Stolz, Schmerz und der Erwartung von Schrecklichem und Großem erfüllte. Es waren sieben Mann. Ihre Kleidung schwelte. Einer der Artilleristen sah nicht wie ein Russe aus. Vielleicht hätte der Junge ihn gar nicht beachtet, wenn nicht die Mutter geflüstert hätte: »Schau nur, dein Vater …«
Von da an wurde er sein Vater. Der ganze Film handelte nun von seinem Vater. Der Vater war jung wie die Burschen aus dem Sowchos. Er war von niedrigem Wuchs, hatte ein rundes Gesicht und flinke Augen, die böse in dem von Schmutz und Rauch schwarzen Gesicht funkelten, er wirkte flink und geschmeidig wie eine Katze. Da, die Schulter gegen ein Rad des Geschützes gestemmt, drehte er sich um und rief jemandem weiter unten zu: »Munition! Schnell!« Seine Stimme wurde übertönt vom Donner einer neuen Explosion.
»Mama, ist das mein Vater?«, fragte Awalbek die Mutter.
»Was?« Sie verstand nicht. »Sitz ruhig und pass auf!«
»Du hast doch gesagt, er sei mein Vater.«
»Ja freilich. Aber sei still, stör die andern nicht.«
Warum hatte sie das gesagt? Vielleicht einfach so, zufällig, unüberlegt; vielleicht in der Erregung, weil sie an ihren Mann erinnert wurde. Und er, der kleine Dummrian, glaubte es, war ganz verwirrt vor Freude, einer jähen, nie zuvor erlebten Freude, und ihn erfasste kindlicher Stolz auf seinen Vater, den Soldaten. Das war doch ein richtiger Vater! Sein Vater! Und die Jungs neckten ihn dauernd, er habe gar keinen. Jetzt sollen sie seinen Vater endlich sehen, sie und auch die Hirten! Diese Hirten, die immerzu nur in den Bergen herumwandern und die Kinder nicht mal mit Namen kennen! Er hilft ihnen die Schafherden in den Pferch zum Scheren treiben, er jagt ihre Hunde auseinander, wenn sie sich raufen, und dennoch setzen ihm die Hirten mit Fragen zu. So viel Hirten es auf der Welt auch gibt, jeder fragte ihn unbedingt: »Na, Dshigit, wie heißt du denn?«
»Awalbek.«
»Und wer ist dein Vater?«
»Ich bin der Sohn von Toktossun.«
Die Hirten wissen nicht gleich, wer das ist. »Von Toktossun?«, fragen sie und beugen sich aus dem Sattel herab. »Von was für einem Toktossun?«
»Ich bin der Sohn von Toktossun«, beharrt er.
Die Mutter hat ihn geheißen, so zu antworten, und auch die blinde Großmutter ermahnt ihn, er dürfe den Namen des Vaters nie vergessen. Sie zieht ihn sogar an den Ohren. Die Böse …
»Aaah, wart mal, du bist doch der Sohn von der Telefonistin auf der Post, nicht wahr?«
»Nein, ich bin der Sohn von Toktossun.« Er bleibt dabei.
Da endlich kapieren die Hirten.
»Na freilich, du bist der Sohn von Toktossun! Bist ein tüchtiger Junge! Wir wollten dir ja bloß auf den Zahn fühlen. Nimms nicht krumm, Dshigit, das ganze Jahr sind wir in den Bergen, und ihr wachst hier wie das Gras, wie soll man sich da auskennen.«
Dann tauschen sie lange Erinnerungen an seinen Vater aus. Flüstern miteinander, sagen, dass er blutjung an die Front gegangen ist, viele können sich gar nicht mehr an ihn erinnern. Gut, dass er einen Sohn hinterlassen hat, wie viele Burschen sind unverheiratet ins Feld gezogen, und keiner trägt heute mehr ihren Namen!
Seit dem Augenblick jedoch, da die Mutter ihm zuraunte: »Schau, dein Vater …«, wurde der Soldat auf der Leinwand sein Vater. Er sah tatsächlich dem Foto des Vaters, einem jungen Soldaten mit Käppi, sehr ähnlich. Dem Foto, das sie später vergrößern ließen und unter Glas gerahmt aufhängten.
Nun betrachtete Awalbek den Vater mit Sohnesaugen, und sein kindliches Herz wurde von einer heißen Woge nie gekannter Sohnesliebe und Zärtlichkeit durchflutet. Der Vater auf der Leinwand wusste anscheinend, dass der Sohn auf ihn blickte; es war, als wollte er sein kurzes Leben im Film so nützen, dass der Sohn ihn für immer im Gedächtnis behielt und auf ihn, den Soldaten, für immer stolz war. Jetzt erschien der Krieg dem Jungen gar nicht mehr unterhaltsam, und es war gar nicht mehr komisch, wie die Menschen fielen. Der Krieg wurde ernster, erregender, schrecklicher. Und zum ersten Mal bangte er um einen ihm nahestehenden Menschen, um den, den er immer vermisst hatte.
Der Filmapparat surrte, der Krieg ging weiter. Vorn tauchten angreifende Panzer auf. Sie näherten sich drohend, rissen mit ihren Raupenketten die Erde auf, drehten die Türme und schossen im Fahren aus ihren Kanonen. Die sowjetischen Artilleristen aber zogen mit letzter Kraft die Pak hinauf.
»Schneller, Papa, schneller! Die Panzer kommen, die Panzer!«, feuerte der Sohn den Vater an. Endlich hatten sie die Pak oben, schoben sie in ein Haselnussgestrüpp und eröffneten das Feuer auf die Panzer. Die schossen zurück. Es waren viele. Ihm wurde unheimlich.
Der Sohn meinte dort neben dem Vater zu sein, im Feuer und Kampfeslärm. Er zappelte auf den Knien der Mutter, wenn Panzer in Brand gerieten und schwarzer Rauch aufstieg, wenn es die Raupenketten von den Rädern riss und die Panzer blindwütig auf der Stelle mahlten. Er wurde still und krümmte sich zusammen, wenn Sowjetsoldaten bei dem Geschütz fielen. Es wurden immer weniger … Die Mutter weinte, ihr Gesicht war tränenfeucht und glühte.
Der Filmapparat surrte, der Krieg ging weiter. Der Kampf entbrannte mit neuer Kraft. Die Panzer kamen näher und näher. Neben der Lafette kauernd, schrie der Vater zornig etwas in den Hörer des Feldtelefons, aber in dem Lärm war nichts zu verstehen. Da fiel noch ein Soldat bei dem Geschütz; er versuchte vergeblich aufzustehen, dann stürzte er mit dem Gesicht auf die Erde. Der Boden färbte sich schwarz von seinem Blut. Nun waren nur noch zwei übrig geblieben, der Vater und ein anderer Soldat. Sie feuerten erst einen Schuss ab, dann zwei unmittelbar hintereinander. Doch die Panzer rollten vorwärts. Wieder schlug ein Geschoss ein, direkt neben der Pak. Explosion, Feuer und Dunkelheit. Jetzt erhob sich nur noch einer – sein Vater. Er stürzte aufs Neue zum Geschütz. Lud selber, richtete selber. Es war der letzte Schuss. Die Leinwand wurde von einer Explosion verdunkelt. Vaters Kanone lag zerbeult auf der Seite. Doch er war noch am Leben. Stand langsam auf und ging dem Panzer entgegen, kohlschwarz und mit rauchenden Kleiderfetzen. In der Faust hielt er eine Handgranate. Er sah und hörte nichts mehr, sammelte die letzten Kräfte.
»Halt, du kommst nicht durch!« Er schwang die Handgranate und erstarrte für eine Sekunde in dieser Haltung, das Gesicht von Hass und Schmerz verzerrt.
Die Mutter presste dem Sohn die Hand so fest zusammen, dass ihm der Atem stockte. Er wollte sich losreißen und zum Vater laufen, doch aus der Mündung des Panzer-MGs prasselte eine lange Salve, und der Vater stürzte wie ein gefällter Baum. Er rollte über die Erde, versuchte hochzukommen und fiel wieder auf den Rücken, die Arme weit ausgebreitet.
Der Filmapparat verstummte, der Krieg brach ab. Der erste Teil war zu Ende. Der Vorführer machte Licht, um einen neuen Streifen einzulegen. Als es im Stall hell wurde, verkniffen alle die Augen und blinzelten, aus der Welt des Films, aus dem Krieg zurückgekehrt in ihr wirkliches Leben. Der Junge purzelte von den Wollballen und rief triumphierend: »Kinder, das ist mein Vater! Habt ihr gesehn! Meinen Vater haben sie getötet!«