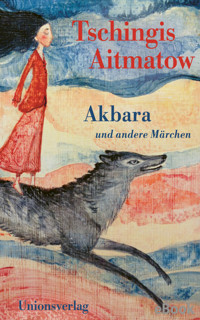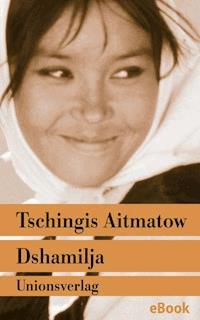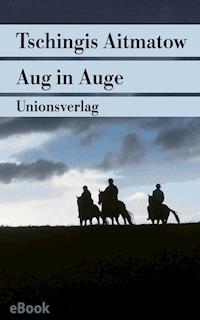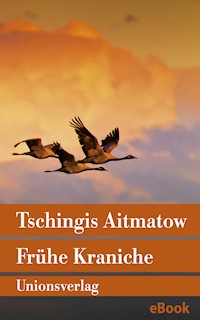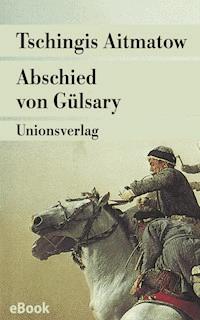9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aitmatow erzählt von seiner Jugend, die ebenso reich war wie schwer: Er war noch zu klein, um richtig aufs Pferd zu steigen, da musste er als Sekretär des Dorfsowjets die Steuern eintreiben und den Frauen die Todesmeldungen von der Front überbringen. Aber zu dieser kirgisischen Kindheit gehört auch das Eintauchen in die reichen Überlieferungen seines Volkes, gehören heitere Erinnerungen und Erlebnisse. Die wahre Geschichte einer verbotenen Liebe im Dorf entpuppt sich als Kern von Dshamilja. Einige Jahre später erntet der junge Viehzuchtexperte Aitmatow Auszeichnungen für seine rund hundert musterhaft gehaltenen Milchkühe. Als er aber seine ersten Novellen publiziert, entfesselt er im Schriftstellerverband einen Sturm der Entrüstung - er hat mit seinen Werken zu viele Tabus gebrochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Aitmatow erzählt von seiner Jugend: Er war noch zu klein, um richtig aufs Pferd zu steigen, da musste er schon als Sekretär des Dorfsowjets die Steuern eintreiben und den Frauen die Todesmeldungen überbringen. Aber zu dieser kirgisischen Kindheit gehört auch das Eintauchen in die reichen Überlieferungen seines Volkes, gehören heitere Erinnerungen und Erlebnisse.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tschingis Aitmatow (1928–2008) erlangte mit der Erzählung Dshamilja Weltruhm. Er besuchte das Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau und war Redakteur einer kirgisischen Literaturzeitschrift. Sein Werk fußt auf den Erzähltraditionen Kirgisiens und verarbeitet die Grundfragen der Zeit.
Zur Webseite von Tschingis Aitmatow.
Friedrich Hitzer (1935–2007) war freischaffender Autor, Übersetzer und Redakteur und engagierte sich als Kulturvermittler zwischen Europa, Russland und Mittelasien. 2006 wurde er mit der Puschkin-Medaille für sein Lebenswerk als Brückenbauer geehrt.
Zur Webseite von Friedrich Hitzer.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tschingis Aitmatow
Kindheit in Kirgisien
Autobiografische Erzählung
Herausgegeben und aus dem Russischen von Friedrich Hitzer
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Wir danken Maria Urmatowa (Aitmatow) für die Zusammenstellung der historischen Fotografien und die dokumentarischen Aufnahmen am Ende des Bildteils.
© by Tschingis Aitmatow 1998
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Dusko Matic
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30760-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 14:14h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KINDHEIT IN KIRGISIEN
Vorbemerkung des HerausgebersGroßmutterDas erste HonorarErinnerung an den VaterBegegnung mit den WölfenWie ich jemanden töten wollteDie schwarzen PapiereDas Häschen auf dem PostamtSejtaly – der erste LehrerMullah TscharginStudent und EselDer FuchsDer wahre IsmailDas Jerseyrind und die PappelDshamilja und DanijarBeschwörungenBeschwörung des GewittersAm GebirgspassAn den NeumondDer SämannZootechnische ArbeitenErfahrungen in der VersuchsfarmGenügt dreimaliges Melken?Die Maisration bei der TierfütterungBilderAbbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Mehr über dieses Buch
Über Tschingis Aitmatow
Tschingis Aitmatow: Über mein Leben
Kasat Akmatow: Tschingis Aitmatow bei sich zu Hause
Über Friedrich Hitzer
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tschingis Aitmatow
Zum Thema 2. Weltkrieg
Zum Thema Nomaden
Zum Thema Asien
Zum Thema Kindheit
Vorbemerkung des Herausgebers
Als Tschingis Aitmatow 1990 das Amt eines Botschafters der Sowjetunion in Luxemburg antrat, ahnte er noch nicht, dass daraus ein so langer Aufenthalt in Europa werden würde. Aus dem Botschafter der UdSSR wurde nach deren Auflösung Ende 1991 der Vertreter der Russischen Föderation; rund drei Jahre danach der Botschafter der unabhängigen Republik Kyrgyzstan bei der Europäischen Union in Brüssel.
Die Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend haben sich bei Tschingis Aitmatow, je länger er sich in Europa aufhielt, immer stärker gezeigt. Er hat nicht nur privat davon erzählt, sondern auch vor großem Publikum dann und wann die eine oder andere Geschichte gleichsam preisgegeben.
Sie waren nirgendwo nachzulesen. Natürlich finden sich in seinem Werk autobiografische Motive, aber meist verschlüsselt und nicht immer im Kontext der Erinnerungen von heute.
Im Mai 1996 gingen wir nach einer Lesereise für einige Tage in Klausur. Tschingis Aitmatow begann zu erzählen, ich zeichnete das gesprochene Wort auf. Er sah die Aufzeichnungen durch, ergänzte und redigierte sie für die Veröffentlichung. Es sollten keine geschriebenen, sondern erzählte Geschichten werden, wiedergegeben in der Tonlage, die er selbst in der Begegnung mit dem Publikum dem Abgelesenen vorzieht.
Friedrich Hitzer
Großmutter
Zu meiner frühen Kindheit gehört vor allem die Erinnerung an meine Großmutter Aimchan. Sie war eine herausragende Persönlichkeit und genoss bei den Menschen ihres Dorfes hohes Ansehen. Offenbar war sie eine weise Frau.
Sie hatte meinem Vater vieles beigebracht und war sehr stolz auf ihn. Sie besuchte uns des Öfteren in der Stadt. Sie hatte ihren weißen Turban auf dem Kopf, den Eletschek, den nach unserer nationalen Tradition nur verheiratete Frauen tragen durften. Sie war eine stattliche, anmutige Erscheinung. Der Eletschek stand ihr sehr gut und verlieh ihr etwas Majestätisches.
Fünf Kinder hatte sie auf die Welt gebracht – drei Töchter und zwei Söhne. Eine ihrer Töchter, meine Tante Karagys-apa, die wir noch kennenlernen werden, hat mich in meiner Jugend sehr gefördert.
Die älteste Tochter hieß Aimchul. Ich habe sie noch erlebt. Sie hatte es in ihrer Familie sehr schwer.
Dem Alter nach folgte ihr mein Vater Torekul, danach kam Tante Kulaim.
Der letzte Sprössling von Großmutter Aimchan hieß Ryskulbek. Onkel Ryskulbek war gescheit und gebildet. Er soll den Vorschlag gemacht haben, mir den Namen Tschingis zu geben. Offenbar kannte sich der Onkel in der Geschichte aus. Die Tradition war ihm wohl vertraut, Kinder nach berühmten Persönlichkeiten zu benennen.
Onkel Ryskulbek kam auf gleiche Weise ums Leben wie mein Vater Torekul.
Als ich später, nach dem gewaltsamen Tod meines Vaters, nach Scheker zurückkehrte, kümmerte sich Ryskulbek um uns, er war fünfundzwanzig Jahre alt. Er beschaffte uns Lebensmittel und half, wo er nur konnte.
Aber man holte ihn immer wieder zu Verhören ab. Die Bevollmächtigten des Kreises setzten ihm besonders zu und sorgten dafür, dass er keine Arbeit fand. Eines Tages – im Spätherbst 1937 – tauchten drei Milizionäre auf und holten ihn ab.
Ich schlief bei ihm im Bett.
»Hab keine Angst, schlaf nur, schlaf!«, sagte er noch und hüllte mich in eine Decke ein.
Aber ich zitterte vor Angst, während ich im schummrigen Licht einer Petroleumlampe auf die unheimlichen Gesichter der Polizisten blickte.
Wir haben Ryskulbek nie wieder gesehen. Es heißt, er sei in der burjätischen Mongolei umgekommen – in einem Konzentrationslager …
Ja, meine Großmutter Aimchan hatte fünf Kinder. Sie starb am Vorabend dieser schrecklichen Ereignisse …
Sie war eine fesselnde, kluge Persönlichkeit, kannte viele Lieder und Märchen. Sie konnte weder lesen noch schreiben. Und doch stand meine ganze Kindheit unter ihrem strahlenden Glanz – dem Glanz einer märchenhaften Welt.
Es war einmal wieder Sommerszeit, ich war fünf, sechs Jahre alt, und man brachte mich zu Großmutter. Wir brachen auf in die Berge – zum sommerlichen Nomadenlager. Wahrscheinlich war das einer der letzten großen Nomadenzüge in unserer Gegend. Das Nomadenleben neigte sich seinem Ende entgegen. Überall breitete sich die sesshafte Lebensweise aus. Neue Siedlungen entstanden, Kolchosen und Sowchosen. Da spielten die Jahreszeiten nicht die gleiche Rolle wie früher. Der Höhepunkt des Nomadenlebens war nämlich jene Saison, bei der die Menschen mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack zu neuen Weidegründen fürs Vieh umsiedelten …
Ich erinnere mich lebhaft an diese Zeit, denn sie zog uns Kinder ganz besonders in ihren Bann.
Wenn die Bewegung zum Aufbruch einsetzt, geraten alle in eine gehobene, ja erregte Stimmung.
Die Jurten werden zusammengetragen. Die Gerätschaften werden auf Kamele, Pferde und Ochsen gepackt. Und danach bricht die ganze Gemeinschaft der Nomaden mit ihren zahlreichen Viehherden aus Steppen und Vorbergen in die Richtung der hohen schneeweißen Bergriesen auf. Sie ziehen über die Pässe hin zum Dshajloo, den sommerlichen Weidegründen im Hochgebirge.
Das Nomadenlager ist ein wohlgeordnetes System, man musste alles vorkehren, damit die Umsiedlung normal ablief und das Leben in den Bergen im Handumdrehen weitergehen konnte. Dort musste alles griffbereit sein, auf der Stelle ausgepackt, ausgebreitet und eingerichtet werden können.
Die Viehzüchter und ihre Angehörigen kommen ja an einen völlig menschenleeren Ort. Die Menschen hätten sich an diesem Platz seit Langem niedergelassen und angesiedelt, wäre dort ein Leben das ganze Jahr über möglich gewesen. Aber das Dshajloo ist nur im Sommer zugänglich. Bis Ende Mai sind die Gebirgspässe unüberwindbar. Da häufen sich noch meterhohe Eis- und Schneemassen. Und ab Ende September, Anfang Oktober setzen wieder die Schneefälle und Schneestürme ein und schließen die Pässe ab, sodass sie erneut unüberwindlich bleiben – bis zum nächsten Mai. Zwei Drittel des Jahres ist dieser Ort im Hochgebirge von allem abgeschlossen, für nichts und niemanden erreichbar. Nicht einmal für wilde Tiere.
In dieser Zone, bei drei- bis viertausend Metern über dem Meeresspiegel, herrscht polares Klima. Bei Dauerfrost und ewigen Schneestürmen kann nichts bestehen, am allerwenigsten der Mensch. Dafür zieht es ihn aber umso heftiger in die Höhe während der kurzen Frist des Sommers, als müsse er diesen Augenblick nutzen.
In der Folklore wird diese Zeit manchmal mit der Jugend verglichen – der blühenden, glücklichen Jugendzeit, die das Alter rasch einholt und beendet.
Der Dshajloo ist märchenhaft und paradiesisch. Blumen und Gräser der Alpen und Hochgebirge sprießen und blühen fantastisch. Helle und klare Bäche und Flüsse strömen von den Gletschern herab. Allerlei Getier und Vögel tummeln sich reichlich in den Bergwäldern. Es gibt Brennholz in Hülle und Fülle. Dieser Flecken Erde schenkt den Menschen die besten Tage des Lebens.
Die Kirgisen schlugen also zur Sommerszeit an diesen Stellen des Hochgebirges ihre Jurten auf. Und mit Beginn des Herbstes räumten sie wieder diesen Platz des Lebens, um in die Täler zurückzukehren. Dabei musste man sehr auf der Hut sein, damit sich der Pass vor der Rückkehr nicht schloss. Solche Fälle waren zwar selten, doch kam es vor, dass Menschen aus weiß Gott welchen Gründen den Zeitpunkt der Rückkehr verpassten und die Steppe nie mehr erreichten. Wenn der Pass verschlossen war, kamen die Menschen um – es gab keinen Ausweg mehr. Wer dort bei Anbruch des Winters zurückbleibt, kommt in den Schneemassen und bei den polaren Frösten um – sogar die Wölfe, die mit den Menschen zurückbleiben. Deshalb waren die Menschen darauf bedacht, die Zeit einzuhalten.
Unser sommerlicher Nomadenzug nahm also seinen Anfang. Großmutter Aimchan ließ mich auf ein Pony steigen. Bis heute erinnere ich mich an das Pferdchen. Ja, man hat ein Kerlchen von fünf, sechs Jahren schon selbst reiten lassen. Für Kinder gab es Sättel, die auf beiden Seiten in Lendenhöhe Schutzleisten hatten, damit das Kind nicht nach links oder nach rechts vom Sattel rutschte. Sie ähnelten gewissermaßen den Kinderstühlen in der Stadt, die auch so gesichert sind, dass die Kleinen am Tisch der Erwachsenen mit Platz nehmen können.
Ich hatte also meinen Sattel und mein Pferdchen und war darauf mächtig stolz. Ich ritt selbstständig im Zug der Nomaden mit. Das Pferdchen gehorchte mir. Man hatte mir kein ungestümes Pony ausgewählt, das Hals über Kopf ausreißt. Ich brauchte keine Angst zu haben.
Und so ritt ich an der Seite von Großmutter und den Verwandten. Wir setzten den Herden nach, den Pferden und Schafen. Auf dem Rücken der Kamele schaukelten die Traglasten. Alle zog es zum großen Dshajloo.
Aber welche Vorbereitungen und Mühen kostet dieser Zug über die Pässe, um dort nur zwei Monate zu verbringen, danach zurückzukehren und von Neuem dorthin aufzubrechen. Der Hin- wie der Rückweg ist voller Beschwernisse und Gefahren. Mitunter kommt es dabei zu Naturkatastrophen. Aus heiterem Himmel bricht ein Schneesturm los, oder ein Erdrutsch begräbt Menschen und Tiere unter sich, zerstört Hab und Gut. Ganze Familien mit Kind und Kegel, mit Sack und Pack und all den Jurten sind unterwegs. Diese Zeit ist stets mit vielen Vorahnungen und Empfindungen verbunden.
Die Nacht vor dem Zug zum Gebirgspass hat den Namen Schykama – das ist die Nacht der Sammlung. Der Nomadenstrom nähert sich dem Ort vor der allerletzten Wegstrecke in die Höhe.
Unsere Karawanen versammelten sich dort gegen Abend.
Es machte wenig Sinn, die Jurten nur für die eine Nacht zu errichten, deshalb rastete man in Zelten. Lagerfeuer brannten, an denen sich die Menschen wärmten.
Am Fuß der Massen aus Eis und Schnee breitete sich ringsum die raue, schöne und majestätische Bergwelt aus. Und man dachte nur das eine: Wie werden wir morgen früh den Gebirgspass erstürmen? Sogar die Herden spürten diesen Augenblick vorweg – üblicherweise laufen die Tiere achtlos nach allen Seiten auseinander, aber hier verharrten sie alle an Ort und Stelle: Kein einziges Tier entfernte sich. Eine Nacht lang standen die Herden in dicht gedrängten Haufen.
Die Alten – Frauen oder Männer – heben an den Lagerfeuern ihren Sprechgesang an. Sie appellieren an die Geister der Berge und Pässe. Sie tragen ihre Beschwörungen vor.
»Nun sind wir am Fuß des Passes angelangt. Alle sind da – unsere Herden, die Familien und die Kinder, der Hausrat und die Jurten. Wir möchten dort hinauf, um das Licht der Welt zu erblicken. Jenseits des Passes liegen die frischen Wiesen und fließen die klaren Flüsse. Wir wollen dort unseren Sommer verbringen.«
Sie flehen zu den Geistern des Gebirgspasses.
»Haltet uns nicht auf, und schüttet keinen Regen über uns aus! Fallt nicht mit Winden über uns her, und verdeckt uns nicht die Sicht mit Wolken oder Nebel! Verschont uns mit dem Unheil der Elemente!«
»Wir schwören euch: Auch wir lieben diesen Himmel, diesen Pass und diese Berge! Beschert unsere Kinder mit Glück! Lasst das Vieh seinen Weg zum Dshajloo gesund beenden! Und behütet unseren Weg zurück ins Winterlager!«
»Lasst alle Nöte hier unten zurück! Schenkt den Tieren, jeder Kuh und jedem Schaf wie jedem Pferd, das Glück, die Wiesen unterm Himmel zu sehen. Und wir möchten die Vögel hören und die Tiere unterm Himmelszelt erblicken! Wir sagen Dank dem Schöpfer Tenir, Dank dir, Tenir, dass es den Weg über den Gebirgspass gibt.«
Was für eine verzauberte Zeit! Auch in späteren Jahren bin ich zum Dshajloo geritten, aber dann war schon alles anders und der Zauber verflogen. Doch nun herrschte noch eine ursprüngliche, romantische Stimmung vor. Und natürlich kam es zu unvergesslichen Begebenheiten …
Die erste hatte damit zu tun, dass mir plötzlich ein Zahn wehtat.
Wir hatten uns bereits auf dem Dshajloo niedergelassen und in verschiedene Ails aufgeteilt. Zwanzig bis dreißig Jurten standen jeweils zusammen. Üblicherweise taten sich die verschiedenen Sippschaften und Klans zusammen.
Plötzlich tat mir der Zahn schrecklich weh. Ich hielt mich nicht an die Aufteilung nach Klans, sondern rannte von Jurte zu Jurte. Kein Verwandter, kein Mensch konnte mir helfen. Wer sollte da auch einspringen – Zahnärzte gab es sowieso nicht.
Der Zahn schmerzte Tag und Nacht. War ich zuvor mit den anderen Kindern vom frühen Morgen bis zum Anbruch der Dunkelheit durch die blühenden Wiesen gerannt, so lag ich nun da und wimmerte.
Die Kinder rannten um die Wette und spielten unentwegt. Den Erwachsenen war das recht, sie wollten ja, dass die ganze Kinderschar sich in der reinen Natur und der Höhenluft austobte. Niemand hat uns da je zurechtgewiesen. Über uns wölbte sich ein klarer Himmel. Der Himmel leuchtete, und ein Wasser von besonderer Reinheit umgab uns allenthalben wie die Gräser, die sonst nirgendwo so schön wachsen. Wenn da nur nicht mein Zahn gewesen wäre, der mich furchtbar quälte.
Großmutter machte mir Kompressen mit Kräutern, legte einen erhitzten Stein auf die Stelle. Sie tat, was sie konnte, doch nichts half. Da schickte sie einen Verwandten los, einen Pferdehirten. Er sollte einen bekannten Wunderheiler holen. Wo der sich aufhielt, weiß ich nicht mehr, vielleicht im benachbarten Dshajloo.
Der Pferdehirt ritt weg zum Wunderdoktor. Ein zweites Pferd führte er am Zügel. Heute würde man, bräuchte man jemanden, ein Auto hinfahren lassen – aber im Dshajloo, da gibt es bis heute keine Straßen.
Der Zahn tat weiterhin schrecklich weh. Ich weinte und wimmerte und versuchte, mich irgendwie abzulenken.
Endlich brachte man den Wunderdoktor. Er war ein alter Mann, aber noch recht munter und beweglich. Großmutter hatte ihn schon von Weitem erkannt.
»Da kommen sie endlich.« Großmutter freute sich. »Gott wird uns schon helfen und dich erleichtern.«
Und sie fügte voller Überzeugung hinzu: »Jetzt werden wir deinen Zahn endlich kurieren!«
Ich war rasch auf den Beinen und hüpfte aus der Jurte. Da sah ich, wie unser Verwandter die Furt am Fluss überquerte. Seitlich hinter ihm ritt der Wunderheiler auf dem Pferd, das man ihm eigens geschickt hatte.
Er wurde empfangen, wie sich das gehörte. Ohne Umstände trat er auf mich zu und fragte: »Wo tuts weh?«
Ich heulte sofort und zeigte ihm den Zahn: »Da!«
»Hör auf zu weinen«, sagte er. »Wir kurieren dich auf der Stelle.«
Ich glaubte ihm aufs Wort, dachte mir wohl: Wenn er schon hierhergeritten ist, dann muss es ja stimmen, was er sagt. Und wie wir ihn erwartet hatten!
Der Wunderdoktor streichelte mir über den Kopf und wandte sich an Großmutter: »Sorgt dafür, dass alle anderen verschwinden. Lasst mich mit dem Kind allein in der Jurte. Da soll sich der Junge hinsetzen. Ich bedecke ihn dann mit einem Tuch – von oben bis unten.«
Gesagt, getan. Ich sitze unter ihm auf dem Boden und halte den Kopf gesenkt. Er stellt eine Tasse vor mich hin. In die Tasse kommt eine Kerze, die er anzündet. Sie brennt mit kleiner Flamme.
Und er fängt an zu sprechen: »Öffne deinen Mund und blicke auf die Kerze!«
Er bedeckt mich mit einem Tuch. Es wird dunkel. Nur die kleine Kerze brennt …
Zuvor sah ich noch, wie sich der Wunderheiler eine rituelle Kleidung überzog. Sie bestand aus Bändern, Federn und Lederstreifen, langen und kurzen. Das zottige Gewand war seltsam. In der Hand hielt er einen langen Stock, der ihn weit überragte. An diesem Stock hingen allerlei Eisenstückchen, Lappen und Lederriemen. Zudem hatte sich der Mann eine merkwürdige Mütze über den Kopf gestülpt.
Ich sitze also unter dem Tuch und über der Kerze und bin völlig bedeckt. Er rennt um mich herum, lässt den Stock erklirren, indem er ihn immer wieder auf die Erde stößt. Dabei gibt er völlig unverständliche Töne von sich und spricht fremdartige Wörter vor sich hin …
Damals wusste ich natürlich nicht, dass es ein Schamane war, der mich kurierte. Obwohl man bei uns den Islam als Religion längst angenommen hatte, war das Schamanenwesen, zumindest in rudimentären Formen, noch erhalten geblieben.
Der Schamane umkreiste mich unentwegt. Er schrie seine Verwünschungen und Anrufungen aus sich heraus.
Erstaunlicherweise – niemand wird es mir glauben, aber es war so und nicht anders – tat der Zahn plötzlich nicht mehr weh.
Der Zahn, der mich tagelang ununterbrochen mit rasenden Schmerzen geplagt, den man mit Salz und heißem Wasser gespült, mit Kompressen und anderen Mittelchen behandelt hatte, ließ mich in Ruhe. Von einem Augenblick zum anderen hörte der Zahnschmerz auf.
Er fragt mich: »Tuts noch weh?«
»Nein, nicht mehr«, antworte ich.
»Siehst du! Bleib noch ein wenig sitzen!«
Ich habe gar nichts dagegen und bleibe sitzen.
Er nimmt das Tuch von meinem Kopf. Und was sehen meine Augen?
Er hatte die kleine Porzellanschale mit Wasser unter die Decke gestellt. Als er die Decke von mir nahm, zeigte er auf diese Schale und sprach: »Sieh doch! Lauter kleine Würmer!«
Ich sah sie tatsächlich. Da krümmten sich Würmchen so dünn wie Haare.
Der Wunderdoktor hatte den Zahn beschworen. So war es doch?
Ich habe das nie vergessen und muss immer wieder daran denken. Denn genau so und nicht anders hat es sich abgespielt …
Viele Jahre später fragte ich Zahnärzte, ob solche Würmchen im Zahn eines Menschen vorkämen.
»Nein, so etwas gibt es nicht«, wurde mir stets geantwortet.
Warum sie aber bei mir wirklich vorkamen, kann ich bis heute nicht erklären.
Der Schamane sagte mir damals: »Schau, sie sind herausgefallen. Alle. Jetzt tut dein Zahn nicht mehr weh!«
Hatte er sie herbeigezaubert? Oder war es so gewesen, wie er es mir erklärte? Für mich ein Rätsel bis heute.
Natürlich hatte ich, kaum war das Zahnweh verschwunden, alles sofort wieder vergessen. Meine Spielkameraden kamen herbeigerannt. Wir tollten wieder umher, hüpften und spielten nach Herzenslust.
Vor lauter Freude schlachtete Großmutter ein Lamm. Dem Schamanen wurde herzlich gedankt. Er erhielt Geschenke und ritt wieder auf dem Pferd, auf dem er gekommen war, davon.
Warum sich den Kopf über das Rätsel zerbrechen? Die Hauptsache war doch – der Zahn tat nicht mehr weh.
Das erste Honorar
Während der Sommerszeit auf dem Dshajloo verdiente ich mein erstes Honorar.
Obwohl in jenen Jahren die Kolchosen entstanden, trieb man die großen Pferdeherden noch immer auf die Sommerweiden der Dshajloos. Auch für die Herden war das die verschwenderische Zeit eines paradiesischen Lebens. Wenn sich ein Pferd erinnern und fantasieren kann, dann malt es sich bestimmt – daran glaube ich fest – während der kalten Wintermonate die Jahreszeit aus, in der es frei über Hänge und durch rasch dahinfließende Bergflüsse laufen könnte. Die Herde weidet in einer Fülle von saftigen Gräsern und in sattem Grün. Die Pferde erleben Wind, Wetter und Hagel, bewegen sich unter einem riesigen nächtlichen Sternenzelt unter herrlichen Regenfällen, die ihre Körper waschen.
Eines Tages gerieten die Männer auf unserem Dshajloo in helle Aufregung und liefen hin und her. Schließlich versammelten sie sich vor unserer Jurte – sie suchten meine Großmutter auf, um sich mit ihr zu beraten. Es waren die Pferdehirten.
Ihr Zuchthengst war krepiert, das stärkste und wertvollste Tier in der Pferdeherde, das Leittier und der Anführer auf allen Wegen.
Man muss hier erwähnen, dass damals die Zucht bei der Viehhaltung eingeführt wurde. Die Kolchosen und Sowchosen sollten planmäßig organisiert werden. Dazu gehörte auch die Sorge um die Zuchthengste. Ich habe das erst viele Jahre später begriffen und mir lebhaft ausmalen können, ich studierte ja an der Fakultät für Tiermedizin und Viehzucht.
Ein Zuchtbetrieb, der hochwertige und produktive Rassen hervorbringen und deren Eigenschaften dauerhaft festigen will, muss viele Jahre lang Selektionsarbeit leisten. Solche Versuche bei Schafen, Pferden und Großhornvieh wurden zentralisiert durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden die Männchen zum Decken mitunter auch aus fernen Ländern hergebracht. Zum Beispiel wurden Schafböcke aus Australien mit heimischen Muttertieren gekreuzt und ließen eine neue Rasse Schafe entstehen. Ähnliches geschah bei der Pferdezucht.
Den Hengst, der auf dem Dshajloo krepiert war, hatte man auch eigens zur Selektion hergebracht. Er war ein berühmter Zuchthengst – ein Dongestütler, für die Kolchose ein ganz besonderes Tier. Und natürlich hatte man den Hengst vom Don auf die herrlichen Weiden in die Berge mitlaufen lassen.
Aber der Hengst vom Don verendete auf völlig unerwartete Weise.
Wir hatten uns an dem Ort niedergelassen, der den Namen Uu-Sas trug, das heißt Giftwiese. Dort wuchsen giftige Kräuter. Die einheimischen Tiere meiden diese Giftpflanzen aus natürlichem Instinkt. Dem Dongestütler aber ging der heimische Instinkt unserer Pferde ab. Er hatte wohl von diesen Kräutern gefressen.
Mit anderen Burschen rannte ich zu der Stelle, wo das Unglück geschehen war.
Wir wollten mit eigenen Augen sehen, wie das aussah. Der Dongestütler lag seitlich hingestreckt auf der Weide mit einem riesigen, aufgeblähten Wanst und abstehenden Beinen. Sein Kopf war zurückgebogen, mit fletschendem Gebiss und verglasten, unheimlich großen Augen.
Die Hirten standen um das Pferd. Sie waren äußerst erregt, schüttelten den Kopf und seufzten. Sie redeten durcheinander und stritten darüber, wie so etwas geschehen konnte.
Was war da los? Das beste Pferd in der Herde, eigens von weit, weit hergebracht, verendet mir nichts, dir nichts … Heute ist mir natürlich klar, dass sie auch Angst hatten, man würde sie zur Verantwortung ziehen, mussten sie doch auf das Zuchttier besonders achtgeben.
Sie brauchten einen Zeugen, der sie entlastete und plausibel erklären und protokollieren konnte, warum das Pferd krepiert war. Deshalb schickte man einen Eilboten in die Kreisstadt.
Am folgenden Tag traf ein Russe ein. Der Mann war Tierarzt, ein rothaariges, typisch russisches Mannsbild.
Die Hirten bemühen sich, ihm zu erklären, was dem Pferd zugestoßen war. Er hört zu, sieht sich alles an und kann überhaupt nicht verstehen, warum ein gesunder Gaul plötzlich tot umfällt und alle viere von sich streckt – der Körper sieht doch völlig unversehrt aus. Der Hengst hat nichts ausgekotzt und zeigt keinerlei Verletzungen.
Die Leute fuchteln mit den Händen, sie tun alles, um ihm die Sache zu erklären. Aber der Rothaarige kann kein Kirgisisch, und unsere Leute sprechen kein Russisch – damals war es eine Ausnahme, wenn einer beide Sprachen beherrschte.
Plötzlich fällt einem der Hirten ein: Da ist doch der Enkel von Großmutter Aimchan, der kann Russisch.
Auf zu Aimchan! Der Junge muss die Sache erklären, er soll übersetzen und dem russischen Tierarzt erzählen, was mit dem Dongestütler passiert ist …
Wie immer spielte ich damals mit meinen Freunden im Freien. Großmutter stöberte mich auf, nahm mich bei der Hand und sagte: »Komm mit und hilf den Leuten, dass sie miteinander reden können.«
»Ich will aber mit dem nicht reden«, antwortete ich ihr. »Ich möchte hier spielen.«
»Aber du kannst die russische Sprache. Wenn du nicht hilfst, werden alle Verwandten böse auf dich sein. Auch auf deinen Vater und deine Mutter. Also los, gehn wir!«
Großmutter schaffte es schließlich, mich zu überreden.
Wir kamen zu der Stelle, an der sich eine große Menschenmenge um das verendete Pferd versammelt hatte – bärtige Alte, die Jungen, fast das ganze Sommerlager hatte sich eingefunden. Mitten unter ihnen stand der Russe, der rothaarige und blauäugige Mann mit den chromledernen Stiefeln und der Lederjacke.
Großmutter Aimchan und ich treffen ein. Alle treten erwartungsvoll auseinander. Man bringt mich zum Tierarzt. Offenbar hat man auf uns schon gewartet – ich war schon angekündigt.
»Na, Junge, grüß dich!«, sagt er zu mir. Alle sind verstummt. Ich schweige.
»Sei gegrüßt!«, wiederholt er.
Da antworte ich: »Sdrawstwui! Grüß dich!«
»Du willst mir also helfen, ja? Bist ein kluges Kerlchen. Schön! Da ist also das größte Pferd krepiert, siehst du? Da liegt es. Tot! Man wird uns jetzt erklären, warum das passiert ist.«
Ein alter Mann tritt auf mich zu und spricht. Alle Übrigen hören und schauen uns zu. Der Alte streichelt mir über den Kopf und sagt: »Söhnchen! Erklär jetzt diesem russischen Mann: Der Ort in den Bergen, wo wir jetzt sind, heißt Uu-Sas, die Giftwiese. Hier wächst eine Giftpflanze, die unsere Pferde kennen und deshalb nicht fressen. Aber das Pferd da ist ein zugereistes und zum ersten Mal auf den Dshajloo gekommen, den es nicht kennt. Es hat dieses Kraut gefressen und sich vergiftet, deshalb ist das Pferd verendet. Das musst du jetzt dem Tierarzt erklären.«
»Na, red schon!«
Der Tierarzt wendet sich ungeduldig an mich und will es genau wissen: »Was hat er denn gesagt?«
»Onkel, das Pferdchen hat schlechte Kräuter gefressen.«
»Was soll denn das sein? Schlechte Kräuter?« Der Tierarzt fragt ganz verwundert.
»Ja, hier gibt es sehr schlechte Kräuter. Unsere Pferde fressen diese Pflanzen nicht, aber das Pferdchen da hat sie gefressen.«
»Aha! Sind die schlechten Kräuter etwa giftig?«, bohrt jetzt der Tierarzt nach.
»Genau, wahrscheinlich sind die schlechten Kräuter ganz giftig.«
Der Alte erklärt weiter auf Kirgisisch. »Siehst du, wie aufgebläht der Wanst des Pferdes ist? Das ist ein Riesenwanst und nicht normal.«
Ich übersetze. »Das Pferd bekam einen sehr großen Wanst, weil es schlechte Pflanzen gefressen hat.«
»Du bist ein Mordskerl«, sagt darauf der Tierarzt. »Jetzt kann ich alles verstehen und aufschreiben.«
Gleich an Ort und Stelle setzte er ein ordentliches Protokoll auf. Alle Hirten und der Tierarzt unterzeichneten das Protokoll, in dem zu lesen war, dass der Hengst, ein Dongestütler, krepiert war, weil er sich durch giftige Kräuter vergiftet hatte. Alles war wieder im Lot, weil nun das Papier unterschrieben war. Die Leute seufzten erleichtert und beschlossen, den russischen Tierarzt in der Jurte meiner Großmutter zu bewirten. Ihr gehörte die beste Jurte auf dem Dshajloo, auch ihr Geschirr war das schönste. Man schlachtete ein Lamm und verköstigte den Gast.
Ich spielte mit den Kindern draußen vor der Jurte. Plötzlich wurde mir von drinnen zugerufen: »Die Alten rufen dich, geh schon!«
Großmutter Aimchan saß in der Jurte und strahlte voller Stolz. Einer der Alten sagte: »Weil du so ein gescheiter Junge bist und uns beim Übersetzen geholfen hast, damit wir uns verstehen und ein gemeinsames Protokoll unterschreiben konnten, kriegst du jetzt ein schönes Stück Fleisch von uns.«
Das war mein erstes Honorar. Ich erhielt das Stückchen Siedfleisch. Die Spielkameraden erwarteten mich vor der Jurte. »Was war los?«, wollten sie von mir wissen.
»Den Schilik hab ich bekommen!« Das ist ein Stück saftiges Fleisch mit Knöchelchen. Wir teilten es unter uns auf und verspeisten es genussvoll. Danach spielten wir weiter.
Auf diese Weise wurde ich zum ersten Mal Dolmetscher aus dem Russischen ins Kirgisische und aus dem Kirgisischen ins Russische. Und diesen beiden Kulturen diene ich bis heute.
Es war eine ganz und gar naive und ursprüngliche Erfahrung. Doch meine Kinderseele sog sie auf, und sie prägte sich mir ein. Die Zweisprachigkeit begleitet mich seit damals durch mein ganzes Leben. Das Schicksal hat mir gleichsam zwei Sprachen mit auf den Weg gegeben. Die Sprache meiner Vorfahren und die russische Sprache, die im 18. Jahrhundert zu uns drang und dann bei uns blieb – runde zweihundert Jahre.
Die russische Sprache hat in die historische Entwicklung und die Kulturen unserer Regionen – ich meine das Gebiet von Turkestan – aktiv eingegriffen. Die Kenntnis der russischen Sprache wurde lebensnotwendig. Im frühen Knabenalter bin ich damit konfrontiert worden.
Erinnerung an den Vater
Ich sehe vor mir meinen Vater mit seinem dichten, schwarzen Haarschopf, im Feldrock und in hohen Lederstiefeln. Er fährt auf einem Zweispänner, die Kutsche ist offen, die Sitzfläche auf Federn befestigt. Vorne sitzt der Kutscher, und hinten, auf dem Platz für den Fahrgast: Dort sitzt mein Vater.
Ich sehe auch die Häuser in Fergana vor mir – ärmliche Häuser mit Flachdächern, die sich um einen umzäunten Hof gruppierten.
Hier spielte sich das Leben im Rahmen eines eigenen Gemeinwesens ab, ja eines ganzen Kollektivsystems – die Machalla bildete eine ständige Gemeinschaft im Wohnviertel. Die Älteren – Männer und Frauen – gaben hier den Ton an. Zu einer Bestattung, einer Hochzeit oder einem anderen Ereignis strömten die Leute aus dem ganzen Viertel zusammen. Diese Tradition ist bis heute in Usbekistan erhalten geblieben.