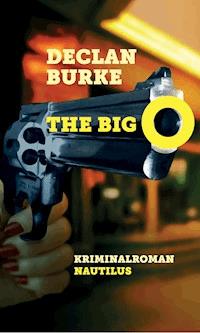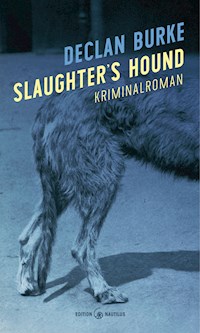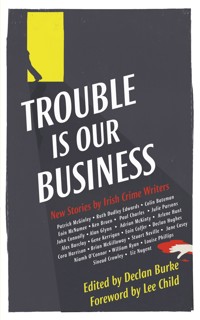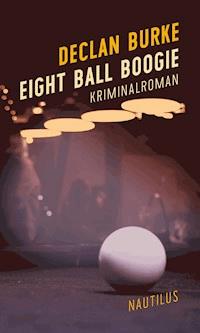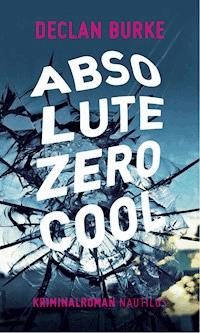
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine dreifach ausgezeichnete Krimi-Entdeckung aus Irland, wie Sie es noch nie gelesen haben! Billy Karlsson muss es einfach schaffen. Unbedingt. Der Krankenhausportier, der so ganz nebenbei ein bisschen Sterbehilfe betreibt, hängt als Figur in einem unvollendeten und unveröffentlichten Roman fest. Gefangen in dieser Vorhölle, geistig verwirrt und beinahe schon dem Wahnsinn nahe, muss er dringend etwas unternehmen, um endlich veröffentlicht zu werden. Denn wenn es schon nicht mehr genügt, alte Leute um die Ecke zu bringen, wird ihm wohl nur noch eines übrigbleiben: das Krankenhaus in die Luft zu jagen. Nur sein Schöpfer, der Autor, kann ihn noch aufhalten... Absolute Zero Cool stellt alle Traditionen des Krimigenres auf den Kopf und begeistert und verstört in gleichem Maße. Der Roman ist ein witziger selbstreflexiver Angriff auf das Genre selbst, eine einfallsreiche Story über die Fähigkeit des menschlichen Geistes, nicht nur schöpferisch, sondern auch zerstörerisch zu sein. Der Roman wurde mit dem Goldsboro Crime Fest Last Laugh Award 2012 für den witzigsten Krimi ausgezeichnet, stand auf der Shortlist des Irish Book Award 2011 (Kategorie "Crime Novel of the Year") und zählte zu den Best Books of the Year der Sunday Times.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Declan Burke ist einer der innovativsten Krimiautoren Irlands und betreibt die Krimi-Website Crime Always Pays. Absolute Zero Cool wurde mit dem Goldsboro Crime Fest Last Laugh Award 2012 ausgezeichnet und stand auf der Shortlist des Irish Book Award 2011.
Declan Burke
ABSOLUTEZEROCOOL
Kriminalroman
Aus dem Englischen übersetztvon Robert Brack
Der Verlag dankt für diefinanzielle Unterstützungder Übersetzung dieses Buches durch:Ireland Literature Exchange(Übersetzungsfonds), Dublin, [email protected]
Die Originalausgabe des vorliegendenBuches erschien unter gleichlautendemTitel bei Liberties Press, Dublin 2011
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D - 22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten© Edition Nautilus 2014Deutsche Erstausgabe August 2014Umschlaggestaltung:Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.de1. AuflagePrint ISBN 978-3-89401-793-4E-Book ePub ISBN 978-3-86438-159-1
Inhalt
PROLOG
I WINTER
II FRÜHLING
III SOMMER
IV HERBST
DANKSAGUNGEN
Graphomanie (die Besessenheit, Bücher zu schreiben) wird zwangsläufig zur Massenepidemie, wenn die gesellschaftliche Entwicklung drei grundlegende Voraussetzungen erfüllt:
1) hoher Grad allgemeinen Wohlstands, der es den Leuten ermöglicht, sich unnützen Tätigkeiten zu widmen;
2) hohes Maß an Atomisierung des gesellschaftlichen Lebens und daraus hervorgehend allgemeine Vereinsamung der Individuen;
3) radikaler Mangel bedeutender gesellschaftlicher Veränderungen im inneren Leben eines Volkes. (…)
Allerdings beeinflusst das Ergebnis rückwirkend die Ursache. Die allgemeine Vereinsamung verursacht Graphomanie, die massenweise Graphomanie wiederum verstärkt und steigert die allgemeine Vereinsamung. Die Erfindung des Buchdrucks hat es der Menschheit ermöglicht, sich untereinander zu verständigen. Im Zeitalter der allgemeinen Graphomanie erhält das Bücherschreiben einen umgekehrten Sinn: jeder ist von seinen Buchstaben umzingelt wie von Spiegelwänden, durch die von außen keine Stimme mehr dringt.
Milan Kundera, Das Buch vom Lachen und Vergessen
Die Zeiten sind schlecht. Die Kinder gehorchen ihren Eltern nicht mehr und jeder schreibt ein Buch.
Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.)
PROLOG
Der Mann am Fuß meines Betts ist zu gut angezogen, um etwas anderes zu sein als ein Anwalt oder ein Zuhälter. Er liest sehr aufmerksam, also ist er wohl eher ein Zuhälter, denn Anwälte sind heutzutage eher damit beschäftigt, Romane zu schreiben anstatt sie zu lesen.
Über seinem Kopf, dicht unter der Decke, hängt ein moosgrüner Gecko als einziger Farbtupfer in diesem ansonsten völlig weißen Raum. Weiße Wände, weiße Fliesen. Die Jalousien, das Nachtschränkchen, die Laken, die Kacheln, die Tür – alles weiß.
Da es sich bei seiner Lektüre um ein Romanmanuskript handelt, ist die mir zugewandte Seite ebenfalls weiß.
Er schaut mich an.
»Du hast es echt drauf«, sagt er. Er legt das Manuskript zur Seite und hält eine Zeitung hoch. »Die sind einen Tag hinterher, aber man bekommt einen Eindruck.«
Die Titelseite der Zeitung wird beherrscht von einem verkohlten Krankenhausgebäude, das sich zur Seite neigt.
Ich greife mir Stift und Notizblock, die auf dem Nachttisch bereit liegen, und schreibe ein Wort darauf.
Rosie?
Er steht auf, geht ums Bett herum und nimmt mir den Block ab.
»Der Kleinen geht es gut«, sagt er. »Hat anscheinend ein bisschen Rauch in die Lunge bekommen, ist aber nichts Ernstes. Das wird wieder.«
Er faltet die Zeitung auseinander und blättert sie durch. »Zwischen den Zeilen lesen. Ihrer Ansicht nach wäre eine Anklage wegen Sachbeschädigung für dich am glimpflichsten. Das bedeutet, du musst auf geistige Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Wenn du mit ›total durchgeknallt‹ anfängst und dann bei ›zeitweilig geistesgestört‹ endest, kommst du vielleicht in fünf Jahren wieder raus. Aber das wäre das bestmögliche Szenario.«
Ein Mensch kann sich nicht vor der Welt verstecken. Das lässt die Welt nicht zu. Die Schwerkraft ist unerbittlich. Entweder aufrechter Gang, mit erhobenem Kopf, oder gar nicht.
»Im schlimmsten Fall«, sagt er, »holen sie die ganz großen Knüppel aus der Kiste: Angriff auf staatliche Institutionen, Terrorismus, das ganze Programm. Es gibt zwar kein spezielles Gesetz gegen das Sprengen von Krankenhäusern, aber ich gehe mal davon aus, dass sie einigen Spielraum haben.«
Er hält inne. Die Klimaanlage summt vor sich hin. Durch das abgedunkelte Fenster dringt das leise Zirpen der Zikaden.
»Soweit die gute Nachricht. Die schlechte ist…« Er hält die Kommentarseite hoch und tippt auf das Editorial. »… dass sie der Meinung sind, du könntest unmöglich allein gehandelt haben. Sie gehen davon aus, dass du Helfer gehabt hast, vielleicht eine ganze Gruppe.«
Dem ist nichts hinzuzufügen. Dann wäre alle Mühe umsonst gewesen.
Er faltet die Zeitung zusammen und schiebt sie unter mein Kopfkissen. Greift nach dem Manuskript und legt es auf die blitzsaubere Bettdecke neben meine Hand.
Oben drauf platziert er einen roten Stift, so dass er den Titel »Die Babykiller« unterstreicht.
»Da du in den nächsten Tagen kaum hier wegkommst, dachte ich mir, du möchtest es vielleicht noch mal durchgehen. Und überlegen, ob wir nicht noch mehr Babys umbringen können.«
Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von Samuel Beckett: Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern.
Er taucht einfach auf, als hätte man ihn herbeigewünscht.
Ich sitze draußen auf der Terrasse neben dem Goldfischteich an einem milden Frühlingsmorgen, die Knospen sprießen, die Sonne geht auf, es wird ein warmer Tag. Die Bienen summen, der Springbrunnen gurgelt vor sich hin wie ein zufriedenes Baby. Eine Tasse guten Kaffee in der Hand. Gerade denke ich noch, dass alles so ist, wie es sein soll, da fällt ein Schatten auf die vor mir liegenden Blätter. Als ich aufschaue und meine Augen gegen die Helligkeit abschirme, steht er da, schüchtern und mit einem leicht blöden Grinsen im Gesicht.
»Du erinnerst dich nicht mehr an mich«, sagt er.
Bestimmt verwechselt er mich mit einem anderen. Wir haben uns in den letzten Tagen zugenickt, wenn wir einander begegneten, in der Kantine oben im Großen Haus oder wenn wir auf dem Gelände unterwegs waren. Jedes Mal hatte ich den Eindruck, er warte darauf, dass ich ihn wiedererkenne, ihn freundlich anlächle und ihn auffordere, sich mit mir zu unterhalten.
So läuft das aber nicht bei mir. Ich bin hier, weil ich mich zurückziehen, mich abschotten, mich auf meine Arbeit konzentrieren will. In stiller Abgeschiedenheit und auf Eingebung hoffend.
Jetzt lehne ich mich zurück, schirme immer noch meine Augen ab, und stelle fest, dass er mir unbekannt ist. Ich höre, wie ich mich entschuldige, ich hätte schon immer ein schlechtes Personengedächtnis gehabt; Namen ja, ich hätte nie Schwierigkeiten, mich an die Namen von Leuten zu erinnern, aber Gesichter könne ich mir einfach nicht merken. Tatsächlich stimmt das gar nicht, das Gegenteil ist der Fall, aber selbst wenn es wahr wäre, hätte ich mich an diesen Kerl erinnert.
»Wahrscheinlich liegt es an der Augenklappe«, sagt er. »Außerdem war ich damals nicht blond.« Er hat sehr kurz geschnittenes platinblondes Haar, ein strahlend blaues Auge wie Paul Newman und breite Wangenknochen. Ich schätze ihn auf Mitte dreißig. »Und ich war ungefähr acht Zentimeter kleiner.«
Er tritt von einem Fuß auf den anderen. »Ein Mann sollte was hermachen.«
Ich hätte ihn für einen Dichter gehalten, wenn er nicht diese Motorradstiefel angehabt hätte. Aus irgendwelchen Gründen bevorzugen die Dichter hierzulande bequemes Schuhwerk.
»Ich nehme an, es ist kein Kaffee mehr übrig?«, fragt er.
Nur weil ich höflich sein will, und weil ich frischen Kaffee brauche, gehe ich über den Rasen in mein hübsches Häuschen und bereite zwei Tassen Kaffee vor. Während ich darauf warte, dass der Wasserkessel kocht, schaue ich durchs Fenster in den Garten, wo er sich gerade eine Zigarette stibitzt. Jede Wette, dass es nicht mehr lange dauert, bis er zu jammern anfängt, wie schwer er es im Leben hat und keiner ihn versteht.
Und ich denke noch, Mensch, vielleicht solltest du einfach mal etwas mehr Zeit am Schreibtisch verbringen, ein paar Sachen klären, anstatt dich herumzutreiben, von anderen was einzufordern und ihnen die Zigaretten zu klauen…
Die Wette: Wenn er innerhalb der nächsten zehn Minuten anfängt, über das Arts Council zu nörgeln, nehme ich mir den Nachmittag frei und gehe zum Angeln an den See.
Als ich zurück auf die Terrasse komme, starrt er in den Teich.
»Hören Sie mal«, sage ich. »Das wird jetzt langsam peinlich und…«
Er dreht sich um, wirft mir einen trotzigen Blick zu. »Karlsson«, sagt er.
»Und wir haben uns schon mal getroffen«, sage ich zweifelnd und puste auf meinen Kaffee.
»In gewisser Weise.«
»Da komme ich jetzt nicht ganz mit.« Gleichzeitig wird mir klar, dass er mich übers Internet kennen könnte, wegen des Blogs, den ich schreibe, in dem es um die neuesten Entwicklungen in der irischen Krimiszene geht. Der Name Karlsson kommt mir nicht bekannt vor. Vielleicht kenne ich ihn unter einem anderen Namen, als virtuelle Identität.
»Ich würde mich doch an jemanden erinnern, der Karlsson heißt«, sage ich. »Sind Sie Schriftsteller?«
»Im Moment bin ich der böse Geist.«
»Ich verstehe schon, deshalb die Augenklappe und so.
Aber was waren Sie, als wir uns kannten?«
»Aushilfskraft.«
»Eine Aushilfe?«
»So eine Art Mädchen für alles im Krankenhaus.«
Ich greife nach dem Tabak und drehe mir eine. Nehme einen Schluck Kaffee und warte auf ein Zucken oder eine winzige Andeutung, die ihn verrät. Er starrt mich einfach nur an.
»Sie sind also dieser Karlsson?«
»Genau der, ja.«
»Okay, ich will mal mitspielen. Sie sind Karlsson. Was kann ich also für Sie tun?«
»Du könntest mir erst mal erzählen, was passiert ist.«
»Mit Karlsson? Nichts.« Ich erkläre ihm, dass ich die erste Fassung immer ausdrucke und dann für sechs Monate weglege. Ohne Ausnahme.
»Meinetwegen«, sagt er. »Aber das ist jetzt fast fünf Jahre her. Ich war achtundzwanzig, als du den Text geschrieben hast. Und ich weiß doch, dass du nicht aufgehört hast zu schreiben. Ich hab dein neuestes Buch gesehen, The Big O, es kam vor einigen Jahren in den Buchhandel.«
»Es hat sich eben alles anders entwickelt. Ist nicht böse gemeint.«
»Ich hab nie geglaubt, dass du das freiwillig getan hast«, sagt er. »Damit du es weißt: Ich befinde mich hier im Fegefeuer.«
Er schiebt den Zeigefinger unter die Augenklappe und kratzt etwas weg.
»Du musst veröffentlichen, sonst bin ich verdammt.«
Karlsson war eine Aushilfskraft im Krankenhaus, er half alten Menschen, die ihn darum baten, beim Sterben. Seine Freundin Cassie fand es heraus. Dann mischten die Bullen sich ein, weil Cassie anonym mit ihnen Kontakt aufgenommen hatte, bevor sie ihn zur Rede stellte. Die Bullen waren allerdings mehr daran interessiert, wo Cassie nun abgeblieben war.
»Wie geht’s Jonathan?«, frage ich.
»Jonathan?«
»Jonathan Williams. Mein Agent oder ehemaliger Agent. Soweit ich weiß, ist er der Einzige, der das Manuskript je zu Gesicht bekam. Es sei denn, er hat es an einen Außenlektor zur Beurteilung gegeben.«
Ich vermute, dass dieser Typ hier ein schräges Theaterstück aufführt, indem er die Identität von Karlsson annimmt, einer unveröffentlichten Romanfigur, die durch Raum und Zeit wabert. Nicht dass es mich besonders stört, auf der Bühne könnte es ein ziemlicher Spaß sein, aber es wäre mir lieber, Jonathan hätte mich um Erlaubnis gefragt, bevor er das Manuskript zur Bearbeitung weitergab.
»Ich kenne keinen Jonathan Williams«, sagt er. »Wie sollte ich auch? Ich befinde mich hier im Fegefeuer.«
»Stimmt ja. Und dieses Fegefeuer hält Sie davon ab, für die Rechte am Originalstoff zu zahlen?«
Etwas Dunkles flammt im hellblauen Paul-Newman-Auge auf. »Glaubst du etwa, das hier ist ein Scherz?«
»Ehrlich gesagt, kommt es mir eher wie eine Tragikomödie vor. Keine ausgereifte Tragödie, aber durchaus anrührend, ja.«
»Siehst du, genau das ist ja das Problem«, sagt er. »Es ist überhaupt nicht ausgereift.«
So langsam mag ich ihn. Nicht nur, dass er Karlsson ziemlich gut spielt, er kritisiert auch das Stück, in dem er spielt.
»Vielleicht haben Sie Recht«, lenke ich ein. »Um die Wahrheit zu sagen, bin ich mir nicht sicher, ob ich jemals die Absicht hatte, es zu veröffentlichen. Es war einfach irgendwelches Zeug, das ich damals schreiben musste, um die leeren Seiten vollzukriegen. Heutzutage schreibe ich Komödien. Zum einen ist es leichter. Und außerdem macht es mehr Spaß. Das Leben ist schon beschissen genug, warum sollen die Leute ihre kostbare Zeit damit verschwenden, solche morbiden Sachen zu lesen.«
»Moment mal«, unterbricht er mich. »Willst du damit sagen, dass du es nie abgeschickt hast?«
»Immerhin hab ich es nicht weggeschmissen.« Er hat eine gewisse Ausstrahlung, das muss man ihm lassen, eine Intensität, neben der ich mir zaghaft, lächerlich und kleinmütig vorkomme. »Soll heißen, ich habe es Jonathan gegeben.«
»Und was hat er gesagt?«
»Er sagte, er hätte vorher noch nie so etwas gelesen. Er meinte, dass er ungefähr in der Mitte aufgehört hätte, sich Notizen zu machen. Er las es nur noch durch. Ich glaube, dieser ganze perverse Sex hat ihn ziemlich aufgewühlt.«
»Das ist doch gut, oder?«
»Nicht bei der heutigen Marktsituation. Agenten in Aufregung zu versetzen ist nicht mehr cool.«
»Und er hat es nicht noch mal gelesen?«
»Wollte er, aber ich habe ihn davon abgebracht. Weil ich ihm The Big O gab.«
Wir sitzen schweigend da. Die Sonne scheint auf die Hügel im Süden, und die Umgebung erwacht zum Leben. Die Clematis knospen, rosa Apfelblüten gehen auf, Schneeglöckchen und Narzissen wiegen sich im sanften Wind, der vom See herweht. Ab und zu schimmert es orange im Teich, wenn Weißer Hai und Moby Dick, die beiden Koi-Karpfen, dicht unter der Oberfläche schwimmen. Die Fontäne plätschert vor sich hin.
»Und wie hat sich The Big O verkauft?«, fragt er und schaut den Hügel hinauf zum Krankenhaus, dessen Glasfront das Licht der aufgehenden Sonne reflektiert.
»Es lief ganz gut, ja. Die Rechte gingen in die Staaten. Zweibuch-Vertrag mit anständigem Vorschuss.«
»In die Staaten?«
»Ja. An Harcourt. Allerdings wurde der Verlag von Houghton Mifflin aufgekauft und mein Lektor gefeuert, weshalb sie drüben nicht sehr viel dafür getan haben. Aber es gab einige wohlwollende Kritiken, die wir für den Umschlag des zweiten Buchs verwenden können.«
»Und daran schreibst du jetzt gerade.«
»Ganz genau.«
»Und was wird aus mir?«, fragt er. Die vergessene Zigarette brennt zwischen seinen Fingern ab.
»Keine Ahnung.«
»Du kannst mich doch nicht einfach hier hängenlassen.«
»Ich verstehe Sie ja. Aber ich bin jetzt erst mal damit beschäftigt.« Ich deute mit dem Kopf auf die Manuskriptseiten, die auf dem Tisch liegen. »Ich habe einen Abgabetermin. Ich kann nicht einfach aufhören und mit was Neuem anfangen.«
»Wenn es gut genug ist«, sagt er, »werden sie schon drauf warten.«
»Das bezweifle ich. Die Buchindustrie hat sich in den letzten fünf Jahren enorm verändert. Sie glauben ja nicht, wie schwierig alles geworden ist. Außerdem habe ich jetzt mehr Verantwortung. Ich bin verheiratet. Und wir haben eine Tochter. Sie heißt Rosie.«
Er gratuliert mir widerwillig.
»Worauf ich hinauswill«, sage ich, »ist Folgendes: Ich kann mir nicht leisten, mich mit etwas zu beschäftigen, dass kommerziell betrachtet keine Chancen hat. Oder, um ganz ehrlich zu sein, mit etwas, das mir keinen Spaß macht. Diese düsteren Sachen zu schreiben, ist harte Arbeit. Und wenn Sie das nicht…«
»Wer ist wohl schuld daran, dass es so düster ist?«
»Ich natürlich. Aber…«
»Nichts aber. Wenn du es düster gemacht hast, kannst du es doch auch lustig machen. Geh einfach noch mal drüber.«
»Was soll denn an Sterbehilfe lustig sein?«
»Hör mir einfach mal kurz zu«, sagt er. »Wäre das möglich? So viel bist du mir mindestens schuldig.«
»Ich höre ja zu.«
»Also«, sagt er. »Ich bin nicht so ein Mensch. So wie dieser Karlsson, meine ich. Ich habe sogar meinen Namen geändert, als ich meine Haare färben ließ. Ich heiße jetzt Billy.«
»Billy?«
»Ich versuche, alles um mich herum zu normalisieren.«
»Dann ist die Augenklappe aber zu viel des Guten.«
»Die hab ich nur aufgesetzt, um deine Aufmerksamkeit zu erregen.« Er nimmt die Klappe ab. Darunter befindet sich eine leere Augenhöhle, eine faltige violette Wunde, die mich an eine Dörrpflaume erinnert. Er sucht in den Taschen seiner Reißverschlussjacke und zieht schließlich eine getönte Brille hervor, die er aufsetzt.
»Was ist denn mit Ihrem Auge passiert?«, frage ich.
»Das würdest du mir sowieso nicht glauben. Aber egal – dieser Karlsson, das bin nicht ich. Nicht mehr jedenfalls. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals so war. Ich meine, ich mochte Cassie. Sehr sogar. Und selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich sie nicht umgebracht, bloß um mit dieser Sterbehilfe weitermachen zu können. Eine Schwuchtel hätte ich vielleicht umgebracht. Die alten Leute, das war eine Sache, die wollten ja sterben, und ich half ihnen nur dabei. Aber Cassie? Niemals.«
»Ich habe nie behauptet, dass Sie sie getötet haben.«
»Nein, aber du hast es angedeutet.«
»Soweit ich mich erinnere, habe ich Ihnen ein Happy End beschert. Sie sind davongekommen. Der ermittelnde Bulle verfiel dem Wahnsinn und verlor sich in seinen Theorien über Geburtenkontrolle. Er war ein großer Fan der Chinesen, wenn ich das richtig erinnere.«
»Nicht mal ich hab das geglaubt«, sagt er. »Der Schluss war eine einzige Katastrophe.«
Ich muss zugeben, dass er Recht hat.
»Du kannst das wirklich besser«, sagt er.
»Nicht mit Ihnen.«
»Nicht ich bin das Problem, Mann. Die Geschichte ist das Problem.«
»Die Geschichte ist so, wie sie ist. Und sie ist zu Ende erzählt.«
»Ich hab den Schlusschor aber noch nicht gehört.«
Ich drücke meine Zigarette aus. »Hören Sie mal, äh, Karlsson. Ich muss jetzt…«
»Billy.«
»Billy, gut. Hör mal, Billy. Ich muss jetzt los. Deborah kommt heute noch vorbei, und ich muss vor dem Mittagessen ein paar Seiten schaffen. Also…«
»Die Geschichte war viel zu durchgeknallt.« Er hebt eine Hand, um mich aufzuhalten. »Viel zu überkandidelt, aber nicht groß genug. Außerdem hast du mich als Vollidioten dargestellt. Das kann man alles noch ändern.«
»Ich weiß nicht, ob das möglich ist.«
»Sag mir mal eins, bitte. Wie oft hast du in den letzten fünf Jahren an mich gedacht?«
»Ich hab schon ab und zu an dich gedacht. Und ich wünschte…«
»Ich weiß, wie man die Geschichte größer aufziehen könnte. Allerdings musst du mir gegenüber ehrlicher sein. Wenn es funktionieren soll, muss ich wirklicher werden. Mehr ich sein, verstehst du?«
»Im Moment sitzt du mir gegenüber und rauchst meine Zigaretten.« Auch wenn er mich von meiner Arbeit ablenkt, muss ich zugeben, dass seine Unverschämtheit mich beeindruckt. »Ich weiß nicht, ob ich mit dir klarkäme, wenn du noch realer wärst.«
»Weil ich jetzt Billy bin. Karlsson ist ja nie in Erscheinung getreten, oder?«
»Nein, er tauchte nie auf.«
»Ja, eben. Er hätte wahrscheinlich die kleine Rosie entführt und sie gefoltert, bis du die Geschichte so umgeschrieben hättest, wie er es will.«
»Also weißt du, ich glaube, Karlsson war mit sich ganz zufrieden. Ich glaube nicht, dass er ein Problem damit hatte, was mit Cassie passiert ist.«
»Weil der Kerl ein Psychopath war.« Er zuckt mit den Schultern. »Wer will denn so leben?« Er beugt sich vor, nimmt die Sonnenbrille ab und starrt mich aus seinem Paul-Newman-blauen Auge an. »Glaubst du nicht, dass ich auch gern mal mit einem kleinen Mädchen wie Rosie spielen möchte?«
»Wirklich?«
»Keine Ahnung.« Er lehnt sich zurück und setzt die Brille wieder auf. »Ich spüre es nicht, falls du das damit meinst. Aber es heißt ja, dass Männer erst zu Vätern werden, wenn ihr Kind auf die Welt gekommen ist, vielleicht sogar erst ein bisschen später.«
»Das war bei mir der Fall, ja.«
»Sieh mal, ich will ja nichts weiter als eine zweite Chance haben, um herauszufinden, ob ich es diesmal schaffe.«
»Aus dem Fegefeuer.«
»Genau. Vielleicht, wenn ich eine schriftliche Erlaubnis von diesen alten Leuten bekomme. Dann könnte ich sie Cassie zeigen, wenn sie das mit der Sterbehilfe herausgefunden hat. Das wäre ein erster Schritt.«
»Ich würde dir und Cassie ja gern helfen. Aber das würde die grundlegende Idee der Geschichte nicht ändern.«
»Das ist wieder eine andere Sache«, sagt er. »Ich glaube, du brauchst eine ganz neue Grundidee. Also echt jetzt, ein Handlanger im Krankenhaus, der alte Leute umbringt? Über so was wird ständig in den Zeitungen berichtet. Wer will denn darüber ein Buch lesen?«
»Ich schätze, es kommt darauf an, wie interessant der Mörder ist.«
»Also jetzt mal ehrlich: Du bist keine Patricia Highsmith.«
Ich gebe zu, dass ich das nicht bin, erinnere ihn aber daran, dass ich komödiantische Kriminalgeschichten schreibe.
»Wenn du meine Meinung wissen willst«, sagt er, »dann funktionieren Geschichten am besten, wenn es eine besondere Spannung gibt zwischen dem Leser und der Hauptfigur, die er sympathisch findet, die aber Dinge tut, die er normalerweise nicht toleriert. Wie König Lear…«
Er zählt an den Fingern einer Hand ab. »… Raskolnikow, Hazel Motes, Long John Silver, Tom Ripley…«
»Ich versteh schon, was du meinst.«
»Dein Fehler war, dass du Karlsson als kranken Idioten beschrieben hast. Niemand mit einem Funken Verstand im Hirn kann so jemanden mögen.«
»Okay, nehmen wir also mal an, ich mache dich sympathischer. Was dann?«
»Wir jagen das Krankenhaus in die Luft.«
Nach dem Mittagessen strecken wir uns auf der Terrasse aus. Ich erzähle Debs, dass mir der Gedanke gekommen sei, die Karlsson-Geschichte zu überarbeiten.
»Karlsson?«
Ich klebe Rosies Windel zu und schließe die Knöpfe ihres Stramplers. »Der Kerl aus dem Krankenhaus.«
Sie muss eine Weile nachdenken. »Der Typ, der die ganzen alten Leute umgebracht hat?«
»Ich überlege, es in eine Komödie zu verwandeln. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann abends daran arbeiten, wenn die anderen Sachen erledigt sind.«
»Dein Vater ist ein Traumtänzer«, sagt sie zu Rosie. Die Kleine ist frisch gewickelt und gluckst wie ein verstopfter Ausguss.
»Ich muss es ja nur überarbeiten«, sage ich. »Nichts Großes.«
»Ich werde die Heiratsurkunde überarbeiten«, sagt Debs. Sie kitzelt Rosie am Bauch. »Aber keine Angst, das ist nichts Großes.«
I
WINTER
Der Typ von der Krebsberatung scheucht uns mit einer zusammengerollten Zeitung von den Fenstern weg, damit seine Patienten uns nicht beim Rauchen sehen. Wir sind die Kinder, die gerade in den Brunnen fallen.
Einige meiner Mitraucher schleichen um die nächste Ecke in die Nähe des gläsernen Korridors, der den alten mit dem neuen Krankenhausbereich verbindet. Dort weht ein kalter Wind. Sie drängen sich zitternd zusammen. Es ist ein grauer Tag im Dezember. Schneegraupel klebt an den Fenstern. Eisiger Ostwind.
Der Typ von der Krebsberatung klopft gegen die Fenster, ruckt den Kopf hin und her, gestikuliert mit dem Daumen. Ich zeige ihm den Finger.
Er macht das Fenster auf, lehnt sich hinaus und winkt mich zu sich. Ich schlendere zu ihm. Als ich nahe genug bin, tut er so, als würde er meinen Namen vom Plastikschild abschreiben.
»Verstehe ich das richtig?«, frage ich. »Wollen Sie mir disziplinarische Maßnahmen pantomimisch androhen?«
Das provoziert ihn so sehr, dass er einen Stift aus der Tasche zieht und sich meinen Namen auf dem Handrücken notiert. »Ich werde mich über Sie beschweren, Karlsson.«
»Wie undankbar. Wenn wir nicht rauchen, haben Sie bald keinen Job mehr.«
Sein Gesicht läuft rot an. Er möchte nicht gern daran erinnert werden, dass er ein Parasit ist. Das geht vielen so. »Ganz unter uns«, sage ich. »Stress macht die Leute kaputt.«
Ihm glüht der Kopf, als er das Fenster schließt. Ich versuche, eine Beziehung herzustellen zwischen meinem Rauchen und der Krebserkrankung seiner Patienten, aber es will mir nicht so recht gelingen. Die Zuständigkeiten gehen ineinander über, okay, und krebserregende Stoffe sind überall zu finden. Trotzdem finde ich keine Berührungspunkte.
Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von Henry G. Strauss: Ich habe vollstes Verständnis für den Amerikaner, der von den schlimmen Folgen des Rauchens las und darüber so sehr erschrak, dass er das Lesen aufgab.
»Das unterscheidet sich nicht wesentlich von der ersten Fassung«, sagt Billy. Wir sind wieder draußen auf der Terrasse. Noch so ein schöner Morgen. Ich hoffe, das gute Wetter hält an, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ins Haus einladen möchte.
»Ich glaube, es funktioniert ganz gut«, sage ich. »Du musst schon ein bisschen schräg rüberkommen, sonst nimmt uns keiner ab, dass du fähig bist, das Krankenhaus in die Luft zu jagen.«
»Schon richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich ihm den Finger zeigen soll. Das ist doch irgendwie überflüssig. Ich an meiner Stelle wäre da etwas subtiler.«
»Ich denk mal drüber nach«, sage ich und mache mir eine Notiz.
»Was kommt dann?«, fragt er.
»Die Szene, wo du den dünnen Mann für die Leistenoperation rasierst.«
»Prima, der Nächste bitte!«
Heute rasiere ich einen dünnen Mann namens Tiernan, der eine Leistenoperation vor sich hat. Die Latexhandschuhe sind kalt, aber er scheint das nicht zu registrieren. Er tut so, als würde er nicht bemerken, dass ein fremder Mann sich an seinen Genitalien zu schaffen macht.
Stattdessen erzählt er mir von einem Freund, der jemanden kennt, der während der Anästhesie gestorben ist. Tiernan sagt, er möchte nicht sterben, ohne es zu wissen. In Wirklichkeit will er damit sagen, dass er überhaupt nicht sterben will. In Wirklichkeit will er damit sagen, dass er keinen hat, den er ins Vertrauen ziehen kann, nur den Typen, der ihm den Intimbereich rasiert.
»Ich bin nur fürs Rasieren zuständig«, sage ich. »Ich schiebe Rollstühle durch die Gegend und hebe schwere Patienten hoch, wenn die Pfleger viel zu tun haben. Wenn Sie einen Priester sehen wollen, kann ich versuchen, einen herzuholen. Aber es ist ja nur eine Leisten-OP. Reißen Sie sich zusammen.«
Er ist schockiert. Ich wische den Rest vom billigen Rasierschaum weg. »Sie glauben, Sie haben ein Problem?«, frage ich. »Ich muss Tag für Tag die Schwänze von anderen Männern angucken. Wollen Sie mit mir tauschen?«
Er arbeitet in einer Reiseagentur und verbringt den ganzen Tag damit, Pornobilder per E-Mail an seine Freunde zu verschicken, die so tun, als würden sie seinen angeblich ironischen Umgang damit gut finden.
»Sie möchten nicht sterben?«, frage ich. »Dann tun Sie was. Wenn Sie was tun, dann ist das Sterben nicht mehr so schlimm. Malen Sie ein Bild. Schaffen Sie sich ein Kind an. Und dann lassen Sie los. Sterben ist eigentlich nichts anderes als Loslassen.«
Aber er hört nicht zu. Er denkt wieder an diesen Typen, den sein Freund gekannt hat, der starb, ohne es mitzubekommen. Ich finde das total witzig. Ich meine, wenn die Toten eins wissen, dann, dass sie tot sind. Und falls das ungefähr so ähnlich sein sollte wie die Gewissheit der Lebenden, dass sie leben, dann ist es jedenfalls keine große Sache.
Er sieht zu, wie ich die Latexhandschuhe abstreife.
»Passen Sie gut auf«, sage ich. »Sie werden später vielleicht darauf zurückgreifen müssen. Sie wären überrascht, wie viele Menschen gelernt haben, ohne Würde zu leben. Statistisch gesehen haben Sie gute Chancen, einer von denen zu werden.«
Die Oberschwester kommt rein. Ich frage mich, ob man diese Art von Geschäftigkeit auf der Krankenpflegerschule lernt. Sie macht Tiernans Kittel auf. Oberschwestern prüfen normalerweise nicht, ob die Rasur korrekt ist, aber vor ein paar Wochen habe ich versehentlich die falsche Seite rasiert.
»Wie geht es Ihnen, Mr Tiernan?«, fragt sie. Das sagt sie, um darüber hinwegzutäuschen, dass sie meine Arbeit überprüft.
»Ich hab einen Höllendurst«, sagt er.
»Es dauert nicht mehr lange«, sagt sie. »Bald ist es vorbei.« Sie spricht mit mir, ohne mich anzuschauen.
»Karlsson, bringen Sie Mr Tiernan bitte um Viertel vor vier nach unten in den OP.«
»Hoffentlich passiert unterwegs nichts Unvorhergesehenes«, sage ich. Aber sie hört nicht hin.
Er lümmelt auf seinem Stuhl und tippt sich mit dem Ende seines Bleistifts gegen die Lippen.
»Du nennst mich immer noch Karlsson«, sagt er.
»Genau genommen sind es die anderen Charaktere, die dich Karlsson nennen.«
»Sie sollen mich Billy nennen.«
»Das könnte ich ändern, klar. Aber wenn du Billy wirst, bist du nicht mehr Karlsson.«
»Ich bin nicht mehr Karlsson.«
»Nicht für mich oder dich. Aber wenn die anderen Personen dich Billy nennen, dann erwarten sie, dass du auch so aussiehst wie jemand, der Billy heißt. Und dann muss ich mir die Mühe machen, dein Aussehen zu ändern, und zwar jedes Mal, wenn es beschrieben wird. Deine Haare, deine Augen, die Art, wie du läufst…«
»Ändern wir das jetzt, oder ändern wir das nicht?«
Sein Ton gefällt mir nicht.
»Ich will dir ja nicht zu nahe treten, Billy, aber ich tu dir hier einen Gefallen. Okay? Und da wir das zusätzlich zu meiner anderen Arbeit machen, können wir uns nicht mit jedem winzigen Detail herumschlagen. Du musst dir deine Rolle mehr wie ein Schauspieler vorstellen. Kapiert? So tun, als wäre die Geschichte ein Film von Mike Leigh oder einer von diesen Dogma-Streifen. Du fügst einfach hier und da etwas zu der Karlsson-Rolle hinzu, erfindest neue Dialoge, einen Spleen, eine Marotte.
Veränderst ihn so, dass er dir mehr ähnelt, aber du solltest vorsichtig rangehen. Wie findest du das?«
Er braucht eine Weile zum Überlegen.
»Okay«, sagt er dann. »Ich kann’s ja mal probieren.«
»Prima. Also pass auf. Ich hab mir überlegt, dass wir diesen Kram mit dem Papst und Camus weglassen.«
»Welchen Kram?«
»Diese Torwartsache.«
Er schüttelt den Kopf. »Kann mich nicht daran erinnern. Was hab ich denn dazu gesagt?«
Albert Camus und Papst Johannes Paul II. waren beide in ihrer Jugend Torwarte. Ich stelle mir vor, wie sie an den entgegengesetzten Seiten des Stadions stehen und sich gegenseitig den Ball zuspielen, während die Hooligans auf ihren Plätzen den Aufstand proben.
Als ehemalige Torwarte haben Camus und Papst Johannes Paul II. vielleicht oder vielleicht auch nicht gekichert, als sie von James Joyces Anspruch lasen, er wolle gleichzeitig Wärter und Kreuziger des Bewusstseins seiner Nation sein.
Was mich betrifft, so wurde ich geboren. Später lernte ich lesen, dann schreiben. Seitdem beschäftige ich mich größtenteils mit Büchern. Mit Büchern und mit Masturbieren.
Schreiben und Masturbieren haben gemeinsam, dass sie für temporäre Erleichterung sorgen und die Illusion vermitteln, man hätte etwas erreicht. Viele große Schriftsteller sind begeisterte Onanisten gewesen, und viele begeisterte Onanisten waren große Schriftsteller. Der einzige wesentliche Unterschied ist, ob für sie das Wichsen oder das Schreiben zuerst kommt.
Was mich betrifft, ich schreibe was, hole mir einen runter und gehe ins Bett. Nur ein Barbar würde zuerst wichsen und dann schreiben.
Mein Zitat für den heutigen Tag stammt von dem dänischen Schriftsteller Isak Dinesen: Ich schreibe jeden Tag ein bisschen, ohne Hoffnung und ohne Verzweiflung.
Jonathan Williams ist ein amüsanter Waliser, auch wenn er dem Hollywood-Klischee eines netten englischen Professors sehr ähnelt.
»Nein«, sagt er. »Ich hab die Karlsson-Geschichte niemandem gegeben.« Seine Stimme dröhnt durchs Telefon. »Ohne deine Erlaubnis würde ich das niemals tun.«
»Nicht mal, um ein Leservotum zu bekommen?«
»Soweit ich weiß nicht. Und ich würde mich bestimmt daran erinnern«, lacht er. »Ein Leservotum über dieses besondere Prachtstück.«
»Deshalb frage ich ja.«
»Warum? Gibt’s ein Problem?«
»Nicht direkt ein Problem.« Ich erzähle ihm, dass ich eine Auszeit genommen habe, sechs Wochen Klausur zum Schreiben, und von Billys Idee, die Karlsson-Geschichte zu überarbeiten. »Ich frage mich nur, wie er an die Geschichte rangekommen ist.«
»Ich habe keine Ahnung«, sagt er. »Von mir hat er sie bestimmt nicht bekommen.«
Jonathan ist nicht mehr mein Agent, aber da er ein guter Kerl ist, fragt er noch, wie’s bei mir so läuft. Ich erzähle ihm, dass mein Lektor bei Harcourt mich wegen des Abgabetermins bedrängt.
»Vergiss ihn«, mahnt er. »Mach es gut, das ist das Allerwichtigste. In zehn Jahren interessiert sich niemand dafür, ob du den Abgabetermin eingehalten hast oder nicht.«
Die Worte eines Heiligen.
»Falls es dir nichts ausmacht, würde ich dich gern was fragen…«
»Schieß los.«
»Hast du dich beim Arts Council beworben, damit sie die Kosten deiner Klausur tragen?«
»Hab ich, ja, aber ich hatte kein Glück. Anscheinend werden Kriminalkomödien nicht gefördert.«
»Ich nehme an, du hast nicht die Karlsson-Geschichte eingereicht«, sagt er.
»Doch, hab ich. Sie wollten ja Arbeitsproben von mir haben, und Karlsson lag halt herum.«
»Das ist wahrscheinlich die Lösung«, sagt er. »Jemand vom Arts Council hat die Geschichte gelesen und sie deinem Freund Billy gegeben. Das ist natürlich nicht die feine Art, aber es erklärt alles.«
»Und ich kann nicht herauskriegen, wer es gelesen hat?«
»Wahrscheinlich nicht. Solche Gutachten sind in der Regel anonym, um Mauscheleien auszuschließen. Aber ich kann ja mal diskret nachfragen, wenn du willst.«
»Das wäre super.«
»Mach dir keine Sorgen«, sagt er. »Wegen der Rechte, meine ich. Falls es irgendwann Probleme geben sollte, dann erzähle ich allen, die danach fragen, dass ich das Manuskript in seiner ursprünglichen Form gelesen habe und dass du der einzige Urheber bist.«
»Vielen Dank, Jonathan.«
»Keine Ursache. Oh, und sag doch bitte Anna, dass ich nach ihr gefragt habe, wenn du sie das nächste Mal siehst. Sie ist wirklich nett, findest du nicht?«
Anna MacKerrig, die Tochter von Lord Lawrence MacKerrig, der als nobel gesonnener Adeliger und schottischer Presbyterianer vor zwanzig Jahren die Künstlerresidenz in Sligo gegründet hat.
»Ich hab sie schon länger nicht mehr gesehen, aber ich richte es ihr aus, wenn ich sie treffe.«
»Sehr schön. Also ich rede dann mit … Oh, jetzt fällt mir wieder ein, warum ich dich überhaupt angerufen habe.«
»Ja?«
»Wegen The Big O. Ein italienischer Verlag hat ein Angebot gemacht. Der Vorschuss ist mehr eine symbolische Geste, aber immerhin…«
»Macht nichts, ist doch toll, wir sagen zu. Eine italienische Ausgabe wäre hübsch.«
»Ganz bestimmt.« Er lacht vor sich hin. »Vielleicht reicht das Honorar ja für ein Wochenende in Rom.«
Vielleicht. Wenn ich hinschwimme.
»Ich melde mich dann«, sagt er und ist wieder weg.
»Weißt du«, sagt Billy, »ich glaube nicht, dass ich Schriftsteller sein möchte. Ich sehe ja, dass du was draufhast und Karlsson eine gewisse Tiefe verleihen willst. Aber jetzt…«
»Hast du deine Meinung geändert, seit du mich kennengelernt hast?«
Ich meine das scherzhaft, aber er nickt. »Ich glaube«, sagt er, »dass es nicht zusammenpasst, dass Karlsson einerseits ein Schriftsteller werden und kreativ sein will und andererseits das Krankenhaus in die Luft sprengen möchte.«
»Die Lust der Zerstörung ist gleichzeitig eine schaffende Lust.«
»Hmm«, sagt er. »Ich bin nicht sicher, ob die Leute mich mögen, wenn ich solche nihilistischen Phrasen dresche. Diese Endzeitsprüche kommen beim Publikum nicht mehr so gut an.«
»Wie wär’s dann damit«, sage ich. »Zu Anfang willst du Schriftsteller werden. Leider bekommst du nur Absagen. Also bist du enttäuscht und entschließt dich, das Krankenhaus in die Luft zu sprengen.«
»Zu narzisstisch. Nur ein Schriftsteller kann so egomanisch denken.«
»Aber ein Krankenhaus in die Luft zu sprengen ist doch nicht narzisstisch.«
»Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erregen, oder? Du hast mich doch in die Situation gebracht, dass ich etwas Drastisches tun muss.«
»Lass mich da raus, Billy. Das mit dem Krankenhaus war deine Idee.«
»Ich war doch nicht immer so, Mann. Wenn du mich vorher gefragt hättest, dann hätte ich dir erzählt, dass ich davon geträumt habe, als Kapitän einer Charteryacht zwischen den griechischen Inseln herumzusegeln.«
»Ein Hilfsarbeiter, der auf einer Yacht durch die Ägäis schippert?«
Er kneift die Augen zusammen. »Soll das etwa heißen, dass die Unterschicht kein Recht auf Träume hat?«
»Die Unterschicht kann träumen, was sie will, Billy, aber wir reden hier nicht über irgendwelche bescheuerten Groschenromane. Wenn dein Traum plausibel gewesen wäre, dann…«
»Ein plausibler Traum?«
»Du kannst es auch realisierbare Phantasie nennen. Jeder darf sich wünschen, was er will, viel Glück dabei, aber wenn es nicht zur Logik der Geschichte passt, dann geht’s halt nicht.«
»Das schränkt aber ganz schön ein, oder?«
»Es gibt nun mal keine Einhörner im Weltraum, Billy.«
Er grinst. »Könnte es aber geben, wenn sie speziell für sie entworfene Helme tragen würden.«
»Na schön. Wenn du gern Einhörner auf dem Mars hast und Aushilfen, die mit Yachten herumschippern, soll es mir Recht sein. Aber niemand wird so was kaufen.«
»Damit gibst du nur zu, dass du nicht gut genug bist, um es überzeugend zu schreiben.« Leichtes Achselzucken. »Vielleicht ist das ja der Grund, warum du immer noch neben deinem normalen Job schreibst und dir spezielle Auszeiten fürs Überarbeiten nehmen musst.«
»Kann schon sein. Vielleicht sollten wir das Ganze einfach vergessen, damit ich mich wieder mit dem beschäftigen kann, was mir beim Schreiben Spaß macht.«
Er steht auf. »Lass uns mal eine Pause machen. Wir kriegen heute ganz eindeutig nichts Konstruktives mehr auf die Reihe.« Er dreht sich eine Zigarette von meinem Tabak und zündet sie an. »Eine Sache noch«, er bläst den Rauch aus. »Man kann nicht einfach so drohen, den Stecker zu ziehen. Entweder man tut es oder nicht. Wenn man nicht vollkommen davon überzeugt ist, dann funktioniert es nicht. Der Anfang ist das Einfachste. Wenn es dir jetzt schon schwerfällt, dann wird es ein Albtraum, wenn wir in die Endphase kommen.«
Er hat recht, aber sich jetzt zu entschuldigen ginge einfach zu weit.
»Übrigens«, sage ich, »bin ich morgen nicht hier. Wir fahren mit Rosie zu Debs Eltern.«
»Kein Problem.«
»Ich bin bestimmt nicht vor Sonntagabend zurück.«
»Dann sehen wir uns also Montagmorgen.«
»Montag, ja.«
Debs steht im Durchgang zum Patio des kleinen Häuschens, hat Rosie über die Schulter gelegt und klopft ihr auf den Rücken, damit sie ihr Bäuerchen macht. Ich lege das Manuskript auf den Tresen, stelle die Kaffeebecher daneben und gehe in die Hocke, um Rosie ins Gesicht zu sehen, aber sie hat glasige Augen und döst, nachdem sie sich satt getrunken hat.
»Weißt du«, sagt Debs, »es ist ganz gut, dass niemand sonst das sehen kann, was ich sehe. Mir würde nämlich gar nicht gefallen, dass andere Leute meinen Mann für einen Geisteskranken halten, der stundenlang mit seinen erfundenen Figuren reden muss, um mit seinem Alltag klarzukommen.«
»Soll ich die Kleine nehmen?«
»Das passt gut.« Sie reicht mir Rosie rüber und riecht dabei an ihr. »Ich glaube, sie braucht eine frische Windel. Bei der Gelegenheit kannst du auch ihren Strampler wechseln. Zieh ihr diesen kleinen Kimono an.«
»Den weißen?«
»Nein, den rosafarbenen, den deine Mutter ihr gekauft hat. In Rosa sieht sie besonders hübsch aus.«
»Komm her zu mir«, singe ich und streichle Rosies Rücken. Sie rülpst, und eine weiße, cremige Flüssigkeit rinnt über meine Schulter. »Bist ein gutes Mädchen.«
Ich hege große Sympathie für Orpheus. Vielleicht fühle ich mich deshalb so zu Kellern, Untergeschossen, Höhlen und Katakomben hingezogen. Bestimmt hängt das mit diesem Freud’schen Schauder zusammen, der mit meiner Faszination für Gewölbe, Grabstätten und Bunker einhergeht. Während meiner regelmäßigen Besichtigungsgänge durch den höhlenartigen Untergrund der Tiefgarage frage ich mich allerdings manchmal, ob solche pseudogynäkologischen Erkundungen nur meine Sehnsucht nach einer Rückkehr in den Mutterleib kaschieren oder eher von einem bösartigen Drang zum Penetrieren und Eindringen zeugen. Steige ich in die Unterwelt hinab, um Eurydike zu befreien oder um sicherzustellen, dass mein absehbarer Blick zurück ihre Hoffnungen für immer zerstört?
Orpheus hatte das Glück, von einem feinsinnigen und hochtalentierten Künstler wie Apollonios von Rhodos erschaffen zu werden. In der ursprünglichen Mythologie ist er ein angesehenes Mitglied der Argonauten, die seine geliebte Frau vor dem Vergessen retten.
Leider hatte er das Pech, dass seine Geschichte später von Virgil, Plato und Ovid bearbeitet wurde, die daraus nicht nur eine Tragödie machten, in der der Held sich mit den Schrecken der Hölle herumschlagen muss, sondern ihn auch noch als Feigling darstellten, der an Eurydikes Auslöschung schuld ist. Weil seine Liebe nicht wahrhaftig war, wurde Orpheus von den unberechenbaren Göttern bestraft.
In meiner Unterwelt durchstreife ich die Schatten und düsteren Ecken der Katakomben des Krankenhauses und frage mich, ob je ein Sterblicher mutig die Urteile der Götter ertrug, die ja die Ewigkeit auf ihrer Seite haben, um ausgiebig das Für und Wider einer endgültigen Selbstaufopferung zu diskutieren.
Später beim Abendessen mit einem guten Glas Rotwein bemühe ich mich, die Feinheiten herauszukitzeln.
»Du möchtest also wissen«, sagt Cassie, »ob es mir lieber wäre, wenn du mich aus der Hölle rettest oder wenn du mir dort Gesellschaft leistest?«
»So ungefähr, ja.«
»Schwer zu sagen.« Sie nimmt etwas Pasta in den Mund und kaut nachdenklich. »Könnten wir nicht einfach die Plätze tauschen?«
»Ich glaube nicht, dass Orpheus diese Option hatte.«
»Typisch. Der Typ, der das geschrieben hat, war garantiert ein Sexist.«
»Eigentlich waren es mehrere Autoren. Aber sie waren alle Sexisten, das stimmt schon.«
»Das ist ziemlich spannend. Würdest du es tun?«, fragt sie.
»Was tun?«
»Den Platz mit mir tauschen.«
»Das macht doch keinen Sinn. Ich sollte besser am Leben bleiben und versuchen, dich da rauszuholen, oder?«
»Nein, die Möglichkeit gebe ich dir nicht. Würdest du also?«
»Ich weiß nicht.«
»Warum nicht?«
»Na ja, schwer zu sagen. Du bist ja nicht in der Hölle.«
»Karlsson, wir sind gerade zusammengezogen. Wie viel schlimmer könnte die Hölle denn sein?«
»Eins zu null für dich.«
Ich lernte Cassie über eine Kontaktanzeige kennen. Ihr Text gefiel mir, weil sie erklärte, sie lege Wert auf »durchschnittlichen Sinn für Humor«. Die meisten Leute schreiben in solchen Fällen »guten Sinn für Humor«, aber Cassie redete nicht um den heißen Brei herum. Entweder etwas ist witzig oder nicht, sagte sie.
Die meisten Leute behaupten, dass ihnen zu allererst der Sinn für Humor beim Anderen gefallen hat, womit sie durchblicken lassen, dass das äußere Erscheinungsbild ihnen nicht so wichtig sei, weil Schönheit ja vergänglich ist. Dazu gehört die Annahme, dass der Sinn für Humor nicht altern kann, dass Humor keine Falten bekommt, nicht austrocknet und keinen Tumor entwickelt. Die meisten Leute glauben, dass Dinge, die sie nicht sehen können – Hoffnung, Sauerstoff, Gott – sich nicht ändern, nicht alt werden und nicht sterben.
Ein Sinn für Humor ist wie alles andere: Er dient einem bestimmten Zweck und wird dann in eine andere Energieform umgewandelt. Das Kunststück besteht darin, geschmeidig und im Fluss zu bleiben, um mit jeder neuen Erscheinungsform ganz spezifisch umgehen zu können.
»Den nächsten Abschnitt möchtest du vielleicht lieber streichen«, sage ich. »Es ist ein Ausschnitt aus dem Roman, den Karlsson gerade schreibt.«
»Ist er denn gut?«
»Eigentlich nicht. Größtenteils sind es nur Kritzeleien oder Entwürfe.«
»Können wir was davon verwerten?«