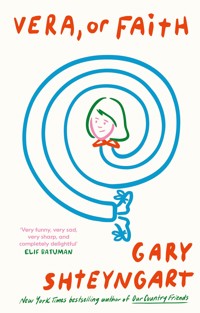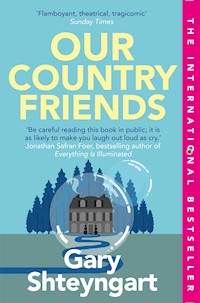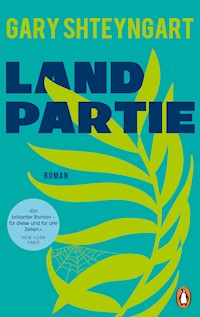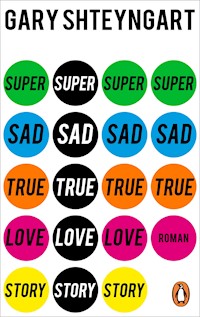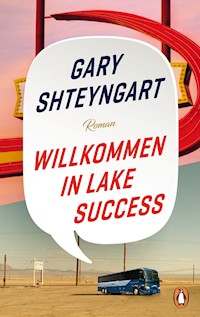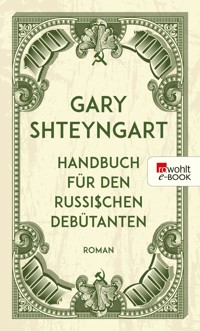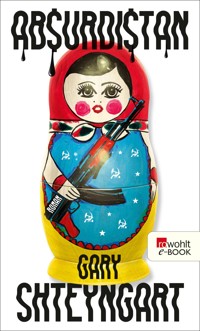
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mischa Vainberg ist 30, 147 Kilo schwer und auf der Suche nach der Liebe. Seine Mutter starb, als er noch klein war. Als 18-Jähriger schickte ihn sein Vater zum Studium und zur Beschneidung nach Amerika. Doch just als Mischa ihn in St. Petersburg besuchen will, wird der alte Vainberg erschossen. Für Mischa beginnt eine Irrfahrt: Zurück in die USA kann er nicht, da ihm die Einreise verweigert wird. Also sucht er sein Heil in der Flucht. Ein Bekannter ist belgischer Diplomat in Absurdistan, vielleicht verschafft der ihm die nötigen Papiere? Aber Absurdistan wird gerade von einem Bürgerkrieg erschüttert … Einfallsreich. Wortgewaltig. Grenzenlos. «Gary Shteyngart ist so böse wie Borat und lustiger als Nabokov.» (Die ZEIT) «Gary Shteyngart ist ein virtuoser Geschichtenerzähler.» (The New York Times) «So politisch unkorrekt ist schon lange kein Romanheld mehr durchs Zeitgeschehen gerast.» (Der Spiegel) «In dieser derb-amüsanten und überschäumend bösartigen Satire schießt der jüdische Exil-Russe Shteyngart gegen alles.» (Süddeutsche Zeitung) «So eine umwerfende, abenteuerliche und bis zum Schluss spannende Story … ist für sich schon eine Rarität … Aber bei Shteyngart erzeugt obendrein der verschwenderische, ausgreifende Erzählstil einen echten Sog.» (Frankfurter Allgemeine)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Gary Shteyngart
Absurdistan
Roman
Über dieses Buch
Mischa Vaingart ist 31, 147 Kilo schwer und auf der Suche nach der Liebe. Seine Mutter starb, als er noch klein war. Als 18-Jähriger schickte ihn sein Vater zum Studium und zur Beschneidung nach Amerika. Doch just als Mischa ihn in St. Petersburg besuchen will, wird der alte Vaingart erschossen. Für Mischa beginnt eine Irrfahrt: Zurück in die USA kann er nicht, da ihm die Einreise verweigert wird. Also sucht er sein Heil in der Flucht. Ein Bekannter ist belgischer Diplomat in Absurdistan, vielleicht verschafft der ihm die nötigen Papiere? Aber Absurdistan wird gerade von einem Bürgerkrieg erschüttert …
Einfallsreich. Wortgewaltig. Grenzenlos.
«Gary Shteyngart ist so böse wie Borat und lustiger als Nabokov.» (Die ZEIT)
«Gary Shteyngart ist ein virtuoser Geschichtenerzähler.» (The New York Times)
«So politisch unkorrekt ist schon lange kein Romanheld mehr durchs Zeitgeschehen gerast.» (Der Spiegel)
«In dieser derb-amüsanten und überschäumend bösartigen Satire schießt der jüdische Exil-Russe Shteyngart gegen alles.» (Süddeutsche Zeitung)
«So eine umwerfende, abenteuerliche und bis zum Schluss spannende Story … ist für sich schon eine Rarität … Aber bei Shteyngart erzeugt obendrein der verschwenderische, ausgreifende Erzählstil einen echten Sog.» (Frankfurter Allgemeine)
Vita
Gary Shteyngart wurde 1972 als Sohn jüdischer Eltern in Leningrad (St. Petersburg) geboren und emigrierte im Alter von sieben Jahren in die USA. Er veröffentlichte die Romane «Handbuch für den russischen Debütanten», ausgezeichnet u.a. mit dem National Jewish Book Award for Fiction, «Absurdistan» und «Super Sad True Love Story» - sein dritter Roman wurde in mehr als vierzig Sprachen übersetzt. Gary Shteyngart lebt in New York.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel «Absurdistan» bei Random House, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Januar 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel
«Snack Daddys abenteuerliche Reise» im Berlin Verlag GmbH, Berlin
Gary Shteyngart: Snack Daddys abenteuerliche Reise
Copyright © der deutschen Übersetzung 2006 by Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin
«Absurdistan» Copyright © 2006 by Gary Shteyngart
Umschlaggestaltung Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildungen Mart Klein/Ikon Images/Getty Images; thinkstockphotos.de
Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-40057-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Von wo aus ich anrufe
Dies ist ein Buch über die Liebe. Mit der prallen russischen Gefühlsseligkeit, die als echte Herzenswärme durchgeht, widme ich die folgenden 452 Seiten meinem Geliebten Herrn Papa, der Stadt New York, meiner süßen, verarmten Freundin in der South Bronx und der US-Einwanderungsbehörde.
Außerdem ist dies ein Buch über zu viel Liebe. Es ist ein Buch über das Verarschtwerden. Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin verarscht worden. Sie haben mich benutzt. Mich ausgenutzt. Mich abgecheckt. Haben gleich gewusst: Ich bin der Mann, den sie zum Affen machen können. Falls «Mann» hier das richtige Wort ist.
Vielleicht ist dieses ganze Verarschbarkeits-Ding genetisch. Ich denke da an meine Großmutter. Sie war eine glühende Stalinistin und treue Mitarbeiterin der Leningrader Prawda, bis Alzheimer ihr an Grips nahm, was noch übrig war, und sie hatte die berühmte Allegorie von Stalin als Bergadler verfasst, der ins Tal herabstieß, sich drei imperialistische Dachse zu greifen, Großbritannien, Amerika und Frankreich, deren magere Körper in den blutigen Krallen des Generalissimo in Stücke gerissen wurden. Es gibt ein Bild von mir als Baby auf Omas Schoß. Ich sabbere sie voll. Sie sabbert mich voll. Man schreibt das Jahr 1975, und wir sehen beide völlig gaga aus. Nun sieh nur, was aus mir geworden ist, Oma. Siehst du die Zahnlücken und den kaputten Unterleib? Was sie meinem Herzen angetan haben, diesem zerquetschten Kilo Fett, das an meinem Brustbein baumelt? Für die Aufgabe, sich im 21. Jahrhundert in Stücke reißen zu lassen, empfehle ich mich als der vierte Dachs.
Dies schreibe ich in Davidovo, einem kleinen Dorf nahe der Nordgrenze der ehemaligen Sowjetrepublik Absurdsvanï, bevölkert ausschließlich von den sogenannten Bergjuden. Ach, die Bergjuden! In ihrer weltfernen Abgeschiedenheit hinter den sieben Bergen und ihrer starrsinnigen Hingabe an die Sippe und Jehova erscheinen sie mir prähistorisch, noch nicht einmal wie Säugetiere, sie erinnern mich eher an schlaue Mini-Dinosaurier, die sich einst über die Erde quälten, Vertreter der Gattung Chaimosaurus Rex.
Es ist früh im September. Das Blau des Himmels ist unerschütterlich, seine Leere und Grenzenlosigkeit erinnern mich daran, weiß auch nicht wie, dass wir uns auf einem kleinen runden Planeten befinden, der sich seinen Weg Zentimeter für Zentimeter durch ein schreckliches Nichts bahnt. In ihrem Schlaf auf den Dachfirsten der weitläufigen Rotklinkeranwesen richten sich die Satellitenschüsseln des Dorfes auf die Berge der Umgebung aus, deren Gipfel zartes Alpenweiß bekrönt. Eine sanfte Spätsommerbrise kühlt meine Wunden, und selbst der gelegentliche streunende Köter tapert so ruhig und zufrieden daher, als würde er morgen in die Schweiz auswandern.
Das ganze Dorf hat sich um mich versammelt, die vertrockneten Senioren, die öligen Teenager, die einheimischen Schwerverbrecher mit sowjetischen Gefängnistätowierungen auf den Fingern (frühere Freunde meines Geliebten Herrn Papa), selbst der verwirrte einäugige Greis von einem Rabbi weint nun an meiner Schulter und wispert mir in seinem schlechten Russisch zu, was für eine Ehre es sei, einen bedeutenden Juden wie mich in seinem Dorf zu wissen, und wie gern er mich mit Spinatküchlein und Hammelbraten wieder aufpäppeln würde, um mir dann im Dorf eine gute Frau zu suchen, die mir einen bläst und mich stopft, bis mein Bauch aussieht wie ein Gummiball kurz vorm Platzen.
Ich bin ein tiefungläubiger Jude und finde weder in Nationalismus noch Religion meinen Frieden. Aber hier unter diesen seltsamen Abkömmlingen meiner Rasse packt mich nun doch ein Wohlgefühl. Die Bergjuden verhätscheln und verwöhnen mich; ihr Spinat ist saftig und nimmt all ihren Knoblauch und ihre zerlassene Butter auf.
Und doch sehne ich mich danach, in die Lüfte zu steigen.
Quer über den Globus zu brausen.
Auf der 173. Straße zu landen, an der Ecke Vyse Avenue, wo sie auf mich wartet.
Mein hochmögender Psychoanalytiker Dr. Levine (Park Avenue!) hat mich schon beinahe von der Vorstellung befreit, dass ich fliegen kann. «Wir wollen auf dem Boden bleiben», so sagt er gern. «Wir wollen uns auf das Mögliche beschränken.» Kluge Worte, Herr Doktor, aber vielleicht haben Sie es einfach noch nicht geschnallt.
Ich bilde mir nicht ein, ich könnte fliegen wie ein anmutiger Vogel oder ein toller amerikanischer Superheld. Ich fliege wohl eher so, wie ich alles tue – ruckend und zuckend, immer in Gefahr, dass mich die Schwerkraft auf das dünne schwarze Band des Horizonts schmettert, dass spitze Felsen an meine Titten und Bäuche schrammen, Flüsse mir den Mund mit vermoostem Wasser füllen und Wüsten mir die Taschen mit Sand auskleiden und sich jede hart erkämpfte Landung in einen scharfen Absturz ins Nichts verwandelt. Und so mache ich es jetzt, Herr Doktor. Ich brause davon, weg von dem greisen Rebbe, der sich liebevoll an den Kragen meines Jogginganzugs klammert, fort über das Blattgemüse des Dorfes und seine vorgeschmorten Hammel, über den grün betupften Überhang zweier zusammenstoßender Gebirgsketten, die den prähistorischen Bergjuden Schutz vor den unheilbringenden Muslimen und Christen der Umgebung gewähren, über das geplättete Tschetschenien und das pockennarbige Sarajewo, über hydroelektrische Dämme und die leere Welt der Geister, über Europa, die herrliche Polis, die Bergfestung mit dem blauen Sternenbanner auf ihren Mauern, über die frostige Totenstille des Atlantiks, der mich am liebsten ein für alle Mal ertränken würde, immer und immer wieder, und schließlich näher, näher, näher, näher und näher zu ihr, der Spitze jener schlanken Insel …
Nordwärts fliege ich, zur Frau meiner Träume. Ich bleibe dicht über dem Boden, genau wie Sie gesagt haben, Herr Doktor. Ich versuche, einzelne Formen und Orte auszumachen. Ich versuche, mein Leben wieder zusammenzustückeln. Da ist der pakistanische Imbiss in der Church Street, wo ich die ganze Küche leer gefressen und mich in Ingwer und eingelegten Mangos ertränkt habe, in scharfen Linsen und Blumenkohl, während die versammelten Taxifahrer mich anfeuerten und die Nachricht von meiner Unersättlichkeit an ihre Verwandten in Lahore funkten. Jetzt bin ich über der kleinen Skyline, die östlich des Madison Park entstanden ist, mit dem kilometerhohen Nachbau des Campanile von San Marco in Venedig, der goldenen Spitze des New-York-Life-Gebäudes, diesen Symphonien aus Stein, diesen modernistischen Formationen, die sich die Amerikaner aus mondgroßen Felsen geschnitzt haben müssen, diesem letzten Sichaufbäumen hin zu einer gottlosen Unsterblichkeit. Jetzt bin ich über der Klinik in der 24. Straße, wo mir einmal ein Sozialarbeiter gesagt hat, dass ich HIV-negativ bin, dass ich kein Aids habe, worauf ich auf dem Klo voller Schuldgefühle um die schönen dünnen Jungen weinen musste, deren ängstliche Blicke ich im Wartezimmer an mir hatte abprallen lassen. Jetzt bin ich über dem dichten Grün des Central Park und fahre die Schatten junger Matronen nach, die ihre häppchengroßen orientalischen Hunde auf die kommunale Versöhnungswiese des Großen Rasens führen. Unter mir fliegt der trübe Harlem River vorbei; ich ziehe über das silbrige Dach des langsam vorwärts tuckernden Pendlerzuges und setze meinen Flug nach Nordosten fort; mein Körper ist müde und schlaff und bittet um Landeerlaubnis.
Jetzt bin ich über der South Bronx, längst nicht mehr sicher, ob ich noch fliege oder schon in olympiareifem Tempo über den Asphalt schlittere. Die Welt meiner Freundin greift nach mir und umfängt mich. In alle grausamen Wahrheiten der Tremont Avenue bin ich eingeweiht – wo einem anmutig geschwungenen Graffito zufolge BEBO ewig LARA liebt, wo mich die neonglänzende Fassade der tapferen Hühnerbraterei bittet, ihre ölig-süßen Aromen zu kosten, und der Schönheitssalon «Adonai» mir droht, meine schlaffe Lockenpracht aufwärts zu wenden und in Brand zu setzen wie die orangene Fackel der Freiheitsstatue.
Wie ein fetter Lichtstrahl sause ich durch Billigläden, die Achtzigerjahre-T-Shirts und nachgemachte Rocawear-Jogginghosen verkloppen, durch die dunklen Sandsteinklötze der Sozialwohnungsbauten (Warnung: «Operation Sauberer Flur». Und: «Unbefugte werden verhaftet!»), hinweg über die Köpfe der Jungen mit ihren gangfarbenen Stirnbändern und ihren Haarnetzen, die im Sattel ihrer Monsterräder miteinander Turniere ausfechten, über die dreijährigen dominikanischen Mädchen in ihren Tanktops, mit ihren Strassohrringen, über den sauberen Vorgarten, wo die weinende dunkelhäutige Jungfrau nicht von dem Rosenkranz um ihren errötenden Nacken lassen kann.
An der Ecke 173. Straße und Vyse Avenue, auf den Eingangsstufen eines Sozialwohnungs-Ziegelbaus, übersät mit vom Winde verwehten Käsetörtchen und roten Lakritzstangen, hat mein Mädchen seinen nackten Schoß mit Lehrbüchern für das Hunter College geschmückt. Ich fahre mitten hinein in die Pracht ihrer zuckerglasierten Sommerbrüste. Das engsitzende gelbe Hemdchen, das die beiden kaum bedeckt, informiert mich: «‹G› steht für Gangsta». Und wie ich sie so mit Küssen bedecke, wie der Schweiß meines Transatlantikfluges sie in Salz und Sirup meiner eigenen Machart einlegt, trifft mich vor lauter Liebe für sie der Schlag und vor lauter Trauer um fast alles sonst. Trauer um meinen Geliebten Herrn Papa, den echten «Gangsta» in meinem Leben – Trauer um Russland, das ferne Land meiner Herkunft, und um Absurdistan, wo der Kalender nie über die zweite Woche des September 2001 hinauskommen wird.
Dies ist ein Buch über die Liebe. Aber es ist auch ein Buch über Geographie. Die South Bronx mag schlecht ausgeschildert sein, doch wo ich auch hinschaue, entdecke ich hilfreiche Pfeile, die mir sagen: SIE SIND HIER.
Ich bin hier.
Ich bin hier an der Seite der Frau, die ich liebe. Schon eilt die Stadt herbei, um meinen Aufenthaltsort festzustellen und mich zu bestätigen. Womit habe ich dieses Glück verdient?
Manchmal kann ich gar nicht glauben, dass ich noch am Leben bin.
Absurdistan
1 Der fragliche Abend: 15. Juni 2001
Ich bin Mischa Borisowitsch Vainberg, 30 Jahre alt, ein ungeheuerlich übergewichtiger Mann mit kleinen, tiefliegenden blauen Augen, einem hübschen jüdischen Zinken, der an die edelsten Papageienarten erinnert, und so zarten Lippen, dass man sie nur mit dem nackten Handrücken abputzen möchte.
Viele der vergangenen Jahre habe ich in St. Petersburg verbracht, weder aus Lust noch freiwillig. Stadt der Zaren, Venedig des Nordens, Kulturhauptstadt Russlands … das können Sie alles vergessen. Im Jahr 2001 hat unser St. Leninsburg die Anmutung einer phantasmagorischen Dritte-Welt-Stadt angenommen, unsere neoklassizistischen Häuser versinken in den müllverstopften Kanälen, auf den breiten Boulevards mit ihrer kapitalistischen Ikonographie (Zigarettenwerbung mit einem amerikanischen Footballspieler, der einen Hamburger in seinem Baseballhandschuh fängt) haben sich bizarre Bauernhütten aus Wellblech und Sperrholz ausgebreitet, und das Schlimmste: Unsere intelligente, depressive Einwohnerschaft ist von einer neuen Mutantenrasse in oberwestlichen Outfits ersetzt worden, jungen Frauen in engsitzendem Acryl, die hochgequetschten kleinen Brüste gleichzeitig auf New York und Schanghai ausgerichtet; Männern in nachgemachten Calvin-Klein-Jeans, die ihnen schlaff um die eingefallenen Ärsche hängen.
Und nun die gute Nachricht: Wenn du ein unheilbarer Fettsack bist wie ich (147 Kilogramm beim letzten Wiegen) und der Sohn des 1238streichsten Mannes in Russland, eilt dir ganz St. Leninsburg diensteifrig entgegen: Die Zugbrücken senken sich, sobald du dich näherst, und die hübschen Paläste stehen an den Kanalufern Spalier und recken dir ihre kurvenreichen Friese entgegen. Du bist mit dem größten Schatz gesegnet, der sich in diesem rohstoffreichen Land finden lässt. Du bist mit Respekt gesegnet.
Am Abend des 5. Juni im Katastrophenjahr 2001 erwiesen meine Freunde mir jede Menge Respekt, und zwar in einem Restaurant namens «Russisches Fischerheim» auf der Insel Krestowskij, einer der grünen Inseln im Delta der Newa. Auf Krestowskij tun wir Reichen so, als lebten wir in einer Art postsowjetischer Schweiz, schleppen uns über die blitzsauberen, rund um unsere kottedsches und taun chauses angelegten Radwege und füllen unsere Lungen mit abgepackter importierter Alpenluft.
Der Hit am «Fischerheim» ist, dass man sich den Fisch in einem künstlichen See selber fängst, worauf ihn das Küchenpersonal für ungefähr 50 Dollar das Kilo räuchert oder auf Kohlen grillt. Am «fraglichen Abend», wie die Polizei ihn später nennen würde, standen wir auf dem Steg der Laichenden Lachse, brüllten unsere Dienstboten an und schütteten karaffenweise jungen kalifornischen Riesling in uns hinein, während unsere Nokia-mobilniki mit dieser einzigartigen geselligen Dringlichkeit der Weißen Nächte klingelten, Ergebnis jenes Angriffs des Lichts auf die Nachtstunden, der die Einwohner unserer verfallenden Stadt mit dem rosa Abglanz einer nördlichen Sonne wach hält. Am besten, man säuft mit seinen Freunden durch bis in den Morgen.
Ich will Ihnen mal was sagen: Ohne gute Freunde können Sie sich in Russland gleich ertränken. Jahrzehntelang haben wir uns das altvertraute Agitprop unserer Eltern angehört («Wir werden für euch sterben!», singen sie), wir haben die kriminelle Enge des russischen Familienlebens überlebt («Verlass uns nicht!», betteln sie) und die verschärften Erziehungsmethoden unserer Lehrer und Fabrikdirektoren («Wir werden eure beschnittenen chuj an die Wand tackern!», drohen sie). Jetzt bleibt uns nur noch eine Dose Bier mit einem genauso gescheiterten Freund an einem versifften Freiluftbüdchen.
«Auf deine Gesundheit, Mischa Borisowitsch.»
«Auf deinen Erfolg, Dimitrij Iwanowitsch.»
«Auf das Heer, die Luftwaffe, die sowjetische Flotte … Und ex!»
Ich bin von Natur aus bescheiden und blase gern daheim in Ruhe Trübsal, also habe ich nicht viele Freunde. Mein bester Kumpel in Russland ist ein Ex-Amerikaner, den ich Aljoscha-Bob zu rufen pflege. Als Robert Lipshitz in den nördlichen Ausläufern des Staates New York geboren, flog dieser kahle kleine Adler (im Alter von 25 Jahren war ihm das letzte Haar ausgegangen) vor acht Jahren in St. Leninsburg ein und verwandelte sich, von Alkoholismus und Trägheit befeuert, in einen erfolgreichen russischen biznesman namens Aljoscha, Besitzer von ExcessHollywood, einer rasend profitablen DVD-Import-Export-Firma, und in den Herzbuben Swetlanas, einer scharfen jungen Petersburgerin. Aljoscha-Bob ist nicht nur kahl, sein verkniffenes Gesicht läuft auch noch in einem rötlichen Ziegenbärtchen aus, seine wässrigen blauen Augen vermitteln dauernd den Eindruck, er werde gleich losheulen, und seine enormen aufgeworfenen Fischlippen säubert er stündlich mit Wodka. In der U-Bahn beschrieb ein Skinhead ihn einmal als gnussnji zhid also «ekelhafte Judenfresse», und das wird wohl der größte Teil der Menschheit in ihm sehen; ich tat es ganz gewiss, als ich ihn vor einem Jahrzehnt am Zufallscollege im amerikanischen Mittleren Westen als Kommilitonen im ersten Semester kennenlernte.
So oft wie möglich pflegen Aljoscha-Bob und ich unser interessantes Hobby. Wir verstehen uns als die Gentlemen Who Like to Rap. Als Gentleman-Rapper. Unser Œuvre reicht von den klassischen Jams von Ice Cube, Ice-T und Public Enemy bis zu den sinnlichen Gegenwartsrhythmen des ghetto tech, einer Mischung aus Miami-bass und Chicago-ghetto-tracks mit einem Hauch Elektronischem aus Detroit. Dem modernen Leser mag «Ass ’n Titties» von D.J. Assault vertraut sein, das vielleicht richtungweisende Werk dieses Genres.
Am fraglichen Abend begann ich die Action mit einer kleinen Melodei nach Detroiter Art, die mir den Sommer versüßte:
Aw, shit
Heah I come
Shut yo mouf
And bite yo tounge.
In seinen abgetragenen Schlabberhosen von Helmut Lang und seinem Zufallscollege-Sweatshirt fiel Aljoscha-Bob ein:
Aw, girl
You think you bad?
Let me see you
Bounce dat ass.
Und so ertönten unsere an sexuellen Anspielungen reichen Lieder über den vier Stegen des «Russischen Fischerheims» (Laichender Lachs, Fürstlicher Stör, Kapriziöse Forelle und Süßer Kleiner Butterfisch), über diesem ganzen künstlichen See, wie er auch immer heißen mochte (Dollarsee? Lago di Euro?), über dem kostenlosen bewachten Parkplatz, auf dem die vertrottelten Bediensteten gerade meinen neuen Landrover verbeulten.
Heah come dat bitch
From round de way
Box my putz
Like Cassius Clay.
«Sing it, Snack Daddy!», feuerte Aljoscha-Bob mich an, wobei er meinen Spitznamen vom Zufallscollege benutzte.
My name is Vainberg
I like ho’s
Sniff ’em out
Wid my Hebrew nose
Pump that shit
From ’round the back
Big-booty ho
Ack ack ack
Da wir uns in Russland befanden, einer Nation aus aufdringlichen, in eine tölpelhafte Moderne geschleuderten Kleinbauern, war klar, dass uns bald jemand den Spaß verderben würde. Und so versuchte es unser Neben-biznesman, ein sonnenverbrannter Killer aus dem mittleren Management, seine teigige Freundin aus irgendeiner kuhreichen Gegend im Gespann, mit: «Na, Jungs, ihr müsst doch nicht singen wie die Austauschstudenten aus Afrika. Ihr seht doch kultiviert aus», anders gesagt: wie ekelhafte Judenfressen, «warum deklamiert ihr nicht lieber ein wenig Puschkin? Gibt es von ihm nicht ein paar schöne Verse über die Weißen Nächte? Das würde doch zur Jahreszeit passen.»
«He, wenn Puschkin heute leben würde, wäre er Rapper geworden», sagte ich.
«Genau», sagte Aljoscha-Bob. «Er wäre MC Push.»
«Fight the power!», sagte ich.
Unser Puschkin-Verehrer starrte uns an. So geht es einem übrigens, wenn man kein Englisch kann. Man findet keine Worte. «Möge Gott euch Kindern helfen», sagte er schließlich, nahm seine Begleiterin am winzigen Ärmchen und geleitete sie ans andere Ende des Steges.
Kinder? Meinte der uns? Was würden Ice Cube oder Ice-T jetzt machen? Ich griff nach meinem mobilnik und wollte gleich meinen Analytiker Dr. Levine anrufen (Park Avenue!) und ihm berichten, dass ich schon wieder von einem meiner Landsleute beleidigt und verletzt, schon wieder gedemütigt worden war.
Und dann hörte ich, wie mein Diener Timofej seine Tischglocke erklingen ließ. Das mobilnik fiel mir aus der Hand, der Puschkin-Verehrer und seine Freundin verschwanden vom Steg, der Steg selbst schwebte davon in eine andere Dimension, sogar Dr. Levine und seine sanften amerikanischen Predigten wurden so leise wie ein entferntes Brummen.
Es war Fütterungszeit.
Mit einer tiefen Verbeugung präsentierte Timofej mir ein Tablett mit Störkebab in Zuckercouleur und einer Karaffe Black Label. Ich ließ mich in einen Plastikstuhl fallen, der sich unter meinem Gewicht verzog und verdrehte wie eine modernistische Skulptur. Ich beugte mich über den Stör, roch mit geschlossenen Augen daran wie in einem stillen Gebet. Ich presste meine Füße aneinander, in ängstlicher Erwartung schlug Knöchel an Knöchel. Ich nahm meine Esshaltung ein: die Gabel in der Linken; meine kraftvolle Rechte im Schoß zur Faust geballt, bereit zum Schlag, falls jemand versuchen würde, mir mein Essen wegzunehmen.
Ich biss in das Störkebab und füllte mir den Mund mit der krossen Kruste und dem weichen fleischigen Inneren. In meinem gigantomanisch weiten Puma-Jogginganzug erzitterte mein Körper, meine heldenhaften Eingeweide drehten sich gegen den Uhrzeigersinn, meine zwiefaltigen Brüste schlugen gegeneinander. Vor mir stiegen die üblichen, vom Essen inspirierten Bilder auf. Ich, mein Geliebter Herr Papa und meine junge Mutter gleiten in einem ausgehöhlten Schwan an einer Grotte vorbei, um uns erklingt triumphale Musik aus der Stalin-Zeit («Hier ist mein Pass! Was für ein Pass! Mein herrlicher roter Sowjetpass!»), mein Geliebter Herr Papa reibt mir mit seinen feuchten Händen den Bauch und fährt am Gummi meiner Shorts entlang, und ich spüre die weichen, trockenen Hände meiner Mutter am Nacken und höre die müden, heiseren Stimmen der beiden im Chor: «Wir lieben dich, Mischa. Wir lieben dich, Babybär.»
Mein Körper begann sich zu wiegen, wie sich fromme Menschen wiegen, wenn die Gottesanbetung sie in Trance versetzt. Ich verschlang das erste Kebab, das zweite, die öligen Störsäfte tropften mir vom Kinn, meine Brüste zitterten, wie unter Eisbeuteln begraben. Wieder fiel mir ein Batzen Fisch in den Mund, diesmal satt mit Petersilie und Olivenöl bedeckt. Ich sog die Düfte des Meeres ein, die Rechte noch immer zur Faust geballt, die Finger in die Handfläche gegraben, die Nase auf dem Teller, meine Nasenlöcher von Störextrakt überzogen, mein kleiner beschnittener chuj brennend vom Glück der Erleichterung.
Und dann war es vorbei. Und dann waren die Kebabs weg. Ich saß vor einem leeren Teller. Ganz allein. Ach, ich Armer! Was sollte nun werden? Dem einsamen Babybär war das kleine Fischlein weggeschwommen. Ich warf mir ein Glas Wasser ins Gesicht, tupfte mich ein wenig mit der Serviette ab, die Timofej mir in den Hosenbund gesteckt hatte. Ich hob die Karaffe mit Black Label an meine kalten Lippen und kippte sie mir mit einer einzigen Drehung meines Handgelenks in den Schlund.
Rundherum erstrahlte die Welt in goldenem Glanz, die Abendsonne ließ eine Reihe im Wind sich wiegender Erlen erstrahlen; die Erlen klangen wider vom Trillern der Zeisige, der kleinen, gelb gestreiften Freunde aus unseren Kinderliedern. Für einen Augenblick wurde ich zum Idylliker und dachte an meinen Geliebten Herrn Papa, der auf dem Dorf geboren worden war und dem man ein Leben auf dem Land verschreiben sollte, denn nur dort – dösend im Kuhstall, nackt und hässlich, aber doch auch nüchtern – könnte das sanfte Zittern, eine Vorahnung des Glücks, sein aufgedunsenes aramäisches Gesicht erfassen. Eines Tages würde ich ihn hierher mitnehmen müssen, ins «Russische Fischerheim». Ich würde ihm ein paar eisgekühlte Flaschen seines geliebten Flagman-Wodkas kaufen und ihn auf den abgelegensten Steg entführen, meine Arme um seine von Schuppen bedeckten Schultern legen, seinen winzigen Lemurenkopf in eine meiner Speckschwarten drücken und ihn spüren lassen, dass wir beide trotz aller Enttäuschungen, die ich ihm in den letzten 20 Jahren bereitet hatte, für immer zusammengehörten.
Als ich aus dem Bann des Essens erwachte, fiel mir auf, dass sich die demographische Zusammensetzung der Menschen auf dem Steg der Laichenden Lachse verändert hatte. Eine Gruppe junger Angestellter in blauen Blazern war erschienen, angeführt von einem Clown mit Fliege, der den Animateur gab, die Angestellten in Gruppen aufteilte, ihnen Angelruten in die schwachen Händchen drückte und dann einen Chor mit ihnen anstimmte: «Fi-hisch! Fi-hisch!» Was war denn hier los? War dies das erste Zeichen für das Entstehen einer russischen Mittelklasse? Arbeiteten diese Idioten für eine deutsche Bank? Vielleicht waren sie alle BWLer mit amerikanischem Collegeabschluss.
Inzwischen starrte alles auf eine beeindruckende ältere Dame in einer bodenlangen weißen Robe, geschmückt mit schwarzen Mikimoto-Perlen, die am künstlichen See ihre Angel auswarf. Sie war eine jener geheimnisvollen eleganten Frauen, die wirkten wie geradewegs aus dem Jahr 1913 hereinspaziert, als hätten all die roten Pionierschals und Bauernblusen aus unseren vertrottelten Sowjettagen sich nie auf ihren Schultern niedergelassen.
Ich muss schon sagen, dass ich für solche Leute wenig übrig habe. Kann man denn ganz außerhalb der Geschichte leben? Darf man denn Immunität beantragen und sich dabei nur auf Schönheit und Herkunft berufen? Aber eines tröstete mich: Weder diese bezaubernde Kreatur noch die jungen Angestellten der Deutschen Bank, die nun im Chor «La-hachs! La-hachs!» riefen, würden heute etwas Schmackhaftes fangen. Mein Geliebter Herr Papa und ich haben eine Abmachung mit dem «Russischen Fischerheim» – wann immer ein Vainberg zur Angel greift, springt der Neffe des Besitzers in seinen Taucheranzug, schwimmt unter die Stege und hängt uns die besten Fische an die Haken. Zarin Schwarzperle würde für all ihre Mühen also höchstens mit einem faden, kranken Lachs belohnt werden.
Die Geschichte schlägt immer zurück.
Am fraglichen Abend wurden Aljoscha-Bob und ich von drei lieblichen weiblichen Wesen begleitet: Rouenna, der Liebe meines Lebens, für drei Wochen zu Besuch aus der Bronx, New York; Swetlana, Aljoscha-Bobs dunkeläugiger Tartarenschönheit, der jungen PR-Managerin einer örtlichen Parfümkette; und Ljuba, des Geliebten Herrn Papas 21-jähriger Gattin vom Lande.
Es machte mich wirklich sehr nervös, sie alle auf einem Haufen zu sehen (zumal ich generell Angst vor Frauen habe). Swetlana und Rouenna sind von Natur aus aggressiv; Ljuba und Rouenna sind einfacher Herkunft und gelegentlich unfein; Swetlana und Ljuba zeigen als Russinnen Symptome leichter, auf frühe Kindheitstraumata zurückgehender Depressionen (vgl. Papadapolis, Spiro: «Das sind meine Piroggen: Transgenerationelle Konflikte in der postsowjetischen Familie»; Annalen der post-lacanianischen Psychiatrie, Boulder/Paris, Bd. 23, Nr. 8, 1997). Ein Teil von mir fürchtete Unstimmigkeiten zwischen den Frauen, also das, was die Amerikaner fireworks nennen – Rabatz. Ein anderer Teil von mir wollte einfach sehen, wie diese versnobte Schlampe Swetlana voll eine reinkriegte.
Während Aljoscha-Bob und ich am Rappen waren, hatte Ljubas Dienerin die Mädchen in einer der Umkleidehütten des Fischerheims mit Haargel und Lippenstift aufgebrezelt, und als sie auf dem Steg zu uns stießen, stanken sie nach frischer Zitrone (mit einem Hauch von echtem Schweiß). Die Mittsommernacht ließ ihre Lippen sanft erglühen, und eine interessante Konversation über das gefeierte finnische Warenhaus Stockmann am Newskij Prospekt, St. Leninburgs großer Prachtstraße, brachte ihre kleinen Stimmchen zum Summen. Sie besprachen ein Sommersonderangebot – zwei handgekettelte finnische Handtücher für 20 US-Dollar – beide Handtücher geadelt durch ihre höchst unrussische, schockierend westliche Farbe: Orange.
Als ich so der Mär von den orangenen Handtüchern lauschte, bemerkte ich weiter unten in der Abteilung des beschnittenen purpurfarbenen halb-chuj eine leichte Schwellung. Unsere Frauen waren so niedlich! Na ja, außer meiner Stiefmutter Ljuba natürlich, die elf Jahre jünger ist als ich und ihre Nächte offenbar gern verlogen stöhnend unter dem baumstammartigen Rumpf meines Geliebten Herrn Papa verbrachte, mit seinem beeindruckenden Schildkröt-chuj. (Gern erinnere ich mich daran, wie er in der Badewanne umherbaumelte und ich versuchte, ihn mit meinen neugierigen Babyhänden einzufangen.)
Und Swetlana machte mich auch nicht an, denn trotz ihrer modischen, mongolisch hohen Backenknochen, ihres eng anliegenden italienischen Pullovers und der sorgfältig kalkulierten Reserviertheit, dieser angeblich aufreizenden Pose der gebildeten russischen Frau, trotz alledem weigerte ich mich wirklich ganz und gar, mit einer Mitrussin zu schlafen. Gott weiß, wo die sich rumgetrieben hatten!
Womit nun alles an Rouenna Sales hing (ausgesprochen Sah-lez, auf spanische Art), meinem Schatzischatz aus der South Bronx, meiner grobknochigen Preziose, meiner riesigen Multikulti-Schnecke mit ihrem krausen Haar, das sie brutal in ein rotes Tuch bindet, und ihrer glänzenden, birnenförmigen braunen Nase, die ständig nach Küssen und Hautcreme verlangt.
«Ich denke», sagte meine Stiefmama Ljuba auf Englisch, Rouenna zuliebe, «ich denkte», fügte sie hinzu. Sie hatte Probleme mit den Zeitformen. «Ich denke, ich denkte … Ich finde, ich fande …»
Ich denke, ich denkte … Ich finde, ich fande …
«Was denktest du denn, Schätzchen?», fragte Swetlana und ruckte ungeduldig an der Angel.
Aber Ljuba ließ sich nicht so leicht entmutigen. Nach zwei Jahren Ehe mit dem 1238streichsten Manne Russlands entdeckte die liebe Frau endlich ihren wahren Wert, und nun wollte sie sich in einer strahlenden neuen Sprache zum Ausdruck bringen. Erst kürzlich war ein Arzt aus Milano damit beauftragt worden, ihr die bösen orangenen Sommersprossen rund um den derben Riechkolben wegzubrennen, während ein Chirurg aus Bilbao schon dabei war, ihr das Babyfett aus den vollen Teenagerwangen zu meißeln. (Eigentlich sah sie mit dem Fett netter aus, wie ein gefallenes Bauernmädchen, das gerade die Adoleszenz hinter sich hatte.)
«Ich finde, ich fande», sagte Ljuba, «orangenes Handtuch so hässlich. Für Mädchen ist schön blasslila, für Jungen wie mein Mann Boris hellblau, für Dienstboten schwarz, weil ihre Hand schon schmutzig.»
«Scheiße, Baby», sagte Rouenna. «Du bist echt hardcore.»
«Was das, ‹Hartko›?»
«Scheiße über die Dienstboten erzählen. Von wegen schmutzige Hände und so.»
«Ich fande …» Peinlich berührt, sah sie auf ihre schwieligen Bauernhände herab. Auf Russisch flüsterte sie mir zu: «Mischa, sag ihr, dass ich auch im Unglück lebte, bevor ich deinen Papa getroffen habe.»
«1998 war Ljuba noch sehr arm», erklärte ich Rouenna auf Englisch. «Dann hat mein Papa sie geheiratet.»
«Stimmt das, sister?», sagte Rouenna.
«Du nennst mich sister?», hauchte Ljuba, und ihre liebe russische Seele erzitterte. Sie legte die Angel nieder und breitete die Arme aus. «Dann will ich auch deine Schwester sein, Rouennatschka!»
«Das sagt man unter Afroamerikanern nur so», sagte ich ihr.
«Ganz genau», sagte Rouenna und trat zu Ljuba, um sie fest zu drücken, was das zurückhaltende Mädchen tränenreich erwiderte. «Weil, so wie ich das sehe, seid ihr ganzen Russen auch bloß totale niggaz.»
«Was soll heißen?», sagte Swetlana.
«Versteh das nicht falsch», sagte Rouenna. «War als Kompliment gemeint.»
«Das kein Kompliment!», bellte Swetlana. «Also was soll das?»
«Immer locker bleiben», sagte Rouenna. «Was ich sagen will, ist … Eure Männer haben keine Arbeit, wenn einem was nicht passt, ballert man wild in der Gegend rum, die Kinder haben Asthma, und ihr wohnt alle in Mietskasernen.»
«Mischa wohnt nicht in einer Mietskaserne», sagte Swetlana. «Ich wohne nicht in einer Mietskaserne.»
«Aber ihr seid ja auch nicht wie die anderen Typen. Ihr seid echt OGs», sagte Rouenna und machte mit ihrem Arm eine Ghetto-Geste.
«Was sind wir?»
«Original gangsters», erklärte Aljoscha-Bob.
«Mischa zum Beispiel», sagte Rouenna. «Sein Vater hat für irgendeinen Scheiß einen amerikanischen Geschäftsmann umgelegt, und jetzt kriegt er kein US-Visum mehr. Das ist doch echt hardcore.»
«Das ist nicht nur wegen Papa …», flüsterte ich. «Das liegt am amerikanischen Konsulat. Am Außenministerium. Die hassen mich.»
«Was ist nun ‹Hartko›?», fragte Ljuba, die nicht mehr wusste, was aus dieser Unterhaltung werden sollte und ob Rouenna und sie noch «Schwestern» waren.
Swetlana stützte beide Hände in die kaum vorhandenen Hüften und nahm sich Aljoscha-Bob und mich vor. «Das ist eure Schuld», zischte sie auf Russisch. «Ihr mit eurem blöden Gerappe. Diesem idiotischen ghetto tech. Kein Wunder, dass die Menschen uns wie Tiere behandeln.»
«Wir haben uns bloß amüsiert», sagte Aljoscha-Bob.
«Wenn du ein Russe sein willst», erklärte Swetlana meinem Freund, «musst du an dein Image denken. Uns halten sowieso schon alle für Nutten und Banditen. Wir müssen unsere Marke neu positionieren.»
«Ich entschuldige mich mit ganzer Seele», sagte Aljoscha-Bob, wobei er die Hände symbolschwer auf sein kleines Herz legte. «Von nun an wollen wir nicht mehr vor dir rappen. Wir werden an unserem Image arbeiten.»
«Scheiße, was habt ihr niggaz da laufen?», sagte Rouenna. «Sprecht endlich Englisch.»
Swetlana fixierte mich mit ihren fiesen, fehlfarbenen Augen. Ich trat ein wenig zurück, bis ich fast zu den laichenden Lachsen gefallen wäre. Meine Finger befühlten schon die Schnellwahltaste für Dr. Levines Notfallnummer, da eilte hastig und an seinem eigenen sauren Atem fast erstickend mein Diener Timofej herbei. «Oi, batjuschka», rief mein Diener und schnappte nach Luft. «Vergebet Timofej die Unterbrechung. Denn er ist nur ein ganz gewöhnlicher Sünder. Doch Herr, ich muss Euch warnen! Die Polizei ist auf dem Weg. Ihr seid es, wie ich fürchte, den sie sucht …»
Ich verstand nicht so genau, was er wollte, bis auf dem Steg der Kapriziösen Forellen nebenan ein Bariton erklang. Donnernd ließ ein Gentleman das Wort «Polizei» erklingen. Die jungen Banker mit ihren amerikanischen Abschlüssen, die alte Zarin mit ihren schwarzen Perlen und der weißen Robe, der biznesman mit dem Faible für Puschkin – sie alle stürzten zum kostenlosen bewachten Parkplatz, wo ihre Landrover im Leerlauf brummten. Drei ausladende Gendarmen liefen an ihnen vorbei, den mageren doppelköpfigen russischen Adler auf ihre schicken blauen Käppis geprägt, gefolgt von ihrem Chef, einem alten Sack in Zivil, der seine Hände in den Taschen trug und sich jede Menge Zeit ließ.
Jetzt war klar, dass die Bullen es auf mich abgesehen hatten. Aljoscha-Bob stellte sich schützend neben mir auf und legte seine Hände auf meinen Rücken und meinen Bauch, als würde ich gleich kentern. Ich beschloss, standhaft zu bleiben. Es war empörend! In zivilisierten Ländern wie Kanada wurden ein gut betuchter Mann und seine Angelpartie von der Obrigkeit in Frieden gelassen, selbst wenn sie ein Verbrechen begangen hatten. Der Alte in Zivil, der, wie ich später erfuhr, den leckeren Namen Belugin trug (wie der Kaviar), schob meinen Freund sanft beiseite. Er hängte seine Schnute einen Zentimeter vor die meine, sodass ich in das graue Gesicht eines alten Mannes blicken musste, mit gelblichen Augäpfeln, ein Gesicht, wie es in Russland für Autorität und Inkompetenz zugleich stand. Höchst gefühlvoll starrte er mich an, ganz als wollte er mir ans Geld. «Mischa Vainberg?», fragte er.
«Wer will das wissen?», fragte ich. Womit ich sagen wollte: Weißt du überhaupt, wer ich bin?
«Ihr Papa ist soeben auf der Palastbrücke ermordet worden», sagte mir der Polizist. «Mit einer Mine. Und stellen Sie sich vor: Ein deutscher Tourist hat alles gefilmt.»
2Widmungen
Zunächst möchte ich vor der Zentrale der US-Einwanderungsbehörde in Washington, D.C., auf die Knie fallen, zum Dank für die erfolgreiche Arbeit dieser Behörde im Interesse von Ausländern auf der ganzen Welt. Mehrfach haben mich Vertreter dieser Behörde bei meiner Ankunft auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen willkommen geheißen, und jedes Mal war noch besser als das davor. Einmal hat ein herziger Mann mit einem Turban meinen Pass gestempelt, nach einer völlig unverständlichen Bemerkung. Ein anderes Mal hat eine angenehme schwarze Dame, mit einem Leibesumfang fast so beachtlich wie dem meinen, den Rettungsring rund um meinen Magen anerkennend betrachtet und den Daumen gehoben. Was soll ich sagen? Die Einwanderungsbehörde ist fair und gerecht. Sie ist der wahre Torhüter Amerikas.
Mit dem US-Außenministerium dagegen und dem geistig behinderten Personal des Konsulats in St. Petersburg habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Seit ich vor über zwei Jahren nach Russland zurückgekehrt bin, haben sie meinen Antrag auf ein Visum neun Mal abgelehnt und sich dabei jedes Mal auf den Mord berufen, den mein Vater an ihrem kostbaren Geschäftsmann aus Oklahoma begangen hat. Ganz ehrlich: Der Herr aus Oklahoma und seine rotwangige Familie tun mir leid, es tut mir leid, dass er meinem Papa vor die Flinte gelaufen ist, es tut mir leid, dass sie ihn am Eingang des U-Bahnhofs Dostojewskaja mit dem überraschten Ausdruck eines Kindes auf dem Gesicht und einem gluckernden roten, auf dem Kopf stehenden Ausrufezeichen auf der Stirn gefunden haben, aber nachdem ich mir die Geschichte seines Todes neun Mal habe anhören müssen, geht mir das alte russische Sprichwort nicht mehr aus dem Kopf: «Beim chuj, beim chuj, wenn er hin ist, ist er hin.»
Dieses Buch also ist mein Liebesbrief an die Generäle, die der US-Einwanderungsbehörde vorstehen. Ein Liebesbrief und ein Bittbrief zugleich: Meine Herren, lassen Sie mich wieder rein! Ich bin ein Amerikaner, eingesperrt im Körper eines Russen. Ich bin ein Absolvent des Zufallscollege, einer ehrwürdigen Institution des Mittleren Westens für junge Adlige aus New York, Chicago und San Francisco, wo gar oft die Vorzüge der Demokratie bei einem Tässchen Tee diskutiert wurden. Acht Jahre lang habe ich wie ein beispielhafter Amerikaner in New York gelebt und meinen Beitrag zur Wirtschaft geleistet, indem ich über zwei Millionen Dollar für legal erworbene Güter und Dienstleistungen ausgab, darunter für die teuerste Hundeleine der Welt (für kurze Zeit besaß ich zwei Pudel). Ich bin mit meiner kleinen Rouenna Sales ausgegangen – nein, ausgegangen ist das falsche Wort: Ich habe sie aus dem Albtraum ihrer Jugend in der Arbeiterklasse der Bronx erhoben und sie am Hunter College untergebracht, wo sie sich heute zur Chefsekretärin ausbilden lässt.
Gewiss verfügen alle Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde über tiefe Kenntnisse der russischen Literatur. Wenn Sie auf diesen Seiten von meinem Leben und meinen Kämpfen lesen, werden Sie gewisse Ähnlichkeiten mit Oblomow erkennen, dem famos umfangreichen Herrn, der sich in dem gleichnamigen Roman des 19. Jahrhunderts weigert, von seinem Lager aufzustehen. Ich werde nicht versuchen, Sie von dieser Analogie abzubringen (schon weil ich nicht genug Energie dafür habe), aber vielleicht darf ich Ihnen eine andere Möglichkeit vorschlagen: Fürst Myschkin aus Dostojewskijs Idiot. Wie der Fürst bin ich eine Art tumber Tor. Reine Unschuld, von Ränkeschmieden umgeben. Ein junger Hund in den Klauen eines Wolfsrudels (nur das sanfte blaue Leuchten meiner Augen hält sie davon ab, mich in Stücke zu reißen). Wie Fürst Myschkin habe ich meine Schwächen. Auf den folgenden 427 Seiten werden Sie gelegentlich erleben, wie ich meinem Diener eins auf die Ohren gebe oder einen Laphroaig über den Durst trinke. Aber Sie werden auch meinem Versuch beiwohnen, ein ganzes Volk vor dem Genozid zu retten; Sie werden dabei sein, wenn ich den unglücklichen Kindern St. Petersburgs Gutes tue; und Sie werden zusehen, wie ich gefallene Frauen besteige mit der kindlichen Leidenschaft eines reinen Herzens.
Wie bin ich ein solch tumber Tor geworden? Die Antwort liegt in meiner ersten Erfahrung in Amerika begründet.
Damals, im Jahr 1990, beschloss mein Vater, dass sein einziges Kind auf dem Zufallscollege zu einem normalen wohlhabenden Amerikaner erzogen werden sollte, tief im Inneren des Landes, sicher vor den lustigen Zerstreuungen der westlichen und östlichen Gestade. Papas Beschäftigung mit dem kriminellen Oligarchenwesen war damals noch eine Liebhaberei – die Rahmenbedingungen für die Ausplünderung Russlands im großen Stil stimmten noch nicht –, aber trotzdem hatte er im Leningrader Autohandel schon seine erste Dollarmillion verdient und dabei alle möglichen niederträchtigen Dinge verkauft, nur keine Autos.
Wir lebten beide in einer engen, feuchten Wohnung in den südlichen Vorstädten Leningrads – Mami war an Krebs gestorben – und gingen einander meistens aus dem Weg, weil keiner von uns die Entwicklung des anderen verstehen konnte. Eines Tages saß ich hemmungslos onanierend auf dem Sofa, die Beine gespreizt, sodass ich aussah wie eine satte, genau in der Mitte aufgeschnittene Flunder, als Papa aus der Winterkälte hereinstolperte. Über seinem seidigen neuen westlichen Rollkragenpullover hüpfte sein schwarzbärtiger Kopf auf und ab, und seine Hände zitterten vor Schreck, weil sie plötzlich so viel grünes amerikanisches Geld zählen mussten. «Steck das Ding weg», sagte er und blickte meinen chuj verächtlich aus rot geränderten Augen an. «Komm in die Küche. Wir müssen reden. Unter Männern.»
«Unter Männern», das klang nicht gut, weil es mich wieder daran erinnerte, dass Mami tot war und mich niemand mehr zur Schlafenszeit in meine Decke wickelte und mir sagte, dass ich noch immer ihr Liebling war. Ich packte meinen chuj ein und verabschiedete mich traurig von dem Bild, das mir Lust bereitet hatte (der riesige Arsch von Olga Makarowna über den Stuhl vor mir quellend, des ekligsten Mädchens in der Klasse mit dem Bauernkäsegeruch nach ungewaschenem Geschlecht und nassen Lederlatschen). Ich setzte mich zu meinem Vater an den Küchentisch, unter der Last dieser Zumutung seufzend, wie jeder Teenager geseufzt hätte.
«Mischka», sagte mein Papa. «Bald wirst du in Amerika sein, interessante Fächer studieren, mit den einheimischen jüdischen Mädchen schlafen und deine Jugend genießen. Und was deinen Papa betrifft … Nun, er wird allein hier in Russland sitzen, ohne eine Menschenseele, die sich darum sorgt, ob er lebt oder tot ist.»
Nervös knetete ich meine dicke linke Brust in eine neue längliche Form. Auf dem Tisch bemerkte ich ein verlorenes Stück Salamipelle und überlegte, wie ich es mir schnappen könnte, ohne dass Papa es merkte. «Dass ich aufs Zufallscollege gehe, war deine Idee», sagte ich. «Ich gehorche dir nur.»
«Ich lasse dich ziehen, weil ich dich liebe», sagte mein Vater. «Weil es für einen kleinen popka wie dich in diesem Land keine Zukunft gibt.» Er packte das schwebende Luftschiff meiner Rechten, die Onanierhand, und drückte sie fest zwischen seine beiden kleinen Hände. Auf seinen Wangen schienen unter seinen grauen Bartstoppeln die geplatzten Blutgefäße hervor. Er weinte still. Er war betrunken.
Ich musste auch weinen. Es war sechs Jahre her, seit mein Vater mir das letzte Mal Händchen halten wollte und mir gesagt hatte, dass er mich liebte. Sechs Jahre, seit ich mich von einem blassen kleinen Engel, den die Erwachsenen gern kitzelten und dem die Schulhof-Rowdys gern eine reinhauten, in eine dicke, fette Judensau mit großen Patschhänden und ziemlich eklig vorstehenden Zähnen verwandelt hatte. Nun war ich fast doppelt so groß wie mein Vater, was uns beide ganz schön verblüffte. Vielleicht gab es da auf der Seite meiner winzigen Mutter ein rezessives polnisches Gen (ihr Mädchenname war Jasnawski, nu?).
«Mischa, du musst mir einen Gefallen tun», sagte Papa und wischte sich die Augen.
Ich seufzte wieder und schob mir mit der freien Hand die Salamipelle in den Mund. Ich wusste, was von mir erwartet wurde. «Keine Sorge, Papa, ich werde nichts mehr essen», sagte ich, «und ich werde mit dem Medizinball üben, den du mir gekauft hast. Ich schwöre, dass ich wieder abnehme. Und wenn ich erst mal am Zufallscollege bin, werde ich hart daran arbeiten, ein Amerikaner zu werden.»
«Idiot», sagte Papa und wackelte mit seiner Nase, die beweglich war wie Gummi. «Du wirst nie ein Amerikaner sein. Du wirst immer ein Jude bleiben. Wie kannst du nur vergessen, wer du bist? Und du bist noch nicht einmal weg. Jude. Jude. Jude.»
Von einem entfernten Vetter in Kalifornien wusste ich, dass man gleichzeitig Amerikaner und Jude sein konnte und dazu noch praktizierender Schwuler, aber ich wollte mich nicht streiten. «Ich will versuchen, ein reicher Jude zu werden», sagte ich. «Wie ein Spielberg oder ein Bronfman.»
«Wunderbar», sagte mein Vater. «Aber deine Amerikareise hat noch einen anderen Grund.» Er zog ein verschmiertes Blatt Millimeterpapier hervor, vollgekritzelt mit exotischen englischen Lettern. «Sobald du in New York bist, meldest du dich bei dieser Adresse. Du wirst dort ein paar Chassidim treffen, und sie werden dich beschneiden.»
«Papa, nein!!», schrie ich, heftig blinzelnd, denn der Schmerz vernebelte mir schon die Augen, der Schmerz darüber, dass man sich mein bestes Stück greifen und wie eine Orange schälen wollte. Seit ich ein Riese geworden war, hatte ich mich an eine Art körperlicher Unverletzlichkeit gewöhnt. Im Klassenzimmer hämmerten die Schläger nicht länger meinen Kopf gegen die Tafel, bis ich mit Kreide bedeckt war und sie «Schuppenjude!» rufen konnten (in der russischen Mythologie leiden Juden an übermäßiger Schuppenbildung). Niemand wagte es noch, mich anzugreifen. Es mochte mich überhaupt niemand mehr anfassen. «Ich bin 18 Jahre alt», sagte ich. «Wenn man ihn jetzt beschneidet, wird mein chuj schrecklich weh tun. Außerdem mag ich meine Vorhaut. Sie schlabbert so schön.»
«Als du ein kleiner Junge warst, hat deine Mutter nicht erlaubt, dass du beschnitten wirst», sagte Papa. «Sie hatte Angst vor dem Bezirksausschuss. Was würde das für einen Eindruck machen? ‹Zu jüdisch›, würden sie sagen. ‹Zionistisches Verhalten.› Vor allen hatte sie Angst, diese Frau, nur vor mir nicht. Dauernd hat sie mich in aller Öffentlichkeit ‹Scheißefresser› genannt. Dauernd habe ich eins mit der Bratpfanne auf den Kopf bekommen.» Er sah zum Küchenschrank hinüber, einst Heimstatt der Bratpfanne. «Aber jetzt trage ich die Verantwortung für dich, popka. Und du tust, was ich sage. So ist das als Mann. Man tut, was der Vater sagt.»
Inzwischen zitterten meine Hände im selben Rhythmus wie die Papas, und wir schwitzten beide so sehr, dass der Dampf in unsichtbaren weißen Wolken von unseren fettigen Köpfen aufstieg. Ich versuchte, mich ganz auf Vaterliebe und Sohnespflicht zu konzentrieren, aber eine Frage blieb. «Was sind Chassidim?», sagte ich.
«Es gibt keine besseren Juden», sagte Papa. «Sie studieren und beten den ganzen Tag.»
«Warum wirst du dann kein Chassid?», fragte ich ihn.
«Ich muss heute hart arbeiten», sagte Papa. «Ich muss viel Geld verdienen, damit ich ganz sicher bin, dass dir niemand weh tun kann. Denn du bist mein Leben. Ohne dich würde ich mir meine Kehle von einem Ohr zum anderen aufschlitzen. Und ich bitte dich doch nur um den kleinen Gefallen, dich von den Chassidim stutzen zu lassen, Mischka. Willst du das denn nicht für mich tun? Als du noch klein und dünn warst, habe ich dich so geliebt …»
Ich spürte wieder, wie mein kleiner Körper an seinem aufgehoben war, wie seine weisen braunen Adleraugen mich auffraßen, wie die wolligen Stoppeln seines Schnurrbarts meinen Wangen einen männlichen Ausschlag schenkten, den ich tagelang in Ehren hielt. Es gibt Witzbolde, die sagen, Männer sehnten sich ihr ganzes Leben lang zurück in den Mutterschoß, aber ich gehöre nicht zu diesen Männern. Das Kitzeln von Papas tiefem Wodka-Atem an meinem Nacken, seine hartnäckigen haarigen Arme, die mich an seine teppichweiche Brust pressen, der Tiergeruch von Überlebenskampf und Verfall – das ist mein Mutterschoß.
Und so fand ich mich einen Monat später in einer Mietdroschke, die durch ein schrecklich heruntergekommenes Viertel von Brooklyn rauschte. In der Sowjetunion hatte man uns gesagt, dass Menschen afrikanischer Abstammung – Neger und Negeretten hatten wir sie genannt – unsere Brüder und Schwestern waren, aber den sowjetischen Juden, die damals neu ins Land kamen, schienen sie so fürchterlich wie Kosakenhorden, die über die Ebenen stürmten. Ich dagegen verliebte mich auf den ersten Blick in das bunte Völkchen. Der Anblick der unterbeschäftigten Männer und Frauen, aufgestellt vor endlosen Reihen bröckelnder Veranden und verwahrloster Vorgärten, hatte etwas Verfluchtes, Verruchtes, geradezu Sowjetisches – wie meine sowjetischen Landsleute schienen sie ihre Niederlage zum Lebensstil erhoben zu haben. Der Oblomow in mir war schon immer von Menschen fasziniert, die fast so weit waren, ihr Leben aufzugeben, und das Brooklyn des Jahres 1990 war ein einziges oblomoweskes Paradies. Um gar nicht von den jungen Mädchen zu reden, schon so groß und dick wie Baobab-Bäume, die Brüste geformt wie perfekte Flaschenkürbisse, die sie würdevoll die Straße hinabtrugen; die schönsten Wesen, die ich im Leben gesehen hatte.
Langsam machte das Schwarzenviertel einem Latinoviertel Platz, genauso zerzaust, aber angenehm vom Geruch gerösteten Knoblauchs erfüllt, und das wiederum machte Platz für das Gelobte Land meiner jüdischen Glaubensbrüder – Männer, die auf dem Kopf ganze Eichhörnchennester über die Straßen trugen, deren Koteletten im Frühsommerwind flatterten und unter deren samtigen Mänteln kostbarer Sommer-Muff wohnte. Ich sah sechs winzige Jungen, vielleicht zwischen drei und acht Jahren, denen ihre blonden, ungeschnittenen Locken die Anmutung kleiner Rockstars gaben, um eine todmüde, pinguinartige Frau herumlaufen, die hinter einem Schirm aus Einkaufstüten die Straße hinunterwackelte. Was war das bitte für eine Jüdin mit sechs Kindern? In Russland hatte man eins, zwei, vielleicht drei, wenn einem die dauernden Abtreibungen zu viel wurden und man sehr, sehr promisk lebte.
Das Taxi hielt vor einem alten, aber ehrwürdigen Haus, das sich mit seinem ganzen Gewicht sichtbar in die Stützpfeiler lehnte wie ein älterer Mitbürger in seine Gehhilfe. Ein angenehmer junger Chassid mit intelligentem Gesichtsausdruck (ich ergreife immer Partei für Menschen, die halbblind aussehen) hieß mich mit einem Handschlag willkommen, und nachdem er festgestellt hatte, dass ich weder Hebräisch noch Jiddisch sprach, begann er, mir den Begriff der mitzvah zu erklären, was «gute Tat» bedeutet. Offenbar war ich dabei, eine sehr wichtige mitzvah zu tun. «Das hoffe ich doch, Mister», sagte ich in meinem knospenden, aber noch unvollkommenen Englisch. «Weil Schmerz von Schwanzschneiden muss sein unerträglich.»
«Ist gar nicht so schlimm», sagte mein neuer Freund. «Und du bist so groß, das merkst du gar nicht!» Als er mein noch immer furchtsames Gesicht sah, sagte er: «Während der Operation stellen sie dich sowieso ruhig.»
«Stellen?», sagte ich. «Stellen wohin? Oh nein, Mister. Ich muss sofort zurück in mein Hotel.»
«Komm, komm, komm», sagte der Chassid und rückte sich mit einem müden Zeigefinger die Brille zurecht. «Ich hab da was, das wird dir bestimmt gefallen.»
Mit gesenktem Kopf folgte ich ihm ins Herz des Hauses. Im Vergleich mit der Freudlosigkeit der typischen sowjetischen Einraumwohnung mit ihrem monströsen Kühlschrank, der in seiner Ecke vibriert wie eine Interkontinentalrakete auf der Abschussrampe, schien mir das Heim der Chassidim ein wahres Feuerwerk aus Licht und Farben, besonders die gerahmten Plastikbilder des goldenen Felsendoms von Jerusalem und die zerdrückten blauen, mit gurrenden Tauben bestickten Kissen. (Später, auf dem Zufallscollege, lehrte man mich, auf solche Dinge herabzusehen.) Überall standen hebräische Bücher mit herrlichen goldenen Rücken, die ich irrtümlicherweise für Übersetzungen von Tschechow und Mandelstam hielt. Der Geruch von geröstetem Buchweizen und gebrauchter Unterwäsche erwies sich als einladend und heimelig. Als wir weiter ins Innere des Hauses vordrangen, liefen kleine Jungen zwischen den Baumstämmen meiner Beine umher, und aus einem Badezimmer trat eine großbusige junge Frau, den Kopf in ein Tuch gewickelt. Ich wollte ihr die nasse Hand schütteln, aber sie lief schreiend weg. Das war alles sehr interessant, und beinahe vergaß ich den schmerzhaften Anlass meines Besuchs.
Und dann hörte ich ein tiefes kehliges Brummen, als würden hundert Greise auf einmal dumpf vor sich hin brüten. Langsam löste das Brummen sich in einen Chor aus Männerstimmen auf, die etwas sangen wie: «A hummus tov, a tsimmus tov, a mazel-tov, a tsimmus tov, a hummus tov, a mazel-tov, a hummus tov, a tsimmus tov, hey, hey, Yisroel.» Einige Worte erkannte ich wieder: mazel-tov ist eine Art Gratulation, tsimmus ein Gericht aus gestampften und gezuckerten Karotten, und Yisroel ist ein kleines Land am Mittelmeer mit vorwiegend jüdischer Bevölkerung. Ich hatte aber nicht die leiseste Ahnung, was diese Wörter hier miteinander machten. (Später fand ich sogar heraus, dass sie gar nicht zum Text gehörten.)
Durch einen niedrigen Türrahmen duckten wir uns in den hinteren Anbau des Hauses, in dem lauter junge Männer unter steifen Hüten Plastikbecher schwenkten und sich an Schwarzbrotschnittchen und Senfgurken festhielten. Sofort drückte man mir auch einen Becher in die Hand, schlug mir auf die Schultern, rief mazel-tov! und wies mir den Weg zu einer alten Badewanne, die auf zwei Paaren geschwungener Füße in der Mitte des Raumes ruhte. «Was ist das?», fragte ich meinen Freund mit der dicken Brille.
«A tsimmus tov, a mazel-tov …», sang er und stieß mich vorwärts.
Wodka riecht nach nichts, aber ein 18-jähriger Russe wie ich brauchte nicht lange, um zu merken, dass es sich bei der Flüssigkeit in der Wanne genau darum handelte, nebst ein paar darin herumschwimmenden Zwiebelringen. «Fühlst du dich jetzt zu Hause?», riefen mir die fröhlichen Chassidim zu, während ich den Plastikbecher leerte und eine saure Gurke nachwarf. «A tsimmus tov, a hummus tov», sangen sie, die Männer verschränkten die Arme und traten mit den Füßen in die Luft, und ihre außergewöhnlich blauen Augen leuchteten betrunken aus ihrer schwarzen Kluft.
«Dein Vater hat uns gesagt, dass du vor der bris vielleicht ein wenig Wodka brauchst», erklärte der Anführer der Chassidim. «Deshalb die kleine Fete.»
«Fete? Wo sind die Mädchen?», fragte ich. Mein erster amerikanischer Witz.
Die Chassidim lachten nervös. «Auf deine mitzvah!», rief einer. «Heute wirst du einen Bund mit Hashem schließen.»
«Was ist das?», fragte ich.
«Gott», wisperten sie.
Ich trank noch ein paar Becher, verblüfft, wie sehr die Zwiebeln den Geschmack verbesserten, und doch ging mir der Gedanke, einen Bund mit Gott zu schließen, nicht ganz so glatt runter wie das 40-prozentige Gesöff. Was hatte Gott damit zu tun? Ich wollte doch nur, dass mein Vater mich liebte. «Vielleicht Sie mich besser bringen in Hotel, Mister», stammelte ich. «Ich gebe Ihnen 17 Dollar in meiner Tasche. Meinem Papa bitte sagen, ich bin schon geschnitten. Er guckt nicht mehr da unten, weil ich bin jetzt so fett.»
Das kauften mir die Chassidim nicht ab. «Du musst auch an uns denken», riefen die im Chor. «Für uns ist es auch eine mitzvah.»
«Ihr auch euren Schwanz schneiden?»
«Wir kaufen den Gefangenen frei.»
«Wer ist Gefangener?»
«Du bist ein Gefangener der Sowjetunion. Wir machen einen Juden aus dir.» Und damit flößten sie mir noch ein paar Becher Wodka ein, bis der Raum mit seinem wirbelnden Diorama aus steifen Hüten und fliegendem Schweiß sehr ansprechend vor mir verschwamm.
«Auf zum mitzvah-Mobil!», riefen die Jüngsten von ihnen, und bald fand ich mich umhüllt von einem Dutzend samtiger Mäntel, aufgehoben in der Ummantelung meiner eigenen Rasse und dabei sanft hinaus in die chassidische Sommernacht getrieben, wo selbst der gelbe Mond Schläfenlöckchen trug und die Grillen in der tiefen melodiösen Sprache unserer Vorfahren zirpten.
Ich wurde quer auf die weiche Rückbank eines amerikanischen Kleinbusses geworfen, noch immer versorgten verschiedene junge Männer mich mit Wodka, den ich pflichtschuldig trank, denn als Russe ist man nicht gern unhöflich. «Wir fahren zurück zu Hotel, Mister?», sagte ich, während der Bus in irrem Tempo durch die geschäftigen Straßen raste.
«A hummus tov, a mazel-tov», sangen meine Begleiter.
«Ihr wollt Gefangenen freikaufen!», versuchte ich unter Tränen auf Englisch. «Seht nur! Ich bin ein Gefangener! Von euch!»
«Dann wirst du jetzt freigekauft», kam es mit entwaffnender Logik zurück, und der nächste Becher Wodka wurde mir ins Gesicht gekippt.
Schließlich lud man mich im grell beleuchteten Wartezimmer eines armen städtischen Krankenhauses ab. Spanische Babys schrien nach Milch, und meine Begleiter warfen sich an eine improvisierte Klagemauer und beteten sich die blassen Gesichter rot. «Dein Vater wird stolz auf dich sein», flüsterte mir jemand ins Ohr. «Du bist wirklich tapfer!»
«18 ist zu alt für schneiden Schwanz», flüsterte ich zurück. «Das weiß jeder.»
«Abraham war 99, als er sich selbst beschnitt!»
«Aber er war Held aus Bibel.»
«Genau wie du! Von nun an wird dein biblischer Name Mosche lauten, also heißt du Moses.»
«Ich heißen Mischa. Das ist russische Name meine herrliche Mutter hat mich gerufen.»
«Aber du bist wie Moses, denn du führst die sowjetischen Juden aus Ägypten.» Ich konnte den Plastikbecher an meinen Lippen beinahe riechen. Ich soff wie der jugendliche Alkoholiker, der ich inzwischen geworden war. Man hielt mir ein Stück Schwarzbrot hin, aber ich spuckte darauf. Dann lag ich in einer Art umgedrehten Kittelschürze auf einem rollenden Bett; das rollende Bett hielt an; grüne Kittel umwehten mich; ein Paar kalter Hände zog mir mitleidlos die Hosen herunter. «Papa, sie sollen aufhören!», weinte ich auf Russisch.
Eine Maske wurde mir aufs Gesicht gedrückt. «Zähl rückwärts, Moses», befahl mir eine amerikanische Stimme.
«Njet!», wollte ich sagen, aber natürlich konnte mich niemand hören. Die Welt zerbrach in tausend Stücke und setzte sich nicht wieder zusammen. Als ich schließlich wieder aufwachte, beteten die Männer mit den schwarzen Hüten über mir, und unterhalb der sorgsam gefalteten Fleischberge, die meine Gürtellinie bildeten, fühlte ich nichts. Ich hob den Kopf. Ich trug ein grünes Krankenhausgewand mit einem runden Loch im Schritt, und da, zwischen den weichen Kissen meiner Schenkel, lag bewegungslos ein purpurroter zertretener Käfer. Flüssigkeit sickerte aus seinem Chitinpanzer, der nervenzerfetzende Schmerz seines Ablebens wurde von den Betäubungsmitteln gelindert.
Dass ich kotzen musste, hielten meine Glaubensbrüder irgendwie für ein Zeichen der Genesung, und sie wischten mir das Kinn und lachten und riefen mazel-tov und tsimmus tov und hey, hey, Yisroel.
Die Wunde entzündete sich noch am selben Abend.
3Wer hat Geliebten Herrn Papa gekillt?
Wer war es? Wer hat den 1238streichsten Mann Russlands gemeuchelt? An wessen Händen klebt das Märtyrerblut? Ich werde es Ihnen sagen: Es waren Oleg der Elch und sein syphilitischer Vetter Zhora. Woher wir das wissen? Weil Andi Schmid, ein 19-jähriger Tourist aus Stuttgart, alles auf Video aufgenommen hat.
Am fraglichen Abend schipperte Herr Schmid zufällig auf einem Ausflugsdampfer an der St. Petersburger Palastbrücke vorbei, genoss die Designerdroge MDM und die blecherne House-Musik, die an Bord aus den Lautsprechern schepperte, und filmte eine russische Möwe, die einen englischen Teenager attackierte, einen dünnen Hering mit abstehenden Ohren, und seine liebliche blasse Frau Mama.
«So eine böse Möwe habe ich noch nie gesehen», erzählte Herr Schmid den Polizeikommissaren und mir am Tag darauf und strahlte uns aus seinen fusseligen Stahlwollhosen und seinem PHUCK-STUTTGART-T-Shirt an, wobei seine kastenförmige Selima-Optique-Brille einen Schatten von Intelligenz um seine toten jungen Augen legte. «Sie hat einfach immer weiter auf dem armen Kind herumgehackt», beschwerte er sich. «In Deutschland sind die Vögel viel netter.»
Schmids Videoband zeigt uns, wie die schneeweiße Möwe im Anflug auf die englische Familie mit dem blutigen Schnabel ausholt, wie die Engländer die Möwe um Gnade anflehen, wie die Schiffsbesatzung mit den Fingern auf die Ausländer zeigt und lacht … Dann sieht man die massiven steinernen Pfeiler der Palastbrücke und ihre gusseisernen Straßenlaternen. (Einmal, in den Achtzigerjahren, der schönen Gorbatschow-Perestroika-Zeit, sind Papa und ich auf der Palastbrücke angeln gegangen. Wir fingen einen Barsch, der Papa wie aus dem Gesicht geschnitten war. In fünf Jahren, wenn meine Augen vom Leben in Russland glasig geworden sind, werde auch ich ihm ähneln.)
Dann dreht Schmid sich einmal um die eigene Achse, für einen Rundblick auf St. Petersburg an einem warmen Sommerabend. Der Himmel leuchtet in einem künstlichen Blau, die dicken Mauern der Peter-und-Pauls-Festung stehen von goldigem Flutlicht übergossen, der Winterpalast liegt an seinem Ufer vertäut wie ein Schiff, das sich sanft im immer währenden Zwielicht wiegt, und die dunkle Masse der Isaakskathedrale wacht über sie alle … Ach! Wie schrieb Mandelstam? «Leninsburg! Ich will noch nicht sterben!»
Und nun, da die Möwe wieder zum Angriff ansetzt und einen irgendwie slawischen Vogelschrei ausstößt, sehen wir auf der Brücke einen Mercedes-ML-320-Offroader, der aussieht wie eine futuristische, abgerundete Version der sowjetischen Milizjeeps, in denen sie Papa früher in die Ausnüchterungszelle gekarrt haben, gefolgt von einer jener grotesken gepanzerten Wolga-Limousinen, die mich immer irgendwie an ein amerikanisches Gürteltier erinnern. Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man jetzt beinahe Papas gelben Kürbiskopf erkennen, wie er aus dem Wolga-Fenster schaut, mit einer einzigen grauen Locke auf der Glatze, wie von einem Kind dort hingekritzelt … Oh, mein Papa, mein toter, ermordeter papotschka, mein Mentor, mein Hüter, mein Jugendfreund. Weißt du noch, Papa, wie wir immer den antisemitischen Nachbarshund unter einem Getränkekasten gefangen gesetzt und abwechselnd angepinkelt haben? Wenn ich nur glauben könnte, dass du jetzt in einer besseren Welt lebst, jener «anderen Welt», von der du damals faseltest, wenn du am Küchentisch aufwachtest, die kleinen Ellenbogen in der Heringstunke, aber es gibt bestimmt kein Leben nach dem Tod und keine «andere Welt», außer New York, und die Amerikaner wollen mir kein Visum geben, Papa. Ich sitze in diesem schrecklichen Land fest, weil du einen Geschäftsmann aus Oklahoma abgemurkst hast, und jetzt habe ich nichts mehr als die Erinnerung an dich, an dein fast heilig schönes Leben, dies ist die Last, die dein einziges Kind zu tragen hat.
Na gut, zurück zum Video. Da rumpelt der zweite Mercedes-Offroader über die Palastbrücke, der letzte Wagen in Papas Konvoi, und jetzt sieht man zwei Männer auf einem Motorrad am Jeep vorbeiziehen. Ganz klar kann man hinter der unverwechselbaren Fünfzigerjahre-Tolle von Oleg dem Elch die teigige Masse des syphilitischen Zhora erkennen (möge er an seiner Syphilis verrecken wie einst Lenin!) … Das Motorrad saust am Wolga vorbei, und da fliegt die Mine, oder jedenfalls ein dunkler Zylinder, der nur eine Mine sein kann – ehrlich, hat hier schon mal jemand eine Mine gesehen? Ich stamme nicht aus der Art Familie, die man zusammen mit den blauäugigen Jungs nach Tschetschenien kämpfen schickt – da fliegt die Mine auf das Dach des Wolga, noch eine Sekunde, und schon lenkt ein elektrisch geladener Blitz die Möwe von den zusammengekauerten Engländern ab, und das Dach des Wolga fliegt davon (zusammen mit Papas Kopf, wie wir später erfahren werden), und es erhebt sich eine Wolke aus billigem Rauch … Knallbum.
Lange Rede, kurzer Sinn, so wurde ich zur Waise. Möge ich meinen Frieden finden unter den Trauernden Zions und Jerusalems. Amen.
4Rouenna
Als ich meinen Abschluss am Zufallscollege gemacht hatte, mit allen cum laudes, die man einem fetten russischen Juden ans Revers hängen konnte, beschloss ich, wie viele junge Leute, nach Manhattan zu ziehen. Amerikanische Ausbildung hin oder her, in meinem Herzen war ich noch immer ein Sowjetbürger, befallen von einer Art stalinistischer Gigantomanie, sodass mein Blick, als er über die Topographie Manhattans schweifte, naturgemäß an den Zwillingstürmen des World Trade Centers hängenblieb, jenen emblematischen, von Bienenwaben besetzten 110-stöckigen Riesen, die in der Abendsonne wie Weißgold glänzten. Sie schienen mir wie die Erfüllung aller Versprechen des sozialistischen Realismus, jugendliche Science-Fiction, ins beinah Unendliche gedehnt. Man könnte sagen, ich war in sie verliebt.