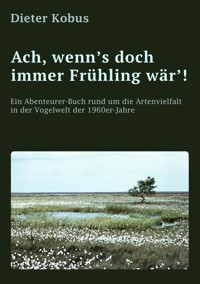
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein Leben für die Natur: Dieter Kobus begeisterte sich seit frühester Jugend für Ornithologie und ist seitdem auch aktiv im Naturschutz tätig. In den 1960er-Jahren erkundete er vor allem Biotope im deutschsprachigen Raum und veröffentlichte in Fachzeitschriften erzählerische Berichte über seine Beobachtungen in der urwüchsigen Natur. „Ach, wenn’s doch immer Frühling wär‘!“ ist eine Sammlung bisher unveröffentlichter Texte, die er vor rund 60 Jahren in jeder freien Minute geschrieben hat – etwa auf der Rückseite von Rechnungen, Reklamesendungen oder alten Briefumschlägen. Sie beschreiben seine Liebe zur Natur und wie man respektvoll mit ihr umgeht. Auf jeder Exkursion – von den norddeutschen Inseln bis zu den Seetaler Alpen – begleiteten ihn eine schwere Kameraausrüstung, Fernglas und Tarnzelt. Im Buch abgebildet sind 36 Fotos von Vögeln, Brutgebieten und Nestern, die er auf Diafilmen festhielt. Darüber hinaus geben die lebendig erzählten Abenteuer des engagierten Zeitzeugen fundierte Einblicke in die Artenvielfalt der Vogelwelt Deutschlands zu dieser Zeit. Manche der Vogelarten, die der Autor in den 1960er-Jahren noch antraf, waren schon damals bedroht und sind heute längst aus ihren ursprünglichen Biotopen verschwunden – wie etwa der Goldregenpfeifer und andere Regenpfeiferarten, die ihren natürlichen Lebensraum durch die Abtorfung von Sumpf- und Moorlandschaften verloren. Dieter Kobus schreibt über eigene Erkenntnisse und Erfahrungen, die uns besser verstehen lassen, wie das Artensterben in der Vogelwelt seinen Lauf nahm. Darüber hinaus schildert er harte Geduldsproben, Glücksmomente und unterhaltsame Interaktionen zwischen Mensch und Tier. Wenn man seine detailreichen Geschichten liest, kann man manchmal das Gefühl haben, selbst dabei gewesen zu sein. „Meines Erachtens sind Ausdauer, Geduld und eine Menge Glück die wichtigsten Faktoren beim Beobachten der Vogelwelt“, sagt Dieter Kobus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dieter Kobus
Ach, wenn’s doch immer Frühling wär’!
Ein Abenteurer-Buch rund um die Artenvielfalt in der Vogelwelt der 1960er-Jahre
Inhalt
Cover
Titelblatt
Vorwort
Küstenseeschwalben und Sturmmöwen auf der Insel Amrum
Eiderenten auf der Insel Amrum
Sandregenpfeifer auf der Insel Amrum
Seeregenpfeifer auf der Insel Amrum
Säbelschnäbler auf der Insel Föhr
Sumpfohreulen auf der Insel Norderney
Wiesenweihen auf der Insel Norderney
Trauerseeschwalben am Dümmer
Haubentaucher am Dümmer
Uferschnepfen am Dümmer
Kampfläufer im Dalum-Wietmarscher Moor
Goldregenpfeifer im Dalum-Wietmarscher Moor
Birkhühner im Dalum-Wietmarscher Moor
Kiebitze in einem Vorort von Essen im Ruhrgebiet
Kiebitze und Flussregenpfeifer auf einem Essener Zechengelände
Brachvögel im Münsterland
Eisvögel im Münsterland
Wasseramseln in einem Waldgebiet in Leun an der Lahn
Zwergtaucher am Chiemsee
Wasserrallen am Chiemsee
Flussuferläufer am Chiemsee
Bekassinen am Chiemsee
Mornellregenpfeifer am Zirbitzkogel in den Seetaler Alpen
Urheberrechte
Ach, wenn's doch immer Frühling wär'!
Cover
Titelblatt
Vorwort
Mornellregenpfeifer am Zirbitzkogel in den Seetaler Alpen
Urheberrechte
Ach, wenn's doch immer Frühling wär'!
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Vorwort
Im Laufe der Jahrzehnte, in denen ich die Vogelwelt beobachtet habe, hat sie sich sehr verändert. Einige Vogelarten sind fast ganz verschwunden oder nur noch stark reduziert vertreten. An diesem Schwund der Artenvielfalt ist überwiegend der Mensch schuld. Durch sein unüberlegtes Eingreifen in die Natur sind viele Lebensräume zerstört worden, die den Vögeln Nahrung und Nistplätze gaben. Einige Versuche sind geglückt, durch Züchtungen und die darauffolgende Auswilderung in noch natürliche Lebensräume wieder gut zu machen, was zerstört wurde. Doch den alten Zustand der Natur wird der Mensch nicht wieder herstellen können, da die Lebensräume trotz all seiner Bemühungen schwinden oder bestenfalls konstant bleiben.
Dieses Buch soll kein Lehrbuch sein, ich möchte damit auf erzählerische Weise zeigen, wie man unterschiedliche Vogelarten in ihrer natürlichen Umgebung mit viel Ausdauer und Geduld selbst in schwierigen Situationen beobachten kann, ohne Schaden anzurichten. Ich verstehe es als ein spannendes Abenteurerbuch für Naturfreunde. Meine beschriebenen Erinnerungen stammen ausnahmslos aus den 1960er-Jahren, als man viele Naturschutzgebiete in Deutschland noch vorsichtig betreten durfte, die heute nicht mehr zugänglich sind. Manche der Vogelarten, die ich in diesem Jahrzehnt noch antraf, waren schon damals bedroht und sind heute längst aus ihren ursprünglichen Biotopen verschwunden.
Als Autor habe ich meine behutsamen Beobachtungen in der Natur über mehrere Jahrzehnte hinweg in Fachzeitschriften wie „Gefiederte Welt“, „Ornithologische Mitteilungen“, „Vogel und Umwelt“ und „Luscinia“ veröffentlicht. Meine Texte, die ich in diesem Buch zusammenfasse, sind jedoch bisher unveröffentlicht und erscheinen inhaltlich so, wie ich sie vor mehr als 60 Jahren geschrieben habe. Oftmals bin ich dazu angeregt worden, meine Erlebnisse in Buchform herauszubringen, nun setze ich dies nach sechs Jahrzehnten um. Der Titel „Ach, wenn’s doch immer Frühling wär’!“ bezieht sich auf die bevorzugte Jahreszeit für meine Beobachtungen, in der die Vögel brüten und alles Leben um sie herum neu erblüht.
Bei vielen der beschriebenen Exkursionen – von Norddeutschland bis in die Seetaler Alpen – begleitete mich meine Frau Gerda-Marie.
Dieter Kobus, im Juli 2023
Küstenseeschwalben und Sturmmöwen auf der Insel Amrum
Mir war die Insellandschaft von Amrum fremd, als ich sie zum ersten Mal sah, da ich zuvor nur Wald und Feld durchstreift hatte. Bestimmt hätte ich die Insel in der Nordsee schon früher besucht, hätte ich geahnt, wie reizvoll ihre Landschaft ist. Aber allein der Gedanke an karg bewachsene Sanddünen, das endlos wirkende Meer und bloße Kies- und Sandstrände, die ungeschützt unter den Strahlen der heißen Sonne lagen, weckte in mir ein Bild trostloser Einsamkeit. Verständlich ist das schon, denn wer nur lauschig kühle Wälder kennt, in die man sich flüchtet, sobald die Sonne über den Feldern glüht, der schätzt diese Annehmlichkeiten. Doch als ich dann die völlig andere Landschaft auf der Insel sah, war ich, wie nicht anders zu erwarten begeistert, denn ihre Vielseitigkeit ist für Naturfreunde und speziell für Vogelfreunde wie geschaffen. Immer wenn der Mai naht, überfällt mich eine Sehnsucht nach den norddeutschen Inseln, der ich nur schwer widerstehen kann. Heute entlockt mir die Tatsache, dass mir Seeschwalben, Möwen, Austernfischer und die anderen Seevögel einst fremd waren, ein verständnisloses Lächeln.
Als ich nach meiner Ankunft an jenem sonnigen Morgen zum ersten Mal meinen Fuß auf den Sandboden setzte, da mag es mir ergangen sein wie einem kleinen Jungen, den ich kurz zuvor beobachtet hatte, wie er an der Hand seiner Eltern, mit Sandschaufel und Eimerchen bewaffnet, voller Erwartung zum Strand ging. Als er dann den vielen Sand erblickte, war er nicht mehr zu halten und bald schon sah ich ihn mit vor Aufregung hochrotem Kopf wild herum scheppen, es schien fast, als sollte der ganze Sand des Strandes wenigstens einmal über seine Schüppe rieseln. Ich will hiermit nicht sagen, dass es mir genauso ging wie dem Jungen. Doch war auch ich von einer inneren Unruhe befallen, als ich über den Bohlenweg zu einer Aussichtsdüne lief und vor mir die Dünenlandschaft in der Sonne liegen sah, durchbrochen von Heideflächen und in der Ferne flimmerte das weite Meer. So ergeht es wahrscheinlich jedem, der schöne Dinge in sich aufnehmen kann und hohe Erwartungen daran knüpft.
Am ersten Tag durchstreifte ich die Insel im Osten, um mich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen. Zuerst sah ich die Herren dieser Landschaft, die Silbermöwen, dann einige Austernfischer und am Strand die Sturmmöwen. Danach fand ich mein erstes Nest in einem kleinen Dünental zwischen dem Strandhafer. Eigentlich waren es nur Überreste von einem Gelege des Vorjahres, das Herbststürme und Winter überdauert hatte und dementsprechend in Form von Schalenresten in der Sonne verwitterte. Immerhin war es für mich der erste Hinweis darauf, wo ein Nest von einem Vogel hier an der See angelegt werden könnte. Am Tag darauf ging ich zum Vogelschutzgebiet an der Nordspitze. Auf dem Wege dorthin, der mich durch sumpfige Wiesen führte, begegnete ich dem Rotschenkel und einem Kiebitz, der schon große Junge hatte und später, als ich das Schutzgebiet wieder verließ, sah ich am äußersten Ende auf dem Kiesstrand eine Zwergseeschwalbe. Doch nun wieder zum Vogelschutzgebiet zurück.
Auf Empfehlung meines Zimmervermieters, einem Amrumer von altem Schrot und Korn, der selbst ein Fachmann war und die einzelnen Vogelarten an unscheinbaren kleinen Federn erkannte, durfte ich das Schutzgebiet unter Aufsicht des Vogelwarts betreten. Das war eine absolute Ausnahme, da das ganze Gebiet zu diesem Zeitpunkt bis zum „flügge werden“ der Jungen gesperrt war, um die Vögel nicht unnötig zu stören. Nachdem ich den Vogelwart, einen jungen Mann aus Hamburg gefunden hatte, kletterten wir zusammen die Düne hinauf, schlichen dann geduckt durch das Dünengras, bis wir einen Blick in das von Dünen umgebene Tal werfen konnten. Dort brüteten zwischen Heidekraut und Krähenbeeren einige hundert Fluss- und Küstenseeschwalben, deshalb wurde die Nordspitze der Insel unter Schutz gestellt. Obwohl wir sehr vorsichtig waren, hatten uns schon einige Seeschwalben entdeckt und kamen uns mit lautem „Kriiiiä“ entgegengeflogen.
Auch wenn es zuvor in der Kolonie nicht gerade ruhig zuging, so war sie nun voller Unruhe, denn Hunderte von Vögeln flogen laut schreiend über uns und zeigten deutlich ihren Unwillen den Störenfrieden gegenüber. Genau das wollten wir vermeiden, woraufhin mein Begleiter vorschlug, wieder den Rückzug anzutreten. So viele Seeschwalben mitten in der Kolonie und ein Tarnzelt gab es auch, aber ich durfte nicht dort hingehen. Wie ärgerlich! Als ich dann den Vogelwart fragte – es war übrigens, wie fast immer, ein junger Zoologie-Student, der für ein Jahr das Naturschutzgebiet betreute – ob ich andernorts auf der Insel noch brütende Seeschwalben antreffen könnte, antwortete er: „Naja, Flussseeschwalben wohl kaum, die werden wahrscheinlich alle im Schutzgebiet brüten, doch Küstenseeschwalben werden hier und da auf der Insel noch in einzelnen Paaren anzutreffen sein.“ Hoffen wir das Beste, dachte ich.
Der dritte Tag brach an. Heute wollte ich ein Seeschwalben-Paar mit Gelege finden. Es musste doch irgendwo zwischen den Dünen oder auf den weiten Flächen am Strand noch weitere Seeschwalben geben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich alle Exemplare dieser Vogelart nur auf einem kleinen Fleck im Schutzgebiet der Insel als Brutgemeinschaft zusammengefunden hatten. Deshalb lief ich wieder über einen der Holzstege, die vom Dorf aus durch die Dünenlandschaft in Richtung Strand hinausführten, um den Badegästen den beschwerlichen Weg durch den Sand ein wenig zu erleichtern. Auf diesem Bohlenweg ging ich zu den Dünen, von dort aus führte er mich langsam abwärts, bis er endete und sich als normaler Weg durch den nicht sehr hohen Sand und die daran anschließenden Kiesflächen zum Strand hin fortsetzte. Hier prägten kleinere und größere bültenartige Heideflächen das Landschaftsbild. Ich verließ den Weg und bog nach Süd-Westen ab, bis ich einen langen hohen Dünenwall erreichte, der den Heidecharakter unterbrach. Plötzlich hörte ich über mir einen bekannten Ruf, rau und bestimmend „Kriiiiää-kriiiiää“. Leider konnte ich nichts sehen, die Sonne blendete zu sehr. Auch als ich die Hand über die Augen legte, ließ sich nichts erkennen.
Dann sah ich sie. Im sonnendurchfluteten Himmel hob sich das blendende Weiß der Seeschwalbe nur undeutlich ab. Wieder ein warnendes „Kriiiiää“ hoch über mir. Aus dem Verhalten des Vogels wurde ich nicht so recht schlau. Er flog herum und benahm sich dabei etwas sonderbar, wie auch andere Vogelarten auf der Insel. Am Vortag tauchte ein Austernfischer plötzlich aus dem Nichts auf, überflog mich mit seiner schallenden Ruffolge, um dann auf einem Dünenkamm niederzugehen und dort plappernd einen Augenblick zu verweilen, ehe er hinter einer Düne wieder verschwand. Auch die Silbermöwe, die mich von der See kommend in gemächlichem Tempo überflog, kippte nach links ab und kehrte im Sturzflug mit lautem „Kjau-kjau“ zurück, sodass ich unwillkürlich den Kopf einzog. Sie stieg dann wieder auf, um mit den gleichen ruhigen Flügelschlägen weiter landeinwärts zu fliegen, als ob gar nichts gewesen wäre.
Was diese Seeschwalbe jedoch von den anderen Vögeln unterschied war, dass sie nicht wegflog, sondern mich in gleichbleibendem Abstand umkreiste und dabei ab und zu ihre Stimme hören ließ. Deshalb wollte ich sie weiter beobachten, es war ja auch die erste Seeschwalbe, die ich weitab vom Schutzgebiet im Inneren der Insel sah. Der Vogel flog eine Runde nach der anderen, unglaublich, dass er überhaupt nicht müde wurde. Irgendetwas musste das ständige Kreisen zu bedeuten haben. Da er sein Verhalten nicht änderte, ging ich ein Stück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Er folgte mir noch eine Weile, doch dann ließ er von mir ab und flog wieder zurück, kreiste aber immer noch fliegend umher. Jetzt stand für mich fest: Irgendwo in der Nähe musste ein Gelege sein – und keiner hätte mich von dieser Idee abbringen können.
Ich drehte mich um und ging erneut in die Richtung, in der sich die Seeschwalbe aufhielt. Gleich darauf kam sie auf mich zu, doch diesmal ließ ich mich nicht dadurch ablenken und ging einfach geradeaus auf eine kleine Kiesfläche zu, die von hohen Dünen umgeben war. Das „Kriiiiää“ wurde noch bestimmender, noch rauer, ich traute meinen Ohren nicht, hörte ich da nicht noch einmal den gleichen Ruf? Ich sah nach oben, tatsächlich, eine zweite Seeschwalbe. Ich folgte ihnen mit den Augen, wahrscheinlich handelte es sich um Männchen und Weibchen, dann musste hier auch irgendwo das Nest sein. Der zweite Vogel hatte vermutlich bis eben auf dem Gelege gesessen, kombinierte ich. Erst als ich direkt auf die kleine Kiesfläche zuging, war er auf einmal am Himmel zu sehen. Je näher ich dieser Fläche kam, desto dreister und aggressiver wurden die beiden Vögel. Wie Falken rüttelten sie über meinem Kopf, ließen immer wieder ihr „Kriiiiää“ hören, um sich dann wie ein Stein fallen zulassen. Kurz über mir fingen sie sich ab, entfernten sich, um mich nun mit einem knatternden „Tek-tek-tek-tek“ anzufliegen, rissen sich wieder hoch und verschwanden am blauen Himmel. So ging es weiter, Schlag auf Schlag, bis ich mich entfernte. Zwar konnte ich noch immer nichts entdecken, musste mich aber dem Verhalten der Tiere nach ganz in der Nähe des Geleges befunden haben.
Langsam beruhigten sie sich, als ich weit entfernt im dichten Gras hinter einer kleinen Düne lag und sie von dort aus beobachtete. Einer der beiden Vögel, ich weiß nicht welcher, denn man konnte sie nur schlecht voneinander unterscheiden, versuchte nun über einer bestimmten Stelle rüttelnd und zur Kiesfläche nach unten spähend, sich auf dem Gelege niederzulassen. Kurz über diesem noch immer rüttelnd, stieg der Vogel wieder auf, um in weiten Kreisen mit dem Partner das vermutliche Brutgebiet zu umfliegen. Ob sie wohl wussten, dass ich noch in der Nähe war? Oder war ich für sie in dem dichten hohen Dünengras unsichtbar? Runde um Runde drehten sie, bewundernswert war ihre Ausdauer, bis dann doch der Bruttrieb siegte. Plötzlich stand eine Seeschwalbe zwischen den Schottersteinen der Kiesfläche. Aufmerksam sah sie sich nach allen Seiten um, ehe sie sich niederließ, noch einige kuschelnde Bewegungen und sie saß fast regungslos auf dem Nest. Nur ihr Kopf ging hin und her und beobachtete die sie umgebende Landschaft.
Hier, außerhalb der Brutgemeinschaft, waren die beiden auf sich allein gestellt. Sie konnten sich nicht auf den Warnruf eines wachsamen Nachbarn verlassen. Es ist sonderbar, dass sich manche der Seeschwalben der großen Brutgemeinschaft entzogen. Sind es Außenseiter oder wurden sie von den anderen aus der Kolonie ausgestoßen? Geheimnisvoll sind manche Wege der Natur und voller Rätsel. Die zweite Seeschwalbe ließ sich bald neben dem brütenden Vogel auf einem kleinen Heidehügel nieder, um sich zu putzen. Endlich war es so weit! Ich erhob vorsichtig mein Fernglas und sah hinüber zu den nun ganz unbekümmert wirkenden Vögeln. Leider hatte der brütende Vogel, der frei saß, mir sein Hinterteil zugewandt, sodass ich den Schnabel nicht sehen konnte, das sicherste Erkennungszeichen zwischen Fluss- und Küstenseeschwalbe. Wenn er doch einmal den Kopf bewegte, lag dieser entweder im Schatten oder er zog ihn so schnell wieder zurück, dass ich nichts erkennen konnte. Langsam schmerzten mir die Augen vom konzentrierten Beobachten. Zum plötzlichen Aufstehen von ihrem Gelege veranlasste die Seeschwalbe ein ganzer Trupp junger Leute, die laut rufend zum benachbarten Badestrand liefen. Sie nutzte diese fast willkommene Störung zu einem ergiebigen Recken und Strecken, ordnete ein wenig ihre Federn und ließ sich nach kurzem Umsehen dann wieder nieder. Ich dachte, sie würde sich nun anders hinsetzen, aber sie ließ sich nur kuschelnd auf dem Gelege nieder und kehrte mir dabei mal die linke, mal die rechte Seite zu, bis sie schließlich wieder ihre alte Stellung einnahm.
Vorsichtig erhob ich mich aus meiner verkrampften Haltung und nutzte die hierdurch erfolgte Störung, um noch einmal nach dem Gelege zu sehen. Einen größeren Stein und einen kleinen mit Heidekraut bewachsenen Hügel visierte ich als Markierungen an, genau dazwischen saß die Seeschwalbe auf der Kiesfläche. Ich fasste die beiden auffälligen Punkte ins Auge und ging darauf zu. Zeitgleich erhoben sich die beiden Vögel, um mich mit einem wütenden, und wie es mir vorkam, noch rauer klingenden „Kriiiää“ anzufliegen. Es schien fast, als ob sie sich über ihr leichtsinniges Verhalten mir gegenüber ärgerten. Fast hätte ich durch einen Flügelschlag, der mich ins Gesicht traf, mein Ziel aus den Augen verloren. Verängstigt durch ihre eigene Courage, ließ sich die eine Seeschwalbe einige Minuten lang nicht mehr blicken. Es ist eine falsche Behauptung, dass die Vögel dies mit Absicht machen. Solche Scheinangriffe können aber, wie in meinem Fall, im Eifer des Gefechts manchmal etwas außer Kontrolle geraten. Ein Kurgast erzählte, dass ihm von einer Seeschwalbe im vergangenen Jahr durch Schnabelhiebe erhebliche Wunden am Kopf zugefügt wurden, während er an einem schmalen Kiesstrand nach versteinerten Seeigeln suchte. Im Laufe der Zeit beobachtete ich noch viele Seeschwalben, doch abgesehen von einem leichten Flügelschlag ins Gesicht wurde ich nie von den Vögeln verletzt. Erst Jahre später, als ich ein Gelege fotografierte, traf mich der Schnabelhieb einer Seeschwalbe, die ihr Nest verteidigen wollte, so heftig, dass es stark blutete. Aber das war nur ein unglücklicher Zufall, davon bin ich überzeugt.
Die Kiesfläche, die aus der Ferne wie ein breiter Streifen wirkte, sah beim Näherkommen immer größer aus. Jetzt griffen die beiden Vögel wieder ständig an. Zwischen Stein und Hügel suchte ich nun den Boden Zentimeter für Zentimeter ab, um die gut getarnten Eier inmitten der Kieselsteine nicht im letzten Moment noch zu zertreten. Endlich fand ich sie! Nie mehr sah ich solch gut getarnte Seeschwalbeneier, die sich dem Boden optisch vollkommen anpassten. Der steingraue Grund ihrer Schalen war übersät mit winzigen dunkelbraunen Pünktchen und außergewöhnlich großen Flecken sowie aschgrauen Unterflecken. In diesem Augenblick war ich sehr glücklich, denn es war mein erstes Vogelgelege in einer fremden Landschaft, weitab von den mir vertrauten Wäldern und Feldern. Die über mir schreienden Vögel sah ich jetzt nicht mehr. Wie kleine Kunstwerke lagen die beiden Eier in einer flachen Mulde zwischen den fast gleichfarbigen Kieselsteinen. Ja, oft fand ich auf der Fläche Steine, die sogar die gleiche Form und Größe dieser Eier hatten. Nun konnte ich mir gut vorstellen, dass sie so manches Mal ungewollt zertreten wurden.
Anschließend widmete ich meine ganze Aufmerksamkeit den beiden Seeschwalben, von denen ich noch nicht wusste, ob es Fluss- oder Küstenseeschwalben waren. Dann änderte sich auf einmal ihr Verhalten. Sie ließen mich in Ruhe und versuchten, eine Sturmmöwe zu vertreiben, die in ihr Brutgebiet eingedrungen war. Diesen Moment nutzte ich, um den hohen Dünenkamm zu erklimmen, der die westliche Grenze ihres Areals bildete, denn sobald die beiden Seeschwalben die Möwe über diese Grenze getrieben hatten, ließen sie von ihr ab und flogen zurück. Doch es dauerte nicht lange, da kam der Eindringling wieder retour und versuchte die Grenze zu überfliegen, und abermals stürzten sich die beiden Seeschwalben auf den Störenfried. Dieses Verhalten war mir unerklärlich, da Möwen bei einer solchen Abwehr sonst immer laut schreiend das Weite suchen. Ich konnte dies deutlich im Schutzgebiet beobachten, wo Silbermöwen die Seeschwalbenkolonie belagerten, um bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein Ei zu stehlen. Erdreistete sich hin und wieder mal eine und kam der Kolonie zu nahe, dann wurde sie sogleich von einigen Seeschwalben angeflogen, vor denen sie laut schreiend durch geschicktes Ausweichen zu entkommen versuchte. Ja, so war es mit den Möwen, sobald sie als Nestplünderer erkannt wurden, nahmen sie gleich Reißaus.
Die Sturmmöwe aber gab sich nicht damit zufrieden. Immer wieder versuchte sie, in das Brutgebiet der Seeschwalben einzudringen, sie griff sogar ihre beiden Verteidiger an. Nun kam bei mir die Frage auf: Wer ist hier überhaupt der Eindringling und wer der Platzherr? Von meinem erhöhten Sitz auf der Düne aus konnte ich das sonderbare Verhalten der drei Vögel als unparteiischer Schiedsrichter beobachten. Um mich kümmerte sich keine der Seeschwalben mehr, ihre ganze Aufmerksamkeit galt jetzt der Möwe. Nur ab und zu, wenn eine mir etwas näherkam – mein Sitzplatz lag auf einer Ebene mit ihrer Flughöhe – „schnarrte“ sie mich kurz an, als ob sie sagen wollte, ach, du bist auch noch hier! Deutlich konnte ich jetzt den blutroten Schnabel sehen, das sicherste Erkennungszeichen der Küstenseeschwalbe, die sich hierdurch von der Flussseeschwalbe unterscheidet, die zusätzlich eine schwarze Schnabelspitze hat. Plötzlich war in der Luft noch ein vierter Vogel zu sehen, eine zweite Sturmmöwe hatte sich in das Kampfgeschehen gestürzt. Nun änderte sich das Bild. Die Jäger wurden zu Gejagten und die Seeschwalben mussten oftmals den Möwen ausweichen, die ihnen, dadurch ermutigt, dass sie nun zu zweit waren, ständig nachstellten.
Ich konnte mir das Verhalten der beiden Möwen nur so erklären, dass sie im Brutgebiet der Seeschwalben ebenfalls ein Gelege hatten oder gerade eines bauen wollten. Sie jagten sich noch eine Zeitlang, bis sich eine der Sturmmöwen auf einer kleinen Erhöhung, nicht weit von dem Seeschwalbengelege entfernt, niederließ und nach kurzem Sichern dann damit begann, das niedrigstehende Heidekraut mit dem Schnabel zu bearbeiten. Inzwischen hatten sich die anderen drei Vögel weit verstreut voneinander niedergelassen. Lauernd beobachteten sie sich gegenseitig, bis die beschäftigte Möwe abstrich, gefolgt von der anderen. Ich wollte nicht länger stören. Ringsherum war alles ruhig, nur aus der Ferne, dem Brutgebiet der Silbermöwen, drangen noch jaulende Laute an mein Ohr. Langsam senkte sich die Dämmerung und beendete das geschäftige Treiben. Die ersten Sterne zeigten sich am Himmel, ein einsames Wölkchen zog ganz langsam und verloren seine Bahn. Wie Schatten, fast unsichtbar, flogen drei Brandgänse niedrig über mich hinweg, von der See aus ins Inselinnere. Aus der Ferne hörte ich noch zweimal das „Pink-pink“ eines Austernfischers, der wohl durch irgendetwas gestört wurde oder träumte er nur laut von den fetten Prielwürmern im lockeren Schlick des Wattenmeeres? Nun war endgültig die Stille der Nacht über diese Dünenlandschaft hereingebrochen, über der sich ein Himmel voller funkelnder Sterne wölbte, der wohl nirgendwo so hoch und unendlich scheint, wie gerade hier am Meer.
Inzwischen waren vier Tage vergangen, seitdem ich die zwei Küstenseeschwalben zum ersten Mal sah. Am Morgen danach in aller Frühe führte mein erster Weg wieder zu den Seeschwalben. Auch an diesem Tag wurde ich mit einem rauen „Kriiiiää“ empfangen. Die Stimmen der Küstenseeschwalben waren mir schon so geläufig in Tonfall und Geste, als wäre ich mit ihnen groß geworden, aber das scheinbar beunruhigte „Gia-hähä-giä-hähä“ über mir war mir neu. Es waren die zwei Sturmmöwen, die mich ebenfalls anflogen, doch nicht so scharf wie die Seeschwalben, auch sie wollten mir etwas sagen. Beim Anblick der Möwen fiel mir wieder das sonderbare Verhalten der Vögel vor einigen Tagen ein. Sogleich strebte ich auf die vermutliche Stelle zu, an der sie das Heidekraut mit dem Schnabel abgeknickt hatten. Ich brauchte nicht lange zu suchen, da fand ich diese Stelle und in einer kleinen Mulde ein Ei. Somit hatten sich meine Vermutungen bewahrheitet, die beiden Möwen hatten sich diesen Ort zum Nisten ausgewählt. Welch ein Zufall, denn die Sturmmöwen werden bestimmt nicht mit Absicht ihren Brutplatz nur drei Meter entfernt von dem der Seeschwalben angelegt haben!
Vermutlich kam den Sturmmöwen die verständliche Angriffslust der Seeschwalben seltsam vor, ebenso den Seeschwalben die Hartnäckigkeit, mit denen die Möwen ihre Angriffslust erwiderten. So sah jeder in jedem einen Störenfried. Sonderbar war aber auch, dass die Sturmmöwen sich hier mitten auf der Insel ihr Brutgebiet aussuchten, während ihre Artgenossen, wie mir spätere Nestfunde zeigten, alle am Strand brüteten. Anscheinend hatten sich zwei Außenseiter-Paare gefunden, die sich gegenseitig das Bebrüten ihrer Gelege erschwerten. Vielleicht gewöhnten sie sich auch noch aneinander – ich wollte aber nicht Schicksal spielen, sondern alles dem natürlichen Ablauf überlassen. Am folgenden Tag lag im Nest der Sturmmöwen das zweite Ei, doch am Morgen darauf war das Nest leer und auch die beiden Sturmmöwen waren spurlos verschwunden. Wahrscheinlich hatte einer der Eiersammler ihr Gelege mitgenommen, obwohl es in diesem Jahr verboten war, Eier von Sturmmöwen einzusammeln. So wurde, wenn auch nicht auf natürlichem Wege, der Streit zwischen den beiden Vogelpaaren beigelegt. Ich als Schiedsrichter konnte die alten und neuen Besitzer des Brutgebietes beglückwünschen, worauf sie mir mit einem, wie ich meine, freundlicheren „Kriiiiää“ antworteten, was in diesem Falle in der Seeschwalbensprache wohl heißt: „Wir danken dir, lass uns jetzt aber bitte in Ruhe!“ Das versprach ich ihnen, und wenn ich mal wieder durch diesen Teil der Insel kam, dann machte ich einen großen Bogen um ihr Gebiet, um nur nicht wortbrüchig zu werden.
Küstenseeschwalbe am Gelege © Dieter Kobus 2023
Sturmmöwe auf Amrum © Dieter Kobus 2023
Eiderenten auf der Insel Amrum
„Korr-korr-korrerr“, klang es über mir. Mit pfeifenden Flügelschlägen zogen kleine Gruppen der Eiderenten, die hier mit etwa 50 Paaren brüteten, geschäftig vom Inneren der Insel zum Watt. Amrum ist einer der südlichsten Brutplätze dieser halb gansartigen nordischen Tauchenten. Andere Plätze befinden sich auf Sylt, Föhr, auf den niederländischen Inseln Terschelling und Vlieland, der südlichste ist wohl die Küste der Bretagne. Weitere Schwärme kamen vom Wasser oder flogen dorthin. Sie bestanden fast nur aus den überwiegend braun gefärbten Weibchen. Die Männchen, die ihre Gefährtinnen zu Anfang der Brutzeit verlassen, befanden sich in Gruppen gesellig auf dem Wasser rund um die Insel verstreut, da sie durch ihre auffällige Weißfärbung des Gefieders die Brutplätze leicht verraten könnten. Schon oft hatte ich von diesem scheuen, doch zugleich zutraulichen Vogel, der Eiderente, gelesen und nun befand ich mich mitten zwischen ihnen oder besser gesagt unter ihnen, wenn sie mich überflogen. Denn von den vielen Brutvögeln, die hier ihre Nester haben sollten, war nichts zu sehen. Ich durchstreifte die Insel kreuz und quer, ging am Strand entlang durch das Seegras, stampfte durch die Dünenlandschaft im Inneren, streifte durch die weiten Flächen des Heidekrautes unter den Strahlen der sengenden Maisonne.
Eines Tages fand ich dann in der Nähe der Vogelkoje die ersten Anzeichen der brütenden Enten. Auf dem um diese Jahreszeit noch dunklen Heidekraut lagen die ersten Daunen der Enten verstreut, die auf ein Gelege schließen ließen. Es gab auch ein Nest tief verborgen zwischen diesem Pflanzenwuchs, das jedoch zerzaust und ausgeraubt war von den Silbermöwen, ihrem größten Feind hier neben den Menschen, die noch immer nicht wissen wollen, was Naturschutz bedeutet. Von dem Gelege waren nur einige mit Eigelb verschmierte Schalenreste zurückgeblieben. Im Laufe des Tages fand ich zwei weitere Nester, ebenfalls durch die verstreuten Daunen gekennzeichnet und ausgeraubt. Erst jetzt konnte ich verstehen, warum die Möwen an manchen Stellen so ruhig und scheinbar teilnahmslos auf den Pfählen der eingezäunten Kiefernschonungen herumsaßen, dabei ihre Umgebung aber aufmerksam beobachteten.
Sonst hielten sie sich in ihrem Brutgebiet in den Dünen, weiter im Inneren der Insel auf oder am Wasser, aber nicht in dieser Heidelandschaft, wo es anscheinend nichts für sie zu holen gab. Oder doch? Ja, hier gab es sehr wohl etwas zu holen, denn drei Nester der Eiderenten waren schon von ihnen zerstört worden. Es schien sich, der großen Anzahl der Möwen nach zu urteilen, um ein Gebiet zu handeln, in dem mehrere Eiderentenweibchen ihre Nester verborgen hatten. Mir fiel nichts von brütenden Enten auf, doch den Augen der Möwen entging keine noch so kleine Bewegung im Heidekraut. Auch wenn das Weibchen äußerst vorsichtig das Gelege verließ und zudeckte, diese Geier des Meeres hätten es bemerkt, denn davon zeugte die große Anzahl zerstörter Nester. Es schien, als ob sich die hier versammelten Räuber auf Eiderenten-Gelege spezialisiert hätten. Verließ eine Möwe ihren Platz auf dem Pfahl, so wurde dieser bald schon von einer anderen besetzt, die plötzlich von irgendwoher auftauchte. Dieser ständigen Gefahr ausgesetzt, mussten die Eiderenten ihr Brutgeschäft verrichten.
Ein paar Tage später war mir, wie schon so oft, der Zufall hold. An jenem Morgen wurde ich etwas früher wach als gewöhnlich. Sonderbar kommt dem erwachenden Fremden zu Anfang die Umgebung an der See vor. Kein Rufen der Meisen, Schlagen von Finken oder der unvergleichlich schöne Gesang der Amseln, die zwischen Tag und Tau ihr Lied von der höchsten Stelle eines Dachfirstes hören lassen. Solche Morgen, erfüllt vom Leben in der Natur, geben dem Menschen immer wieder neuen Lebensmut und Kraft für den anbrechenden Tag. An der See ist es etwas anders. Möwenrufe fern und nah in den verschiedensten Ruffolgen. Austernfischer nähern sich im Fluge. Ihre schallenden Rufe erklingen erst leise, werden beim Näherkommen lauter und ehe sie der erwachende Schläfer in ihrer vollen Stärke wahrgenommen hat, werden sie auch schon wieder leiser, bis sie in der Ferne ganz verstummen. Und dann der Gesang der vielen Lerchen. Als ich vor die Tür trat, pfiff mir ein kalter Wind um die Nase, der auch die letzten Spuren der Nacht vertrieb.
Es war etwas neblig. Zick-zack, zick-zack, flitzten links und rechts von mir graue Wildkaninchen hin und her, verschwanden in ihren Löchern, kamen wieder heraus und machten Männchen. So viel gab es hier zu beobachten und zu hören: Brandgänse auf den Feldern, Kiebitze, die ihre Jungen warnten und das ohrenbetäubende Gezeter der Rotschenkel. Solche Morgen, in denen die Natur zu einem spricht, sind unvergleichlich schön. Nachdem ich den kleinen Kiefernwald durchquert hatte, in dem der Vogelwart vor zwei Tagen die jungen Waldohreulen beringt hatte, gelangte ich in eine Senke, wo sich die Jungen des einzigen Brachvogel-Paares aufhielten, das wohl jedes Jahr hier brütete. Am Tag zuvor hatte ich zwei der Jungen gesehen. Erst nach längerem Beobachten konnte ich erkennen, wie sie durch den weißen Sand liefen. Als ich mich näherte, verschwanden sie schnell zwischen dem Strandhafer und stellten sich tot. Sie legten sich flach auf den Boden, nur ihre Augen verfolgten mich aufmerksam, während die Alten kläglich rufend umherflogen. Nun brauchte ich nur noch die vor mir gelagerte Dünenkette zu erklimmen, dann erreichte ich das Brutgebiet der Eiderenten, in dem ich die zerstörten Nester gefunden hatte. Dort bot sich mir das gleiche Bild wie zuvor.
Als ich mich ihnen annäherte, flogen die Möwen nur widerwillig von ihren Beobachtungsposten auf den Pfählen weg, um diese jedoch bald wieder zu besetzen. Auch jetzt zeigte sich in dieser Heidelandschaft nichts, was für mich im Zusammenhang mit den Enten von Bedeutung sein konnte. Außer den ausgeraubten Nestern und einigen von Möwen in die Dünen verschleppten und dort ausgetrunkenen Eiern fand ich nichts. Erschrocken fuhr ich zusammen, als kurz vor mir aus dem hohen Heidekraut ein Fasanenhahn aufflog und mit seinem abgehackten lauten Gegacker in der Ferne verschwand. Dann fand ich ein Nest. Obwohl ich nah am Gelege der brütenden Ente vorbeiging, dicht am Maschendraht von der Innenseite der Kiefernschonung aus, flog sie nicht schreiend auf. Sie bespritzte auch nicht die Eier mit Kot, wie es manchmal vorkam. Stattdessen verließ sie das Nest etwas aufgeregt und lief etwa drei Meter mit mir zugewandter Rückseite, um sich dann hinzusetzen und unbeweglich zu verharren. Ich war genauso erschrocken wie diese Eiderente, ging eilig einige Schritte zurück und bückte mich, damit das Weibchen meine Störung gleich vergessen würde, um sofort wieder das Gelege zu besetzen. Doch das tat sie nicht, sie blieb unbeweglich auf der Stelle sitzen, als ob sie dort brüten würde. War es nur ein Trick oder ein Verhalten, das durch mein Erscheinen in ihr ausgelöst wurde?
Wenn ich die „organisierte“ Nestplünderei durch die auf den Pfählen lauernden Möwen zunächst nur vermutet hatte, so konnte ich sie nun, da das Eiderentenweibchen sein Gelege verließ, bestätigen. Als ich am Zaun entlanglief, flogen die sitzenden Vögel lautlos nacheinander auf, um sich irgendwo anders niederzulassen. Dann war alles ruhig, bis ich zu der Stelle kam, wo die Ente das Nest verlassen hatte. In diesem Moment erhob sich eine Möwe nach der anderen, einige riefen, andere fielen ein. Bald kreisten alle Möwen über der Stelle, an der sich das Gelege der Eiderente mit den fünf großen, graugrünen Eiern befand. Das Verhalten der Vögel war jedoch sonderbar. Obwohl links und rechts von der Ente in einigen Metern Abstand Möwen saßen, belästigten sie das Tier nicht, um ans Nest zu gelangen. Oder hatten sie die Ente, die durch ihr in der Landschaft optisch untergehendes Gefieder gut getarnt war, tatsächlich nicht bemerkt? Schließlich verfallen Eiderenten während des Brütens in eine regelrechte Brutstarre.
Auch konnte es sein, dass die Ente ihr Gelege bisher noch nie verlassen hatte. Einige Eiderenten wurden dabei beobachtet, wie sie 28 Tage lang bis zum Schlüpfen der Jungen fest auf den Eiern saßen, ohne jegliche Nahrung aufzunehmen. Es gab viele Möglichkeiten, sich in die Lage der Tiere hineinzuversetzen. Hätte ich mich nun einfach entfernt, wäre das Gelege eindeutig dem Verderben preisgegeben worden. Deshalb musste ich also warten, bis die Ente das Gelege wieder besetzt hatte. Mit allerlei Gegenständen, die ich um mich herum fand, warf ich nach den Möwen, schrie und fuchtelte mit einem Stock in der Luft herum, bis ich diesen dann vor lauter Wut in ihre Richtung warf. Sie aber ließen sich überhaupt nicht von mir stören.
Inzwischen war ungefähr eine halbe Stunde vergangen, nachdem die Ente das Gelege verlassen hatte. Nach dieser langen Zeitspanne bewegte sie sich endlich, drehte sich in Richtung des Nestes, blieb dann aber doch wieder sitzen. Als ich die Ente zum ersten Mal sah, bemerkte ich gleich eine Schwellung am Hinterkopf, die ich als Beule deutete und die wohl durch den Schnabelhieb einer Möwe hervorgerufen wurde. Wenn ich den Silbermöwen auch allerlei zutraute, so schien mir eine solche Aggressivität Altvögeln gegenüber doch eher unwahrscheinlich, vielleicht war es nur irgendeine Wucherung am Kopf. Aus einer Entfernung, aus der mich meines Erachtens nur die Möwen sehen konnten, beobachtete ich das weitere Verhalten der Ente. Langsam kam wieder Leben in ihren plumpen Körper. Sie erhob sich ein wenig und schlich einige Schritte weiter, um sich dann wieder hinzuhocken und zu verharren. Unter diesem langsamen Vorwärtstasten, das sie zweimal wiederholte, näherte sie sich schließlich ihrem Gelege, wartete noch einige Minuten davor und besetzte es dann. Ich atmete erleichtert auf, nun konnte ja wohl nichts mehr schief gehen!
Die Tage vergingen. Wenn ich ab und zu an diesem Ort vorbeikam, bot sich mir aus weiter Ferne immer das gleiche Bild: die lauernden Möwen auf den Pfählen und die friedlich brütende Ente. Dann trat endlich der Moment ein, in dem die Eierschalen unter dem ständigen Schaben der ans Licht drängenden Jungen barsten und sie als nasses Etwas im Nest landeten. Die ersten Eiderentenküken waren bereits geschlüpft, als ich zum Nest kam. Eng aneinander geschmiegt verharrten sie unbeweglich neben der Mutter, die noch auf den restlichen Eiern saß. Im Laufe des Tages waren auch die anderen beiden Jungen geschlüpft, denn als ich am nächsten Morgen zum Nest kam, war es verlassen. Um diese Zeit herum begann überall auf der Insel das große Wandern, denn die jungen Eiderenten mussten ja zu ihrem Nahrungsspender – dem Wasser – gelangen. Einige Mütter hatten nur kurze Wege mit ihren Kleinen zurückzulegen, so wie die von mir beobachteten Enten, manche aber auch doppelt so lange. Hatten einige Gelege die Gefahren der langen Brutzeit gut überstanden, so begann nun für die Altvögel die nächste Sorge, wie sie ihre Jungen ohne Schaden zum Wasser bringen konnten, denn die Silbermöwe blieb ihr größter Feind. Schon wenige Stunden nachdem die Jungen trocken waren, begann auf Schleichwegen der Marsch und die Auslese der Natur, denn nur kräftige Jungtiere konnten überleben. Die Kleinen, die die See erreichten, waren nun in ihrem Element, außer Gefahr waren sie dadurch aber nicht, denn auch hier lauerten die Silbermöwen. Durch Eintauchen konnten sich die jungen Eiderenten den Schnäbeln der Möwen für kurze Zeit entziehen, bis sie wieder auftauchen mussten. Auch hatten sich manche Möwen, wie bei den Nestplündereien, auf Eiderentchen spezialisiert. Sie verfolgten die tauchende kleine Ente, bis sie vor lauter Erschöpfung aufgab. Doch nicht nur Möwen brachten den Kleinen das Verderben, sondern wohl auch das Wasser, wie einige tote Entchen, die ich am Ufer fand, erahnen ließen.
Ich könnte Vermutungen anführen warum und wieso, aber wie sie wirklich ums Leben kamen, habe ich nie gesehen. Oftmals ging ich bei Flut zum Ostufer, an dem sich die Eiderenten mit ihren Kleinen ausruhten. Nur wenn sie müde waren oder die See zu unruhig, gingen sie an Land. Sobald ich mich näherte, liefen sie ins Wasser hinein, doch die Kleinen kamen in den anrollenden Wellen nur langsam vorwärts. Waren sie erst einmal aus der Uferdünung heraus, ging es schon besser und bald sah man sie Welle für Welle, wie auf eine Kette gereiht, hinter der Mutter herschwimmen. So führten manche Weibchen bis zu 20 Junge, die natürlich nicht allein von einem Exemplar erbrütet wurden. Denn Enten dieser Art nehmen sich mit besonderer Fürsorge verwaister Küken an. Nicht alle Mütter gelangten mit ihren Jungen geschlossen zum Wasser, häufig wurden sie durch Badegäste von den Küken getrennt. Die Kleinen, die dann instinktiv das Seewasser fanden, wurden ganz ohne Bedenken von einer anderen Entenmutter aufgenommen.
Nun, da die Entenmännchen die brütenden Weibchen nicht mehr durch ihr auffallendes Gefieder gefährden konnten, gesellten sie sich wieder zu ihnen. Hier und da sah ich eines, wie es sich aus dem Wasser aufrichtete und mit den Flügeln schlug. Irgendwo unter den vielen Eiderenten befand sich vielleicht auch das Weibchen aus der Kiefernschonung. Die Kleinen wurden größer und flügge und verließen dann die Altvögel. Bald schon werden auch sie eigene Familien gegründet haben und versuchen, ihre Art zu erhalten. Dabei sollte der Mensch ihnen ein helfender Freund sein und nicht ihr Feind!
Eiderente auf Amrum © Dieter Kobus 2023
Gelege der Eiderente © Dieter Kobus 2023
Sandregenpfeifer auf der Insel Amrum
Der scharfe Wind brachte Regen mit sich, Wolken prall und düster wie Wassersäcke, die sich dann bald entleerten. Es war einer der wenigen Regentage im Mai auf der nordfriesischen Insel, der aber eher Abwechslung als Trübsinn brachte. Pfeifend trieb der Wind die Wellen der aufgewühlten See voran, wo die Eiderentenweibchen mit ihren erst wenige Tage alten Küken Schutz suchten vor den mächtigen Wassermassen von oben. Gelangweilt putzte sich jetzt Groß und Klein, oder die Enten fetteten ihr Gefieder ein. Für den Ernstfall mussten sie gerüstet sein, denn waren die Wellen auch noch so hoch und die Brandung noch so stark, bei Gefahr gings hinein ins nasse Element. Obwohl es für die Kleinen sehr gefährlich war, würden die Mütter das Leben der Jungen eher der tosenden See anvertrauen als einem nahenden Feind.
Dann wurde es wieder heller und mit den abziehenden Regenwolken schwand fast gleichzeitig das Wasser mit all den Enten und das Wattenmeer breitete sich über eine große Fläche aus. Jetzt fielen Brandgänse ein und suchten in den zurückgebliebenen Prielen und Pfützen nach Nahrung, Rotschenkel und Austernfischer stocherten im Schlick, Möwen fanden einen reich gedeckten Tisch. Das Meer, das oft so grausam sein konnte, dachte an seine Kinder. Und noch jemand suchte dort nach Nahrung. Mit einem „Plüit-plüit“ fiel ein Exemplar der zweiten hier brütenden Art aus der Familie der Regenpfeifer ein, es war der Sand- oder Halsbandregenpfeifer! Wie für den Seeregenpfeifer schien auch für ihn die Tarnung das halbe Leben zu sein. Wenn er ruhig stand in dem nass schimmernden und funkensprühenden Watt, über dem jetzt wieder heiß die Sonne schien, dann war er eins mit seiner Umgebung. Erst wenn er wieder lief, wurde er sichtbar. Ich suchte das Watt, soweit es ging links und rechts von mir ab und fand dabei vier dieser kleinen Flitzer. Es waren zwei Männchen mit kräftigem dunklen Kröpfband und zwei Weibchen, bei denen das Band etwas schmaler und blasser war – also zwei Paare, die sich zwischen Watt und den etwas höher gelegenen Wiesen auf einem der langgestreckten Kiesstreifen aufhielten. An manchen Stellen erstreckten sich diese mehr oder weniger tief ins Grünland. Die kleinen Vögel entfernten sich immer weiter, bis einer nach dem anderen in einer Senke im Watt verschwand, sodass ich sie nicht mehr sah. Erst mit der Flut kehrten sie wieder zurück.
Wenn das Wasser kam und weiße Schaumkronen vor sich herschob, füllte es erst die Priele und andere Vertiefungen im Watt. Dann stieg es etwas höher und überspülte zunächst die Bodenwellen, auf denen sich die Regenpfeifer vor dem zurückflutenden Wasser in Sicherheit brachten. Stieg das Seewasser immer höher, flogen sie zur nächsten Erhebung dem Festland zu, bis sich auch dort das Wasser sammelte und an Höhe zunahm. So ging es weiter, bis die Tiere schließlich wieder auf dem schmalen Kiesstreifen angelangt waren. Hier konnten sie nicht von der See vertrieben werden, hier war ihr Reich. War es auch schmal, so bot es doch alle Voraussetzungen, die sie benötigten, um eine Familie zu gründen und Junge aufzuziehen. Eines der beiden Paare schien sich besonders für den Teil des kleinen Strandes zu interessieren, an dem ich mich ständig aufhielt. Sie liefen aufgeregt hin und her, pickten am Boden und sahen zu mir hinüber. Wenn ich dann auf sie zuging, erhoben sie sich, um über die höher gelegenen Weiden zu fliegen und auf der anderen Seite am Kiesstreifen niederzugehen. Sobald ich mich ihnen erneut näherte, flogen sie wieder auf die andere Seite, zuerst über die Wiese und dann zurück übers Wasser. An ihrem Verhalten hatte sich nichts geändert. Sie ließen sich aus ihrem Gebiet, das sie durch Überfliegen kennzeichneten, nicht vertreiben. Nur bei Ebbe liefen sie ins Watt. Sollte dies ihr Brutgebiet sein?
Bei den Regenpfeifern ist es nicht so wie bei den Seeschwalben, Möwen oder Austernfischern, die durch ihre sich steigernde Aggressivität den etwaigen Stand des Nests anzeigen. Von den Sandregenpfeifern muss man sich stattdessen einige Meter entfernen, um beobachten zu können, wo sie sich zum Brüten niederlassen. Gerade das war hier aber unmöglich. Von der einen halben Meter höher liegenden Weide aus konnte ich nichts sehen, da der schmale Kiesstreifen im toten Winkel lag. Und vom Strand aus schränkten in Längsrichtung kleine Landzungen mein Blickfeld ein, die oft bis ins Wasser reichten. So war es bei Flut, doch auch bei Ebbe war die Chance nicht größer etwas zu sehen, denn dann wurde das Watt am Kiesstreifen zur „Watt-Tret-Promenade“. Ständig kamen Kurgäste vorbei mit vom Schlick schwarz gefärbten Beinen. Die Regenpfeifer hatten sich weit ins Watt geflüchtet. Dann flaute der Betrieb etwas ab und die Vögel wagten sich langsam wieder näher, doch in ihrem ganzen Verhalten lag etwas Zögerndes. Oftmals gingen sie ein ganzes Stück zurück ins Watt, pickten am Boden und liefen eilig vorwärts. Ein Männchen kam geradewegs auf mich zu und schien dies nicht zu bemerken. Ich lag an der Kante der erhöhten Weide, verdeckt vom Strandwermut.
Die ganze Aufmerksamkeit des näherkommenden Regenpfeifers galt den Wattwandernden, die jeden seiner Versuche, den Küstenstrand ungestört zu erreichen, scheitern ließen. Fast hatte der Vogel es immer noch vorsichtig sichernd geschafft, als ich aus der Ferne leise Stimmen vernahm und hoffte, dass es nur Spaziergänger waren, die sich auf dem Weg durch die Weiden befanden. Die Stimmen wurden aber lauter und kamen immer näher, ein unwohles Gefühl überkam mich. Wären es einfache Fußgänger gewesen, so hätten sie längst schon links dem Weg folgen müssen, sollten es jedoch wieder diese „Gesundheitsapostel“ sein? Ich hoffte, dass bis zu ihrem Erscheinen noch einige Minuten vergingen, vielleicht würde sich das Männchen doch noch dazu entschließen, seinen Weg fortzusetzen. Aber dann ließ es, noch immer unentschlossen, sein zartes Stimmchen vernehmen, erhob sich und flog, gefolgt von dem ihm entgegenkommenden Sandregenpfeiferweibchen ins Watt zurück. Resigniert ließ ich den Kopf auf die Arme sinken. Mittlerweile waren die Störenfriede hier angekommen. Junge Leute waren es, voller Unbekümmertheit und Lebensfreude, wie konnte es auch anders sein bei sonnigem Urlaubswetter unter einem blauen Himmel an der See. Sie winkten freundlich zu mir herüber, da konnte ich ihnen nicht mehr böse sein. Menschen, die sich freuten und gar nicht wussten, dass sie hier störten. Also grüßte ich und winkte zurück. Morgen wollte ich es an dieser Stelle noch einmal versuchen, vielleicht hatte ich dann mehr Glück.
Am nächsten Morgen war ich sehr früh unterwegs, fast noch zwischen Tag und Tau. Über die dann menschenleeren Straßen ging ich bis zum südlichen Anfang des Ostdeichs. Hinter einem dichten Reetbestand fing der kiesige Sandstreifen an, der sich längs der Ostseite der Insel erstreckte. Von hier aus wollte ich bis zu meiner gestern entdeckten Stelle am Ufer entlang gehen, vielleicht würde ich ein Gelege finden oder etwas noch Aufschlussreicheres im Zusammenhang mit den Sandregenpfeifern. Es war gerade Flut. Fröstelnd schlug ich meinen Kragen hoch. Am Wasser wehte in den frühen Morgenstunden noch ein eisiger Wind, den selbst Sonnenstrahlen nicht zu erwärmen vermochten. Vorsichtig suchte ich den Boden ab. Neben Muscheln konnte man hier die unterschiedlichsten Dinge finden, die von der Flut angeschwemmt wurden. Ungefähr auf halbem Wege fand ich abermals ein kleines Ei, in seiner Form war es anders und auch etwas größer als das der Seeregenpfeifer. Es konnte nur vom Sandregenpfeifer sein. Aber diesmal hatte ich nicht das Glück, ein Nest mit den dazugehörigen Eiern zu finden. Es wird wohl ein Notei gewesen sein.
Langsam ging ich weiter. Klatschend spritzte das Wasser hoch, als ich um die nächste Landzunge bog. In dieser kleinen Bucht war, wie schon erwähnt, der Lieblingsplatz der Eiderenten, wo sie ihren müden Jungen etwas Ruhe gönnten. Gefolgt von den Kleinen glitten sie ins nasse Element, in dem die Eiderentenküken nur langsam vorwärtskamen. Sobald sie sich aber außerhalb der gefährlichen Uferbrandung befanden, ging es schon besser und sie folgten eilig in langen Ketten den Alten, Welle auf Welle. Ehe ich dort ankam, waren sie schon einige Meter entfernt. Für kurze Zeit verließ ich das Ufer, da hier ein breiter Graben die See ein Stück lang mit dem Inneren der Insel verband, ging diesen entlang bis zu einer kleinen Brücke, über die ich wieder zum Strand gelangte und bald darauf die gesuchte Stelle erreichte. Die Regenpfeifer flitzten zwar wieder herum, zeigten mir aber durch ihr Verhalten nicht das, was ich suchte. Auch dieser Tag schien erfolglos zu enden, doch dann fand ich eine kleine Mulde, die fein säuberlich mit Steinchen ausgelegt war und in Größe und Anfertigung den Gelegen des Seeregenpfeifers glich. Es war keineswegs ein durch Zufall entstandenes Gebilde, sondern zeigte deutlich, dass sich die Regenpfeifer hier mit Brutabsichten beschäftigten. Nun fehlten nur noch die vier Eier, die wohl im Laufe der kommenden Tage folgen würden. Ich steckte einen Stock in die höher gelegene Kante der Weide gegenüber der Mulde und ging dann.
Ein Tag war vorüber, der zweite verging und ich ließ noch einen dritten Tag verstreichen, ehe ich wieder zu dem Küstenstreifen lief. An der Mulde hatte sich nichts verändert, sie war noch immer leer. Sollte ich doch noch einige Tage warten oder weitersuchen? Vielleicht brüteten sie auch ganz woanders. Ich ließ den Sand durch meine Finger gleiten und überlegte. Mir fielen die Augen immer wieder zu, die Müdigkeit übermannte mich, wenn ich stillsaß. In den letzten Tagen war ich viel gelaufen. Laufen im Sand macht müde, nicht am ersten Tag, doch ich war viele Tage lang unterwegs gewesen unter den heißen Strahlen der Sonne, ohne Pause. Man muss laufen, wenn man etwas Ungewöhnliches sehen will, das ist wohl das, was die meisten Menschen scheuen – und deshalb auch nichts Besonderes in der Natur entdecken.
Sehr oft lief ich umsonst umher, doch dann fand oder sah ich etwas und alle Strapazen waren vergessen. Es war schön in der warmen Sonne zu sitzen, wenn die Lerchen ihr Wiegenlied sangen. Man möchte dann nie mehr in den Alltag zurück. Doch heftiges Hundegebell weckte mich aus meinen Träumen. Die beiden Kläffer hatten mich hier wohl nicht erwartet, deshalb hatten sie sich erschrocken und bellten vor lauter Angst. Ich ging ein Stück weiter auf der Kiesfläche, um fast mitten im Schritt anzuhalten, denn vor mir lag das Nest der Sandregenpfeifer! Was muss man nicht alles über sich ergehen lassen, ehe man einen Blick in ein solches Nest werfen kann. An dieser Stelle war ich schon einige Male vorbeigegangen, ohne es zu bemerken. Die vier Eier lagen in einer Mulde, die wie mosaikverziert mit kleinen Bruchstücken von Muscheln ausgelegt war. Zwischen Strandwermut, umgeben von Seetang und angeschwemmten Brettern, lösten sie sich ganz in ihrer natürlichen Umgebung auf.
So waren die Eier gut getarnt und unsichtbar für neugierige Wattwanderer, der hier vorbeikamen, nicht aber geschützt vor ungewolltem Zertreten. Sie waren kreiselförmig und auf sandfarbenem Untergrund mit gleichgroßen, kleinen dunkelbrauen und aschgrauen Unterflecken versehen. Die leere Mulde befand sich von dieser etwa vier Meter entfernt und schien wohl aus der Balzzeit zu stammen, in der das muldendrehende Männchen dem Weibchen einige Orte zur Eiablage anbietet. Mich irritierte aber, dass auch diese schon fein sauber mit Steinchen ausgelegt war, denn im Allgemeinen sind solche Mulden nur kleine Vertiefungen ohne jegliche Polsterung. Während ich am Nest stand, liefen die beiden Regenpfeifer leise rufend in respektvollem Abstand im Watt umher. Durch kleine Unterbrechungen, in denen sie mir am Boden pickend ihre scheinbare Interessenlosigkeit zeigen wollten, versuchten sie mich abzulenken, behielten mich dabei aber stets wachsam im Auge. Diese Regenpfeifer sind eben nicht so wehrhaft wie andere Seevögel. Ihre kaum spürbare Abwehr und das ängstliche, zarte Rufen gingen im Wind und dem anhaltenden Gezeter der Rotschenkel unter. Leider war es mir nicht vergönnt, die Vögel beim Brüten zu beobachten, da ich kein Tarnzelt dabeihatte, sonst wäre es eine Kleinigkeit gewesen.
Sandregenpfeifer am Gelege © Dieter Kobus 2023





























