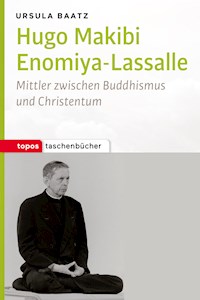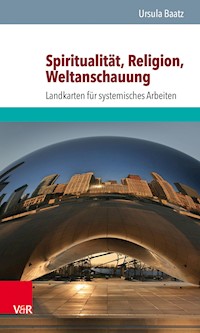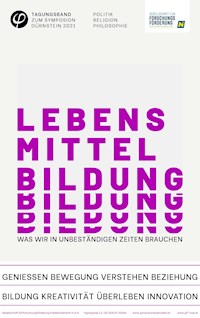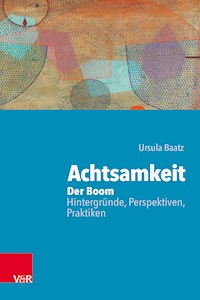
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Achtsamkeit – »mindfulness« – ist zum Schlagwort geworden. Was steckt wirklich dahinter? Aus einer weitgehend unbekannten buddhistischen Meditationspraxis wurde eine Methode, die das US-Militär genauso wie Krankenhäuser, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten anwenden. Ursula Baatz zeichnet die facettenreiche und faszinierende Geschichte dieser Transformation nach, gibt Auskunft über die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu Achtsamkeit und fragt nach der Relevanz des buddhistischen Hintergrunds. Am Ende zeigt sich: Die Karriere von Achtsamkeit ist von der Zunahme von Stress und Burnout nicht zu trennen. Dazu beigetragen haben die Erkenntnisse der Neuroforschung ebenso wie die westliche Buddhismus-Rezeption.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Baatz
Achtsamkeit: Der Boom
Hintergründe, Perspektiven, Praktiken
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2023 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress und Wageningen Academic.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Paul Klee, Sonnenuntergang, 1930/agk-images
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-647-99961-6
Inhalt
1 Einführung
1.1 Atemlose Arbeitswelt
1.2 Ein kurzer Überblick
2 Achtsamkeiten
2.1 Ellen Langer
2.2 Achtsamkeitspraktiken
2.3 Drei Beispiele für Achtsamkeitsübungen
2.3.1 Retreat nach S. N. Goenka
2.3.2 Retreat in Plum Village nach Thich Nhat Hanh
2.3.3 MBSR: Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn
2.4 Achtsamkeit: eine kulturelle Praxis
2.4.1 Globale Kontexte
2.4.2 Kurzer historischer Überblick
3 Aufmerksamkeit und die Konstruktion der modernen Arbeitswelt
3.1 Die Erforschung der Wahrnehmung
3.1.1 Leistungssteigerung und das Problem der Ermüdung
3.1.2 Zerstreuung fordert Aufmerksamkeit
3.1.3 Entspannung: Heilmittel zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit
3.2 Krieg, Stress und Burn-out
4 Achtsamkeit in der Industriegesellschaft
4.1 Modernisierter Buddhismus: Naturwissenschaft und Ewige Wahrheit
4.2 Pursuit of Happiness: Die Entdeckung der Achtsamkeit
5 Tradition(en) der Achtsamkeit
5.1 Was übersetzen Übersetzungen?
5.2 Achtsamkeit vorbuddhistisch
5.3 Pali-Kanon
5.3.1 Satipahāna Sutta
5.3.2 Ānāpānasati Sutta
5.3.3 Metta Sutta
5.3.4 Nirwana: Erwachen und Befreiung
5.4 Anfängergeist: Nichtdualistische Achtsamkeit im Mahayana
6 Kolonialismus in Südostasien
6.1 Ledi Sayadaw (1846–1923)
6.2 U Bha Khin (1899–1971) und S. N. Goenka (1924–2013)
6.3 Die »neue burmesische Methode«
6.4 Weitere Verbreitung der Vipassana-Bewegung
6.5 Engagierter Buddhismus: Thich Nhat Hanh
7 Achtsamkeitsbilder im Wandel
7.1 Traditionelle Gleichnisse und Metaphern
7.2 Der Einfluss von Technik und Wahrnehmungspsychologie
7.3 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR): Von Metaphern zu Definitionen
7.4 Exkurs: Achtsamkeit für das Militär
8 Achtsamkeitspraktiken
8.1 Biotope der Achtsamkeit
8.2 Achtsamkeitsbasierte Methoden
8.2.1 Segmentierte Achtsamkeit: Eine offene Liste
8.2.2 Achtsamkeit und therapeutische Interventionen
8.3 Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Achtsamkeit
8.3.1 Forschungen zu MBSR und MBCT
8.3.2 Verschiedene Übungen bewirken Verschiedenes
8.4 Wie aussagekräftig sind die Forschungsergebnisse?
9 Interkulturelle Differenzen: Sati oder Mindfulness?
9.1 Zeit
9.2 Emotionen
9.3Power: Energie und Stärke
9.4 Ethik
9.5 Selbst
10 Zusammenfassung und Ausblick
Dank
Literatur
1 Einführung
1.1 Atemlose Arbeitswelt
Es war vor Jahren in Thailand. Auf der Fähre zur Insel Koh Chang hatte ich ein nettes junges Paar kennengelernt, sie Französin, er Thai, zwei nette Hippies. Gemeinsam machten wir uns auf die Suche nach einer passenden Unterkunft. Die Insel war weitgehend autofrei, wir mussten uns also zu Fuß auf den Weg machen. Vom Rucksack beschwert, blieb ich zunehmend zurück. Der junge Thai bot an, mein Gepäck zu tragen, was ich gern annahm. Nach einer Weile fanden wir einen netten Ort am Strand. Er stellte meinen Rucksack ab, und ich dachte, dass er sofort beginnen würde, wegen der Unterkünfte zu verhandeln. Doch stattdessen legte er sich eine ganze Weile auf eine Bank in die Sonne, um sich von der Anstrengung zu erholen. Ich merkte, wie ich unruhig wurde – wie konnte er bloß jetzt eine Pause machen? Und so lang?
Der Bungalow, den er für mich organisierte, lag direkt am Meer. Ich konnte vor der Tür sitzen und den Wellen des Golfs von Thailand zusehen, die kamen und gingen, eine Welle lief den Strand hoch, verebbte, dann kam die nächste, sie überschnitten einander in komplexen Mustern, und aus dem Wechsel von Mehr und Weniger, Überschäumendem und Verschwindendem, Kommen und Gehen und den Pausen dazwischen ergab sich ein Rhythmus.
Sich entspannen und wieder anspannen, im Rhythmus, den der Körper vorgibt. Statt loszurennen mit verspanntem Rücken, hatte der junge Mann zunächst pausiert, durchgeatmet, die Spannung losgelassen und sich gesammelt, bevor er zur nächsten Aktivität überging. Ich dagegen machte kaum je Pausen und bemühte mich, so rasch wie möglich von einer Aktivität zur nächsten überzugehen. Pausen machen verboten.
Meine Freundin Anna erzählte mir, dass sie als Studentin einen Sommer lang in einer Schokoladenfabrik am Fließband stand. Sie musste die silbrig und goldgelb verpackten Schokoladenkugeln in Schachteln einordnen. Das Fließband war so eingestellt, dass es bei hoher Konzentration gerade gelang, die Schachtel fertig zu befüllen, bevor die nächste kam. Niemand konnte daher eine Pause machen, nicht mal, um auf die Toilette zu gehen, denn dazu hätte das Fließband abgestellt werden müssen. Und das ging natürlich nicht. Anna war heilfroh, nach diesem Sommerjob zu ihrem Studium zurückzukehren, wo sie ihre Zeit selbst einteilen konnte.
Das Fließband in der Schokoladenfabrik hat eine lange Ahnenreihe. Getaktete Arbeit wurde erstmals um 1900 eingeführt und seither perfektioniert. Zunächst wurden die notwendigen Arbeitsschritte in kleine Einheiten zerlegt und in ein Zeitraster gebracht, an das sich die Arbeitenden anpassen mussten, wodurch sich auch die Arbeitsleistung genau kontrollieren ließ. Durch die Digitalisierung veränderte sich dies nochmal. Die Leistung – der »Output« – kann nun auch ohne Fließband getaktet und kontrolliert werden, etwa von Lagerarbeitern bei Amazon oder bei dem britischen Lebensmitteldiscounter Tesco durch elektronische Tags. Auch die Anwesenheit am Schreibtisch lässt sich kontrollieren – nicht nur im Büro, auch im Home-Office.
Allerdings lassen sich viele Berufe, vor allem im Sozialbereich, nicht so einfach takten. Doch auch bei diesen gibt es seit etwa zwei Jahrzehnten strikte Zeitvorgaben: wie lang es dauern darf, eine Patientin zu waschen, zu füttern, wenn sie nicht mehr selbst essen kann, sie umzubetten etc.
Nora ist Krankenschwester in einem großen Krankenhaus. Ihr Dienst ist unregelmäßig. Sie liebt ihren Beruf, die Arbeit mit den Patienten, doch ist seit einigen Jahren eine umfassende Dokumentation ihrer Tätigkeit vorgeschrieben, die sehr viel Zeit verschlingt. Zudem wurde das Personal verringert, weswegen Nora nun mehr Patienten als zuvor betreuen muss. Eine Bekannte hat ihr geraten, einen Achtsamkeitskurs zu besuchen, um mit dem Stress besser umgehen zu können. In diesem Acht-Wochen-Kurs hat sie gelernt, sich etwas von der Hektik ihres Berufs zu distanzieren, auch wenn der alltägliche Druck im Krankenhaus manchmal sehr heftig ist, die Dokumentationen viel Zeit in Anspruch nehmen und oft während der Pausen erledigt werden müssen.
In der getakteten Arbeitswelt sind Pausen von außen vorgegeben. Die biologischen Notwendigkeiten müssen sich in diesen Takt einfügen oder ausgeblendet werden. Könnte man den Arbeitsrhythmus selbst bestimmen, wäre alles viel besser – so dachten viele vor zwanzig oder dreißig Jahren. Das Management nahm sich diese Vorschläge aus den 1970er und 1980er Jahren zu Herzen und gestaltete Arbeitsplätze anders – mit mehr Selbstständigkeit bei der Arbeitsgestaltung und mit größerer Flexibilität. Auch eine flexible Arbeitssituation kann Stress bereiten. Längere Arbeitspausen plus darauffolgende Intensivbeanspruchung – als »Flexibilität« bezeichnet – können das gesamte übrige Leben durcheinanderbringen.
Thomas hatte schon während des Studiums mehrere unbezahlte Praktika bei Firmen absolviert. Nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums bekam er rasch eine Stelle, musste sich aber damit abfinden, dass diese befristet war. Danach war er eine Weile ohne festen Job. Es war Sommer, und viele seiner Freundinnen und Freunde beneideten ihn um die freie Zeit, die er im Schwimmbad verbringen konnte. Dann fand er einen weiteren temporären Job, der ihm Spaß machte, aber sehr fordernd war. Schließlich machte er sich als Berater selbstständig und war darin auch erfolgreich. Jedoch hatte er nach mehreren Jahren ein Burn-out, das ihn in eine Burn-out-Klinik brachte. Sein Umfeld war verwundert, hatte es Thomas doch immer gut gelaunt und mit einem sehr lockeren Zeitkorsett erlebt. Manche waren sogar etwas neidisch gewesen, wenn sie nach einem Fest frühmorgens wieder zur Arbeit mussten und Thomas, der sich die Zeit selbst einteilen konnte, ausschlief. In seinem Berufsleben hatte Thomas oft freie Zeit – doch war sie nicht selbst bestimmt. Auch war er beständig bemüht, sich neue Arbeitsfelder zu erarbeiten, an seiner persönlichen Haltung gegenüber Klienten zu feilen und sich selbst zu optimieren. Die Zeit, die er im Schwimmbad verbrachte, war nur aus der Sicht jener entspannt, die in geregelte Arbeitsprozesse eingespannt waren. Thomas’ Gedanken jedoch kreisten trotz Sonne und Wasser um Arbeit – ob er eine neue Stelle finden würde, wie lange er diese behalten könnte, ob er gut genug in seiner neuen Position sein würde, die gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit der Kundinnen1 erfüllen könnte usw. Die aufpoppenden Nachrichten auf dem Mobiltelefon und in den sozialen Medien, bei denen sich Arbeit und Privatleben mischten, beanspruchten seine Aufmerksamkeit und ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. Bei seinem Aufenthalt in der Klinik lernte Thomas Übungen, die ihm helfen sollten, achtsamer mit seiner Aufmerksamkeit und seiner Lebenszeit umzugehen, auch nach dem Aufenthalt in der Burn-out-Klinik bei der Rückkehr in die Arbeitswelt.
1.2 Ein kurzer Überblick
Viele Arbeits- und Lebensprobleme, die Menschen wie Anna, Nora und Thomas bewegen und gelegentlich zur Verzweiflung treiben, sind »stressig« – eine Abfolge von kleinsten, kleinen und größeren Katastrophen, die alle zusammen das Leben schwierig machen. »Full Catastrophe Living« heißt das Buch von Jon Kabat-Zinn, das 1990 erstmals erschien und das Achtsamkeit – eine Praxis aus dem Buddhismus – als Heilmittel gegen Stress propagierte. In den folgenden Jahrzehnten wurde Achtsamkeit zu einer Art Zauberwort für Hilfe in allen Lebenslagen – und gleichzeitig ein Industriezweig, dessen Umsätze in Milliardenhöhe liegen. 2020 nutzten etwa mehr als 60 Millionen Menschen in 190 Ländern die Achtsamkeits-App »Headspace«2, und große Unternehmen wie Google oder auch Bosch bieten Achtsamkeitskurse zur Prophylaxe gegen Stress und Burn-out an.
Der Beginn des Achtsamkeitsbooms fällt in die 2000er Jahre: Aufstieg und Fall der Dotcom-Ökonomie, Terroranschläge in New York, Madrid und Mumbai, Kriege im Irak und Afghanistan, der Aufstieg Chinas zur wirtschaftlichen Großmacht, Immobilienblase, Bankenkrach und internationale Finanzkrisen, die Macht sozialer Netzwerke und international zunehmende soziale Ungleichheiten – Tendenzen, die sich in den Zehnerjahren des 21. Jahrhunderts fortsetzen. Seit den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts ist auch ein durch quantitative Studien belegter deutlicher Anstieg von Stress und Burn-out zu verzeichnen und ebenso eine verstärkte gesellschaftliche Diskussion darüber (Neckel u. Wagner, 2013). Dass Stress und Burn-out mit der Situation am Arbeitsplatz zu tun haben, wird 2019 durch die Aufnahme von Burn-out in der ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) festgeschrieben, der international gültigen Klassifikation von Krankheiten, an der sich Ärzte und Krankenhäuser weltweit für die Diagnosestellung orientieren.
Der Boom von Achtsamkeit in den Industriestaaten des Nordens ist nicht zu trennen von sozialen und ökonomischen Veränderungen und der Geschichte der Arbeitswelt. Den globalen Süden als Zulieferer für die »imperiale Lebensweise« (Brand u. Wisser, 2017) des Nordens betreffen die Veränderungen in anderer Form und unter anderen Voraussetzungen. Interessentinnen und Interessenten für Achtsamkeitspraktiken finden sich hier am ehesten in der Mittelschicht (McMahan, 2012).
Auch wenn die physiologischen Mechanismen von Stress und Stressbewältigung bei Menschen jeder Herkunft ziemlich dieselben sind – die Lebensbedingungen, die Stress auslösen, sind es nicht. Stress betrifft Arbeitslose oder CEOs im globalen Norden genauso wie Geflüchtete aus dem globalen Süden, die es in eines der europäischen Auffanglager geschafft haben. Eine Frau, die in einem der riesigen Flüchtlingscamps in der Türkei, Jordanien oder im subsaharischen Afrika lebt (dort befinden sich laut UNHCR3 26 Prozent der Flüchtlinge weltweit) oder auch in einem der Slums in lateinamerikanischen, asiatischen oder afrikanischen Millionenstädten, ist in einer grundlegend anderen Situation als eine Frau in einer Klein- oder Großstadt der Industriestaaten der nördlichen Halbkugel. Dass sich der Blick dieses Buches auf die Situation des globalen Nordens richtet, liegt auch daran, dass seit Beginn der Industrialisierung vor allem die Perspektiven und Entscheidungen der nördlichen Hemisphäre die Entwicklung des Planeten insgesamt bestimmt haben.
In den von mir begleiteten Achtsamkeitskursen war es berührend, immer wieder zu erleben, dass eigentlich einfache Übungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen helfen konnten. Doch merkte ich auch, dass es für viele schwierig war, Achtsamkeit von der im Berufsleben geforderten Aufmerksamkeit oder von Selbstbeobachtung zu unterscheiden. Wieso wurde aus einer buddhistischen Praxis, kontextlos in die neoliberale Industriegesellschaft verpflanzt, eine global verbreitete kulturelle Praxis? Zudem bedeutete »Achtsamkeit« je nach Kontexten und Motivationen Unterschiedliches. Aus der Suche nach Antworten ist dieses Buch entstanden.
In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Praktiken und Bestimmungen von Achtsamkeit einführend erkundet (Kapitel 2). Die Bedingungen, unter denen eine spezifische religiöse Praxis (»Achtsamkeit«) aus dem Buddhismus globales Interesse wecken konnte, werden in den nächsten beiden Kapiteln skizziert, die sich mit Entwicklungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts befassen. Die Herausbildung der modernen, an Leistung orientierten Arbeitswelt beruhte wesentlich auf der Untersuchung und Instrumentalisierung von Aufmerksamkeit zur Steigerung der Leistung. Diese Untersuchungen bildeten die Brücke zu Achtsamkeitspraktiken. »Entspannung« (aber auch »Zerstreuung«) zum Zweck späterer Leistungssteigerung ersetzte ältere Konzepte wie »Muße« und »Erholung« (Kapitel 3). Unter den Vorzeichen des Kolonialregimes hatten Buddhisten in Sri Lanka und Japan als Teil des antikolonialen Kampfes eine Modernisierung des Buddhismus eingeleitet, was die Rezeption des Buddhismus – und vor allem der Achtsamkeitspraxis – in den USA und Europa ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts möglich machte (Kapitel 4). Die Quellen der Achtsamkeitspraxis von heute sind im frühen Buddhismus und der weiteren Entwicklung in Theravada und Mahayana (Kapitel 5) zu finden. Durch die Wiederentdeckung der Achtsamkeitspraxis auch für Laien in Burma, damals Teil des britischen Kolonialreichs, kann sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine erneuerte buddhistische Achtsamkeitspraxis entwickeln (Kapitel 6). Die traditionellen Metaphern für Achtsamkeit treten in den Hintergrund und unter dem Einfluss der modernen Naturwissenschaften entstehen neue Metaphern, die für die klinische Erforschung und Evaluierung durch Definitionen ersetzt werden. Dies verändert das Verständnis von Achtsamkeit weitgehend (Kapitel 7). Achtsamkeitsübungen werden in unterschiedlichsten Segmenten der Gesellschaft aus diversen Motivationen heraus und für verschiedenste Ziele eingesetzt, unterstützt von (nicht nur, aber auch neuro-)wissenschaftlicher Forschung (Kapitel 8). Doch unterscheiden sich Welt- und Selbstbilder von Achtsamkeitsübenden in traditionell buddhistischen Ländern von denen in Industriestaaten beträchtlich (Kapitel 9). Für die buddhistische Tradition geht es bei Achtsamkeitspraktiken um Selbstkultivierung im erkenntnismäßigen und ethischen Sinn, mit der Perspektive des Endes von Gier, Hass und (egozentrischer) Verblendung, buddhistisch gesprochen um »Erwachen«. Für zeitgenössische Formen der Achtsamkeitspraxis geht es vielfach um ein breites Spektrum von Selbsthilfe bei Stress und Burn-out sowie um Selbstoptimierung für bessere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, aber auch um »Loslassen« von Fixierungen unterschiedlichster Art und ein gelingendes Leben.
Anmerkung: Buddhistische Termini werden meistens in ihrer Pali- und Sanskrit-Schreibweise angeführt. Auf Transliteration wird verzichtet, wenn es sich um Eigennamen oder eingedeutschte Worte, wie zum Beispiel »Nirwana«, handelt.
1 Es werden mal im freien Wechsel weibliche und männliche Formen verwendet, mal beide Formen genannt.
2https://jacobin.de/artikel/mindfulness-achtsamkeit-meditation-apps-headspace-netflix/ (Zugriff am 05.11.2021).
3 Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen; Amt der Vereinten Nationen (UN), das mit dem Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen beauftragt ist.
2 Achtsamkeiten
»Achtsamkeit« ist kein eindeutiger Begriff, obwohl oder besser: weil Psychologinnen, buddhistische Mönche, Lehrer, Bürochefinnen, Offiziere und viele andere »Achtsamkeit« bedeutungsvoll finden. Doch war das Wort zunächst als Terminus technicus für eine bestimmte buddhistische Meditationspraxis ein Insider-Vokabel und bis in die 1970er Jahre selbst in buddhistischen Zirkeln meist nur den wenigen bekannt, die sich intensiver mit Meditationspraktiken befassten. Mit Thich Nhat Hanhs Buch »The Miracle of Mindfulness«, erschienen erstmals 1976, seither immer wieder neu aufgelegt und in viele Sprachen, darunter auch ins Spanische, Chinesische und auf Hindi übersetzt, wird »achtsam« bzw. »mindful« einem breiten Publikum bekannt.4
2.1 Ellen Langer
Eine der Ersten, die sich bereits Ende der 1970er Jahre außerhalb kleiner buddhistischer Zirkel mit dem Thema Achtsamkeit befasste, war die Soziologin Ellen Langer, die »mother of mindfulness«5, wie sie genannt wird. Ihr Interesse galt dem Zusammenhang von Geist bzw. Bewusstsein und Körper. In ihrem berühmtesten, wenngleich nicht unumstrittenen Experiment »Counterclockwise« aus dem Jahr 1979 (Alexander u. Langer, 1990) versetzte sie eine Gruppe achtzigjähriger Männer an einem abgeschiedenen Ort eine Woche lang in die Welt ihrer Jugend – mit Filmen, Musik, der Einrichtung des Hauses usw. Das Ergebnis war überraschend: Bei den nachfolgenden kognitiven und körperlichen Tests zeigten sich deutliche Verbesserungen, und einer der Männer, der bisher am Stock gegangen war, konnte wieder ohne Stock gehen (Feinberg, 2010).
Für eine andere Studie, die Langer gegen Ende der 1970er Jahre zusammen mit Kollegen vom Graduate Center der City University of New York durchführte, fragten die Autoren der Studie Menschen, die sich vor einem Kopiergerät angestellt hatten, ob sie sich vordrängen dürften. Ihre Begründungen waren beliebig und zum Teil sinnlos, zum Beispiel: »Darf ich das Kopiergerät benutzen, weil ich in Eile bin?« oder »Darf ich das Kopiergerät benutzen, weil ich Kopien machen will?« Das Ergebnis: Die Probanden, also die Wartenden vor dem Kopiergerät, waren eher bereit, jemanden vorzulassen, wenn die Person einen Grund angab – ob der Grund vernünftig oder eher lächerlich war, spielte keine Rolle. Langers Schlussfolgerung: Die Leute reagierten mehr auf den vertrauten Rahmen einer Anfrage als auf den eigentlichen Inhalt. Sie reagierten achtlos oder, genauer gesagt, im Autopilot-Modus, automatisch. Doch gab es natürlich Grenzen auch für den Autopilot-Modus, wenn die Begründung zu absurd war (»weil ein Elefant hinter mir her ist«).
Wer unachtsam ist, verlässt sich zu sehr auf »categories and distinctions made in the past, […] automatic behaviour and acting from a single perspective« (Langer, 1989/2015, S. 11 f.). Wiederholungen, voreilige kognitive Festlegungen, Annahme von beschränkten Ressourcen, die Vorstellung einer linearen Zeit und Ergebnisorientierung (S. 42 f.) gehören zu den Fallen der Unachtsamkeit. Schlüsselqualitäten eines achtsamen Zustands sind Offenheit für die Situation, Kontext- und Prozessorientierung, »creation of new categories«, »openness to new information«, »awareness to more than one perspective« (S. 65).
Für Ellen Langer bedeutet Achtsamkeit vorrangig eine sozialkognitive Kompetenz, deren Gegenteil der Modus Autopilot ist. Dieser ursprünglich aus der Schifffahrt und Aviation stammende Begriff taucht mittlerweile nicht nur bei Langer, sondern auch in vielen anderen Veröffentlichungen zu Achtsamkeit auf. Aus technischer Sicht bedeutet Autopilot: reagieren auf Veränderungen einer Situation auf Basis eines schon vorgegebenen Programms. Menschen handeln »im Autopilot«, wenn sie gewohnte Verhaltensweisen weiterverfolgen, auch wenn diese der Situation nicht angemessen sind. Dahinter können sich verschiedene psychische Konstellationen verbergen, Traumata etwa, aber auch ganz einfach mangelnde Präsenz, mangelnde Achtsamkeit.
2.2 Achtsamkeitspraktiken
Die meisten heute kursierenden Auffassungen von Achtsamkeit beziehen sich auf MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. In den 1980er Jahren führte der studierte Molekularbiologe Jon Kabat-Zinn an der University of Massachusetts Medical School mit Schmerzpatienten Achtsamkeitsübungen durch und entwickelte daraus ein Curriculum, das er 1990 in dem Buch »Full Catastrophe Living. How to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness Meditation« veröffentlichte. MBSR ist ein Hybrid aus Neuropsychologie und buddhistischer Meditation, wobei jedoch die buddhistische Perspektive in den Hintergrund tritt. Achtsamkeit ist nach Kabat-Zinn »the awareness that emerges through paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally for the unfolding of experience« (Kabat-Zinn, 2003, S. 145).
Die neurowissenschaftliche Forschung interessiert sich seit etwa zwanzig Jahren für Meditation (Ott, 2010) und im Besonderen für »Achtsamkeit«, doch bleibt der Begriff vieldeutig. Achtsamkeit im Forschungskontext kann bedeuten: psychischer Prozess, Ergebnis eines Übungsprozesses oder Ensemble bestimmter Methoden (Goleman u. Davidson, 2017). Die Unbestimmtheit nimmt zu, sobald nach der Motivation für Achtsamkeitsübungen gefragt wird. Achtsamkeit kann zum Beispiel aus einer buddhistischen oder spirituellen Motivation geübt werden, als Unterstützung oder Methode in der Psychotherapie oder als Tool, das nützlich für Management, Pädagogik oder Militär ist, usw. Mit anderen Worten, Achtsamkeit scheint eine Art Chamäleon zu sein, anpassbar an unterschiedlichste Kontexte und von unterschiedlichsten Personen nutzbar.
Manche – wie etwa Jon Kabat-Zinn – hoffen, dass Achtsamkeit »uns selbst und die Welt heilen« kann (Kabat-Zinn, 2005) und zu einer sozialen Bewegung führt, die gesellschaftlich revolutionäres Potenzial besitzt (Wilson, 2014). Die Vorstellung einer »Achtsamkeitsrevolution« (Boyce, 2011) wird gern von Achtsamkeitslehrenden unterstützt: Wenn genügend Menschen Achtsamkeit übten, könnte die Gesellschaft von Materialismus, Egoismus, Ausbeutung der Natur, Konkurrenzdenken, Zwängen und Frustrationen geheilt werden (z. B. Kotsou u. Lesire, 2018).
Bei genauerem Hinsehen sind aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Achtsamkeitsakteurinnen und -akteursgruppen zu groß, um von einer sozialen oder gar revolutionären Bewegung sprechen zu können (Schmidt, 2020). Kriterien für eine soziale Bewegung (Della Porta u. Diani, 2011, S. 20 ff.) wären unter anderem eine einheitliche kollektive Identität bzw. eine einheitliche Gegnerschaft. Im Fall der »Achtsamkeitsbewegung« lässt sich nicht einmal für das Konzept »Achtsamkeit« eine einheitliche Bestimmung festhalten. Zwar gibt es Gegnerschaft, doch kommen die Gegner aus verschiedenen Lagern. In den USA möchten konservative und christlich-fundamentalistische Kreise verhindern, dass Yoga und Achtsamkeitspraktiken in öffentlichen Schulen implementiert werden (Brown, 2019). Dies widerspreche der Trennung von Kirche und Staat, da Yoga und Achtsamkeit religiöse Praktiken seien. Buddhistische, aber auch gesellschaftskritische Kreise kritisieren, dass es sich um eine spätkapitalistische Selbstoptimierungspraxis (zuletzt Purser, 2019) oder gar eine Verstärkung der neoliberalen Ideologie und Flucht vor sozialer Verantwortung (Žižek, 2006; Arthingthon, 2016) handle.
Schmidt (2020) schlägt daher vor, von Achtsamkeit nicht als Bewegung, sondern als kultureller Praxis zu sprechen. Unter »kultureller Praxis« werden hier nach Reckwitz (2008) meditative Übungspraktiken verstanden, die einander ähnlich sind, aber die in unterschiedlichen Kontexten lokalisiert und mit jeweils unterschiedlichem impliziten Hintergrundwissen und impliziten Motivationen. Gemeinsam ist allen Praktiken, so verschieden sie sind, die körperliche Performanz, dass also der Körper der Ort der Übung ist und dass die Übung darauf abzielt, im Alltag – außerhalb des Übungskontextes – angewendet zu werden (siehe Kapitel 2.3)
2.3 Drei Beispiele für Achtsamkeitsübungen
Dies soll anhand dreier Beispiele verdeutlicht werden. Bei dem Retreat nach Goenka bildet eine bestimmte Interpretation des Theravada-Buddhismus das implizite Hintergrundwissen, das Retreat nach Thich Nhat Hanh ist in den Mahayana-Buddhismus, genauer den vietnamesischen Thiền-Buddhismus6, eingebettet, und die Achtsamkeitspraxis MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction nach Kabat-Zinn in der Klinik oder auch im Arbeitsalltag der Industriegesellschaft lokalisiert.
2.3.1 Retreat nach S. N. Goenka
Eine der weltweit verbreiteten Achtsamkeitspraktiken folgt den Vorgaben von S. N. Goenka (1924–2013). An rund 300 Orten kann man an Zehn-Tage-Retreats nach Goenka teilnehmen, wobei rund 170 dieser Zentren ausschließlich Goenka-Retreats anbieten. Männer und Frauen üben strikt getrennt, und es herrscht durchgehend Schweigen. Die Übungszeit beginnt um 4.30 Uhr und endet um 22 Uhr, wobei etwa zehn Stunden mit formeller Meditationspraxis verbracht werden. Vor dem Kurs müssen die Teilnehmenden einen Fragebogen ausfüllen und sich mit den Regeln vertraut machen, wie eine Kursteilnehmerin im Internet schildert: »Jede Form der Kommunikation zwischen den Kursteilnehmerinnen – einschließlich Körpersprache, Augenkontakt und schriftliche Nachrichten – sowie jeglicher Kontakt zur ›Außenwelt‹ ist bis zum 10. Tag des Kurses verboten. Außerdem sollen wir auf jede Form der sinnlichen oder intellektuellen Unterhaltung verzichten, also etwa lesen, Musik hören, schreiben oder – natürlich – im Internet surfen. Damit uns diese schwierige Aufgabe leichter fällt, übergeben wir alle Bücher, Schreibmaterialien, Handys, Notebooks sowie etwaige andere elektronische Geräte den Koordinatoren. Die Freiwilligen verstauen die potentiellen Ablenkungs- und Zerstreuungs-Werkzeuge an einem uns unbekannten Ort.«7
Sport und Yoga sind in den Pausen nicht erwünscht; alle nicht lebensnotwendigen Medikamente sollen abgesetzt werden. Die letzte Mahlzeit gibt es um 12 Uhr, abends versammeln sich alle zu einem eineinhalbstündigen Video- oder Audio-Vortrag von S. N. Goenka. Assistenzlehrer und -lehrerinnen stehen für technische und andere Unterstützung bereit, etwa auch für Gespräche. Nach eigenem Anspruch lehrt Goenka das, was Buddha Shakyamuni ursprünglich lehrte – nicht Buddhismus, sondern »die Kunst des Lebens«.
Die Hauptübung besteht im sogenannten »Body Sweeping«. Eine Teilnehmerin beschreibt: »Bei der Technik scannt man den eigenen Körper von oben nach unten. Man beobachtet Stück für Stück die Empfindungen in jedem einzelnen Körperteil. Ist man dann einmal damit durch, beginnt man wieder von vorn. Spürt in jeden kleinsten Teil des Körpers hinein und schaut, was für Empfindungen auftauchen.«8 Der Sinn der Übung sei, zu erkennen, dass alles vergänglich ist, es nichts Beständiges gibt, sich alles im Wandel befindet.
Nach Abschluss des zehntägigen Kurses soll man sich verpflichten, täglich zwei Stunden zu üben. Möchte man weiterführende Kurse im Stil Goenkas besuchen, so darf man in der Zwischenzeit nicht an Kursen oder Retreats anderer Lehrer und Lehrerinnen teilnehmen.
2.3.2 Retreat in Plum Village nach Thich Nhat Hanh
Eine ebenfalls international verbreitete Achtsamkeitspraxis basiert auf den Lehren des vietnamesischen Mönchs und Zen-(Thiền-) Lehrers Thich Nhat Hanh. Ausgehend von dem 1982 gegründeten Zentrum Plum Village in Südfrankreich gibt es heute weltweit 1500 Gruppen und acht Praxiszentren in der Tradition von Plum Village. In Plum Village selbst leben dauerhaft rund einhundert Mönche und Nonnen. Tausende Menschen kommen im Laufe des Jahres, um eine Woche oder länger mit den Nonnen und Mönchen zu leben oder an dem vierwöchigen Retreat im Sommer teilzunehmen, bei dem es eigene Programme für Kinder und Jugendliche gibt. Ein neunzigtägiges Retreat steht Mönchen und Laien offen.
Die Übungsformen folgen der vietnamesischen Zen-Tradition9 und umfassen unter anderem Gehmeditation und Meditation im Sitzen sowie Arbeit in Küche und Garten. Zeremonien und Rituale, aber auch innovative Formen wie gemeinsames Musizieren oder die »Glocke der Achtsamkeit« unterstützen die Übung. Wenn die »Glocke der Achtsamkeit« erklingt, halten alle inne, egal was sie gerade tun, und achten auf den Atem. Ein junger, neu angekommener Teilnehmer berichtet von seinem ersten Eindruck beim Erklingen der Glocke: »Es sieht so aus, als ob man bei einem Video die Pausentaste drückt. ›Was ist denn jetzt schon wieder los?!‹, denkt mein Kopf genervt. Die Glocke der Achtsamkeit […]. Der Gong verklingt. Das Leben geht weiter«10.
Der Tagesablauf beginnt um 5.15 Uhr und endet um 21.30 Uhr. Achtsamkeit wird in allen Aktivitäten gelebt: Sitzmeditation und Gehmeditation, Arbeit, Dharma-Vorträge und Gespräche, gemeinsames Teetrinken, aber auch sportliche Betätigung füllen den Tag. Männer und Frauen wohnen getrennt, aber verbringen den Tag gemeinsam. Langzeitpaare können zusammenwohnen. Gemeinschaft wird großgeschrieben im Kloster – jede und jeder sucht sich eine »Dharma sharing family«, die auch gewechselt werden kann, als Basis für gemeinsames Üben und gemeinsame Aktivitäten. Bei den drei täglichen Mahlzeiten gibt es veganes Essen; Alkohol, Nikotin und Fleisch sind verboten.
Durch Achtsamkeit könne man tief erkennen, dass alles miteinander verbunden und voneinander abhängig ist (interbeing), und dies im Alltag umsetzen. Wie man glücklich werden und bleiben kann – dies ist eine wichtige Frage in Plum Village, wie ein Besucher beobachtete. Nach zwei Wochen resümiert er: »Als ich ging, fühlte ich mich konzentrierter, achtsamer, friedlicher und mitfühlender als je zuvor in meinem Leben. Ich ging mit einem gesteigerten Bewusstsein für meine eigenen Gewohnheiten und Muster und somit mit der Kraft, diejenigen zu ändern, die nicht zu mir passten. Ich ging auch mit einer neuen Art der Beziehung zu mir selbst, zu anderen um mich herum und zur Welt im Allgemeinen.«11 Nun verstehe er, warum viele immer wieder nach Plum Village zurückkommen: weil dauerhafte Veränderung nur durch Übung zu erreichen ist.
2.3.3 MBSR: Achtsamkeit nach Jon Kabat-Zinn
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction/Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion) ist ein Acht-Wochen-Curriculum, ein Lehrplan, der aus der Erfahrung von Jon Kabat-Zinn und dem Team des Center for Mindfulness an der Universitätsklinik von Massachusetts erwachsen ist. MBSR-Kurse werden heute weltweit in vielen größeren Städten angeboten, nicht nur in Europa oder Nordamerika; ebenso gibt es Online-Angebote. Global dürfte es mehrere tausend Lehrer und Lehrerinnen geben, grob geschätzt mindestens zweihundert Zentren, zudem zahlreiche Anwendungen in klinischen Kontexten und universitäre Einrichtungen, die MBSR lehren und beforschen. MBSR versteht sich als nicht-religiöse Praxis und hat das Bild von Achtsamkeit in den Industriestaaten des Nordens wesentlich geprägt.
Ein typischer MBSR-Kurs findet durch acht Wochen hindurch jeweils einmal in der Woche statt (zweieinhalb bis drei Stunden). Nach dem fünften Kursabend ist ein ganzer Tag im Schweigen mit Übungen vorgesehen. Während der acht Wochen sollten täglich zu Hause etwa 45 Minuten mit Übungen verbracht werden. Vor dem Kurs führen die Leitenden erste Gespräche mit den Teilnehmenden, um herauszufinden, was deren Anliegen und Probleme sind. Ein MBSR-Kurs erfolgt in Selbstverantwortung, und die Kursleiterin muss versuchen, den Bedürfnissen der Teilnehmenden Rechnung zu tragen, soweit dies möglich ist.
Die Acht-Wochen-Kurse sollen das Potenzial zur Selbstheilung aktivieren, den Blick auf die Situation verändern, eine Erleichterung des Lebensgefühls bringen und eine befreiende Perspektive auf Gutes im Leben eröffnen.
Am ersten Abend erforschen die Teilnehmenden an einer Rosine, was achtsame Wahrnehmung sein kann – eine Art »signature-exercise« für MBSR. Die vielfältigen Aspekte einer Rosine werden mit allen Sinnen ausprobiert – etwa wirkt die Oberfläche uneben, wenn man sie mit den Fingern berührt, aber gebirgig, berührt man sie mit den Lippen. Achtsamkeit, so wird von Anfang an deutlich, ist eine Übung der Sinne und der Öffnung neuer Räume der Erfahrung. Mit dem Bodyscan wird geübt, im Liegen den Körper wahrzunehmen, wie er vom Atem bewegt wird, und dann achtsam wahrnehmend vom linken großen Zeh bis zum Scheitel den Körper durchzuwandern. Für viele ist dies wie ein Ankommen in einem neuen Bereich, einer Dimension der Stille und Entspannung, und eine deutliche Unterbrechung der üblichen Wahrnehmungs- und Lebensgewohnheiten.
Das sogenannte »Dreieck der Achtsamkeit« – Gedanken, Körperempfindungen und Emotionen als drei Aspekte allen Erlebens – unterstützt bei formeller Übung von Atemachtsamkeit im Sitzen, aber auch in alltäglichen Situationen. Yogaübungen, achtsam ausgeführt, kommen als weitere Übungsform dazu. Allmählich stellen sich neue Erfahrungen ein – etwa genaueres Wahrnehmen von Impulsen aller Art, tieferer Genuss beim Essen oder ganz allgemein im Alltag.
Ein weiterer wichtiger Lernschritt betrifft den Einfluss, den mentale Prozesse auf körperliche Prozesse haben und umgekehrt, wobei die Achtsamkeitspraxis einen besseren Umgang mit den eigenen Emotionen, Gedanken und Stimmungen vermitteln kann.
In themenzentrierten Klein- und Großgruppengesprächen werden diese Aspekte ebenso wie der achtsame Umgang mit Stresssituationen erforscht. Dazu gehört Psychoedukation zum Thema »Stress«. Wenn die zunächst hilfreiche Reaktion in Situationen mit unerwarteten, besonderen Anforderungen zu einer chronischen Aktivierung wird, kommt es zu Automatismen im Verhalten und zu einer krankheitsaffinen Veränderung des Gesamtsystems Mensch. Für Kabat-Zinn ist daher wichtig, von der »Stressreaktion« zur »Stressaktion« zu kommen, also nicht im Autopilot-Modus zu reagieren, sondern die Situation achtsam wahrzunehmen und entsprechend zu antworten. Ziel des MBSR-Curriculums ist eine dauerhafte Veränderung der persönlichen Haltung und des Verhaltens, sodass Achtsamkeit zu einer wahrhaft menschlichen, integeren Lebensform wird (Kabat-Zinn, 2005, S. 8–11).
2.4 Achtsamkeit: eine kulturelle Praxis