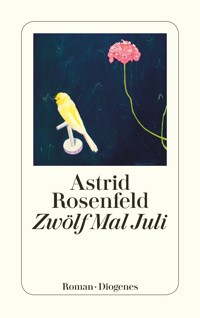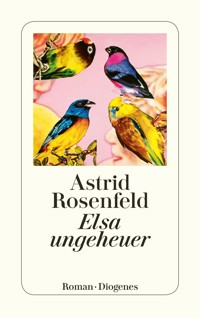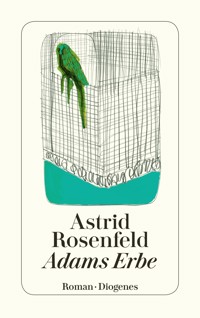
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adam Cohen ist 1938 achtzehn Jahre alt. Edward Cohen wird um das Jahr 2000 erwachsen. Zwei Generationen trennen sie – aber eine Geschichte vereint sie. Von der Macht der Familienbande und der Kraft von Wahlverwandtschaften erzählt dieser Roman und davon, dass es nur einer Begegnung bedarf, um unser Leben für immer zu verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Astrid Rosenfeld
Adams Erbe
Roman
Die Erstausgabe
erschien 2011 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration
von Monica Valdivia
Copyright © Monica Valdivia
Für
Maria Paola Rosenfeld,
Detlef Rosenfeld
und Dagmar Rosenfeld
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2015
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24221 8 (5. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60242 5
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] I
Edward
[7] Fängt man an zu schreiben, weil es jemanden gibt, dem man alles erzählen will?
Fängt man an zu erzählen, weil der Gedanke, dass alles einfach verschwinden soll, unerträglich ist?
Amy, dir möchte ich alles erzählen.
Du bist jetzt in England, und wie oft und ob ich deine Gedanken kreuze, weiß ich nicht. Aber ich kann dich nicht vergessen.
Hier auf diesen Seiten soll auch eine eisige Februarnacht vor dem Verschwinden gerettet werden.
Amy, du und ich, wir sind nur ein kleiner Teil des Ganzen. Denn eigentlich ist das hier Adams Geschichte, aber auf einem Dachboden haben sich meine und Adams Geschichte ineinander verschlungen.
Adam hat mir seine Augen, seinen Mund, seine Nase vererbt, und einen Stapel Papier, der seinen wahren Empfänger nicht erreicht hat.
Amy, manchmal glaube ich, dass ich erst dich treffen musste, um mein Erbe antreten zu können.
[8] Sie haben mir immer erzählt, dass mein Vater tot sei, dabei hat er meine Mutter einfach verlassen. Eigentlich kann man es nicht einmal verlassen nennen, denn sie waren nie richtig zusammen, sie kannten sich fast gar nicht. Genau genommen haben sie ein einziges Mal miteinander geschlafen. Und als meine Mutter feststellte, dass sie schwanger war, war mein Vater längst wieder in seiner Heimat.
Ich war acht Jahre alt, als eine von Mutters Freundinnen ihr einredete, dass es außerordentlich wichtig für meine psychologische Entwicklung sei, die Wahrheit über meinen Erzeuger zu erfahren. Je früher, desto besser.
Die Wahrheit war nicht viel. Mein Vater hieß Sören oder Gören und kam aus Schweden oder Dänemark oder Norwegen. An mehr konnte sich meine Mutter nicht erinnern. »Eddylein, dein Vater ist sicher ein ganz toller Mann, und an diesem Abend, als wir… als du… wie auch immer… Wir mochten uns sehr, sehr gerne.«
Die Variante mit dem toten Vater hatte mir immer mehr zugesagt als die mit dem tollen Sören oder Gören aus Skandinavien.
Obwohl ich meine Zeugung nicht der Liebe zweier Menschen, sondern der enthemmenden Wirkung zweier eiskalter Flaschen Wodka Gorbatschow zu verdanken habe, war [9] ich für meine Mutter ein Wunschkind. Seitdem sie vierzehn war, hatte sie nichts sehnlicher haben wollen als ein Baby. Sie hatte die dreißig schon überschritten, als das skandinavische Sperma ihr dazu verhalf. Im vierten Monat der Schwangerschaft – mein Vater hatte Berlin bereits verlassen – kündigte sie in der Buchhandlung und zog zurück in die Wohnung ihrer Eltern. Ihre Freundinnen empfanden Mitleid mit der armen Magda Cohen, die Karriere und Eigenständigkeit für den Bastard in ihrem Bauch aufgeben musste. Lange versuchten sie meine Mutter zu überreden, trotz Kind weiterzuarbeiten. Aber Magda Cohen war der Antichrist der Frauenbewegung. Und hätte sie nur jemand beizeiten geheiratet und geschwängert, dann wäre sie gar nicht erst auf die Idee gekommen, einen Beruf zu ergreifen.
An einem sonnigen Nachmittag im März presste Magda mich heraus und benannte mich nach einem der Protagonisten ihres Lieblingsromans von Jane Austen: Edward. An diesem Frühlingstag sah ich aus wie alle anderen Babys, aber mit jedem Jahr wuchs die Ähnlichkeit. Adams Augen, Adams Mund, Adams Nase.
Am liebsten spielte ich im Wohnzimmer vor dem Ofen. Er war weiß, mit Schnörkeln, und oben saßen drei fette Putten, die sich mild lächelnd an den Händen hielten. Neben dem Ofen stand eine Kiste voller Autos. Ich liebte meine Autos, ich hielt mich für einen Spezialisten und wollte später irgendwas mit Autos machen, wie wohl fast jeder sechsjährige Junge. Ich war wahrlich kein originelles Kind. Und als gerade der goldene Jaguar, das Juwel meiner Sammlung, den weißen Mustang rammte, hörte ich meinen Großvater [10] schluchzen. Er saß hinter mir auf dem Boden. Schon das verwirrte mich, denn normalerweise saß mein Opa Moses auf dem Sofa oder auf einem Stuhl, aber doch nicht auf dem Parkett. Und dann die Tränen in seinen Augen. Ich legte meine Arme um ihn, aber er drückte mich sanft weg und streichelte mir zitternd über den Kopf.
»Adam«, sagte er.
»Opa?«
Er stöhnte oder seufzte. »Vor vielen Jahren hat hier schon mal ein Junge gesessen, der sah aus wie du. Er hatte keine Autos, sondern Zinnsoldaten. Er hieß Adam und war mein kleiner Bruder.«
»Wo ist er?«
Moses antwortete nicht.
»Wo sind seine Soldaten?«
»Soldaten sterben früh.« Er wischte sich mit der Hand übers Gesicht. »Edward, lass uns zu dem einzigen Gott beten, dass du nur Adams Äußeres geerbt hast und nicht seinen Charakter.«
Opa betete ständig zu dem ›einzigen Gott‹, besuchte regelmäßig die Synagoge in der Pestalozzistraße und bestand auf koscherem Essen. Oma und Mama beteten fast nie, gingen nur selten in die Synagoge und aßen, worauf sie Lust hatten.
Wir hockten auf dem Boden. Opas hebräische Gebete klangen wie das Meckern einer Ziege. Er steigert sich da in irgendwas rein, dachte ich, als wieder Tränen über seine Wangen liefen. Endlich kam meine Mutter nach Hause und setzte der Szene ein Ende. »Papa? Was macht ihr da?«
»Wir beten, wegen Adam«, antwortete ich, weil Opa noch immer wie in Trance zu seinem einzigen Gott sprach.
[11] Meine Mutter seufzte, nahm Opa am Arm und zog ihn hoch. »Papa, komm.«
Er ließ sich bereitwillig abführen.
Der Mustang überschlug sich. Ich warf ihn zurück in die Kiste und zog einen Land Rover heraus, der jetzt den goldenen Jaguar herausfordern sollte. Natürlich hatte er keine Chance, denn ich würde den Jaguar niemals verlieren lassen.
Die Sache mit Adam hätte ich wahrscheinlich sofort vergessen, aber an diesem Abend aß mein Opa nicht mit uns. Er blieb in der Bibliothek, so nannten wir den Dachboden, der zu unserer Wohnung gehörte. Es war keine richtige Bibliothek. Zwar gab es ein Regal mit Büchern, aber eigentlich nutzten wir den riesigen Raum, den man über eine Wendeltreppe erreichte, als Abstellkammer. Alte Koffer, ausrangierte Möbel, von denen man sich aus sentimentalen Gründen nicht trennen wollte, Kartons mit Fotos, Kleider, meine Wiege. Kram halt.
Moses Cohen, mein Opa, verbrachte viel Zeit in der Bibliothek. Wegen der Stille, sagte er. Ich durfte nur selten nach oben. Wegen des Staubs, sagte meine Oma, Lara Cohen.
Wir saßen also zu dritt am Küchentisch, und Oma reckte ihren Hals. Sie hatte einen langen Schwanenhals, auf den sie sehr stolz war. »Was hat Moses denn?«, fragte sie meine Mutter.
»Adam«, lautete die schlichte Antwort.
Omas Hals drehte sich in meine Richtung. »Ich habe immer gehofft, dass es sich verwächst, tja…«
»Er wird schon darüber hinwegkommen«, sagte meine Mutter.
[12] Lara Cohen lachte einmal laut auf. Ihr Lachen war immer genau auf den Punkt gesetzt, kurz und knapp. Es kam nicht aus dem Bauch oder aus dem Herzen, es war wie das Ausrufezeichen auf einer Tastatur. Gedrückt und weg.
»Magda-Liebling, dein Vater denkt mehr über die Toten nach als über die Lebenden, wenn du verstehst, was ich meine.« Bitterkeit vibrierte in ihrer Stimme.
»Ist Adam tot?«, wollte ich wissen.
»Hoffen wir es.« Wieder ihr Lachen.
»Mama, sag so was doch nicht vor Eddylein.«
»Ist er tot?«, hakte ich nach.
»Sagen wir es so, Edward, er hätte den Tod verdient. Er war ein schlechter Mensch, er hat…«
»Mama, hör bitte auf.«
»Hat er was kaputtgemacht?«
»O ja, seine Großmutter und seine Mutter.«
»Mama.« Meine Mutter knallte die Faust auf den Tisch, so etwas machte sie sonst nie.
»Magda-Liebling, das ist kein Grund, die Möbel zu zertrümmern.«
Meine Mutter stand auf und räumte die Teller ab, obwohl wir noch nicht aufgegessen hatten. Ich hatte Blut geleckt, jemand, der seine Mutter und seine Großmutter kaputtgemacht hatte, das hörte man nicht alle Tage.
Oma zog ihren Mantel an und verabschiedete sich, sie ging ins Konzert oder ins Theater. Manchmal begleiteten Mama und ich sie, aber Opa kam nie mit. Er verließ die Wohnung sowieso nur selten.
Ich lag in dieser Nacht wach. Ich hörte, wie meine Großmutter zurückkam, dann war es still. Nur oben knarrten die [13] Dielen. Auf diesen Moment hatte ich gewartet. Ich schlich mich aus meinem Zimmer, die Wendeltreppe hinauf, und öffnete die Tür. Moses saß auf einem alten Sessel, ein aufgeklapptes Buch lag in seinem Schoß, aber er las nicht, er starrte einfach nur vor sich hin. Ich stellte mich neben ihn, fuhr mit meinen Händen über die Lehne und zerrte an dem Sessel, um auf mich aufmerksam zu machen. Opa lächelte traurig. »Solltest du nicht schlafen, Eddy?«
»Ich kann nicht.«
»Das verstehe ich, ich kann auch oft nicht schlafen.«
Und ehe sein Blick wieder erstarrte, bevor er meine Anwesenheit vergessen konnte, zog ich an seinem Ärmel. »Opa, erzähl mir von Adam.«
Es dauerte lange, bis er anfing zu sprechen. Er erzählte von Hitler und dem Krieg, und dass man als Jude besonders schlechte Karten hatte, und dass die ganze Familie auswandern wollte. Sie brauchten Papiere, die sehr teuer waren. Und kurz vor dem Tag der Abreise verschwand Adam mit dem gesamten Familienvermögen. Die Papiere hatten sie zwar, aber ansonsten fast nichts. Die Großmutter und die Mutter von Moses und Adam blieben in Berlin, wollten nicht mit nach England. »Ich glaube, sie haben auf Adams Rückkehr gewartet. Aber er kam nicht zurück.«
»Oma hat gesagt, er hat sie kaputtgemacht. Wie hat er das gemacht, wenn er gar nicht da war?«
»Man kann eine ganze Menge kaputtmachen, indem man bestimmte Dinge nicht tut.«
»Also hat er es nicht getan?«
»Nicht direkt.«
An diesem Punkt begann mich das Ganze zu langweilen, [14] und ich ließ meinen Opa allein auf dem Dachboden zurück.
Zu Lara Cohens Ärgernis hatte Magda weder ihren scharfen Verstand noch ihren Schwanenhals geerbt. Laut meiner Großmutter hatte Mama einen schwachen Willen und war viel zu sentimental. Und während Oma, obwohl sie nicht mehr die Jüngste war, ein Dutzend ehrenamtliche Dienste verrichtete und ein beachtliches kulturelles Interesse an den Tag legte, hatte Magda Cohen kein einziges Hobby und nicht das geringste Verständnis für Kunst. Mozart, Elvis oder Roland Kaiser, Schundromane, Goethe oder Thomas Mann, sie unterteilte alles in zwei simple Kategorien: gefällt mir oder gefällt mir nicht. Nobelpreisträger hin oder her. Sie konnte nicht einmal billigen Sekt von Champagner unterscheiden. Aber wenn ihr etwas gefiel, dann kannte ihre Verehrung keine Grenzen. Wenn sie etwas mochte, dann von ganzem Herzen. Meine Mutter konnte lieben.
Magda hatte viele Freundinnen. Sie alle hielten meine Mutter für einfältig, trotzdem kamen sie ständig zu Besuch und schütteten ihr in unserem Wohnzimmer ihr Herz aus, denn Magda hatte Zeit und war eine gute Zuhörerin. Ich glaube, sie alle haben meine Mutter unterschätzt.
Der erste Mann, den sie mir vorstellte, war Hannes aus dem Wedding. Er war zumindest der erste, an den ich mich erinnern kann. Hannes war Metzger und sechs Jahre jünger als meine Mutter, die hart auf die vierzig zuging. Aber Mama hatte noch immer etwas Mädchenhaftes, etwas Unschuldiges, das sie nie ganz verlieren sollte.
Hannes saß in unserem Wohnzimmer und lächelte ebenso [15] dümmlich wie die Steinengel auf dem Ofen. Egal was gesagt wurde, er zog ständig seine Augenbrauen hoch und staunte. Alles schien ihn zu überraschen.
»Hannes, möchten Sie noch eine Tasse Kaffee?« Und Hannes war baff.
»Ein Fleischer, wie reizend, Magda«, sagte meine Oma, nachdem Hannes die Wohnung verlassen hatte.
Mama überging die spitzen Kommentare ihrer Mutter, oder sie spürte diese Spitzen schon gar nicht mehr. Mein Opa äußerte sich überhaupt nicht, sondern verzog sich auf den Dachboden.
»Eddylein, mochtest du denn den Hannes?«, fragte Mama mit so hoffnungsvoller Stimme, dass ich nicht anders konnte, als mit »Ja« zu antworten, obwohl ich zu dem bärtigen Metzger keine Meinung hatte.
Hannes lud meine Mutter und mich am nächsten Abend zum Essen ein, und da offenbarte sich das Grundproblem dieser noch so frischen Beziehung. Uns allen dreien ging die Gabe des Plauderns vollkommen ab. Meine Mutter war eine trainierte Zuhörerin, ich ein Kind, und alles, worüber Hannes sprechen konnte, war Fleisch. Aber er hielt sich mit diesem Thema in Mamas Anwesenheit, »in der Gegenwart einer Dame«, wie er sagte, zurück. Nachdem er ein paar Sätze über die Herstellung von Blutwurst zum Besten gegeben hatte, herrschte Schweigen an unserem Tisch. Ich fühlte mich zumindest teilweise für den Abend verantwortlich, weil ich auf Pizza bestanden hatte und wir deshalb beim Italiener saßen, der eigentlich ein Grieche war. Vielleicht wäre in einem Steakhaus alles einfacher gewesen. Vielleicht hätte so ein gegrilltes Stück Rind Hannes dazu animiert, doch [16] noch ein bisschen übers Schlachten zu erzählen. Und dann fragte ich ihn: »Hast du schon mal auf ein Tier geschossen?« Einfach, um diese anstrengende Stille zu durchbrechen.
»Ja.«
»Auch auf einen Hirsch?« Ich dachte an Bambis Vater.
»O ja, einen riesigen sogar.«
»Hast du ihn gegessen?«
»Ja, das habe ich.« Er lachte, und sein Bauch wackelte.
»Ich mag Hirsch nicht, der schmeckt nach altem Schwamm.«
Nun war Hannes in seinem Element und erklärte uns, was es mit dem muffigen Geschmack von Wild auf sich hatte. Das hing mit der Geschlechtsreife zusammen und mit noch irgendetwas, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern, da hörte ich schon nicht mehr zu. Ich malte mit den Wachsstiften, die mir der italienische Grieche samt Block auf den Tisch gelegt hatte.
Sie haben sich nach diesem Abend nur noch zweimal getroffen. Es war Hannes, der meine Mutter verließ. So wie alle Männer sie irgendwann verlassen hatten. Sie war immer bereit, den Kelch bis zur Neige zu trinken, egal wie bitter oder fad es schmeckte.
Ich war acht und wusste bereits die Wahrheit über meinen skandinavischen Erzeuger, als der nächste Mann auftauchte. Das war die Zeit, in der es mit Opa wirklich bergab ging. Er verließ den Dachboden fast gar nicht mehr. Er schlief sogar da oben. Je verwirrter und elender Moses wurde, desto strenger schien meine Oma zu werden, die ohnehin schon immer ein harter Brocken war. Einmal, als er die [17] Wendeltreppe mit mühevollen Schritten herunterkam, hörte ich sie sagen: »Wasch dich, du riechst unangenehm. Und reiß dich zusammen, Moses.«
Er antwortete nicht, er sah sie einfach nur an, so traurig, dass einem schwindelig wurde. Er drehte sich um und ging wieder nach oben.
Oma erlaubte mir nicht, ihn in der Bibliothek zu besuchen. »Edward, du bist alt genug, um zu verstehen, dass dein Anblick ihn zu sehr aufregt. Wenn er dich sehen möchte, kann er ja runterkommen. Nicht wahr?«
Aber manchmal, wenn Lara Cohen nicht zu Hause war, widersetzte ich mich ihrem Verbot. Opa saß meistens auf dem alten Sessel, oder er stand am Fenster. Wenn ich klopfte, den Kopf durch die Tür streckte und um Einlass bat, dann lächelte er.
»Hier oben hat früher deine Ururgroßmutter gewohnt, meine Oma.«
Wenige Jahre nach Kriegsende waren meine Großeltern mit ihrer kleinen Tochter Magda nach Berlin zurückgekehrt. Es gab zwar noch keine Mauer, doch man hatte die Stadt schon aufgeteilt. Das Haus, das sämtlichen Bombenangriffen standgehalten hatte, befand sich im amerikanischen Sektor. Nach langem Hin und Her wurde Moses wieder rechtmäßiger Eigentümer der Familienwohnung. Lara wäre lieber wie ihre Schwester in England geblieben, aber Opa sehnte sich nach seiner alten Heimat. Nach seinem Zuhause.
»Deine Ururgroßmutter war eine stolze Frau. Und am allerliebsten mochte sie Adam.« Opa tätschelte meinen Kopf, und ich, Edward, verschwand hinter der Vergangenheit.
[18] Die Zuneigung, die eben noch in Opas Augen geleuchtet hatte, verwandelte sich in Zorn. Er sah mich nicht mehr, sondern Adam, den geliebten, den gehassten Bruder. Ich hörte unten die Schritte meiner Großmutter und machte mich davon. Erleichtert.
Die Sache mit Adam begann mich zu nerven. Die Gene von Sören oder Gören hatten total versagt. Das skandinavische Erbgut hatte vor Adam auf ganzer Linie kapituliert.
Noch bevor Mamas Neuer auftauchte, bekamen wir Kabelfernsehen und ein Klavier. Oma meinte, es sei langsam an der Zeit, dass ihr Enkel ein Instrument erlerne. Doch es war Mama, die täglich auf den Tasten klimperte. »Ach, es wäre schön, wenn man es wirklich könnte«, sagte sie. Aber Magda Cohen wäre niemals auf den Gedanken gekommen, dass das im Bereich des Machbaren lag. Für alle anderen ja, aber nicht für sie.
Mich reizte das Klavier überhaupt nicht. Auf Omas Befehl marschierte ich jedoch zweimal die Woche tapfer zu Frau Nöff, meiner Klavierlehrerin. Sie hatte lange schwarze, von grauen Fäden durchzogene Haare, die traurig auf ihre Schultern hinabfielen. Sie sah alt aus, obwohl sie jünger war als meine Mutter. Frau Nöff hatte einen Schnurrbart, der mich total irritierte, und sosehr ich es auch zu vermeiden versuchte, ich musste ständig hinstarren. Sie war die einzige Frau mit Bart, der ich jemals begegnet war.
Die erste Klavierstunde beendete sie mit den Worten: »Nichts Musikalisches, Eduard. Kein Gehör. Kein Gefühl.«
Ich nickte und drückte ihr die 23 Mark in die Hand. Am Anfang machte ich sie noch darauf aufmerksam, dass ich Edward und nicht Eduard hieß, später gab ich es einfach auf.
[19] In der Nöff-Wohnung, zwei Zimmer, Altbau, roch es nach verlorenen Träumen, und ich meine das wörtlich. Sie riechen. Unverwechselbar.
Die Nöff unterlag starken Stimmungsschwankungen. Manchmal, wenn sie gut drauf war, kochte sie einen Tee, der nach Pisse schmeckte. Mit Rum für sie. Ohne für mich. Dann erzählte sie von ihrer Zeit in Wien am Konservatorium. Und wenn der Rum zu wirken begann, kramte sie einen alten Zeitungsartikel hervor mit dem Titel Christina Nöff. Ein neues Wunderkind?. Was da stand, interessierte mich nicht. Aber ich betrachtete jedes Mal das schlecht gedruckte Schwarzweißfoto, um herauszufinden, ob sie auch schon mit fünfzehn einen Schnurrbart getragen hatte. Nach einem zweiten Tässchen Rum ohne Tee war ihr Redefluss nicht mehr aufzuhalten, Chopin hier, Chopin da.
»Und einmal, da hat so ein neureicher Schuhmacher…« Sie dachte nach. »Wie hieß er denn noch gleich?« Sie stöhnte, empört über ihr eigenes schlechtes Gedächtnis. »Egal, jedenfalls, dieser Schuhmacher hat Chopin aufgefordert, sich ans Klavier zu setzen, und sagte: ›Sie brauchen ja gar nicht lange zu spielen, mein Lieber. Nur so ein bisschen La-la-la, damit man sieht, wie’s gemacht wird.‹
Kurze Zeit später lud Chopin diesen Schuhmacher zu einem Diner ein und überreichte ihm nach dem Essen einen Hammer, Nägel, Sohlenleder und einen alten Schuh und meinte:
›Bitte, lieber Meister, wollen Sie uns nicht eine Probe Ihres Könnens geben? Sie brauchen ja nicht den ganzen Schuh zu besohlen. So ein bisschen Bum-bum-bum genügt. Nur damit man sieht, wie’s gemacht wird.‹« Die Nöff lächelte. [20] Und die Art, wie sie lächelte, ließ mich glauben, sie wäre bei diesem Diner dabei gewesen. »Also, typisch Chopin«, sagte sie und wiegte den Kopf. »Typisch für ihn.«
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass Chopin ein längst verstorbener Komponist war und nicht der beste Freund meiner Klavierlehrerin.
Wenn die Nöff schlecht drauf war, dann redete sie überhaupt nicht, sondern lauschte meinem kläglichen Geklimper. Stumm ließ sie mich spüren, dass sie mich zutiefst verachtete und mir gerne die Finger abhacken würde, alle zehn.
Ich machte keine großartigen Fortschritte, aber immerhin konnte ich meiner Mutter nach drei Monaten Unterricht einen Walzer beibringen. Im Gegensatz zu der Nöff war Mama tief beeindruckt von meinen Fähigkeiten.
»Eddylein, hör noch mal zu.« Vor Aufregung zitternd haute sie in die Tasten. »War das so richtig?«
»Mmmh, ja, nicht schlecht«, antwortete ich kritisch. Die Wahrheit war, dass sie besser spielte als ich, aber das hätte sie mir ohnehin nicht geglaubt. Da hätte Mama gedacht, ich würde mich über sie lustig machen.
Den Nachfolger von Hannes brachte meine Oma ins Haus: Herrn Professor Doktor Strombrand-Rosselang. Seinen Vornamen kenne ich nicht, kannte ich nie, denn obwohl Mamas Liaison mit diesem Herrn einige Monate dauerte, blieb es beim ›Sie‹. Für Mama und für mich.
»Heute Nachmittag kommt Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang zum Kaffee«, sagte Oma und lächelte.
»Ist das ein Arzt?«, wollte ich wissen.
[21] »Ja.«
»Ist Opa krank?«
»Natürlich nicht. Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang ist Gynäkologe.«
Ich bin mir nicht sicher, wie viele Achtjährige wissen, was ein Gynäkologe ist. Ich wusste es jedenfalls nicht.
»Ein Gynäkologe untersucht Frauen, Edward, er ist ein Arzt für Frauen«, erklärte Oma mir ungeduldig.
Mama und ich erfuhren, dass meine Großmutter den Herrn Professor bei irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung getroffen hatte, und dass der Herr Professor alleinstehend war, und dass der Herr Professor es zutiefst bedauerte, keine eigenen Kinder zu haben, und dass der Herr Professor darauf brannte, Mama und mich kennenzulernen.
»Magda, Professor Doktor Strombrand-Rosselang ist ein ganz wunderbarer Mann. Gebildet. Weitgereist. Amüsant.« Oma reckte ihren Schwanenhals, sah mich an und sagte noch einmal mit Nachdruck, damit auch ich es verstand: »Ein ganz, ganz wunderbarer Mann.«
Der Professor war groß, und erst in der Hälfte des Schädels wuchs ihm graues Haar, das er halblang trug. Seine Stirn dehnte sich zu einer riesigen glänzenden Fläche. Zartes Rosé, durchzogen von blauen Äderchen. Er sprach überdeutlich und überlaut. Und womöglich um die ganze Bandbreite seines Wissens zu demonstrieren, sprang er von einem Thema zum anderen: das Attentat auf Papst Johannes Paul II., das ihn zutiefst erschüttert hatte. Die Immobilienpreise in Florida, die ihn wahnsinnig aufregten. Wagner, den er vergötterte. Margaret Thatcher, die ihm suspekt war. Schließlich landete er bei der Gebärmutter.
[22] Während Oma seinen Ausführungen mühelos folgen konnte, hier und da eine Bemerkung oder eine Frage einwarf, schaufelten Mama und ich den Kuchen in uns hinein.
»Mit dieser Frage beschäftigt sich meine Doktorarbeit«, schloss er seine Rede über die Gebärmutter. Ein Räuspern, dann sah er meine Mutter an: »Fräulein Cohen, Sie haben phantastische Hände. Phantastisch.«
Mama errötete, und Oma lächelte zufrieden. Eine Sekunde lang war es still. Jetzt war es an meiner Mutter, irgendetwas zu sagen.
»Ist es nicht seltsam, jeden Tag in das Innere von Frauen reinzuschauen?«, fragte sie, anstatt sich einfach für das Kompliment zu bedanken. Hektische Flecken erschienen auf Omas Schwanenhals. »Ich meine, da ist ja nichts mehr Geheimnisvolles, das muss doch dann…«
»Magda…«, unterbrach Oma sie.
»Nein, nein, Frau Cohen, das Fräulein Cohen hat vollkommen recht. Die Scheide hat als Objekt der Begierde an Reiz eingebüßt. Eine Hand bringt meine romantische Seite mehr zum Klingen als jede Vagina.«
Dann stand Moses im Wohnzimmer. Keiner hatte ihn kommen hören. Omas Blick wanderte von seinem zerknitterten Hemd zu den wild wuchernden Bartstoppeln.
»Ich wollte nur etwas zu essen holen«, sagte Opa. »Ich wusste nicht, dass wir Besuch haben.«
Oma stellte die Herren einander vor, ließ ihnen aber keine Zeit, auch nur eine Höflichkeit auszutauschen, sondern befahl mir, Opa samt Kuchen auf den Dachboden zu geleiten.
Oben setzte er sich in den Sessel und stocherte in der [23] Torte herum. »Ich wusste wirklich nicht, dass wir Besuch haben«, sagte er halb zu sich, halb zu mir, aber eigentlich zu Oma, die ihn nicht hören konnte, weil sie eine Etage tiefer saß.
Zu Lara Cohens Erleichterung bat der Professor meine Mutter um ein Wiedersehen, bevor er sich an diesem Tag verabschiedete.
»Ist er nicht wunderbar?«, fragte Oma erschöpft und glücklich.
Mama zuckte mit den Schultern, und diese offensichtliche Gleichgültigkeit ließ bei meiner Oma irgendetwas explodieren. Ihre sonst so kontrollierte Stimme überschlug sich: »Magda, worauf wartest du? Du bist kein junges Mädchen mehr. Dieser Professor ist das Beste, was dir passieren kann. Du kannst doch nicht für immer hierbleiben, und Edward braucht einen Vater.« Langsam dämmerte es mir, Oma wollte uns loswerden. »Vielleicht möchte ich auch noch etwas mit meinem restlichen Leben anfangen.« Und sie fügte hinzu, dass sie am liebsten alles verkaufen und nach England übersiedeln würde.
»Und Papa?«
»Deinem Vater täte es gut, dieses verdammte Land, diese verdammte Stadt und diese verdammte Wohnung endlich zu verlassen. Wir hätten niemals wiederkommen dürfen. Vergiftete Erinnerungen, vergiftet.«
»Aber er ist zu alt, du kannst ihn nicht…«
»Genug«, sagte Oma, stand auf, nahm ihren Mantel und ging aus der Wohnung.
Mama starrte auf den Boden, sie seufzte. Dann, bloß um [24] irgendetwas zu tun, räumten wir den Tisch ab und spülten das Geschirr mit lächerlicher Ernsthaftigkeit. Als alles glänzte, nahm Mama zwei Teller, und wir aßen den restlichen Kuchen. Uns war schlecht, trotzdem stopften wir das süße Zeug in uns hinein. Hochkonzentriert. Die Torte war weg, aber jetzt hatten wir ja wieder dreckiges Porzellan. Langsam und sorgfältig erledigten wir diesen zweiten Spülgang.
Und dann gab es wirklich nichts mehr zu tun. Wie zwei ausgesetzte Hunde, die auf die Rückkehr ihres Herrchens hofften, standen wir in der Küche. Nur dass wir auf nichts Bestimmtes warteten.
Drei Tage später klopfte abends Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang an unserer Tür, um Mama abzuholen.
»Blumen für die Frau Cohen, Blumen für das Fräulein Cohen und Schokolade für den Nachwuchs«, sagte er und überreichte seine Gaben mit einer kleinen Verbeugung.
»Herr Professor, das war aber nicht nötig.« Meine Großmutter strahlte. »Was für bezaubernde Blumen. Bezaubernd.«
Und wieder verbeugte der Professor sich.
Oma und ich sahen den beiden von der Schwelle aus hinterher, als sie die Treppen hinunterstiegen. Meine Mutter drehte sich noch einmal um und lächelte traurig. Ich wollte sie zurückholen, aber ehe sich meine Beine in Bewegung setzen konnten, zog Oma mich in die Wohnung und schloss die Tür.
»So, hoffen wir das Beste«, sagte sie.
[25] Oma und ich aßen in der Küche. Zur Feier des Tages gab es mein Lieblingsessen, Nudelsuppe. Aber an diesem Abend schmeckte die Suppe genauso urinlastig wie der Tee meiner Klavierlehrerin. Meine Gedanken waren bei Mama.
»Edward, schmeckt es dir nicht?«, fragte Oma gereizt.
»Doch.«
»Dann ist ja gut, weil du…«
Sie hielt inne. Ein Geruch nach Aftershave und Duschgel strömte in die Küche. Moses trug einen Anzug, ein Hemd mit gesteiftem Kragen, die Schuhe waren auf Hochglanz poliert, die Krawatte sorgfältig gebunden und das Gesicht glattrasiert. Mit unsicheren Schritten näherte er sich dem Tisch.
»Darf ich?«
Er setzte sich. Für einen Moment wich die Härte aus Omas Gesicht. Sie stand auf und brachte ihm einen Teller Suppe. Seine Hand zitterte, die Nudeln wollten einfach nicht auf dem Löffel bleiben.
»Langsam Moses, langsam«, sagte Oma und streichelte kurz seinen Arm. Erst als sie es ein zweites und ein drittes Mal tat, verstand ich, dass es nicht absichtslos geschah. Moses’ Hand wurde ruhig, und die Nudeln blieben auf dem Löffel.
Nach dem Essen brachte Oma ihren Mann auf den Dachboden. Ich hockte mich auf die unterste Stufe der Wendeltreppe und lauschte. Aber es fiel kein Wort über Lara Cohens Plan, nach England zu ziehen und Mama und mich loszuwerden. Zuerst war es still. Dann beteten sie gemeinsam zu Moses’ einzigem Gott. Der hebräische Singsang surrte in meinen Ohren, und auch ich begann zu [26] beten, oder besser gesagt zu betteln. »Lass den Professor wieder verschwinden. Lass Mama und mich hier.«
Ich lag in meinem Bett und wartete auf Mamas Rückkehr. Endlich hörte ich den Schlüssel und rannte zur Tür. Magda Cohen sah aus, als ob sie eine Schlacht bestritten hätte. Abgekämpft und das Haar zerzaust.
Normalerweise hätte sie ein bisschen geschimpft, weil ich eigentlich schon schlafen sollte, aber sie legte ihren Arm um mich und seufzte: »Ach Eddylein, Herrgott.«
Ich folgte Mama in ihr Zimmer.
»Er redet so schrecklich viel«, sagte sie und warf sich auf ihr Bett.
»Mama, ich brauche keinen Vater.«
»Ich weiß, Eddylein, ich weiß.«
»Was machen wir denn jetzt?« Ich fragte das nicht wie ein Kind seine Mutter, sondern wie ein Soldat seinen Kameraden.
»Wenn ich das nur wüsste.«
Meine Hoffnungen, dass Opa durch weitere gebügelte und gestriegelte Auftritte das Herz meiner Großmutter erweichen und sie vielleicht ihre Pläne vergessen würde, erfüllten sich nicht.
Der Professor holte meine Mutter nun regelmäßig ab, und irgendwann wurde auch ich in die Sache hineingezogen. An einem eiskalten Sonntag schleppte Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang mich und Mama in den Zoo. Wir waren so ziemlich die einzigen Besucher an diesem Winternachmittag. Zielstrebig marschierte der Professor [27] voran. Wir stolperten ihm durch den Schneematsch hinterher.
»Die Pandabären«, seufzte er.
Das Pandabären-Pärchen war eine Schenkung der chinesischen Regierung an den Altbundeskanzler Schmidt. Das gab dem Professor ordentlich Zunder. Es folgte ein Vortrag über China, die Bundesrepublik Deutschland, alles, was davor war, und alles, was seiner Meinung nach danach kommen würde.
Vielleicht war der zweite schon tot, denn ich erinnere mich nur an einen einzigen Pandabären. Er gewährte uns eine volle Stunde lang den Anblick seines Rückens, bis er sich in einer schleppenden Bewegung umdrehte und uns mit dösigem Blick musterte. Es stank nach Affenpisse. Der Professor dozierte, der Panda stopfte Bambus in sich hinein, und Mama und ich hielten einfach den Mund.
»Ich muss auf die Toilette«, unterbrach ich den Professor, der mich zuerst ungläubig, dann verärgert ansah.
Mama nahm meine Hand, und mit einem Nicken gestattete Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang uns den Abmarsch.
»Ich warte hier«, sagte er, klopfte einmal gegen die Glasscheibe des Pandageheges und fuhr mit seinem Vortrag fort.
»Er redet mit sich selbst«, flüsterte ich meiner Mutter zu.
Sie lächelte nur müde. Ein eisiger Wind blies uns ins Gesicht.
»Ich muss gar nicht«, gestand ich ihr.
»Ich weiß, Eddylein. Ich weiß.«
Ziellos liefen wir durch die Kälte.
»Mama, ich mag ihn nicht.«
[28] »Wenn er doch nicht so viel reden würde«, sagte sie.
»Lass uns einfach gehen.«
»Wohin denn, Eddylein?«
»Nach Hause.«
Einen Moment lang führte ich sie in Versuchung, und ihre Augen leuchteten bei dem Gedanken auf. Aber dann erlosch ihr Blick, und sie schüttelte den Kopf.
»Nein, das können wir nicht machen.«
Magda Cohen trank jeden Kelch bis zur Neige.
Das Tröten eines Elefanten zerriss die Stille. Heute würde ich sagen, es war kein Zufall. Heute würde ich sagen, er hat mich gerufen.
»Mama, kann ich bei den Elefanten warten?«, bettelte ich.
Während meine Mutter zurück zu den Pandabären lief, ging ich in die entgegengesetzte Richtung.
Als ich das Elefantenhaus betrat, hörte ich zuerst den Gesang. Dann sah ich ihn. Er saß auf einer Bank. Zigarettenrauch verhüllte seine Gestalt. Ein Teil von mir wollte wegrennen, der andere Teil wollte näher an den singenden Mann heran. Die Neugier siegte. Er bemerkte mich erst, als ich neben ihm stand. Ohne sein Lied zu unterbrechen oder die Zigarette aus dem Mundwinkel zu nehmen, rutschte er zur Seite und bot mir einen Platz an.
Er sah aus wie Elvis zu seinen besten Zeiten, der Held aus Mamas Jugend. Seine Platten standen noch immer in ihrem Zimmer. Selbst Oma konnte Elvis etwas abgewinnen, denn einmal, als Mama mir seine Musik vorspielte, hatte Lara Cohen das Cover in die Hand genommen und den King einen »verteufelt schönen Mann« genannt.
[29] »Ich bin Jack«, sagte der Fremde mit einem amerikanischen Akzent und reichte mir seine Hand.
»Ich heiße Edward.«
»Willst du?« Jack hielt mir seine Zigarettenpackung unter die Nase.
»Ich bin noch ein Kind, und hier darf man nicht rauchen.«
Er lachte und zündete sich eine an.
»Bist du ganz alleine hier?«
»Nein, meine Mutter ist bei den Pandabären.«
»Mit deinem Vater?«
»Nein, mit dem Professor Doktor Strombrand-Rosselang. Mein Vater ist in Schweden oder Dänemark oder Norwegen. Das weiß man nicht so genau.«
»Da hast du ja schon eine ganze Biographie beisammen, da kann man ruhig eine rauchen.«
Ich war acht, und meine erste Zigarette schmeckte zum Kotzen.
»Und der Doktor mit dem langen Namen, ist das ein Arzt?«
»Ja, für Frauen. Nur für Frauen.«
Jack stimmte ein trauriges Lied an, während ich mich bemühte, meinen Hustenreiz zu unterdrücken.
»Man muss für die Elefanten singen, das bringt Glück«, sagte er.
»Ist das dein Beruf?«
»Nein, das ist meine Religion«, antwortete Jack.
»Wir sind Juden. Wir beten.«
Die zweite Zigarette schmeckte schon ein bisschen besser und machte mich irgendwie mutig. Ich traute mich nun, [30] die Fragen zu stellen, die mir durch den Kopf schossen. Er war Amerikaner und Reisender, Musiker und Geschäftsmann. Keine Verwandtschaft mit Elvis. Keine Kinder und keine Frau. Er war erst seit ein paar Wochen in Berlin, davor in Hamburg, davor in Kiel, davor in Italien.
Er hieß Jack Moss, und ich bewunderte ihn augenblicklich.
Nach der dritten Zigarette verwandelte sich meine Kühnheit in Unruhe. Bald würden Mama und der Professor kommen, um mich abzuholen. Ich würde Jack wahrscheinlich nie wieder sehen. Aber ich wollte, dass dieser Mensch in meinem Leben blieb. Da sagte er, als ob er meine Gedanken gelesen hätte, dass er noch eine ganze Weile in Berlin bleiben und jeden ersten Sonntag im Monat den Elefanten einen Besuch abstatten werde.
Ich hörte Schritte und ließ die Zigarette fallen.
»Eddylein.«
Jack und ich drehten uns gleichzeitig um. Röte überzog schlagartig Mamas Gesicht, das eben noch fahl und abgekämpft gewirkt hatte. Ich konnte es in ihren Augen lesen, sie war hingerissen von dem Mann, der ebenso schön aussah wie der echte Elvis. Jack stand auf und ging mit leichten Schritten auf meine Mutter und den Professor zu.
»Guten Tag, Jack Moss.« Sein amerikanischer Akzent, in dem noch irgendetwas anderes mitschwang, war betörend.
Während Mama strahlte und strahlte, musterte der Professor den falschen Elvis voller Argwohn.
»Arbeiten Sie hier, Herr Moss?«, fragte er.
»Ja, und am Sonntag ziehe ich immer einen Anzug an, bevor ich die Ställe ausmiste«, antwortete Jack und zwinkerte meiner Mutter zu.
[31] »Sie sind ja ein richtiger Spaßvogel, Herr Moss.« Der Professor gab sich alle Mühe, möglichst herablassend zu klingen.
»Manchmal.«
»Und Engländer«, stellte Herr Professor Doktor Strombrand-Rosselang fest.
»Nein, Amerikaner mit ein paar italienischen und sehr vielen irischen Wurzeln.«
»So, so. Können wir dann los?« Er griff nach Mamas Hand. »Einen schönen Tag noch, Herr Moss.«
»Wünsche ich Ihnen auch.« Jack klopfte mir auf die Schulter. »Bis bald, Ed.« Er zwinkerte Mama ein letztes Mal zu.
Schweigend verließen wir den Zoo. Sobald wir den Ku’damm erreicht hatten, machte sich der Professor Luft und dichtete Jack Moss einen ganzen verbrecherischen Lebenslauf an.
Mama und ich sagten nichts, wir lächelten vor uns hin.
An diesem Abend legte Magda Cohen ihre alten Elvis-Platten auf, wackelte mit den Hüften und sang mit dem King im Duett.
Mamas gute Laune weckte Lara Cohens Misstrauen.
»Na, hattet ihr einen schönen Tag im Zoo?«, fragte sie mich.
»Weiß nicht.« Ich hielt es instinktiv für ratsam, Jack Moss nicht zu erwähnen.
»Edward, was ist das denn für eine Antwort? ›Weiß nicht‹? Also, hattest du einen schönen Tag oder nicht?«
»Mmm«, machte ich.
»Und deine Mutter? Was ist mit deiner Mutter los?«
»Weiß nicht.«
[32] »Und wo ist der Professor? Ich dachte, er würde heute Abend bei uns essen.«
»Weiß nicht.«
Oma musterte mich skeptisch, aber ehe sie mich weiter ausquetschen konnte, verzog ich mich auf mein Zimmer.
In der Woche darauf lernte ich eine dritte Gemütsverfassung meiner Klavierlehrerin kennen. Es gab Tee, aber sie sagte nichts. Als ich vorschlug, ihr das Lied vorzuspielen, das ich hatte üben sollen, schüttelte sie den Kopf.
»Bitte nicht, Eduard«, hauchte die Nöff.
»Geht es Ihnen heute nicht gut?«, fragte ich vorsichtig.
Die Nöff lachte laut und hysterisch. »Mir geht es schon lange nicht mehr gut, mein liebes Kind.«
Ich starrte in meinen Tee und überlegte, ob es wohl unhöflich wäre, ihr einfach die 23 Mark hinzulegen und zu gehen. Zwei Tropfen Rum perlten von ihrem Schnurrbart, als ich wieder aufsah.
»Eduard, hör niemals auf zu zweifeln.« Sie goss sich noch einen Schluck Hochprozentiges in ihre Tasse. Normalerweise machte sie das heimlich in der Küche, aber heute stand die Flasche auf dem Klavier. »Hast du verstanden? Zweifle, wenn dich alle verdammen, und zweifle genauso, wenn dir alle auf die Schulter klopfen.«
Ich nickte.
»Versuch nicht, deine Zweifel zu beseitigen, aber lass dich auch nicht von ihnen auffressen. Verstehst du das?«
Ich nickte abermals, ohne die geringste Ahnung zu haben, wovon meine betrunkene Klavierlehrerin da gerade sprach.
[33] »Bring die Schäfchen nicht ins Trockene. Lass sie draußen, und hol ihnen einen Schirm. Oder halt den verfluchten Regen einfach aus. Das geht vorbei. Denn drinnen, drinnen ist nichts zu holen, Eduard. Ich bin drinnen. Da ist nichts.«
Die Nöff stand auf, nahm ihre Flasche und ging in das andere Zimmer ihrer Zweiraumwohnung. Ich hörte, wie sie die Türe hinter sich zuzog. Dann war es still. Ich wartete, bis meine Stunde vorbei war, legte das Geld auf den Tisch und verschwand.
Diese dritte Stimmung der Nöff blieb ein einmaliges Ereignis. Es folgten wieder die üblichen Stunden. Mein untalentiertes Geklimper oder ihr Chopin-Geschwätz. Weder die Schäfchen noch die Zweifel wurden je wieder erwähnt und der Rum nur noch in der Küche ausgeschenkt.
Der nächste Monat kam und sein erster Sonntag. Es war Professor Doktor Strombrand-Rosselang, der mir den Tag, auf den ich so sehnsüchtig gewartet hatte, gehörig verdarb.
Anstatt Jack Moss wiederzusehen, saß ich mit Oma und Mutter in einem deprimierenden Häuschen in Zehlendorf, das der Professor »mein Domizil« nannte. Er pries sein Zuhause als den idealen Ort für eine kleine Familie an, und Lara Cohen pflichtete ihm so überschwenglich bei, dass Mama und ich verschämt zu Boden sahen. Wir waren also immer noch zum Abschuss freigegeben.
Es gab Kaninchen.
»Ich züchte sie selbst«, sagte der Professor. Im Garten stand ein Schuppen, in dem die Tiere lebten, bis er Lust bekam, eines zu schlachten.
Professor Doktor Strombrand-Rosselang besaß eine [34] Bibliothek. Eine echte. Nicht bloß einen Dachboden voller Gerümpel so wie wir. Regale bis zur Decke. Die Bücher, die allesamt wie neu aussahen, ordentlich sortiert.
»Das ist sicher schrecklich viel Arbeit, alles instand zu halten«, bemerkte Oma.
»Eine einsame Arbeit.« Die übliche Arroganz schwand aus seiner Stimme. Der selbstbewusste Professor verwandelte sich auf einmal in eine traurige Gestalt mit Halbglatze. »Sehr einsam. Ja, die Einsamkeit…«, seufzte er, und ich schwöre, ich habe Tränen in seinen Augen gesehen. Lara Cohen hätte nicht schockierter geschaut, wenn er seine Hose heruntergezogen hätte, um ein bisschen mit seinem Penis zu spielen.
»Was für eine schöne Sammlung. Wunderbare Bücher, lieber Professor Doktor Strombrand-Rosselang…«, unterbrach Oma das Klagelied unseres Gastgebers und betonte seine Titel mit äußerster Schärfe.
Nach der Bibliotheksbesichtigung platzierte der Professor uns am gedeckten Tisch und holte das Kaninchen aus der Röhre.
»Das sieht phantastisch aus, und wie das duftet«, sagte Oma. »Ein Arzt, der auch noch kochen kann. Ich bin begeistert.« Sie hörte gar nicht mehr auf, ihn und das Essen zu loben.
»Ich habe mir extra ein Buch über das Schächten zugelegt und Winkie, so heißt die Dame, die wir gerade verspeisen, nach dieser Methode geschlachtet. Frau Cohen, Fräulein Cohen, ich respektiere Ihren Glauben zutiefst.«
Mama und ich konnten unser Lachen kaum unterdrücken.
[35] »Habe ich etwas Falsches gesagt?«
»Nein, nein. Das ist eine wirklich noble Geste. Wirklich nobel.«
»Winkie ist nicht koscher.« Es platzte einfach aus mir heraus.
»Edward«, fauchte Lara Cohen.
»Wie bitte?«, fragte der Professor irritiert.
Ich blieb stumm. Es war Mama, die ihn mit leiser Stimme aufklärte.
»Ein Kaninchen ist nicht koscher. Egal, wie sie es schlachten. Es ist einfach nicht koscher.« Sie lächelte mild.
»Das macht nichts, werter Professor. Wir sind da sehr liberal«, sagte meine Großmutter.
»Opa nicht.«
»Edward, würdest du jetzt bitte den Mund halten.« Oma streckte ihren Schwanenhals zu bedrohlicher Länge aus. Ich konnte ihren Atem spüren, und einen verrückten Moment lang befürchtete ich, dass Lara Cohen mir die Nase abbeißen wollte.
»Vielleicht möchte der Nachwuchs die Ställe besichtigen?«, fragte Professor Doktor Strombrand-Rosselang nach dem Essen mit gewichtiger Miene.
»Was für eine wunderbare Idee. Edward liebt Tiere. Nicht wahr, Edward?«
Die Ställe waren nicht mehr als ein düsterer Geräteschuppen. Winkies lebende Brüder und Schwestern hatten alle einen Namen. Der Professor stellte mir jedes einzelne Tier mit stolzgeschwellter Brust vor, als ob wir es gerade mit dem englischen Hochadel zu tun hätten und nicht mit ein paar verschreckten Nagern.
[36] »Schau mal, Edward.« Er öffnete einen der Käfige, und fünf Babykaninchen sahen mich an. »Du kannst sie rausnehmen und streicheln.«
Professor Doktor Strombrand-Rosselang und ich hockten uns auf eine Kiste, beide ein Baby auf dem Arm.
»Frisch geboren. Du darfst sie taufen.«
Ich suchte ihre Namen mit großer Sorgfalt aus. Die drei schwarzen benannte ich nach meinen Helden: Pinocchio, King Kong und Sindbad. Das braune taufte ich Chanel. So hieß das Parfüm meiner Mutter, dessen Duft ich liebte. Das schönste von allen, es hatte ein weißes und ein schwarzes Ohr, erhielt den Namen Jaguar.
Für eine geschlagene halbe Stunde gewann der Professor mein Herz.
»Werden Sie die auch irgendwann essen?«
»Das ist der Lauf der Dinge«, sagte er traurig und wiegte Chanel hin und her. Aber ehe ich Gelegenheit hatte zu sagen, dass er den Lauf der Dinge unterbrechen könne, dass er seine Kaninchen nicht töten und essen müsse, befand ich mich in einer weiteren Vorlesung des Herrn Professor. Und Gott allein weiß, wie er von fünf Babykaninchen zu Hepatitis B und dem Attentat auf Kennedy kam.
Mama und der Professor sahen sich weiterhin regelmäßig, aber die ganze Sache entwickelte sich nicht weiter. Lara Cohen beobachtete die nicht aufgehen wollenden Blüten ihrer Kuppelei voller Ungeduld. Ähnlich ungeduldig wartete ich auf den nächsten Monat. Auch Mama hatte Jack Moss nicht vergessen. Fast jeden Abend hörte ich den King in ihrem Zimmer singen. Aber ich erzählte meiner Mutter nichts von [37] meiner losen Verabredung im Elefantenhaus, manche Dinge muss man ganz allein machen.
Dann kam der Sonntag, und das Glück war auf meiner Seite. Der Professor holte meine Mutter schon am frühen Morgen ab. Oma verließ mittags das Haus, um einen Wohltätigkeitsbasar zu besuchen, und Moses schlurfte wie gewöhnlich auf dem Dachboden herum. Ich war frei.
Am Eingang bezahlte ich den Eintritt. Dann rannte ich Richtung Elefantenhaus. An diesem Tag schien die Sonne, und die Tiere tummelten sich draußen. Vor dem Gehege, mit einer Zigarette im Mundwinkel, stand Jack Moss. Und ich dachte, ich müsste zerspringen oder einfach umfallen. Denn was hätte ich getan, wenn er nicht da gewesen wäre? Wo hätte ich ihn suchen sollen, den reisenden Amerikaner?
Jack Moss sah aus wie der Gott dieser grauen Herde. Ihr einziger Gott. Die Sonnenstrahlen und der Rauch seiner Zigarette umspielten sein hübsches Profil. Die Elefanten im Hintergrund schienen eigens für ihn ihre Rüssel zu schwenken. Erst als ich fast vor ihm stand, rief ich seinen Namen. Jack Moss zwinkerte mir zu, und ich begrüßte ihn mit so wilder Freude, dass ich ins Taumeln geriet.
»Willst du sie anfassen?«, fragte Jack, nachdem ich mich beruhigt hatte.
»Wen?«
»Na, die Elefanten.«
Jack drückte mir einen Keks in die Hand und hob mich hoch. Ich war in der Luft, schwebte auf Jacks Armen über den Zaun. Angelockt durch den Zucker oder den Gesang oder durch die Tatsache, dass ein kleiner Junge kopfüber in ihrem Gehege hing, kamen die Tiere angetrabt. Ich streichelte [38] ihre Rüssel und fütterte sie mit Keksen, bis sie satt und zufrieden abmarschierten.
Jack reichte mir eine Zigarette. Die vierte meines Kinderlebens. Rauchend hielten wir unsere Gesichter in die Sonne. In diesem Moment gehörten wir zusammen, der Gott, die Herde und ich.
Eine fette Frau mit zwei ebenso fetten Zwillingsmädchen in meinem Alter störte unsere Eintracht. »Sie können den Jungen doch nicht rauchen lassen«, schnaufte sie.
Jack lächelte, und seine Schönheit trieb der Dame die Röte ins Gesicht. Mit Elvis hatte sie nicht gerechnet.
»Mein Sohn ist achtzehn«, sagte er freundlich.
Die Frau musterte mich skeptisch, und ihre Bälger glotzten mich an. »Das kann ich nicht glauben«, sagte sie nach einer langen Pause. Jack lachte und wandte sich wieder der Sonne zu, aber die Frau und ihre Töchter blieben stehen. »Also wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich einfach nicht glauben.«
Jack seufzte. »Aber darum geht es nicht, werte Dame. Die Welt wäre ein sehr trauriger Ort, wenn es nur das geben würde, was Sie sich vorstellen können.«
»Wa…was?« Die Dicke war unsicher, ob sie gerade beleidigt worden war oder nicht. Doch bevor sie sich entscheiden konnte, stimmte Jack ein Lied an, und ich klatschte und stampfte im Takt. Die Zwillinge begannen zu weinen, während wir für unsere Herde musizierten und mit den Hüften wackelten.
Es war bereits dunkel, als wir den Zoo verließen. Erst jetzt fiel mir ein, dass Oma und Mama wahrscheinlich schon zu Hause waren und nicht wussten, wo ich mich herumtrieb. [39] Jack bot an, mich zu fahren. Zuerst lachte er, als er bemerkte, dass die Autoschlüssel nicht in seiner Jackentasche steckten, sondern im Zündschloss des schwarzen Volvos. Dann fluchte er und knallte seine Faust gegen das Fenster. Jacks Gesicht verzog sich zu einer unansehnlichen Grimasse. Je länger er vergeblich auf das Glas einschlug, desto zorniger wurde er. Fasziniert und verängstigt zugleich beobachtete ich, wie er außer Kontrolle geriet.
»Ich kann auch mit der Bahn fahren«, sagte ich vorsichtig. Jack sah mich an, und in diesem Moment schien er nicht mehr zu wissen, wer ich war, aber auch ich konnte in diesem tobenden Mann nicht mehr den einzigen Gott der Elefanten erkennen. Er holte aus, und für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, er würde mich schlagen. Schützend hielt ich meine Arme hoch. Das Glas brach, seine Hand blutete, und Jack war wieder Jack. »Steig ein, Ed.« Er zwinkerte mir zu. Nur seine verletzte Faust erzählte von der unendlichen Wut, die ihn eben noch beherrscht hatte.
Jack begleitete mich nach oben. Oma öffnete uns die Tür, und noch ehe ich eine Entschuldigung herausbringen konnte, spuckte sie Gift und Galle. »Und wer sind Sie?« Es klang wie eine Drohung.
»Jack Moss, ich habe Ed nach Hause gefahren.« Er reichte Oma die Hand. Die heile natürlich.
»So, Sie haben Edward nach Hause gefahren.« Sie reckte ihren Hals und betrachtete Jack Moss genauer.
»Sie erinnern mich an irgendwen…« Und dann dämmerte es Lara Cohen. »Elvis«, zischte sie. Halb belustigt, halb verärgert.
[40] »Ich nehme an, Sie kennen auch meine Tochter, Edwards Mutter?«
»Kennen ist wohl übertrieben, aber ich habe ihr schon einmal die Hand geschüttelt.«
Endlich bat Oma uns herein. »Möchten Sie etwas trinken, Herr Moss?«
»Jack, nennen Sie mich bitte Jack.«
Lara Cohen lächelte verächtlich, aber ganz kalt ließ er sie nicht, der hübsche Amerikaner, der da auf unserem Sofa saß.
»Gut, Jack, möchten Sie etwas zu trinken?«
Er wollte. Ohne zu fragen, zündete sich Jack eine Zigarette an. Das hatte noch niemand gewagt, aber er konnte ja nicht ahnen, dass meine Großmutter eine militante Nichtraucherin war. Mit offenem Mund verfolgte ich, wie sie einen Teller aus der Küche holte und ihn auf den Couchtisch knallte. »Wir haben leider keinen Aschenbecher«, sagte sie eisig. Jack bedankte sich artig.
»So, Herr Moss…«
»Jack.«
»Jack, woher kommen Sie?«
»Aus dem Zoo.«
Oma lachte ihr punktgenaues Lachen, das an diesem Abend ein kleines bisschen affektiert klang.
»Sind Sie Amerikaner?«
»Jawohl. Mit irischen und italienischen Wurzeln.«
»Und sind Sie geschäftlich in Berlin?«
»Auch.«
Doch bevor Oma das Verhör weiterführen konnte, ging die Wohnungstür auf und Mama kam herein. Es ist schwer [41] zu sagen, wer von den beiden sich über dieses Wiedersehen mehr freute, Magda Cohen oder er.
»Jack Moss«, flüsterte Mama, sie hatte seinen Namen nicht vergessen. Er stand auf und begrüßte sie. Oma und ich waren nur noch Publikum. Stolz kroch durch meine Adern, denn ich hatte meiner Mutter dieses Lebendgeschenk mitgebracht. Lara Cohen betrachtete die Szene mit der amüsierten Herablassung, mit der man sich auch über einen onanierenden Gorilla, eine misslungene Slapstick-Einlage oder ein billiges Happyend amüsiert.
»Wo ist der Professor?«, fragte Oma, als Mama sich neben Jack auf das Sofa setzte.
»Zu Hause, nehme ich an.«
»So. Na ja dann… Jack wollte uns gerade erzählen, was er in Berlin macht. Nicht wahr?«
Er zündete sich eine weitere Zigarette an und grinste.
»Also Jack?«
»Ich handele.«
»Sie handeln? Und womit, wenn man fragen darf?«
»Zurzeit mit Halbedelsteinen und Fossilien.«
»Das klingt ja aufregend«, sagte Oma spöttisch.
Jack Moss lachte. »Aufregend ist das vollkommen falsche Wort, Gnädigste.«
»Dann ist es hoffentlich ein lohnendes Geschäft, wenn es schon nicht aufregend ist«, bohrte sie weiter.
»Das ist eine Frage für einen Philosophen. Ich möchte mir nicht anmaßen zu bestimmen, was lohnend ist und was nicht.«
Sie schaffte es einfach nicht, ihn in Verlegenheit zu bringen. Aber sie gab nicht auf und fragte ihn, ob er jüdisch sei.
[42] »Wer weiß das schon«, sagte er.
»Sie sollten es wissen, Jack.«
»Sehen Sie, sowohl die irischen Moss als auch die italienischen Picalis, die Familie meiner Mutter, sind ein wilder Haufen. Ein wild kopulierender Haufen. Eine Kuckuckskinderbrutstätte. Und da weiß man halt nicht so genau, woher man kommt und was man eigentlich ist. Aber wenn es für Sie wichtig ist, Gnädigste, dann bin ich ab heute gerne Jude.«
Jack stand Lara Cohen Rede und Antwort und steckte sich die neunte Zigarette an. Da erblickte ich meinen Opa.
Die Tür zwischen Küche und Wohnzimmer war einen Spaltbreit offen. Moses stand, von allen anderen unbemerkt, in der dunklen Küche. Unsere Blicke trafen sich. Das, was in seinen Augen leuchtete, machte mir Angst. Als ich erkannte, dass mein Großvater einen viel zu kleinen Schlafanzug trug, dass seine Haare zu Berge standen und er sich seit mindestens einer Woche nicht rasiert hatte, beschloss ich, ihn zurück auf seinen Dachboden zu bringen, bevor Oma ihn entdeckte. Denn ich fürchtete, dass Moses’ Aufzug ihr einfach nur weitere Munition für die ominösen Englandpläne liefern würde.