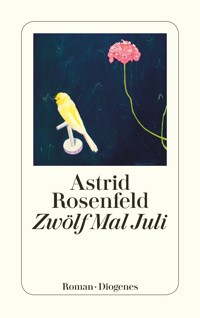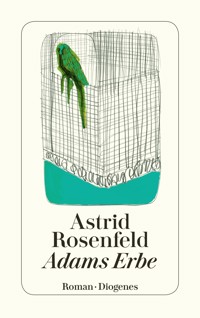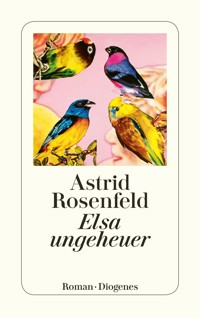Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
Wie viel Unglück verträgt das Glück? Was tun, wenn sich das Leben immerzu im Kreis dreht? Die halbe Welt liegt zwischen Maxwell und Elisabeth. Der Zufall führt sie zusammen und an einen seltsam mystischen Ort irgendwo in der texanischen Wüste. Sie wissen nichts voneinander und erkennen sich sofort. Der amerikanische Cowboy, der kein Cowboy mehr ist, und die deutsche Tänzerin, die nicht mehr tanzen kann. In sich tragen sie die Geschichten ihrer Mütter - Charlotte, die wie eine Löwin für ihr Glück kämpft, und Annegret, der das Leben bloß widerfährt. Geschichten, die von ewigem Sehnen erzählen, vom Streben nach Liebe und Geld und Wahrheit, von kleinen und großen Wundern, von Verlusten in Zeiten des Kriegs und des Friedens. Wie ein unsichtbares Band verbinden all diese Geschichten Maxwell und Elisabeth miteinander. Aber ist es stark genug?Virtuos entwirft Astrid Rosenfeld in Kinder des Zufalls ein schillerndes Panoptikum menschlicher Zustände, das ein halbes Jahrhundert und zwei Kontinente umfasst. Und ihr Ton ist dabei unverwechselbar, mal lakonisch, mal zärtlich, immer von großer Wärme getragen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Rosenfeld
Kinder des Zufalls
Roman
Kampa
For Ty Mitchell
I borrowed your cowboy hat and your saloon
and gave it to Maxwell.
I borrowed your wisdom and your wit
and gave it to Glenn.
The rest is just a little melody.
The sound of waves and desert nights.
With love Astrid
What matters most is how well you walk through the fire.
Charles Bukowski
11. März 1977Ein Junge stirbt fast
Vier Meter über der Erde baumelte der Junge, an einem Ast des toten Eichenbaums. Das Kinn an die Brust gedrückt, versuchte er, ruhig zu atmen. Bald würde der Gürtel ihm die Kehle zudrücken. Hellbraun das Leder, an einigen Stellen hatten Schweiß und Blut die Tierhaut dunkel gefärbt. Sein Schweiß, vermischt mit Onkel Terrys Schweiß. Der Gürtel: ein Geschenk von Onkel Terry. Onkel Terry, der gar nicht sein richtiger Onkel war.
Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben.
Maxwell bekämpfte den Impuls, mit den Beinen zu strampeln. Eine falsche Bewegung würde ihm das Genick brechen.
Nicht sterben.
Sullivan und Allen hatten ihn gejagt, wegen der NolanRyan-Karte. Eine Sammelkarte. Ein Stück Pappe. Maxwell interessierte sich nicht für Baseball, und das Bild des California-Angel-Pitchers konnte ihm gestohlen bleiben. Doch er hatte gelernt, dass es unklug war, Sullivan und Allen das Verlangte widerstandslos zu geben. Jagd und Schläge mussten der Eroberung vorausgehen.
Ein zehnjähriger schlaksiger Junge musste zwei dreizehnjährigen muskelbepackten Gegnern unterliegen. Er wehrte sich, um seine Peiniger glücklich zu stimmen. Das verschaffte ihm eine längere Pause bis zur nächsten Attacke. Bis sie wieder etwas von ihm wollten – Geld, Glasperlen, einen Football, Schokolade, Kaugummis oder Hustensaft.
Nicht sterben. Nicht sterben.
Vor ihm erstreckten sich die Chinati Mountains. Das offene Grasland der Chihuahua-Wüste. Hunderte Yuccas. Mannshoch. Wie ein Volk aus alten Zeiten sahen sie aus. Krieger mit gezackten Helmen. Andere zusammengewachsen, um sich nie wieder zu trennen.
Nicht sterben.
Maxwell und seine Mutter Charlotte waren vor sechs Monaten mit drei Koffern auf der Finsher Ranch angekommen.
»Terry, ich hätte schreiben sollen«, hatte Charlotte gesagt.
»Charly?«, hatte Terry geantwortet. Dann hatten sie sehr lange geschwiegen.
Nicht sterben.
Tränen liefen über Maxwells Wangen.
Nie hatte er Sullivan und Allen verraten. Es war ein Spiel, bei dem Sieger und Verlierer von Anfang an feststanden. Scheußlich, aber nur ein Spiel.
Nicht sterben.
Maxwell hatte sofort gespürt, dass heute etwas anders war. Sah es am Funkeln ihrer veilchenblauen Augen. Hörte es in ihrem Schnauben. Schweiß und blaue Flecken würden heute nicht genug sein. Die Brüder hatten die Regeln geändert. Nein, nicht geändert – es gab sie nicht mehr. Und was steht am Ende einer Jagd, einer Jagd, die kein Spiel ist?
Maxwell war losgerannt.
Immer weiter hatte er sich vom Haupthaus entfernt, den Schlafbaracken, den Ställen, den Verschlägen. Immer schneller wurden seine Beine. Erst als er den toten Eichenbaum erreicht hatte, blickte er zurück. Seine Verfolger waren außer Sichtweite.
Einatmen – ausatmen.
Behände wie ein Äffchen hatte er den Baum erklommen.
Einatmen – ausatmen.
Hier oben hatte er sich in Sicherheit geglaubt. Er würde warten, bis es dunkelte, und dann zurücklaufen. Heute würde er nicht schweigen. Er würde zu Onkel Terry gehen und … Bevor Maxwell seinen Plan zu Ende denken konnte, kamen die Brüder angerannt.
»Maxwell … Maxwell, wir kriegen dich«, hatte Sullivan gerufen und gegen den Baumstamm getreten.
Er war sieben Minuten und vierzig Sekunden älter als sein Zwillingsbruder. Den minimalen zeitlichen Vorsprung empfand er als persönliches Verdienst. »Ich hab dich überholt, Allen. Bin stärker als du.«
Allen akzeptierte Sullivans vermeintliche Überlegenheit, die sich laut Sullivan schon im Mutterleib bemerkbar gemacht hatte.
Die ersten Versuche der Zwillinge hinaufzuklettern, schlugen fehl. Als Sullivan aus drei Metern Höhe zu Boden ging, überkam ihn eine unbändige Wut. Er hämmerte mit den Fäusten gegen den Stamm.
»Du bist tot, Maxwell. Du bist tot. Hörst du, Maxwell? Du bist tot.«
Wild schreiend umklammerte Sullivan den Stamm, zog sich hoch. Die veilchenblauen Augen weit aufgerissen, die Ader am Hals pochte. Maxwells Herz raste. Sollte er springen? Aber unten stand Allen. »Du bist tot, Maxwell.«
Schon packte ihn eine Hand, die viel stärker war als seine. Ein dumpfer Schmerz in seinem Gesicht. Blut tropfte ihm aus der Nase. Sullivan zerrte an seiner Hose. Was wollte er? Was? Was?
Warm und feucht das Leder.
»Du bist tot, Maxwell.«
Dann war es still.
Nicht sterben.
Das Leben der Brüder war aus den Fugen geraten, seit Maxwell und seine Mutter hier waren. Und sie konnten ja schlecht Charlotte verprügeln. Charlotte, die Schuldige. Maxwell begriff nicht nur, er hatte sogar Verständnis für das Verhalten der Zwillinge. Vielleicht hatte er deshalb ihr grausames Spiel stets schweigend ertragen. Aber er würde ihnen nicht sein Leben opfern.
Verschwunden waren Berge und Wüste, verschwunden die Yuccas. Kein Himmel über ihm. Es gab nur noch seine zehn Finger und Terrys Gürtel. Fünf Finger zerrten an dem Leder. Maxwell streckte den rechten Arm. Ein Knacksen in der Schulter. Fünf Finger griffen ins Leere. Einmal, zweimal, dreimal. Dann bekamen sie den Ast zu fassen.
Als er seinen Kopf befreit hatte, wich alle Kraft aus seinem Körper. Er fiel. Ein stechender Schmerz durchfuhr seinen rechten Oberschenkel, trotzdem stand er auf. Stand mit beiden Beinen fest auf der harten Erde.
Langsam kletterte Maxwell den Stamm wieder hinauf. Das Leder war nicht gerissen. Er löste den Gürtel, band ihn um die Hüfte.
Vor ihm erstreckten sich die Chinati Mountains. Das offene Grasland der Chihuahua-Wüste. Hunderte Yuccas. Als ob nichts gewesen wäre.
Erster Teil
1Myrthel Spring
»Danke, das ist sehr nett von Ihnen.«
»Woher kommen Sie, Ma’am?«, fragte Terry, während er ihren Koffer auf der Ladefläche des Pick-up verstaute.
Etwas Fremdes färbte ihre Worte. Sie war keine Texanerin. Vielleicht nicht einmal Amerikanerin.
»Ich bin auf einem Schiff gekommen.«
Sein Blick schweifte über das Land.
»Auf einem Schiff?«
»New York«, sagte sie. »Können wir jetzt …«
»Sie sind aus New York, Ma’am?«
»Nein, ich bin auf einem Schiff nach New York gekommen. Können wir jetzt …«
»Also sind Sie von weit her, Ma’am?«
»Was ist nun mit Frühstück? Ich habe schrecklichen Hunger. Und hören Sie doch bitte auf mit diesem Ma’am.«
»Entschuldigung, Ma’am …«
»Charlotte, ich heiße Charlotte.«
Sie lächelte, zog ihren Rock ein Stück hoch und kletterte auf den Beifahrersitz.
»Charlotte«, sagte er. »Charly.«
Wie jeden ersten Dienstag im Monat war er morgens um fünf in seinen Truck gestiegen, um wie jeden ersten Dienstag im Monat vier Stunden nach Myrthel Spring zu fahren.
Seit seinem sechzehnten Lebensjahr gehörte die Dienstagstour zu Terrys Pflichten. Postamt, Viehfutter, Lebensmittel.
120 Dienstage, kein einziges Mal hatte sich etwas Außergewöhnliches ereignet. Natürlich, sein Leben hatte sich verändert: Vor neun Jahren war die Mutter gestorben, noch während der Dürre. Zeiten der Entbehrung. Terrys Vater Harold Finsher war es gelungen, die 8000 Hektar zu erhalten. Zu einem hohen Preis: 160 Rinder, 21 Pferde, seine Frau und sein Verstand. Im Frühling 1957 setzte Regen ein. Schon zwei Jahre später sah es aus – zumindest auf den ersten Blick –, als wäre nie etwas geschehen. Harte Arbeit, ein Kredit und ein Quäntchen Glück gaben Harold zurück, was die Dürre ihm genommen hatte – fast alles. Das Grab der Frau und die Tage, an denen Harold Finsher sich in der Vorratskammer einsperrte, nackt auf dem Boden saß und If You’re Happy and You Know It sang, dabei in die Hände klatschte, bis sie brannten, erzählten davon, dass sehr wohl etwas geschehen war.
Sechs Jahre nachdem Terry zur Halbwaise geworden war, hatte er Diana geheiratet. Vor einem Jahr waren die Zwillinge zur Welt gekommen. Ja, das Leben hatte sich verändert seit seiner ersten Dienstagsfahrt. Nicht nur seines, auch das der anderen. In Myrthel Spring erfuhr er, wer gestorben war und wie viele Kinder geboren worden waren. Welche Unfälle sich in dem 1300-Seelen-Ort ereignet hatten, welche Krankheiten umgingen und welche Heldentaten vollbracht worden waren. Aber das alles empfand Terry nicht als außergewöhnlich. So war es nun einmal – der Lauf der Dinge. Das Leben. Die blonde Frau, die neben ihm saß – das war etwas Außergewöhnliches.
»Kann ich Ihnen helfen, Ma’am?«, hatte er sie gefragt.
Er konnte: Sie hatte Hunger und wollte sich ausruhen.
»Ich heiße Terry«, sagte er.
»Wie?«, fragte sie.
Der Motor und das Radio übertönten seine Stimme.
»Terry. Ich heiße Terry.«
Sie lächelte, und da fragte er sich, ob er ihr erzählen sollte, dass er verheiratet war und zwei Kinder hatte und auf der Ranch seines Vaters, die eines Tages seine Ranch sein würde, wohnte und arbeitete. Ob er ihr sagen sollte, dass das Leben hart war, dass er seit fast zehn Jahren jeden ersten Dienstag im Monat nach Myrthel Spring fuhr. Und dass sie sein erstes außergewöhnliches Erlebnis war. Dass er ihren Rock hübsch fand und ihre Frisur und ihr Gesicht. Dass er gerne wissen würde, wo sie herkam. Dass er noch nie mit einer Frau wie ihr, einer Frau mit platinblonden Haaren und einer so tief ausgeschnittenen Bluse, gesprochen hatte. Dass er Texas, seine Heimat, liebte und hoffte, dass sie keine Kommunistin war.
Aber all das sagte er nicht, sondern: »Carmen ist klimatisiert.«
»Was?«, fragte sie.
»Carmen. Das Diner. Da gibt es eine Klimaanlage.«
Steve, Craig und Dave saßen am Tresen, erzählten sich die immergleichen Geschichten. Carmen goss Kaffee nach. Ein ganz normaler Dienstag in Carmen’s Diner.
Es wurde still, als Terry und Charlotte eintraten. Auch Steve, Craig, Dave und Carmen spürten, dass hier etwas Außergewöhnliches geschah.
Terry grüßte flüchtig und führte Charlotte in die hinterste Nische. Kaum saßen sie, überlegte er, ob er Charlotte den anderen hätte vorstellen müssen? Doch was hätte er sagen sollen? Sie stand am Straßenrand. Sie heißt Charlotte. Sie hat Hunger.
Und dann hätte der alte Steve von seiner Zeit in Korea angefangen, Dave hätte schmutzige Witze gerissen und Craig alles getan, um Terry lächerlich zu machen.
Carmen kam an ihren Tisch und musterte Charlotte.
»Das ist Carmen. Ihr gehört Carmen«, sagte Terry. »Und das ist Charlotte, sie … sie ist … sie ist eine Reisende.«
Carmen lächelte, aber die hochgezogenen Augenbrauen nahmen ihrem Lächeln jede Freundlichkeit.
»Wie geht es Diana?«, fragte sie Terry und sah dabei Charlotte an, die Augenbrauen noch immer hochgezogen, das Lächeln verschwunden.
»Gut.«
»Und den Zwillingen?«
»Auch gut.«
Die erste Tasse Kaffee tranken sie schweigend. Hastig aß Charlotte eine Portion Spiegeleier mit Speck, während die Jukebox Buck Owens’ I’ve Got a Tiger by the Tail spielte.
Die zweite Tasse Kaffee.
Terry räusperte sich. »Also, Charlotte … Charly, woher kommen Sie?«
»Sie geben keine Ruhe, was?« Die Fremde lachte.
So ein Lachen hatte Terry noch nie gehört, die Frauen, die er kannte, lachten anders. Er wollte ihre Kehle berühren, diesem Lachen näherkommen, es einfangen.
»Warum wollen alle immer wissen, wo man herkommt? Ist das so wichtig? Ist es nicht. Fragen Sie mich doch lieber, wo ich hinwill. Das ist wichtig. Wo jemand hinwill.«
Er brachte es nicht fertig, ihr zu widersprechen, ihr zu sagen, dass es sehr wohl wichtig war, wo man herkam. Dass er nicht er wäre, wenn er aus Chicago oder New Orleans käme. Dass dann alles anders wäre und er ein anderer. Und dass woher man kam, ja nicht nur ein Ort sei, und man die Gegenwart nicht von der Vergangenheit lösen könne. Aber solche Dinge zu erklären, lag Terry nicht.
»Also, Charly, wo wollen Sie hin?«, fragte er schließlich.
»El Paso. Zum Bahnhof. Und dann mit dem Zug nach Kalifornien.«
»Kalifornien. Und was … was wollen Sie in Kalifornien?«
»Das ist ja ein richtiges Verhör.« Wieder dieses Lachen. »Was ich in Kalifornien will?« Charlotte griff nach seiner Hand, legte sie auf ihren Busen. »Ich will, dass es schnell schlägt. Dass ich aufwache und es schnell schlägt. Verstehen Sie?«
Er verstand nicht, nickte aber.
Sie stieß seine Hand weg. »Wie lange brauchen wir nach El Paso?«
»Wir?«
»Wie lange?«
»Vier Stunden, ungefähr. Fünf vielleicht.«
»Also kann ich auf Sie zählen?«
»Was …«
»Ich kann ja schlecht zu Fuß nach El Paso. Helfen Sie mir?«
Diana würde sich Sorgen machen. Vielleicht würde sie jemanden von der Ranch nach Myrthel Spring schicken, und dann würde irgendwer erzählen, dass Terry Carmen’s Diner vor Stunden verlassen hatte. Zusammen mit einer blonden Frau.
Eines Tages würde es ein Telefon auf der Ranch geben, dann würde er Diana anrufen und sagen: »Eine blonde Frau braucht meine Hilfe. Sie kann ja schlecht zu Fuß nach El Paso. Und ich würde sie auch fahren, wenn sie hässlich wäre.« Eines Tages, aber was nützte ihm das jetzt. Er musste eine Entscheidung treffen. Eigentlich lag ihm das: Welche Pferde zu behalten, welche zu verkaufen waren. Ob man die Herde aufstocken sollte. Wie viele Cowboys man zum roundup im Frühling und im Winter anheuern musste. Aber jetzt zögerte er. Er wollte Ja sagen. Er wollte Nein sagen. Das Richtige tun. Er wollte Charlys Lachen hören und sie noch einmal berühren.
»Terry? Kann ich auf dich zählen?«
Im Radio sprach man über den Vietnamkrieg. Über Johnsons Entschluss, die Anzahl der Soldaten auf 125000aufzustocken. Man würde den Vietcong das Fürchten lehren. Absolute Überlegenheit demonstrieren. Der Präsident hatte gesagt: »Wenn die Kommunisten erst einmal so wie wir wissen, dass eine Gewaltlösung unmöglich ist, ist eine friedliche Lösung unvermeidbar.«
»Gibt es keine Musik?«, fragte Charlotte. »Immer diese Kriege, ständig ist Krieg.«
»Ein Freund von mir ist in Vietnam. Navy.«
»Ich war noch nie in China.«
»Vietnam ist nicht in China.«
»Na ja, ist doch alles sehr gleich. Ich kannte einen Chinesen. Zumindest dachte ich, er wäre Chinese. Er nannte sich Joseph, weil niemand seinen Namen aussprechen konnte. Aber er war gar kein Chinese, sondern Japaner.«
»Aha«, sagte Terry, ohne zu verstehen, was der Japaner mit Vietnam zu tun hatte. Aber vielleicht musste man nicht alles verstehen. Vielleicht hatten blonde Frauen, die auf Schiffen herkamen, ihre eigene Logik.
»Joseph war ein feiner Mensch. Er konnte wunderschön Flöte spielen. Ich dachte, ich würde ihn eines Tages heiraten, aber ich war bloß ein Kind und Joseph sehr alt.«
Aus dem Radio kam nur noch ein Knistern. Charlotte drehte an den Knöpfen, vergeblich. »Jetzt gibt es gar nichts mehr. Keinen Krieg, keine Musik.« Sie blickte aus dem Fenster, Kakteen, Hügel, unendliche Weite. »Wie man hier leben kann …«
»Was meinst du?«
»Na ja, ist doch alles sehr karg hier. Man hat das Gefühl, dass die Zeit stillsteht, dass in fünfzig Jahren alles genauso sein wird, wie es schon vor fünfzig Jahren war.«
»Carmen hat eine Klimaanlage, die gab es vor fünfzig Jahren nicht, es gab ja nicht mal Carmen vor fünfzig Jahren.«
»Ach, Terry.« Sie berührte seinen Unterarm. »Du nimmst alles sehr genau, was?«
»Aber schau doch aus dem Fenster, schau doch!«
»Da ist nichts.«
Wo sie nichts sah, sah er Schönheit, sah er Heimat. Wie erklärt man Schönheit? Wie erklärt man Heimat? Terry hatte keine Worte dafür. »Schau doch!«, sagte er noch einmal. Charlotte schüttelte nur lachend den Kopf.
Städte hatte er nie gemocht. Nicht dass er viele gesehen oder dort viel Zeit verbracht hätte. Zwei Mal war er in Dallas gewesen und vielleicht sieben Mal in El Paso. Verkehr, Menschen, ja selbst die Gebäude schienen um Aufmerksamkeit zu buhlen. Ein stetes Rauschen, das ihn verwirrte.
Sie erreichten den Bahnhof.
»Na, dann heißt es jetzt Abschied nehmen«, sagte Charlotte und öffnete die Beifahrertür.
»Warte!« Er griff nach ihrer Hand, spürte die weiche Haut. Auch diese Zartheit verwirrte ihn, eine andere Art Verwirrung. Die weiche Hand ließ ihn wissen, dass sie fortwollte, also ließ er los, zog den Kugelschreiber aus seiner Hemdtasche, zerriss eine Streichholzschachtel und schrieb in Druckbuchstaben:
Finsher Ranch – Terry Finsher
PO Box 17, Myrthel Spring, Texas
»Vielleicht möchtest du mir schreiben.«
»Ich schreibe nie.«
»Aber vielleicht eines Tages, irgendwann.«
Mit einem Lächeln, das mehr war als eine freundliche Geste – das fühlte er genau –, ließ sie das Stückchen Pappe in ihrer Lederhandtasche verschwinden.
Sein Angebot, sie zum Schalter zu begleiten, lehnte sie ab, und so blieb Terry nichts anderes übrig, als ihr den Koffer zu reichen und Lebewohl zu sagen.
Terry sollte die blonde Frau nie vergessen. Jeden ersten Dienstag im Monat hoffte er, einen Brief oder zumindest eine Karte von Charlotte in seiner Post zu finden.
Charlotte vergaß Terry ziemlich schnell. Doch viele Jahre später sollte sie sich wieder an den jungen Rancher aus Texas erinnern.
Nicht vergessen und wieder erinnern sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
An diesem Tag fuhr kein Zug mehr, Charlotte verbrachte die Nacht in einem Hotel in Bahnhofsnähe. Schon am frühen Abend legte sie sich in einem dunkelroten Negligé auf das Doppelbett.
Es war eines von Dutzenden Hotelzimmern, in denen Charlotte seit ihrer Ankunft in New York übernachtet hatte.
Sie spürte ihr Herz schlagen, schnell.
Noch vor kurzem hatte sie in Heidelberg gelebt. Charlotte – das uneheliche Kind eines amerikanischen Offiziers und seiner badischen Haushälterin.
Wahrscheinlich hatte der Offizier sich einsam gefühlt in dem fremden Land. Seine rechtmäßige Frau war noch in Maryland. Die Haushälterin Helga, ein hübsches, etwas ängstliches Fräulein, wärmte Jonathans Körper. Dann rückte die Ehefrau samt siebzehn Koffern und einer senilen Schwiegermutter an. Charlotte war gerade elf Monate alt. Außer einem schlechten Gewissen empfand Jonathan Foreman nicht viel für sein Kind. Doch sein Ehrgefühl gebot ihm, Verantwortung zu übernehmen, gerade so viel, dass es keine Umstände machte. Er sorgte dafür, dass Charlotte Englisch lernte und Helga ihren Posten als Haushälterin behielt. Die Ehefrau nahm weder Anstoß an Helgas Anwesenheit noch an Charlottes Existenz, obwohl sie wusste, wer der Vater des Mädchens war. Selbst die senile Schwiegermutter sah sofort die Ähnlichkeit. Man schwieg einvernehmlich.
Ein Tag verlief wie der andere. Charlotte hatte immer gewusst, dass sie raus wollte, aus dem Haus, der Stadt, dem Land.
Vor einem knappen Jahr war Helga an Gebärmutterkrebs gestorben. Bis zum Schluss hatte sie das Parkett des zweistöckigen Hauses gebohnert und für die Offiziersfamilie gekocht, geputzt und gewaschen.
Nie hatte Charlotte Forderungen an ihren Erzeuger gestellt, nur genommen, was er freiwillig gegeben hatte. Erst nach dem Begräbnis der Mutter bat sie ihn um einen Gefallen.
Es rührte den eitlen Mann, dass Charlotte seine Heimat kennenlernen wollte. Zwar konnte die junge Frau ihm nicht erklären, was genau sie dort wollte, aber das kümmerte Jonathan nicht weiter. Fast zwanzig Jahre nach ihrer Geburt erhielt Charlotte den Namen ihres leiblichen Vaters und einen amerikanischen Pass. Der Offizier und Charlotte nahmen Abschied voneinander. Auch diese letzte Umarmung war nicht mehr als eine Pose.
Und endlich war Charlotte frei: Befreit von der Mutter, diesem bedauernswerten Wesen, die ihre besten Jahre einem Mann geopfert hatte, der ihr außer Millionen Spermien nichts hatte geben können. Helga, die Haushälterin, die es allen recht machen wollte und jede Demütigung schweigend hinnahm. Helga, die sich so leise bewegte, so leise sprach, dass man ihre Anwesenheit mühelos ignorieren konnte.
Die Erbschaft der Mutter wurde in eine Schiffsfahrkarte und ein Bündel Dollarscheine investiert.
Charlottes Habseligkeiten passten in einen kleinen Koffer. Zuletzt packte sie Helgas dunkelrotes Negligé ein, das Einzige, was an der Mutter nicht ängstlich gewesen war. Es schien von der Möglichkeit eines anderen Lebens zu erzählen. Dass einst auch für die Haushälterin Helga ein Türchen offen gestanden hatte. Ein Leben, in dem es ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Freude gegeben hätte. Ein bisschen mehr als Bohnerwachs und den Samen eines amerikanischen Offiziers.
Als freie Frau hatte Charlotte Foreman, geborene Kirchner, das Deck des Schiffes betreten. Das Herz schlug schnell.
Er war ein Dichter. Die schwarzen Haare und die dunklen Augen bildeten einen hübschen Kontrast zu seiner blassen Haut. Im Zug nach Kalifornien las er Charlotte seine Geschichten vor. Geschichten, die nie in einem Happy End oder einer Tragödie endeten, sondern einfach zwischen zwei Gläsern abbrachen.
Der Erzähler fand seine Titelheldinnen in Bars und Kneipen, in denen Dunkelheit herrschte. Hier schien die Sonne auch am Tag nur durch verschlossene Vorhänge. Es wurde getrunken, gevögelt und gehofft.
»Und das ist alles so passiert?«, fragte Charlotte.
»Nie genau so.«
»Aber so in etwa, ja?«
Er lachte.
»Und sind die Frauen dir nicht böse. Zum Beispiel diese Lara. Seitenlang beschreibst du, wie sie untenrum aussieht. Das kann ihr doch nicht gefallen haben? Ich meine, falls es Lara wirklich gibt.«
»Sag ich denn etwas Schlechtes über sie?«
»Aber es geht doch niemanden etwas an.«
»Laras Möse sah aus wie jede andere. Ein Loch. Wäre das besser gewesen? Lara war nicht besonders klug, nicht besonders schön, sie war nichts Besonderes. Das ist die reale Lara. Die fiktive hingegen ist eine … eine Königin der Nacht. Das sollte ihr doch gefallen.«
»Ich weiß nicht. Die ganzen Frauen, sie … sie wirken so, na ja, so verloren.«
»Verloren sind wir alle. Du. Ich. Lara.«
Während der Sunset Limited durch Arizona fuhr, aßen Charlotte und der Dichter ein Sandwich in der Lounge Car und teilten später, zurück auf ihren Sitzen, eine Flasche Wein, die er mitgebracht hatte.
»Ich traf sie in einem Zug, sie sah aus wie die junge Marlene Dietrich. Etwas Fremdes färbte ihre Worte. Sie trank meinen Wein. Als ich meine Hand unter ihren Rock schob …«
»Was soll das werden?«, unterbrach Charlotte ihn.
»Ich schreibe deine Geschichte.«
»Ach ja?«
»Ach ja.«
»Du hast deine Hand nicht unter meinen Rock geschoben, und du wirst es auch nicht tun.«
»In meiner Geschichte schon.«
»So einfach ist das?«
Er nickte. »Versuch es.«
»Was?«
»Der letzte Mann, den du getroffen hast?«
»Terry«, sagte sie. »Terry aus … aus …« Sie holte das Stückchen Pappe aus ihrer Handtasche. »… Terry aus Myrthel Spring, Texas. Wir haben Rühreier gegessen. Dann hat er mich nach El Paso gefahren. Ende.«
Der Dichter lachte. »Myrthel Spring. Wir nennen die Geschichte Myrthel Spring.«
»Es ist doch gar keine Geschichte.«
»Myrthel Spring – schon der Titel ist poetisch … Und eines Tages kamen sie nach Myrthel Spring, all die Verlorenen, Verkannten und Verwundeten, und sie fanden … sie fanden …« Er verstummte.
»Was fanden sie?«
Für einen Moment schloss der Dichter seine Augen. Dann sah er Charlotte an. »Ich weiß es nicht.«
»Ach ja?« Sie schüttelte den Kopf. »So einfach ist es dann doch nicht, wie?«
Als sie sich verabschiedeten, sagte keiner von ihnen: Auf bald. Sie wünschten einander nur »Viel Glück!«
Irgendwo hatte Charlotte gehört, dass es in Los Angeles nach Orangenblüten duften würde, doch es roch nach allem Möglichen, nur nicht nach Orangenblüten.
Im Hotel roch es nach Fäulnis und getrocknetem Schweiß, leicht überdeckt von einem Putzmittel, das sie an ihre Mutter erinnerte. Charlotte bewohnte ein Zimmer in der achten Etage eines vierzehnstöckigen Gebäudes in Downtown.
Der Zufall hatte sie hierhergeführt. Für diejenigen, die sich nur vom Schlag ihres Herzens leiten lassen, ist der Zufall der einzige Wegweiser.
2Freiheit
Collin Goodwin wuchs in Long Beach auf, bei seinem Vater und der halbverrückten Polin. Die halbverrückte Polin war Collins Großmutter. Der Junge hatte nie geglaubt, dass dieses seltsame Wesen tatsächlich mit ihm verwandt war.
Tagsüber arbeitete der Vater in einer Werkstatt. Er war Automechaniker. Nach der Arbeit kam er nach Hause, aß, was die Polin gekocht hatte, und dann verschwand er wieder. Die Wohnung schloss er von außen ab. »Zu eurer Sicherheit«, sagte Donald Miroslaw Goodwin zu Collin und der Großmutter. »Damit euch niemand klaut.«
Meist kam er erst im Morgengrauen zurück, schlief ein Stündchen auf der Couch, bis der Wecker klingelte. Ein blechernes Ungetüm, das ein Eigenleben zu führen schien. An manchen Tagen schellte der Wecker so laut, dass ganz Long Beach es hören musste, an anderen Tagen summte er nur leise, als wollte er niemanden stören.
Die polnische Großmutter weinte viel. Ihr Englisch beschränkte sich auf wenige Wörter. Du. Da. Ja. Nein. Essen. Ich Pole. Du Pole.
Sie roch ranzig. Vor allem aus dem Mund.
Collin sprach kein Polnisch und sein Vater nur gebrochen. Als Kind hatte Donald die Sprache seiner Mutter beherrscht, aber dann wurde Agnieszka halbverrückt und redete nur noch Unsinn. Die polnischen Unterhaltungen verschwanden aus dem Hause Goodwin.
Niemand konnte oder wollte Collin sagen, wo seine Mutter war. »Sie ist weg«, war die einzige Antwort, die er jemals bekommen hatte. Obwohl er keine Erinnerung an seine Mutter hatte, fehlte sie ihm. Nicht die Frau, die ihn rausgepresst hatte. Eine Mutter zu haben, das fehlte ihm. Selbst eine Stiefmutter hätte genügt. Jemand, der nachts bei ihm blieb, ihn nicht mit der Verrückten alleinließ.
Der Vater verbot Collin, die Großmutter verrückt zu nennen. »Halbverrückt. Sie ist halbverrückt, und das ist ein gewaltiger Unterschied.«
Jedes Mal, wenn der Vater die Tür abschloss, setzte Collins Herz für einen Moment aus. Warum musste er sie einsperren? Wer würde sie schon klauen? Eine verrückte Polin und ein Kind, damit kann doch keiner etwas anfangen.
Eines Nachts, als Collin schon fast eingeschlafen war, schrie die Großmutter. Es war nicht das übliche Weinen, an das er sich einigermaßen gewöhnt hatte. Er hielt den Atem an, bewegte sich nicht, hoffte, dass es aufhören würde. Aber die Alte schrie und schrie und schrie. Er schlich ins Wohnzimmer. Wie ein Tier wälzte die Großmutter sich auf dem Boden.
»Sei still«, sagte Collin. »Sei doch bitte still.«
Vorsichtig berührte er ihre Schulter. Sie verstummte. Dann sah sie ihn an. »Du Pole«, sagte sie. »Du Pole. Ich Pole. Du Pole.«
Sie richtete sich auf. Packte ihn bei den Armen und schüttelte ihn, mit einer Kraft, die er ihr niemals zugetraut hätte. Mühsam machte er sich los. Lief zur Tür. Er hatte Angst. Wollte raus. Doch die Tür, die verdammte Tür war abgeschlossen.
Die Großmutter stand hinter ihm. »Du Pole«, brüllte sie. Er dachte, sein Trommelfell würde zerspringen. Er stieß sie zurück und rannte in sein Zimmer. Schob einen Stuhl unter die Klinke und öffnete das Fenster. Sie wohnten im dritten Stock. Es war zu hoch.
Rittlings setzte er sich auf das Fensterbrett. Ein Bein baumelte im Freien. Zumindest ein Bein war frei.
Am nächsten Tag erzählte er seinem Vater, was passiert war.
»Du übertreibst«, sagte er.
»Sie hat mich gepackt. Sie ist verrückt.«
»Halbverrückt. Agnieszka ist halbverrückt. Und was soll ich machen? Sie erschießen? Du bist doch ein Junge, ein starker Junge. Willst du mir etwa erzählen, dass der alte Lappen da«, er deutete auf die Großmutter, »dir Angst macht?«
»Bitte, Papa, schließ nicht mehr ab.«
»Damit euch jemand klaut, ja? Willst du das? Ja?«
»Papa. Bitte …«
»Hör auf mit der Heulerei.«
»Niemand klaut Leute einfach aus der Wohnung. Und schon gar nicht …«
»Schluss jetzt«, sagte Donald.
Collin wusste nicht, dass dem Vater schon einmal jemand aus der Wohnung geklaut worden war. Eines Abends war ein Mann gekommen und hatte Zoe Goodwin mitgenommen. Dass Zoe freiwillig gegangen und der Mann ihr Geliebter gewesen war, hatte Donald verdrängt. Ebenso die Tatsache, dass Zoe ihn schon lange nicht mehr geliebt, ihre Schwiegermutter immer gehasst und das Kind niemals gewollt hatte. Zoe wurde geklaut – das war Donalds Wahrheit. Er ahnte, wie zerbrechlich seine Wahrheit war, deshalb behielt er sie lieber für sich.
Seit jenem Abend saß Collin jede Nacht auf dem Fensterbrett. Ein Bein in der Freiheit. Erst wenn der Vater zurück war, legte sich Collin in sein Bett. Der Schlaf verschwand aus den Nächten und flüchtete in die Tage. Aus dem recht guten Schüler wurde ein ziemlich schlechter. Im Unterricht konnte Collin sich nicht konzentrieren, manchmal fielen seine Augen einfach zu.
Seit ein paar Monaten wohnte Collin in Ozzys Garage, die er sich mit einem alten Crosley Super Station Wagon teilte. Das taubengraue Gefährt war sein erstes eigenes Auto.
Nachdem er die Highschool abgebrochen hatte, war er von Long Beach nach Los Angeles gezogen, hatte in den Küchen sämtlicher Diners gearbeitet.
Ein eigenes Zuhause konnte er sich nicht leisten. Meist war er in den vier Wänden fremder Menschen untergekommen. Manchmal wurden aus den Fremden fast Freunde. Meistens nicht.
Ozzys Garage empfand Collin als Aufstieg. Er, sein Auto, ein Bett. Das war nicht viel und auch nicht sehr schön, für Collin aber war es Freiheit.
Er hatte Ozzy im Whisky kennengelernt. Ein paar Stunden vorher hatte Mary Collin verkündet, dass er ausziehen müsse.
»Ich werde heiraten«, hatte sie gesagt.
»Heiraten? Wen?«
»Er heißt Bill.«
»Wusste gar nicht, dass du einen Freund hast.«
»Ist ziemlich frisch.«
»Und ihr heiratet?«
»Ja. Er hat noch nicht gefragt, aber ich habe da so ein Gefühl, und es wäre komisch, wenn … na ja, wenn hier ein anderer Mann lebt. Ich will nicht, dass er denkt … Tut mir leid, aber du musst ausziehen.«
Collin hatte sich bei Mary beinahe wohl gefühlt. Die Miete war günstig, das Apartment hübsch eingerichtet. Mary wusch seine Wäsche, ohne ihm etwas dafür zu berechnen, und abends wartete eine warme Mahlzeit auf ihn. Eigentlich ideal, wären da nicht Marys Annäherungsversuche gewesen. Hände, Knie, die Collin wie zufällig berührten. Mary war groß und dick. Ein dreiundzwanzigjähriges Mädchen mit zu engen Kleidern am Leib und zu viel Make-up im Gesicht.
Aber es war nicht ihr Äußeres, das Collin abschreckte, es war die Verzweiflung, die in ihren Augen flackerte. Ein Fünkchen dieser Verzweiflung wohnte auch in ihm. Manchmal, wenn Marys graue Augen ihn zu lange ansahen, glaubte er, in einen Zerrspiegel zu schauen. Das Gefühl, das er fürchtete, das er im Schach zu halten versuchte, wuchs unter ihrem Blick, breitete sich in ihm aus.
Ähnliche Augen wie Marys gab es zu Tausenden in Los Angeles. Menschen mit übergroßen Träumen, Menschen mit begrabenen Träumen und Menschen, die niemals Träume gehabt hatten.