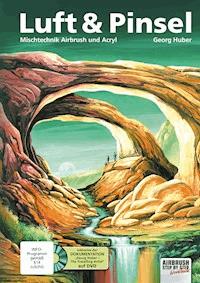Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schirner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schönes Haus in der Vorstadt, ein liebender Ehemann, ein wundervoller Sohn: Obwohl sie all das hat, glaubt die junge Amerikanerin Violet, ihr Glück im Job statt im wahren Leben zu finden. Erst als eine Erkrankung sie zum Innehalten zwingt, erkennt sie, wie weit sie von ihrem wahren Lebensglück entfernt ist. Zwar hat sie nun wieder mehr Zeit für ihre Familie, doch plötzlich plagen sie mysteriöse Träume. Erinnerungen an eine unglückliche Kindheit werden wach. Bei dem Versuch, Klarheit in ihre Gefühle zu bringen, ahnt sie noch nicht, dass sie sich bald auf eine Suche begeben wird, die sie für immer verändern soll. 'Adayuma ' - ein Roman, der Ihnen auf authentische und gefühlvolle Weise zeigt, wie stark die Themen Identitätsfindung, Sinnsuche und Vergebung mit dem Konzept vom individuellen Lebensglück verknüpft sind. Begeben Sie sich auf eine emotionale und erkenntnisreiche Reise, die Sie im Herzen berührt und Sie erkennen lässt, was im Leben wirklich zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORG HUBER
Adayuma
oder bis die Seele vergibt
Über den Autor
Mit dem 15. Lebensjahr begann Georg Huber sich aufgrund eigener »Schicksalsschläge« in der Kindheit und Krankheiten mit dem Thema Heilung auseinanderzusetzen. Er fing an, alte Kulturen und Mysterien zu studieren, und fand Antworten im indianischen Brauchtum.
Als Georg Huber 18 Jahre alt wurde, festigte sich sein Wunsch, Heilung zu erlernen und weiterzugeben. Er ließ sich in einer Energieform (H.U.E) ausbilden und zum Reikimeister weihen. Es folgten weitere Ausbildungen in den Bereichen der psychologischen und körperlichen Heilung, wie der Chakrenlehre, der Symbolarbeit, der Kinesiologie, der Systemaufstellung, der Arbeit mit dem inneren Kind, des Clearing-Beraters und des spirituellen Paarberaters. So sammelte Georg Huber vielfältige Erfahrungen sowie umfangreiches Wissen über die Themen Gesundheit, Spiritualität und Psychologie, das er in seinen Büchern, Veranstaltungen und Beratungen weitergibt.
»Adayuma oder bis die Seele vergibt« ist sein zweiter Roman, der sich dieser Themen annimmt.
Weitere Informationen zum Autor: www.jeomra.de
Originalausgabe Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-8434-6109-2
© 2013 Schirner Verlag, Darmstadt 1. E-Book-Auflage 2014
Umschlag:
Silja Bernspitz, Schirner, unter Verwendung von # 31377492 (Michael Rekochinsky),
www.fotolia.de
Redaktion: Kerstin Noack & Janina Vogel, Schirner E-Book-Erstellung: HSB T&M, Altenmünster
www.schirner.com
Inhalt
Über den Autor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
Mit einem komischen Geschmack im Mund wachte ich auf. Meine beiden Männer, Peter und Justin, lagen aneinandergeschmiegt neben mir im Bett. Justin lag wie immer etwas schräg. Welch ein Segen, dass wir uns ein Kingsize-Bett gekauft hatten, als ich schwanger war. Anders hätten wir niemals in einem Bett zusammen schlafen können.
Ich drehte meinen Kopf nach rechts zum Wecker, der auf meiner Kommode stand und mich mit seiner rot leuchtenden Schrift immer wieder ermahnte, aufzustehen und mich für die Arbeit fertigzumachen. Es war 7.24 Uhr.
Behutsam zog ich die Decke beiseite und stand leise auf. Ich fühlte mich an diesem Morgen wie gerädert, und zu allem Übel merkte ich, dass ich wohl nur noch wenige Sekunden hatte, bevor sich mein Mageninhalt von mir trennen würde.
Ich presste meine linke Hand gegen meinen Mund, während ich mit der rechten die Tür öffnete, um so schnell wie möglich ins Badezimmer zu kommen, das links neben unserem Schlafzimmer lag.
»Toll, so fängt der Tag ja super an«, fluchte ich leise, nachdem ich fertig war, und bemerkte, dass das Brennen in meinem Magen nachgelassen hatte.
An der Tür hing eine leichte Bluse, die ich mir gleich anzog. Anschließend ging ich hinunter in die Küche. Ich hatte gestern noch lange mit Peter zusammengesessen und mich mit ihm unterhalten. Es war schon einige Zeit her, dass wir uns einen schönen Abendausklang gegönnt hatten. Die Flasche Rotwein, die immer noch auf dem Tisch stand, erinnerte mich daran, und wahrscheinlich war sie es auch, die meine Übelkeit verursacht hatte.
Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und nahm die Flasche in die Hand. Prüfend las ich mir das Etikett durch, doch was sollte ich schon finden? Meine Freundin Linda hatte mir den Rotwein vor wenigen Tagen geschenkt und behauptet, dass er ein besonders edler Tropfen sei. Ob nun aber edel oder nicht, er war auf jeden Fall wieder aus meinem Magen herausgekommen. So besonders gut war er also anscheinend nicht gewesen.
Eilig räumte ich das herumstehende Geschirr in die Spülmaschine. Ich konnte es überhaupt nicht leiden, wenn ich morgens wach wurde und noch Reste vom Vortag überall im Haus verteilt standen. Selbst der Laptop auf dem Wohnzimmertisch war immer noch an. Vielleicht hatten wir gestern auch einfach ein Glas zu viel getrunken. Auf jeden Fall hatten wir gelacht. Mit Peter war es eigentlich immer leicht zu lachen. Dennoch war ich selbst für ihn ein schwieriger Kandidat. Schmunzeln, das fiel mir leicht, doch so richtig lauthals lachen? Das geschah wirklich selten.
Ich schaltete unsere Hightechkaffeemaschine an, bei der ich nur noch auf den Knopf drücken musste, und schon floss frisch gebrühter Kaffee in meine Tasse. Ich sog seinen Duft mit einem tiefen Atemzug ein.
An diesem Morgen war es in unserer Siedlung – einer typisch amerikanischen Vorstadtgegend – ungewöhnlich ruhig. Eine Ruhe, die ich in den letzten Monaten, fast schon Jahren, kaum noch gekannt hatte.
Unsere Firma war in den letzten Monaten aufgrund von zahlreichen Großaufträgen gewachsen, und wir zwölf Mitarbeiter kamen mit der Anzahl der Aufträge kaum noch hinterher.
Ich arbeitete in dem Unternehmen als Wirtschaftsprüferin und begutachtete als Juristin zugleich alle Verträge, die wir mit anderen Firmen abschlossen.
Mein Chef Perry achtete zwar darauf, dass seine liebe Violet abends auch mal nach Hause kam, aber dennoch blieb ich teilweise zwölf Stunden am Tag im Büro.
Und es kam nicht selten vor, dass ich selbst nach getaner Arbeit zu Hause noch Aufträge und Verträge überprüfte.
»Guten Morgen«, hauchte es in mein Ohr. Ich erschrak für einen Moment und beinahe wäre der Inhalt meiner Tasse übergeschwappt.
Ich war mal wieder so sehr in Gedanken versunken gewesen, dass ich meinen Mann nicht gehört hatte.
»Alles okay? Du bist heute Morgen so aus dem Bett gestürmt!«, fragte er mich mit einem besorgten Blick.
»Oh, ich dachte du schläfst. Ich wollte dich nicht wecken. Mir … ich glaube, ich habe gestern einfach zu viel Wein getrunken.«
»Hast du dich übergeben?«
Ich nickte.
Peter verzog das Gesicht. »Gott sei Dank, hast du mir das gesagt, ich wollte dir gerade einen Kuss geben!«, lächelte er frech und lief dicht an mir vorbei zum Kühlschrank.
»Hm«, hörte ich ihn brummen.
Ich nickte ihm zu und forderte ihn so auf, mir seine Gedanken mitzuteilen.
»Ach, nichts«, untertrieb er. »Ich erinnere mich nur, dass du beim letzten Mal, als dir morgens übel war, schon bald darauf einen dicken Bauch bekommen hast!«
»Ach, Peter.« Ich lief zu ihm rüber und küsste ihn auf die Wange.
Er wünschte sich so sehr ein weiteres Kind, und eigentlich wollte ich auch noch eines. Doch in den letzten drei Jahren war es aufgrund meines Jobs einfach nicht sinnvoll gewesen, schwanger zu werden.
»Musst du ins Büro, oder bleibst du noch etwas hier?«
Ich schüttelte den Kopf, während ich noch einen Schluck Kaffee nahm.
»Nein, nein, ich muss noch mal ins Büro. Vielleicht noch ein oder zwei Tage, dann bin ich aber durch.« Ich lächelte ihn an, ein bisschen, um ihn milde zu stimmen und um mich zu entschuldigen, aber auch, weil ich mich darauf freute, wieder etwas mehr Ruhe zu haben.
»Das ist schön. Du hast wirklich sehr viel gearbeitet in letzter Zeit!«
Rasch verschwand ich im Bad, um noch eine kurze, erfrischende Dusche zu nehmen. Dann aß ich schnell einen Toast und ging mit meinem Schlüssel zur Tür.
Justin lag immer noch im Bett und schlief. Er konnte problemlos zwölf Stunden am Stück schlafen, obwohl er schon sieben Jahre alt war und eigentlich deutlich weniger Schlaf brauchte.
Er kam da ganz nach seinem Vater. Überhaupt hatte er viel von ihm. »Gott sei Dank«, pflegte ich zu sagen, wenn mich jemand auf Justins Ähnlichkeit mit Peter hinwies.
Ich hatte wirklich viel Glück mit den beiden. Peter war als Ehemann einfach fantastisch, auch wenn es mich ja ab und zu störte, dass er immer so ruhig und ausgeglichen war. Ich war ja eher impulsiv. Vielleicht wirkte ich sogar manchmal unfreundlich und launisch. Nun, wenn man mich mit Peter verglich, war dem sicherlich auch so. Er war wirklich mein Fels in der Brandung oder der tiefe stille See. Ihn brachte nichts aus der Ruhe.
Und irgendwie war Justin genau so.
»Bis heute Nachmittag. Ich mache heute nicht so lang«, winkte ich Peter noch zu, der inzwischen aus der Küche gekommen war.
»Ja, bis bald, mein Schatz!«, antwortete er und lächelte mich an.
Für einen Moment blieb ich stehen, um ihn noch eine Sekunde länger anzuschauen.
Ich wusste genau, wie sehr er sich wünschte, dass ich öfter zu Hause wäre. Doch er ließ mich trotzdem einfach machen und meckerte nicht. Er gab mir nicht einmal zu verstehen, dass er mich lieber öfter zu Hause sehen würde. Er erwähnte es nie, nicht mit einem Satz.
Als ich unser Haus verließ und die Straße überquerte, um in mein Auto zu steigen, blickte ich etwas beschämt auf die Straße. Meine Familie brauchte mich. Peter und Justin brauchten mich, aber dennoch kam ich abends oft erst spät nach Hause.
Das Schlimmste daran: Ich hatte kein Problem damit.
Vielleicht dachte ich, etwas auf der Arbeit verpassen zu können, oder vielleicht flüchtete ich einfach vor meinem Familienleben. Ein Stück weit traf das sicherlich zu. Aber ich liebte auch meinen Job und ebenso den Stress, der damit verbunden war.
Kaum saß ich im Auto, klingelte auch schon mein Handy: Die Arbeit ging los.
Bis zum Mittag, bis 13 Uhr, arbeitete ich im Akkord. Ich schrieb Briefe, überprüfte Verträge und war ständig am Telefonhörer. Eine Zeit lang war ich abgelenkt.
Doch bald schon merkte ich, dass die Übelkeit sich wieder zeigte. Ich bat meine Sekretärin, mir einen Kamillentee zu machen, und arbeitete einfach weiter. So ging es immer. Selbst wenn es mich doch einmal erwischte und ich erkältet war: Von meiner Arbeit brachte mich nichts ab.
Nach dem Mittagessen hatten wir eine Besprechung mit der Delegation einer japanischen Firma – der wahrscheinlich wichtigste Termin, den wir für längere Zeit haben würden. Es ging um einen Auftrag, der unserer Firma eine hübsche Summe Geld einbringen würde. Durch die Glaswand meines Büros blickte ich nach draußen und sah, wie Perry aufgeregt durch die Gänge lief und seine Mitarbeiter nervös auf ihre Vorbereitung hin überprüfte. Er hatte die Angewohnheit, alles zu kontrollieren, damit nichts schieflaufen konnte. Ich hatte das Glück, dass er mich nie kontrollierte. Er vertraute mir und wusste, dass ich meine Aufgaben zuverlässig erledigte. Mehr noch, Perry kümmerte sich sehr um mich, besser gesagt, er umsorgte mich. Er war in den letzten Jahren fast wie ein Vater für mich geworden, und ich war sein großes Mädchen, das er mit ein wenig Stolz zur Schau stellte. Zu gern hätte er mich als seine Partnerin in der Geschäftsführung gesehen, und der Gedanke schmeichelte mir natürlich. Doch dies würde bedeuten, dass ich genauso viel wie er arbeiten müsste. Ich würde noch mehr Zeit in der Firma verbringen, mehr, als ich es ohnehin schon tat. So sehr ich das auch liebte, ich hatte die Grenze der Belastbarkeit erreicht. Ob ich mir das nun eingestand oder nicht.
Ich gönnte mir noch einen Blick in den Spiegel, kämmte meine langen, rotbraunen Haare, zog etwas Lippenstift nach, ganz dezent, und ging dann zum Meeting.
Perry holte mich ab und zog aufgeregt seine Augenbrauen nach oben.
Er zupfte hier und da an seinem Anzug, der etwas eng an seinem kugelrunden Bauch lag.
»Alles gut?«
Ich nickte nur stumm und lächelte ihn an.
»Na, dann. Los geht’s!«
Das Meeting dauerte neunzig Minuten, und ich trank in der Zeit bestimmt einen Liter Wasser. Es war nicht der Durst, der mich dazu zwang, sondern die immer wieder auftretende Übelkeit. Da waren immer noch dieses Brennen in der Magengegend und der saure Geschmack, der kurz danach in meinen Mund stieg.
Was war bloß los mit mir?
Ich verabschiedete mich von meinen japanischen Partnern – denn das waren sie ja jetzt –, und lief schnellen Schrittes in mein Büro zurück.
Ich bat meine Sekretärin um einen weiteren Tee und wies sie darauf hin, dass ich in der nächsten halbe Stunde nicht gestört werden wollte.
Um dies auch für jedermann erkennbar zu machen, ließ ich die Jalousien meines Büros im schnellen Zuge nach unten fallen.
Wieder bahnte sich die saure Magenflüssigkeit einen Weg in meinen Mund, und fast hätte ich mich daran erbrechen müssen. Ich ließ mich auf meinen Sessel fallen, schlug ein Bein über das andere und presste mit der Hand auf meinen Magen.
Ich hatte mir doch hoffentlich nichts eingefangen? Irgendwie beunruhigte mich das Ganze. Seit einigen Tagen schlief ich sehr schlecht, und in mir war ein leeres Gefühl. Ich war irgendwie melancholisch geworden, vielleicht sogar depressiv. Ich hatte in meinem Leben schon immer viel nachgedacht, aber in letzter Zeit waren meine Gedanken von trauriger Natur. Nicht greifbar traurig, es war nur dieses sinnlose und traurige Gefühl in mir, das mich durch den Tag begleitete. Ja, vielleicht war »sinnlos« das richtige Wort. Alles, was ich tat, kam mir ohne Sinn vor, ohne große Freude, und selbst wenn ich Freude bei anderen Menschen sah, konnte ich sie nicht teilen.
Es klopfte an der Tür. Perry sagte etwas, was ich nicht verstand, und so bat ich ihn hereinzukommen.
»War das nicht großartig«, rief er, während er die Tür aufmachte und einen Fuß ins Büro tat. »Und du warst mal wieder die Überzeugendere von uns beiden …«, er holte tief Luft, um weiterzusprechen, doch als er mich auf dem Sessel sah, mit der Tasse Tee in der Hand, stoppte er. Ein klein wenig tat er mir in diesem Augenblick leid. Er freute sich wie ein kleines Kind, und ich saß da und kämpfte, mich nicht wieder übergeben zu müssen.
»Violet, was ist los mit dir? Du bist ja richtig blass.«
Vorsichtig kam er ein paar Schritte auf mich zu, und ich zuckte nur mit den Schultern.
»Lass dir von mir nicht die Freude verderben. Ich habe vielleicht einfach etwas Falsches gegessen.«
»Aber du hast doch nur einen Salat gegessen! Meinst du denn, die Soße war nicht gut?«
Ich lächelte zaghaft. »Nein, das habe ich schon seit heute Morgen.«
Als ich das aussprach, schoss wieder die Säure in meinen Mund, und wieder hatte ich nur wenige Sekunden Zeit. Doch dieses Mal waren es nicht nur zwei Schritte, sondern ich musste den Gang hinunterlaufen, wo die Toiletten waren. Ohne ein Wort zu sagen, rannte ich an Perry vorbei und verschwand aus meinem Büro.
Ich musste auch nichts sagen, denn die Hand auf meinem Mund und der gequälte Ausdruck in meinem Gesicht hatten wohl genug Ausdruckskraft.
Auf der Toilette konnte ich meinen Magen nicht weiter zurückhalten. Wieder stützte ich mich auf die Toilette und gab dem Wunsch meines Magens, sich zu entleeren, nach. Nachdem ich meine Augen wieder geöffnet hatte, sah ich zu meinem Erschrecken, dass mein Mageninhalt rot und schleimig war.
Oh, Gott. Schwach ließ ich mich neben die Toilette fallen.
Ich zog fest am Toilettenpapier und wischte mir den Mund ab. Auch auf meinen Lippen waren Spuren von Blut. Als ob ich das Problem einfach wegwischen könnte, ließ ich das Wasser im Waschbecken laufen und wusch mir immer wieder den Mund aus. Es war niemand außer mir im Bad, und ein wenig beruhigte mich das. Die Wirtschaftsprüferin war auf dem Klo und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Keine besonders tolle Vorstellung.
Ich hörte es leise an der Tür klopfen. Perry wartete schon draußen auf mich.
»Ich denke, du solltest besser nach Hause gehen, meine Liebe«, ermahnte er mich, als ich raus auf den Gang kam.
Erst wollte ich den Kopf schütteln und ihm sagen, dass es keinen Grund dazu gäbe. Doch dann siegte die Vernunft in mir.
»Nein, Perry. Ich werde zum Arzt gehen, ich habe gerade Blut gebrochen.«
Perry riss entsetzt seine Augen auf und blickte mich besorgt an.
»Komm mit, Mädchen«, sagte er laut und zog mich an der Hand in sein Büro.
»Setz dich bitte«, nuschelte er und deutete mit seiner Hand auf den bequemen Sessel vor seinem Schreibtisch.
»Du weißt, ich habe manchmal ziemlich üble Darmprobleme. Ich habe einen richtig guten Arzt, und den ruf ich jetzt an.«
Ich ließ ihn einfach machen. Was blieb mir auch anderes übrig? Es war sicherlich nicht falsch, und ich vertraute Perry, so, wie er auch mir vertraute.
2.
Nur wenige Minuten später saß ich beim Facharzt für Magen- und Darmprobleme im Wartezimmer. Dort war niemand außer mir. Normalerweise hatte der Arzt geschlossen, doch durch meine Versicherung hatte ich gewisse Vorteile, die andere nicht hatten: Ich wurde behandelt wie eine Königin, und so musste ich auch nie lange warten.
Die Angestellte des Arztes öffnete dann auch schon lächelnd die milchige Glastür des Wartezimmers und bat mich, ins Behandlungszimmer zu gehen. Nach einem kurzen Gespräch bekam ich eine örtliche Betäubung, und der Arzt schob mir einen Schlauch durch den Mund in den Magen. Trotz der Betäubung ein extrem unangenehmes Gefühl!
Als der Arzt seine Gummihandschuhe auszog und in den Müll warf, fragte ich nur: »Und?«, und nahm hastig einen Schluck Wasser, das mir freundlicherweise schon hingestellt worden war.
Der Arzt sagte kein Wort, lief um seinen Schreibtisch herum und setzte sich.
»Wann sagten Sie, fing die Übelkeit bei Ihnen an?«
»Heute Morgen!« Ich wollte keine Antworten geben, sondern eine Antwort auf meine Frage bekommen.
Der Arzt nickte nur verwundert.
»Was ist denn jetzt? Ist da …?« Ich schluckte und traute mich nicht, das Wort auszusprechen.
»Nein, nein«, schüttelte er den Kopf. »Sie haben eine Magenentzündung, allerdings vom Feinsten. Das Gewebe und die Schleimhäute sind alle entzündet. Ihre Speiseröhre ist auch davon betroffen. Es wundert mich sehr, dass Sie jetzt erst zu mir kommen.«
Ich zuckte wieder mit den Schultern. »Es hat wirklich erst heute Morgen angefangen.«
Der Arzt nickte wieder nur und zog seine Schublade auf, um einen Block zu entnehmen. Er kritzelte etwas auf einen Zettel, dann etwas auf einen anderen, und schob mir beide Zettel zu.
»Was ist das?«, fragte ich, obwohl mir hätte klar sein müssen, dass ich ohne Behandlung mit der Entzündung nicht weit gekommen wäre.
»Das eine ist ein entzündungshemmendes Mittel, das andere Ihre Krankmeldung.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das brauche ich nicht, so schlimm ist es nicht.«
Der Arzt biss sich auf die Lippe und musterte mich.
»Ich sage es Ihnen ungern, aber die Übelkeit, die Sie heute verspüren, wird sicherlich noch stärker werden. Und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Sie Blut erbrechen müssen. Eine Magenentzündung, die nicht auskuriert wird, hat schlimme Folgen. Dazu gehören auch Geschwüre. Hören Sie bitte auf meinen Rat, und lassen Sie das Arbeiten. Am besten auch zu Hause. Machen Sie nichts, was Ihnen Stress bereitet!«
Ich seufzte laut. »Wie lange?«
»Mindestens drei Wochen«, schoss es aus seinem Mund.
Mein Kopf nickte wie von ganz allein. »Und woher kommt das?«
»Die Entzündung?«
»Ja, die Entzündung!«
»Das kann viele Auslöser haben. Aber das finden wir erst heraus, falls es nicht besser wird und wir weitere Untersuchungen machen müssen. Eine Ursache könnte allerdings der Stress sein, den Sie haben. Kurze und falsche Mahlzeiten, hastiges Essen, Alkohol und Kaffee. Wut und Stress. All das kann eine solche Entzündung verursachen.«
Wieder runzelte der Mann die Stirn und blickte mich musternd an.
»Aber bei der Entzündung, die Sie haben, muss das schon seit Jahren so gehen!«
Ich rieb mir übers Gesicht und schüttelte ungläubig den Kopf. Was würde Perry wohl jetzt denken?
»Okay! Ich gehe dann mal zurück und spreche mit meinem Chef.«
Der Arzt stand nickend auf und reichte mir die Hand. »Gute Besserung! Ich hoffe, Sie in vier Wochen wiederzusehen.«
3.
Perry ließ sofort alles stehen und liegen, als ich in sein Büro kam.
»Ich … ähm!«, begann ich.
»Ich weiß schon Bescheid, Violet!«
»Was? Er hat dich angerufen?«
Perry nickte.
»Aber, das darf der doch gar nicht!«, rief ich empört.
Perry kam auf mich zu und legte seine großen, dicken Hände auf meine Schulter.
»Nein, das darf er nicht, aber er befürchtete, dass du seine Empfehlung nicht ernst nimmst, und hat mich deswegen angerufen.«
Ich lächelte etwas, denn genau an die Empfehlung wollte ich mich nicht halten.
»Wir sehen uns in drei Wochen«, flüsterte Perry und lächelte mich an.
»Aber …« Ich plumpste in seinen Sessel und stützte meinen Kopf mit den Armen ab.
»Wie soll das denn gehen, Perry?«, fragte ich ihn und hoffte, er würde darauf keine Antwort finden.
»Wir haben die großen Aufträge hinter uns, Violet. Mary und ich werden das Kind schon schaukeln, und im Notfall lasse ich einen externen Prüfer kommen.«
Mary war meine Sekretärin, und tatsächlich kannte sie sich mittlerweile schon recht gut aus. »Meinst du wirklich, dass das geht?«
Perry lachte. »Meine liebe Violet, du bist nicht zu ersetzen, aber zumindest eine Zeit lang werden wir es versuchen.«
Er stand auf und klopfte sich auf seinen Bauch. »Traust du mir das etwa nicht zu?«
Ich schmunzelte und nickte schließlich, doch dieses Mal war die Zustimmung erkennbar. »Peter und Justin werden sich sicherlich freuen, wenn du mehr Zeit mit ihnen verbringst, und es war auch schon lange nötig, dass du mal wieder öfter zu Hause bist!«
Ich lief zu Perry und umarmte ihn fest. Ich war einfach dankbar, ihn als Chef zu haben.
»Ich melde mich gelegentlich bei dir und berichte, wie es mir geht.«
»Ich werde dich kaum davon abhalten können.«
Wieder lächelte ich.
»Ich geh noch zu Mary und …«
»Nein, du gehst jetzt nach Hause. Lass mich das machen!«, widersprach er mir.
Ich nickte nur still. Er hatte recht, ich sollte nach Hause gehen und mich ausruhen.
Außerdem musste ich noch die Tabletten holen, die mir der Arzt verschrieben hatte. »Okay«, antwortete ich ihm und hängte mir meine Tasche über die Schulter.
Perry stand auf und öffnete mir die Tür. »Ruh dich aus. Wir schaffen das schon. Es ist wichtig, dass du wieder fit wirst! Wir brauchen dich hier!«
Immer noch fassungslos lief ich zur Tiefgarage und stieg in mein Auto. Erst am Morgen hatte ich darüber nachgedacht, dass ich wirklich etwas zu viel gearbeitet hatte, aber musste das denn jetzt sein? Gleich drei Wochen zu Hause?
Ich fuhr in die Apotheke, ein Ort, an dem ich die letzten Jahre kaum gewesen war.
Wenn Justin etwas fehlte, hatte Peter sich stets darum gekümmert. Ich hatte eine Apotheke oder eine Arztpraxis nur selten zu Gesicht bekommen.
4.
Peter war gerade mit Justin im Garten auf dem Trampolin springen, als er mich durch die Glastür auf die Veranda kommen sah.
»Hey, Mommy!«, rief er laut und sprang weiter mit Justin an den Händen in die Höhe.
An meinem Lächeln erkannte er, dass etwas nicht in Ordnung war, und so hörte er augenblicklich mit dem Springen auf und setzte sich neben mich auf die Bank.
Justin hüpfte weiter und winkte mir freudig zu. Ich schickte ihm einen Kuss und winkte ebenfalls.
»Was ist los?«, fragte er und legte seine Hand auf mein Bein.
Ich ließ meinen Kopf auf seine Schulter fallen und lehnte mich an ihn.
»Ich war beim Arzt, Peter. Ich habe eine Magenentzündung!«
»Ist es schlimm?«, fragte er.
»Ich habe vorhin Blut gebrochen!«
Er schob mich von sich weg und blickte mir in die Augen.
»Du hast Blut gebrochen?«
Ich nickte nur.
»Was hat der Arzt gemacht? Was hat er gesagt?«
Ich berichtete ihm von meinem Untersuchungstermin und versuchte, ihn und mich selbst zu beruhigen.
Peter hörte mir aufmerksam zu.
»Das ist sehr anständig von Perry«, sagte er schließlich, als ich fertig war. »Ich finde das ist eine gute Idee, du solltest dich erholen!«
Kein Wort davon, wie sehr er sich selbst freute, dass ich zu Hause bleiben konnte. Es ging ihm immer nur darum, dass es mir gut ging.
»Mommy, komm!«, rief Justin vom Trampolin und winkte. Ich stand auf und lief ans Sicherheitsnetz. »Oh, ich kann nicht, mein Schatz. Mir ist heute ein bisschen übel, und springen wäre sicherlich keine gute Idee!«
»Okay!«
»Aber gib mir einen Kuss!«, flüsterte ich und spitzte meine Lippen durch das Netz.
»Möchtest du, dass ich mit dir reinkomme und dir einen Tee mache?«, fragte Peter hinter mir.
Ich wandte mich von Justin ab und schüttelte den Kopf.
»Springt ihr mal schön weiter! Ich werde mir vielleicht ein heißes Bad gönnen und mal wieder ein Buch lesen.«
Ich lag zwei Stunden im Bad, immer wieder ließ ich neues heißes Wasser in die Wanne laufen. Zwar wollte ich lesen, doch am Ende tat ich es nicht. Ich dachte über mein Leben nach, vor allem über meine jetzige Lebenssituation.
Ich hatte wirklich sehr viel gearbeitet, und ich fragte mich, ob ich vor irgendetwas davonlaufen wollte.
Es ging uns finanziell sehr gut. Peter war Freiberufler und arbeitete oft von zu Hause aus. Er war professioneller Texter und schrieb für Firmen Werbetexte und sogar Drehbücher für Kurzfilme. Sein Verdienst allein reichte schon aus, um uns zu versorgen. Dennoch war es immer mein Wunsch gewesen, nach der Geburt von Justin bald wieder arbeiten zu gehen. Doch zu welchem Preis? Mein Sohn hatte zu seinem Vater eine viel engere Bindung als zu mir, und vielleicht war ich nicht oft genug für ihn da gewesen. Eigentlich wollte ich immer verhindern, dass mein Kind so einsam aufwächst wie ich selbst in meiner Jugend.
All die Gedanken führten zu nichts. Ich stieg langsam aus der Wanne heraus und hüllte mich in ein kuschelweiches Handtuch. Es war sicherlich alles in Ordnung mit mir, ich war einfach nur ein wenig überarbeitet. Kritisch blickte ich in den Spiegel und betrachtete die Frau, die ich darin sah.
Ich beschloss fest, mir den Tag nicht von meinem Magen verderben zu lassen – und von meinen Gedanken sowieso nicht.
Ich schlüpfte schnell in meinen Hausanzug und bemerkte, wie lange ich ihn schon nicht mehr angehabt hatte. Dann ging ich nach unten zu Peter und Justin auf die Couch.
»Was haltet ihr davon, wenn wir ein Wochenende zu Oma und Opa fahren?«, plauderte ich einfach los und wartete auf Justins Gesichtsausdruck, der seine Großeltern über alles liebte.
Justin riss lächelnd die Augen auf und blickte seinen Vater an. Peter schaute mich an und sagte nur: »Hatte der Arzt nicht gesagt, du sollst jede Art von Stress vermeiden?«
Ich winkte ab. »Ach, deine Eltern sind doch kein Stress, Schatz. Ganz im Gegenteil, es ist immer sehr erholsam dort!«
»Na, dann!«
Justin lachte über das ganze Gesicht. Mir wurde warm ums Herz, als ich mein Kind so glücklich sah.
Ja, es war doch ganz gut, mal eine kleine Auszeit zu haben. Es wurde höchste Zeit, dass ich wieder in Ruhe Zeit mit meiner Familie verbringen konnte.
»Und für den Magen ist schon gesorgt«, dachte ich mir und nahm die zweite Tablette für den Tag ein.
Peter und ich hatten eigentlich vor, den Abend zu zweit zu verbringen. Wir hatten uns einen schönen Film ausgeliehen, doch ich konnte immer nur wenige Minuten den Film gucken, dann musste ich wieder auf die Toilette rennen. Im 15-Minutentakt meldete sich mein Magen bei mir und signalisierte mir, dass er sich entleeren wollte. Es war einfach schrecklich, jedes Mal in die Toilette zu blicken und den schaumigen, roten Inhalt zu sehen. Hätte der Arzt nicht in meinen Magen geschaut, wäre ich davon überzeugt gewesen, Krebs zu haben.
Wer denkt bei einem blutigen Auswurf auch lediglich an eine Entzündung?
Nach der Hälfte des Films gab ich auf und beschloss, ins Bett zu gehen. Der Tag sollte einfach so schnell wie möglich enden. »Morgen ist es sicherlich besser«, flüsterte ich meinem Mann noch ins Ohr und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Er blieb wieder einmal allein zurück und musste den Abend mit sich verbringen.
Die Entzündung hatte mich so erschreckt, dass ich selbst nachts nicht von ihr loskam. Ich träumte davon, wie ich vor der Toilettenschüssel in meinem Bad saß und mich pausenlos übergeben musste. Die Farben, die aus meinem Magen kamen, verwandelten sich, doch es war immer eine dunkle Farbe, die meinen Magen verließ. Der Traum fühlte sich so echt an, dass ich immer wieder kurz erschöpft aufwachte, um mich für einen Moment zu erholen. Dann fiel ich sofort wieder in den Schlaf und übergab mich weiter in meinem Traum.
Als ich mich bestimmt schon das zwanzigste Mal im Traum übergeben hatte, schien es, als würde mein Magen selbst meinen Körper verlassen wollen. Ich spürte in meinem Mund etwas Festes, so, als ob ich ein Stück Sehne im Mund hätte. Es war schrecklich. Ich setzte gerade wieder an, mich zu erbrechen, als ich plötzlich eine Stimme hörte: »Komm her!«
Verwirrt blickte ich mich um, und irgendwie schien ich im Traum aus dem Bild im Badezimmer in ein anderes Bild zu laufen, das sich zeitgleich links neben mir abspielte. Ich war nicht wirklich in dem Traum zu sehen, aber es schien, als ob ich wie ein Vogel über eine Naturlandschaft fliegen würde. Ein riesiges Areal befand sich unter mir, und ich sah Felsen und Wasserfälle, Tiere, vor allem Vögel, und den dichtesten Wald, den ich bisher gesehen hatte. Ein endloser Wald. Dann schien ich tiefer über einen sandigen Weg zu fliegen, bis ich vor einem weiß angestrichenen Metalltor landete. Ich blickte umher und traute mich nicht, das Tor zu passieren, obwohl dieses Tor offensichtlich der Grund meines Fluges gewesen war. Ganz vorsichtig setzte ich einen Fuß nach vorn. Ich blickte nach unten, doch da waren überhaupt keine Füße zu sehen. Wieder hörte ich die Stimme, aber dieses Mal war sie viel lauter als vorher. Die Stimme schien direkt von dem Bereich hinter dem Tor zu kommen. Dann wachte ich auf.
Ich brauchte einen Moment, bis ich verstand, dass ich in meinem Bett lag und an die Decke starrte. Hektisch presste ich Luft in meine Lungen. Ich schien wirklich gestresst zu sein, wenn ich so etwas träumte. Peter wurde ebenfalls wach und fragte, ob er mir helfen könne.
»Nein, nein«, antwortete ich ihm. »Ich habe nur …« Ich wollte »schlecht« sagen, aber die zweite Traumsequenz hatte eigentlich etwas Schönes und Freies, »merkwürdig geträumt«, fügte ich dem Satz hinzu, kuschelte mich wieder in mein Bett und schlief ein.
Kaum hatte ich meine Augen geschlossen, da stand ich auch schon wieder vor dem Tor. Ich wagte erneut einen Blick auf meine Füße, doch obwohl ich es war, die vor diesem alten Tor stand, sah ich keine Füße. Ich spürte im Traum, dass jemand hinter mir war, und bevor ich mich umdrehen konnte, fühlte ich eine große warme Hand auf meiner Schulter. »Komm zu uns, er braucht dich, und du brauchst ihn!«, sagte ein Mann.
Ich blickte mich um, aber der Mann war wieder verschwunden. Der Klang seiner tiefen ruhigen Stimme war noch immer in meinem Ohr, doch ich stand völlig allein vor dem Tor. Wieder setzte ich einen Fuß vor den anderen und lief auf das Tor zu, doch auch dieses Mal wurde ich aus dem Traum herausgerissen und fand mich in meinem Bett wieder.
Die Sonne schien durch die rosafarbenen Gardinen, und der Wecker verriet mir, dass es schon spät am Morgen war.
Neben mir lag eine zerwühlte Decke, doch von meinen beiden Männern war nichts mehr zu sehen.
Ich stieg aus dem Bett und lief barfuß die Treppen nach unten. Ein Geruch von Kaffee und frisch gebackenen Brötchen stieg mir in die Nase.
»Mama, Mama«, rief Justin und kam mir entgegengerannt. »Schau mal, was Papa mir gekauft hat!«, freute er sich und streckte mir seine Hand mit einem großen Plastikflugzeug darin entgegen. »Huiiiii«, rief er und bewegte das Flugzeug elegant durch die Lüfte.
»Das ist aber lieb von ihm«, lächelte ich und beobachtete, wie er wieder in der Küche verschwand.
»Dir habe ich auch was mitgebracht!«, sagte Peter zu mir und gab mir einen Kuss.
»Was denn?«, fragte ich neugierig und grinste leicht.
»Deine Lieblingsblumen«, antwortete er und streckte den Blumenstrauß nach vorn, den er die ganze Zeit hinter seinem Rücken versteckt hatte.
Es waren meine Namensblumen: Veilchen.
»Schön, dass du noch mal eingeschlafen bist heute Morgen.«
Ich nickte und griff bettelnd nach seiner Kaffeetasse, die auf dem Tisch stand.
Peter schüttelte den Kopf. »Ich glaube kaum, dass Kaffee deinem Magen guttut!«, sagte er ernst.
»Ach, komm«, bettelte ich weiter. »Ich trinke dafür heute eine Kanne Kamillentee. Auf meinen Morgenkaffee kann ich nicht verzichten!«
Peter gab auf. Er konnte mir nie einen Wunsch abschlagen.
»Ich mache dir einen Neuen, dieser hier ist doch schon kalt«, sagte er und ging zur Kaffeemaschine.
Ich musste leider allein frühstücken. Mein Mann brachte Justin in die Schule. Er hatte an jenem Tag seinen ersten Schulausflug und war so aufgeregt. Es war mir eine solche Freude, diese Aufregung mit ihm teilen zu dürfen. Eigentlich wollte ich Justin in die Schule bringen, aber Peter bat mich, damit noch ein paar Tage zu warten und erst einmal in Ruhe zu frühstücken. Also saß ich allein in unserem Haus und musste mich irgendwie beschäftigen.
Es fühlte sich für mich fremd an, an diesem Morgen nicht ins Büro zu hetzen, sondern ganz ohne etwas tun zu müssen, zu Hause auf der Couch zu liegen.
Ich machte mir Musik an und legte mich entspannt in die Kissen. Peter hatte natürlich recht, Kaffee war ganz sicher nicht das, was mein Magen jetzt wollte, und so meldete er sich auch sofort, als ich einen großen Schluck nahm. Es brannte fürchterlich, und wieder stieg dieser säuerliche Geschmack in meinen Mund.
Doch was mich im Moment mehr beschäftigte als die Säure in meinem Hals und das Brennen in meinem Magen, war der Traum, den ich gehabt hatte.
So etwas hatte ich noch nie erlebt. Ich träumte oft, und ich träumte auch viel, aber dieser Traum hatte sich angefühlt, als ob ich wach gewesen wäre und alles genau miterlebt hätte.
Ich hatte nicht einfach nur geträumt, nein, ich war mir dessen ganz bewusst gewesen. Ich hatte jeden Hauch des Windes auf meiner Haut gespürt, ich hatte den Geruch des Waldes so deutlich in meiner Nase wahrgenommen und die Euphorie, in der Luft zu fliegen, bis in jede Zelle meines Körpers gespürt. Ich hatte wie unter Strom gestanden, doch es war kein Strom gewesen, der mir schaden konnte. Es war mehr eine Art lebendiges, frisches Kribbeln in mir gewesen. Es hatte sich alles so leicht und frei angefühlt. Interessant fand ich zudem, dass ich mich gar nicht hatte sehen können. Es war mir einfach nicht gelungen, meine Füße oder meine Hände anzuschauen.
Normalerweise konnte man während eines Traumes auch nicht einfach beschließen, sich seine Füße anzuschauen. Doch in diesem Traum war das möglich gewesen. Es war nicht einfach ein Traum, dem ich zuschaute, sondern ich war irgendwie ein bewusster Teil des Traumes gewesen.
Auf einmal lachte ich laut los, denn ich ahnte, was das war: die Tabletten. Sie ließen mich all das träumen. Sie verwirrten wohl meinen Kopf und ließen die »Schaltstellen« durchschmoren.
Ich nahm die Fernbedienung und machte die Musik lauter. Das war doch eine tolle Nebenwirkung. Vielleicht wirkten die Inhaltsstoffe irgendwie halluzinogen.
Ich nahm mir ein Brötchen und biss vorsichtig hinein. So, wie es mir der Arzt befohlen hatte, kaute ich jeden Bissen wesentlich öfter, als ich es normalerweise tat.
Es war für mich sehr verwunderlich, dass diese Entzündung sich jetzt erst zeigte und vor allem, mit welcher Intensität. Es war ja nicht so, dass sich diese Magenprobleme aufgebaut oder sich in irgendeiner Form angekündigt hätten. Nein, es hatte einfach »rums« gemacht, und die Probleme waren plötzlich da gewesen. Der Arzt hatte sich schließlich auch nicht erklären können, wieso es erst jetzt zu Beschwerden gekommen war.
Vielleicht hatte mich mein Magen erst noch den Deal mit der japanischen Firma vollenden lassen, bevor er mir verdeutlichte, dass er ein Problem hatte. Meine Organe schienen mir doch sehr positiv gestimmt.
Auf der Küchenanrichte lagen meine Tabletten, und so stand ich auf, um mir eine zu holen. Ich sollte sie schließlich zum Essen einnehmen, und daran wollte ich mich halten.
Als ich mit dem Frühstücken fertig war, blickte ich umher und überlegte, was ich nun tun könnte. Doch Peter hatte wie immer alles bereits erledigt. Es gab weder etwas sauber zu machen noch wegzuräumen. Ich fragte mich, wie er das bloß immer machte.
Ich würde ihn wohl bitten müssen, einmal für eine Zeit damit aufzuhören, ständig Ordnung zu machen. Wie sonst sollte ich diese drei Wochen überstehen?
Ich war einfach nicht dafür geschaffen, nichts zu tun.
Peter kam genau im richtigen Moment nach Hause, denn ich war gerade im Begriff, mich zu langweilen.
Wir gingen schließlich zusammen einkaufen, natürlich nicht, ohne dass Peter protestierte. Doch ebenso wie beim Kaffee flehte ich ihn auch jetzt wieder an. Was sollte ich denn sonst allein tun? Ich musste mich irgendwie beschäftigen! Außerdem gab es in dem Supermarkt ja auch Kundentoiletten, für den Fall der Fälle.
Einkaufen, das war ebenfalls etwas, worum sich in den letzten Jahren Peter gekümmert hatte. Ich war zwar immer mal wieder kurz im Supermarkt gewesen, um schnell irgendwelche Kleinigkeiten zu besorgen, aber ich hatte trotz der Tatsache, dass ich eine Frau war, keine Ahnung, was in unserem Kühlschrank und in den Vorratsschränken fehlte.
Während ich gerade damit beschäftigt war, eine Brotsorte auszusuchen, geschah das Unvermeidliche: Mein Magen wollte sich wieder entleeren – und fast wäre es zu spät gewesen, die Kundentoilette zu erreichen.
Dieses Problem frustrierte mich zunehmend, vor allem, als mir später am Nachmittag kalt wurde und ich leichtes Fieber bekam.
Notgedrungen legte ich mich mit einer Wärmflasche ins Bett und stellte mir eine Kanne Tee auf den Nachttisch. Ich aß auch nichts mehr, denn alles, was in meinem Magen landete, würde ja doch nicht lange dort bleiben.
Ich konnte nur hoffen, dass die Tabletten bald wirkten und die Entzündung schnell beheben würden. Es war furchtbar langweilig für mich, einfach nur im Bett zu liegen. Ich wusste einfach nicht, wie ich die Zeit verbringen sollte.
Am Abend hörte ich Justin und Peter unten herumtoben. Die beiden lachten, und ich schämte mich dafür, dass ich nicht bei ihnen sein konnte.
War diese Entzündung eine Bestrafung für die viele Zeit, die ich ohne meine Familie verbracht hatte? War es ein Resultat der vielen Arbeit?
Je später es wurde, desto stärker wurde mein Fieber, und ich fühlte mich zunehmend schwächer. Mittlerweile musste ich im Stundentakt aus meinem Bett raus, um ins Bad zu rennen. Ich war so weit, dass ich mit dem Gedanken spielte, mir einen Eimer ans Bett zu stellen, damit ich diesen Weg nicht mehr auf mich nehmen musste. Die Vorstellung widerte mich zwar an, aber ich hatte keine Lust mehr, jedes Mal aufzustehen.
Es war so warm unter der Decke, die Hitze staute sich und ließ mich zumindest zeitweise vergessen, wie kalt mir war. Jedes Mal, wenn ich aus dem Bett stieg, klapperten mir die Zähne.
Um 19 Uhr brachte mir Peter eine neue Kanne Tee und ein Brot nach oben, doch ich schüttelte nur den Kopf. Ich wollte nichts essen. Je weniger in meinem Magen war, desto besser.
Ich konnte in seinen Augen sehen, wie besorgt er um mich war, und es war meine Aufgabe, ihn zu beruhigen.
Ich schlief an dem Abend recht früh ein. Was sollte ich sonst auch tun? Ich war ans Bett gefesselt, und in einem Bett schläft man nun mal.
Sobald ich eingeschlafen war, befand ich mich wieder in der Luft. Es geschah ganz wie von selbst. Als ich über die Landschaft flog, lachte ich sogar und freute mich über die Wirkung der Tabletten. Von meinem Körper und auch von meinem Magen konnte ich wieder nichts spüren, ich war einfach nur leicht und frei.
Während des Flugs über die Wälder dachte ich daran, zu recherchieren, welcher Inhaltsstoff in der Tablette wohl für diese Halluzinationen verantwortlich sei. Dieses Mittel würde sich bestimmt gut als Droge verkaufen. Manche würden sicherlich vor der Apotheke Schlange stehen, um diesen Trip auch einmal zu erfahren. Eine ganz legale Droge in Form von Entzündungsmitteln!
Ich flog wieder die gleiche Route wie in der Nacht zuvor. Es war so, als ob ich auf unsichtbaren Gleisen unterwegs war und magnetisch in die richtige Richtung gezogen wurde. Ich war fasziniert, wie mein Gehirn diese Echtheit produzieren konnte. Die Bäume und die Landschaft unter mir wirkten so real. Wenn es diesen Ort auf der Welt wirklich irgendwo geben sollte, dann würde ich nicht eine Sekunde warten, dorthin zu reisen. Unter mir lagen sanfte Hügel. Immer wieder ragten Felsenlandschaften aus dem dichten Wald hervor. Von einem etwas höheren Berg stürzte ein Wasserfall tief zur Erde. Von oben sah der Wasserfall zwar sehr klein aus, doch ich war mir sicher, dass er von Nahem gewaltige Ausmaße hatte.