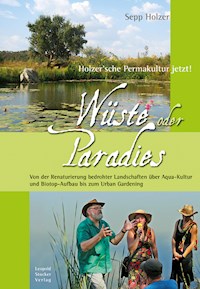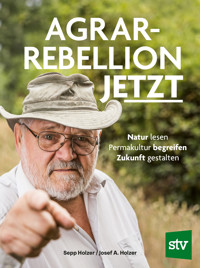
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Mit der Natur, nicht gegen die Natur •Klimakrise begegnen •Landwirtschaft als Teil der Lösung, nicht des Problems •Nachhaltig und standortangepasst Es gibt eine Zukunft jenseits von Monokulturen, Massentierhaltung und Raubbau an der Natur. Davon sind Bestsellerautor "Agrar-Rebell" Sepp Holzer und sein Sohn Josef A. Holzer überzeugt. Sie zeigen, dass standortangepasste Konzepte eine nachhaltige Bewirtschaftung ermöglichen. Der Klimakrise begegnen die Permakultur-Experten mit Wissen, Kreativität, Erfahrung und der Überzeugung, dass uns die Natur Lösungen bietet. Sepp Holzer: "Immer wenn du mit der Natur in Kooperation bist, nützt du dir, deiner Familie, ja, der ganzen Mitwelt." Josef Holzer: "Die Natur gibt uns alles – aber nicht umsonst." Im Buch zeichnen die Autoren den Weg des respektvollen, vorausschauenden Umgangs mit Landschaft, Wasser, Boden, Tieren und Vegetation, indem die Land- und Forstwirtschaft nicht länger Teil des Problems, sondern endlich Teil der Lösung ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sepp Holzer / Josef A. Holzer
AGRAR-REBELLION JETZT
Natur lesen Permakultur begreifen Zukunft gestalten
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Titelbild: © Marcus Auer
Umschlaggestaltung, Layout und Repro: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Der Inhalt dieses Buches wurde von den Autoren und vom Verlag nach bestem Gewissen geprüft, eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist ausgeschlossen.
Rund 30 % der österreichischen Waldbesitzer sind Frauen und mehr als jeder dritte Bauernhof wird von einer Landwirtin geleitet. Frauen sind maßgeblich prägend für die Entwicklung des ländlichen Raumes in Österreich. Der Leopold Stocker Verlag verzichtet in seinen Publikationen, ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit, auf eine geschlechtsspezifische Schreibweise und verwendet stattdessen durchgängig das generische Maskulinum. Die verkürzte Sprachform in unserem Buch beinhaltet keine Wertung, alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5
Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2076-7
eISBN 978-3-7020-2262-4
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright: Leopold Stocker Verlag, Graz 2023
INHALT
ZU DIESEM BUCH
DIE AUTOREN
Sepp Holzer
Josef A. Holzer
„DIE NATUR ZEIGT DIR IMMER EINEN WEG.“
Vorwort Von Sepp Holzer
„KEINE AUSREDEN MEHR!“
Vorwort Von Josef A. Holzer
DER KRAMETERHOF – VON DER SUBSISTENZWIRTSCHAFT ZUR PERMAKULTUR
Die Vielfalt der Selbstversorger Von Josef A. Holzer
Kindheit am Bergbauernhof Von Sepp Holzer
Prägende Versuche Von Sepp Holzer
Schulden, Gift und Dünger Von Sepp Holzer
Plentern und Plantagen Von Sepp Holzer
Ein Zirben- und Menschenfresser Von Sepp Holzer
Guter Rat ist teuer Von Sepp Holzer
Sondersteuer? So ein Glück! Von Sepp Holzer
Ein Tropfen für den Ozean Von Sepp Holzer
Aufwachsen am Krameterhof Von Josef A. Holzer
Permakultur ist keine Glaubensfrage Von Josef A. Holzer
Visionäre einer Gegenbewegung
Franklin Hiram King
Joseph Russell Smith
Raoul Heinrich Francé
Charles Darwin
Percival Alfred „P. A.“ Yeomans
Masanobu Fukuoka
Rachel Carson
René Dubos
Bill Mollison
Drei-Säulen-Prinzip Von Josef A. Holzer
Von der Natur zur Kultur
Begrenzung akzeptieren
Reflexion üben
Permakultur am Krameterhof Von Josef A. Holzer
ALLES EINE FRAGE DES STANDORTES
Von Optimisten, Pessimisten und Toleranten Von Josef A. Holzer
Anfänge in Jennersdorf Von Sepp Holzer
Über den Boden Von Sepp Holzer
Pflanzgemeinschaften und Mitlebewesen Von Sepp Holzer
WAS FÖRDERN WIR?
Systemfehler Von Sepp Holzer
Was ist wirtschaftlicher? Von Josef A. Holzer
Mehr Hirn pro Hektar Von Josef A. Holzer
Der Vergleich macht sicher Von Josef A. Holzer
WELT ERFAHREN
Erfahrungswissen Von Sepp Holzer
Wunsch und Wirklichkeit Von Sepp Holzer
Das Kloster brennt Von Sepp Holzer
Mehr Beton ist auch keine Lösung Von Sepp Holzer
Oblast Smolensk Von Sepp Holzer
Republik Tschuwaschien Von Sepp Holzer
Sibirien Von Sepp Holzer
Verbrannte Erde Von Sepp Holzer
Detroit & Malibu, USA Von Sepp Holzer
POTENZIALE ERKENNEN UND NUTZEN
Lösungen nach Maß Von Josef A. Holzer
Vorbild Wald Von Josef A. Holzer
Wasser ernten Von Josef A. Holzer
ZUKUNFT GESTALTEN
Agieren statt reagieren Von Sepp Holzer
Wasser gegen die Klimakrise Von Sepp Holzer
Förderungen und Forderungen Von Sepp Holzer
Keine Angst vor der Schlange Von Sepp Holzer
Psychotope Von Sepp Holzer
Selbstgemachte, systemische Probleme Von Josef A. Holzer
ZU DIESEM BUCH
Aus einer bergbäuerlichen Tradition kommend, ist Sepp Holzer durch seinen unvoreingenommenen, offenen Ansatz des Probierens und Experimentierens nach und nach auf produktive Muster und Zusammenhänge in der Natur gestoßen. Unbewusst hat er sich damit in eine land- und forstwirtschaftliche Tradition eingeschrieben, die Erfahrungswissen und wissenschaftliche Expertise zusammenführt: „Permanent Agriculture“ – kurz Permakultur.
Ausgehend von persönlichen Erfahrungen von Sepp und Josef Holzer, führt dieses Buch über die wissenschaftlichen Ahnen der Permakultur zu den Grundlagen dieser naturnahen Methode, die auf beobachten und lernen aufbaut – frei von Dogmen, Mythen und Glaubensfragen.
Im abschließenden Plädoyer zeigen die Autoren, wie die Land- und Forstwirtschaft in Zeiten von Klimawandel und Naturkatastrophen einen tatsächlich nachhaltigen und zukunftsträchtigen Umgang mit der Natur finden kann.
„Handle stets so, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst.“
Heinz von Förster
DIE AUTOREN
SEPP HOLZER
Sepp Holzer gilt nicht erst seit der Veröffentlichung des gleichnamigen Buches als Agrar-Rebell. Der heute 80-jährige Experte für Permakultur ist nach wie vor ein so eigensinniger wie leidenschaftlicher Anwalt der Natur.
Als Bergbauernkind hat er gelernt, „im Buch der Natur zu lesen“ und erfolgreich mit der Natur anstatt gegen sie zu arbeiten. In diesem Buch will er gemeinsam mit seinem Sohn Josef zeigen, dass wir – allen negativen Vorzeichen zum Trotz – unsere Zukunft reparieren können. Vorausgesetzt, „wir lernen, Natur zu begreifen, anstatt sie zu bekämpfen.“
Sepp Holzer
© Marcus Auer
JOSEF A. HOLZER
Josef Andreas Holzer ist Land- und Forstwirt sowie international gefragter Experte für Permakultur. 2009 hat er den Krameterhof von seinem Vater, Sepp Holzer, übernommen. Der Hof wurde durch Buchveröffentlichungen und Medienberichte international bekannt und gilt als Permakultur-Vorzeigeprojekt.
Seit 2020 leitet Josef A. Holzer zudem das Beratungs- und Planungsbüro Holzer Permaculture Solutions GmbH.
Josef Andreas Holzer
© Marcus Auer
„DIE NATUR ZEIGT DIR IMMER EINEN WEG.“
VORWORTVON SEPP HOLZER
Wir Menschen müssen wieder lernen, mit der Natur zu kommunizieren, sie wahrzunehmen und uns als Teil von ihr zu verstehen. „Wo fängt man am besten damit an?“, werde ich manchmal gefragt. Vielleicht zuerst einmal im Blumentopf? In der Küche, in der Stube oder am Balkon. Im Grunde eignet sich fast jede Fläche dafür.
Schon Kindern sollte man zeigen, dass in einem Samen Leben steckt, dass das wichtig ist und wunderbar. Sie bedecken Samen mit Erde, sehen wie Pflänzchen keimen und fragen sich, welche Früchte sie einmal tragen werden. Kirschen? Maroni? Äpfel?
Kinder merken sich die Antwort genau. Weil sie es sind, die die Samen in die Erde gesteckt haben, weil es jetzt ihre Pflanzen sind.
Ein Kind, das ein Bäumchen hat, das ihm gehört, wird es wertschätzen, pflegen, vor Gefahren schützen und verteidigen. Es lernt, dass da eine Beziehung zwischen ihm und dem Bäumchen besteht und verinnerlicht, dass es verantwortlich für dieses Geschöpf ist.
Das sind prägende Erfahrungen und für die muss man Kindern auch Platz lassen. Sie brauchen Freiräume und Zeit für Experimente – für Erfolgserlebnisse und für Misserfolge, denn aus diesen lernen sie genauso viel, wenn nicht sogar mehr.
Kinder müssen mit der Welt vertraut werden, damit sie sich in ihr zurechtfinden und lernen, wie man im Buch der Natur liest. Sie müssen erfahren, wie Natur funktioniert und welche Aufgaben ihre Mitlebewesen haben.
Dann sehen sie: Jedes Leben stellt einen Wert dar. Nichts existiert ohne Grund. Jede Kreatur hat eine Aufgabe. Alles ist miteinander verbunden und vernetzt: der Boden, der Baum, der Regentropfen und der Wurm. Kinder verstehen das auf Anhieb – Erwachsene oft gar nicht, weshalb sie ihren Kindern dummerweise so vieles verbieten.
Wo dürfen Kinder heute noch graben, pflanzen, ernten? Fast nirgendwo. Viele Eltern meinen, die Natur sei schmutzig, unappetitlich, gefährlich.
So ein Blödsinn! Gefährlich ist es, unseren Kindern nicht zu vermitteln, wie unglaublich vielfältig und kostbar die Natur ist und dass wir – auf Gedeih und Verderb – mit ihr verbunden sind.
Wir Menschen können so vieles von der Natur lernen. Ein Leben reicht niemals aus, um alle Zusammenhänge zu begreifen. Denn je genauer man hinschaut, umso mehr gibt es zu entdecken. Und das Erforschte kann man auf vielfältige Art und Weise für sich nutzen – auch das begreift jedes Kind intuitiv.
Ich habe schon als kleiner Bub meine ersten Pflanzen gezogen und meinen ersten Garten angelegt. Nichts hat mir mehr Freude gemacht, als zu sehen, wie alles wächst, sich entwickelt und vermehrt. Ich war so stolz auf meinen Erfolg! Diese Glückserfahrung hat mich bestärkt und angetrieben weiterzumachen und immer mehr auszuprobieren.
Immer noch sagt man mir nach, dass ich mich „wie ein Kind“ freuen kann. Und das stimmt auch. Jeden Tag entdecke ich etwas Neues in meinem Garten, das mich begeistert.
Meine Neugierde und Experimentierfreude habe ich mir bis heute erhalten. Ich denke auch nicht daran, mich jetzt, wo ich die 80 schon überschritten habe, auf ein „Bankerl vors Haus“ zu setzen, um auf den Tod zu warten. Nein! Ich pflanze immer noch Bäume und lege neue Gärten an, damit ich und die, die nach mir kommen werden, die Früchte dieser Arbeit ernten können.
Wie man einen Ertrag, eine schöne Ernte bekommt, das habe ich von der Natur gelernt. Es ist wahr, sie ist meine Schule. Was ich mir dort abgeschaut habe, will ich teilen.
Dieses Buch ist in einer Zeit entstanden, in der auf eine Katastrophenmeldung schon die nächste folgt: Pandemie, Krieg, Klimakrise, Hungersnöte, Artenschwund.
Wir haben so viele selbstverschuldete Probleme gleichzeitig und die Menschen sind voller Angst. Sie aber ist der schlechteste Begleiter, den man im Leben haben kann. Wenn ich Angst habe, bin ich der Verfolgte.
Gerade jetzt, wo wir uns dringend neu ausrichten und neue Wege gehen müssen, sollten wir die Angst schleunigst ablegen. Sie verleitet uns dazu, überstürzt zu handeln – sie löst keine Probleme, sondern schafft neue. Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass man angstfrei sein muss, wenn man an einer besseren Zukunft arbeitet. Wer panisch, kopf- und planlos davonläuft, ist verloren. Die Natur aber, die zeigt dir immer einen guten Weg. Sie will dir helfen, denn du bist ein Teil von ihr.
Was für eine Welt wollen wir denen, die nach uns kommen, hinterlassen? Haben sie denn kein Recht auf eine lebenswerte Zukunft, auf sauberes Wasser, auf gesunde Nahrung?
Immer noch und mehr denn je bin ich überzeugt: Wir brauchen eine Agrar-Rebellion, jetzt!
Fordern und fördern wir das Bewusstsein dafür, dass wir es uns nicht länger leisten können, die Natur auszubeuten und sie zu bekämpfen. Wer Land bewirtschaftet, muss sich mit der Natur verbünden und bereit sein, von ihr zu lernen.
Natur nutzen, ohne sie dabei auszunutzen, dass das gelingen kann, davon bin ich überzeugt und davon handelt dieses Buch. Ich habe es mit meinem Sohn Josef und unserem Freund und Co-Autor Andreas Schindler geschrieben.
Es will vor allem Mut machen und zeigen, was alles möglich ist, wenn wir lernen, im Buch der Natur zu lesen, und mit ihr anstatt – wie bisher – gegen sie arbeiten.
Fangen wir damit an. Jetzt.
Sepp Holzer
Sepp Holzer: „Wir Menschen können so vieles von der Natur lernen. Ein Leben reicht niemals aus, um alle Zusammenhänge zu begreifen.“
© Marcus Auer
„KEINE AUSREDEN MEHR!“
VORWORTVON JOSEF A. HOLZER
Im Rahmen meiner Ausbildung hat ein alter Förster einen Satz gesagt, der sich mir eingeprägt hat: „Die Natur gibt uns alles, aber nicht umsonst.“
Heute denke ich, dass das eine der wichtigsten Erkenntnisse für eine erfolgreiche und verantwortungsvolle Land- und Forstwirtschaft ist. Wollen wir der Natur etwas abverlangen, müssen wir uns mit ihr beschäftigen, von ihr lernen und versuchen, sie zu verstehen.
Beobachten und von der Natur lernen. Das ist der Weg der Permakultur und genau damit beschäftige ich mich seit vielen Jahren – zu Hause auf meinem Hof und im Rahmen meiner Arbeit als Berater, Ausbildner und Planer.
Wer sich mit der Natur beschäftigt, erkennt bald, dass alles im Fluss ist. Was wir sehen, sind keine Endergebnisse, sondern lediglich kurze Abschnitte auf einer langen Zeitachse.
Nur aufgrund unserer beschränkten Wahrnehmung wirkt auf uns statisch, was in Wahrheit immer in Bewegung ist.
Wenn wir Natur verstehen und nutzen wollen, müssen wir immer diese Zeitachse mitdenken – „Was war? Was ist? Was kommt? Und warum?“
Die folgenden Seiten möchten vermitteln, dass sich ein genauerer Blick in die Vergangenheit lohnt. Er lässt Chancen und Risiken erkennen und ist daher wesentlich für die Entscheidungsfindung der Gegenwart.
Gerade jetzt, wo Klimakrise, Artenschwund, Dürren und Überschwemmungen den Menschen Angst machen, gilt es, ganz genau hinzuschauen: Was sind die tatsächlichen Ursachen? Wo liegen die Problemfelder?
Eines vorweg: So dringend es auch ist, den Ausstoß klimaschädlicher Gase deutlich zu verringern, das allein wird nicht genügen.
Das Klima verursacht Wetterextreme, ist aber nicht ursächlich dafür verantwortlich, dass unsere Kulturlandschaften mit den Veränderungen dermaßen schlecht zurechtkommen.
Biodiversitätsverlust, verdorrte Felder, Waldbrände, Hochwasser oder Bodenschwund – all das sind, wie die Klimakrise auch, selbstgemachte Probleme, die wir nur dann in den Griff bekommen, wenn wir überholten Vorstellungen und zerstörerischen Praktiken den Kampf ansagen.
Es gibt sie, die tauglichen und erprobten Alternativen zu Monokulturen, Massentierhaltung und Raubbau an der Natur, zukunftsfähige Lösungen, die, wenn man konkret bilanziert, auch weit ökonomischer sind als das, was uns als Fortschritt angeboten wurde und wird.
Schauen wir uns um, sehen wir eine ausgeräumte und ausgebeutete Landschaft. Es lässt sich nicht verantworten, dass wir sie der nächsten Generation in einem weit schlechteren Zustand hinterlassen, als sie einst von unseren Eltern übernommen wurde.
In diesem Buch wollen wir eine Idee davon vermitteln, dass es auch anders geht, dass es viel besser geht! Setzen wir auf Lösungen, die uns die Natur anbietet und fordern wir von der Politik ein, dass Steuergelder nicht länger zur Symptombehandlung, sondern zum Umbau eines Systems verwendet werden, dessen Schwächen zu offensichtlich sind, um sie weiterhin zu ignorieren.
Die Agrarrebellion beginnt mit der Erkenntnis, dass sie notwendig ist – jetzt und mit allen, die bereit sind, mit der Reparatur der Zukunft zu beginnen.
Keine Ausreden mehr, sie halten uns nur auf.
Josef A. Holzer
DER KRAMETERHOF – VON DER SUBSISTENZWIRTSCHAFT ZUR PERMAKULTUR
DIE VIELFALT DER SELBSTVERSORGERVON JOSEF A. HOLZER
Unser Zuhause, der Krameterhof, liegt am Südhang des Schwarzenbergs im Salzburger Lungau, mitten in den österreichischen Alpen.
Heute umfasst unser Hof eine Fläche von knapp 45 Hektar, die sich zwischen 1.100 und 1.500 m Seehöhe erstrecken. Die Winter in dieser recht sonnigen und niederschlagsarmen Region sind lange und streng. Es gibt rund 170 Frosttage, wovon etwa 50 Eistage sind, also Tage, an denen das Thermometer nicht über null Grad Celsius steigt. Der Jahresniederschlag beträgt durchschnittlich knapp 800 mm.
Die Rahmenbedingungen scheinen also herausfordernd und doch wird dieser steile und auf den ersten Blick scheinbar unwirtliche Flecken Erde seit vielen Generationen von Bergbauern bewirtschaftet, schon seit 1890 von meiner Familie.
Wie die meisten Bergbauernhöfe war auch dieser Hof eine Subsistenzwirtschaft, also eine Selbstversorgerlandwirtschaft, die zwar kaum Überschüsse, aber alles zum Leben Notwendige produzieren konnte.
Anders als heute war der Selbstversorgungsgrad in den Bergen einst sehr hoch. Kaum etwas musste oder konnte zugekauft werden. Man darf sich die Menschen auf diesen Höfen aber nicht als arm vorstellen. Im Grunde gehörten sie in der kargen Nachkriegszeit zu den wenigen, die immer etwas zu essen und einen gewissen Wohlstand hatten. Auf einem Subsistenzhof wurde man zwar nicht reich, konnte aber durchaus gut leben.
Viele der Menschen, die auf meinen Hof kommen, meinen, hier etwas völlig Neues zu sehen. Oft werde ich gefragt, wie es denn möglich sei, auf einem Hof in dieser Lage und Seehöhe Gemüse, Obst und Getreide anzubauen. Sie sehen, dass ich Regenwasser in Teichen speichere, mit den Gänsen über den Berg wandere, Schweine auf der Weide halte und fragen mich, wie ich denn auf all diese Ideen gekommen sei? Ich muss dann immer ein wenig schmunzeln und erkläre, dass das alles andere als neu oder innovativ ist. Schließlich wird dieses Gebiet schon seit Jahrtausenden landwirtschaftlich genutzt. Jeder ganzjährig bewirtschaftete Hof versorgte sich im Grunde selbst.
Die Tatsache, dass wir diese Art der Landwirtschaft heute nirgendwo mehr sehen, bedeutet nicht, dass es sie nicht gab. Wie selbstverständlich haben meine Urgroßeltern und Großeltern bereits Obst und Gemüse angebaut, oft in Mengen, die sich heute kaum jemand vorstellen kann. Schließlich mussten auf dem Hof gut zehn Personen versorgt werden.
Zusätzlich wurden Getreide und Kartoffeln, Kraut, Bohnen und Rüben auf Ackerflächen produziert. Auch Öl- und Faserpflanzen – in unserem Falle Flachs beziehungsweise Lein – hat man angebaut. Es gab zudem eine Vielzahl an verschiedenen Tieren.
Tiere ermöglichen es, „Kalorien“ von Flächen zu ernten, die ansonsten nicht erschlossen werden können. Jede Art eignet sich für eine andere Fläche und für anderes Futter. Die Tiere waren notwendig, um die Ressourcen des Hofes optimal zu nutzen – sie lieferten wertvolle Lebensmittel, waren aber auch „Arbeitsgerät“. Die Art und Weise, wie die Tiere genutzt wurden, hatte auch einen enorm positiven ökologischen Einfluss – sie schufen und erhielten überaus artenreiche Lebensräume.
Die Bergbauernhöfe meiner Urgroßeltern und Großeltern waren also sehr vielfältig, denn Vielfalt war überlebensnotwendig.
Wenn man ganz und gar auf die eigene Produktion angewiesen ist, kann man sich das Risiko einer Spezialisierung nicht leisten. Was, wenn etwas schiefläuft? Wie kommt man über den Winter, wenn die Ernte ausfällt? Als Selbstversorger kann man nicht „alles auf eine Karte setzen“.
Weshalb sieht der Krameterhof so völlig anders aus als die umliegenden Bergbauernhöfe?
Der Krameterhof 1954
© SAGIS
Wenn ich Besuchern erkläre, dass ich im Grunde sehr viele Dinge mache, die hier schon seit Jahrhunderten gemacht werden, ernte ich oft ungläubige Blicke.
Sicher hat sich auch unser Hof seit der Übernahme durch meinen Vater in den 1960er Jahren strukturell und auch optisch stark verändert. Aber so wie früher auch produzieren wir immer noch Getreide, Gemüse, Bohnen, Kraut und Obst, halten Rinder, Schweine, Schafe, Hühner und Gänse. Neues ist dazugekommen, Techniken und Ansprüche haben sich geändert, aber alte Traditionen wurden integriert.
Als mein Vater 1962 den elterlichen Hof übernahm, musste er sich wie viele Bauern und Bäuerinnen seiner Generation entscheiden: Spezialisierung in Richtung Milchwirtschaft – so wie die allermeisten das damals taten – oder neue Wege gehen.
Reine Subsistenz war ab den 1950er Jahren nicht mehr zeitgemäß. Höfe wurden erschlossen. Wege und später Straßen haben selbst die entlegensten Höfe an die Welt angebunden.
Dazu kamen Stromleitungen und später sogar Telefonanschlüsse.
Die Straße zu unserem Hof wurde erst im Jahr 1964 fertiggestellt. Nach und nach wurden Investitionen für Maschinen notwendig, weshalb man (mehr) Geld verdienen musste. Gleichzeitig wurden die Arbeitskräfte und Esser auf den Höfen weniger, was wiederrum eine tiefgreifende Änderung der Bewirtschaftung nach sich zog. Bald war es nicht mehr sinnvoll und notwendig, eine vollständige Selbstversorgung zu gewährleisten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg suchte die Agrarpolitik nach Wegen, die Produktion deutlich zu steigern. Subsistenzwirtschaft hatte in diesen Überlegungen keinen Platz, die neuen Vorgaben hatten das Ziel, die Betriebe und darüber hinaus ganze Regionen, zu spezialisieren.
Die Berggebiete wurden fortan zu Grünlandregionen für die Milch-, und im geringeren Ausmaß auch Fleischproduktion. Ackerbau verschwand fast vollständig vom Berg und fand jetzt nur mehr in den Gunstlagen statt, wo wiederum die Tiere rar wurden.
Diese Umstellung war nicht für jede Betriebsgröße und jeden Hof gleichermaßen umsetzbar. Und so wurden Kleinbetriebe relativ bald unrentabel und in den Nebenerwerb gedrängt.
Die Überschussproduktion führte bald zu einem Preisdruck und durch die Änderung der bäuerlichen Landwirtschaft in Richtung Rohstoff-Urproduktion wurden die Bauern immer abhängiger von Abnehmern und Zulieferern.
Während die Erlöse immer geringer wurden, wurden die Produktionsmittel immer teurer.
Viele, vor allem kleine Betriebe, haben diese Umstellung nicht überlebt: In Österreich sind seit 1960 rund 250.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe verschwunden.
Angesichts dieser Entwicklungen entschied sich mein Vater also für die Vielfalt. Er experimentierte erfolgreich mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Methoden und Sparten. Schritt für Schritt und gemeinsam mit meiner Mutter Veronika diversifizierte er den Krameterhof.
Eines der ersten neuen Projekte war der Aufbau einer kleinen Teichwirtschaft. Mein Vater, der sich schon seit frühester Kindheit für Fische begeistert, hatte sich diese Idee in den Kopf gesetzt. Für die meisten seiner Zeitgenossen war das eine „Schnapsidee“: Ein Bergbauer mit einem Hof, der sich eher für die Anlage einer Skipiste eignete, steinig, flachgründig und noch dazu ohne große Wasserressourcen, will Teiche bauen? Seine Antwort: „Gerade weil es hier wenig Wasser gibt, mache ich Teiche.“
Auch wenn es auf den ersten Blick verrückt schien, mein Vater hatte eine genaue Vorstellung davon, wie und wo er seine Vision verwirklichen konnte. Inspiriert haben ihn sicherlich auch die traditionellen Mühlteiche der Region. Früher musste das Wasser der Quellbäche und kleinen Gräben auf den Bergen in Teichen gestaut werden, um genug Wasser für den Betrieb der hofeigenen Mühlräder zur Verfügung zu haben.
Die Nachricht, dass ein verrücktgewordener Bauer ausgerechnet am Schwarzenberg Teiche baut, verbreitete sich wie ein Lauffeuer und bald wusste jeder im Lungau, wo und wer dieser Verrückte war.
Eine bessere Werbung für die neue Fischzucht am Krameterhof hätte es kaum geben können. Das Ganze entwickelte sich so gut, dass mein Vater gebeten wurde, auch andere Betriebe zu beraten. Er zeigte ihnen, wo und wie sie eigene Teiche für die Eigenversorgung mit Fischen anlegen konnten. Und so hat er bald nicht nur Fische, sondern auch sein Wissen verkaufen können.
Vom Erfolg befeuert wurden meine Eltern noch experimentierfreudiger. Trotzdem sind sie ihrer bewährten Strategie treu geblieben, nur Dinge zu machen, für die sie sich begeistern konnten, wie zum Beispiel Teiche, Vielfalt in der Tierhaltung, Pilzzucht oder Streuobstwiesen. Dieser Weg war fast immer erfolgreich, vielleicht sogar zu erfolgreich, denn beinahe hätte er sie ins Burnout geführt.
Die Arbeit meiner Eltern zog immer weitere Kreise. In den frühen 1990er Jahren wurde der Hof schließlich regelmäßig von Studierenden und Lehrenden diverser Universitäten besucht. Unter ihnen bestand einhellig der Tenor, dass es sich beim Krameterhof um eine „Permakultur“ handle. Die Teiche, Terrassen und Pflanzgärten auf unserem Hof erinnerten die Besucher an das, was sie aus den Büchern über diese „neue Methode“ der Landbewirtschaftung gelesen hatten.
Dabei war die Arbeitsweise meiner Eltern alles andere als neu. Auch heute orientieren sich die einzelnen Betriebszweige auf unserem Hof vorrangig an traditionellen Bewirtschaftungsmethoden.
Die Begeisterung für die Natur ist in unserer Familie quasi in den Genen verankert. Dass die Natur mit ihrer Vielfalt einen Wert darstellt und nicht nur als Ressource gesehen werden darf, wurde nie in Frage gestellt. Erhalt und Schutz der Natur ist gleichbedeutend mit dem Erhalt und Schutz unseres eigenen Lebensraumes. Immer war klar: Natur darf man nutzen, aber nie ausnutzen.
Unserer Familie war es schon immer wichtig, sich nie auf nur eine Einnahmequelle zu spezialisieren. Wir wollen vielseitig bleiben, um auf veränderte Bedingungen reagieren zu können und wir wollen mit möglichst wenig Aufwand gute Erträge erzielen. Für diesen Zugang zur Landwirtschaft ist der Begriff Permakultur tatsächlich passend – auch wenn er erst nachträglich und eher zufällig den Weg zu unserem Hof gefunden hat.
Der Krameterhof heute
© SAGIS
Abbildung 1: Plan vom Krameterhof heute
© Josef Holzer
KINDHEIT AM BERGBAUERNHOFVON SEPP HOLZER
Der Bergbauernhof meiner Kindheit war eine kleinstrukturierte Landwirtschaft der Vielfalt. 24 Hektar insgesamt, davon ein Teil Wald. Wir hatten ein paar Rinder – die auch unser Fuhrwerk gezogen haben –, gut 30 Schafe, ein paar Schweine, Hühner und Gänse. Alles, was wir brauchten, haben wir selbst produziert – sofern das möglich war.
Nichts wurde verschwendet, dafür alles genutzt. Was und wieviel angebaut wurde, hat man genauestens geplant und war in erster Linie davon abhängig, wie viele Menschen am Hof lebten und versorgt werden mussten. Der Arbeitstag begann früh am Morgen und endete erst in der Dunkelheit. Die Verpflegung ist genau eingeteilt worden. Für den strengen Winter mussten wir Reserven anlegen. Wurden dabei Fehler gemacht, hat man das den ganzen Winter lang zu spüren bekommen.
Sepp Holzer, zehn Jahre alt, 1952
© Josef Holzer
Nicht nur Lebensmittel, sondern auch Baumaterialien, Textilien, Seile oder Medizin wurden überwiegend direkt am Hof hergestellt. Das Geld für die wenigen Dinge, die wir nicht selbst herstellen konnten, holten wir aus dem Wald, indem wir dort jedes Jahr etwas Holz für den Verkauf geschlagen haben. Zusätzlich wurden besonders hochwertige Produkte wie Fleisch, Speck oder Butter verkauft, weshalb diese kostbaren Lebensmittel eher selten am eigenen Teller landeten.
Alles war sehr knapp und die Arbeit – damals war alles Handarbeit – sehr anstrengend.
Weil mein Bruder oder ich irgendwann einmal den Hof übernehmen sollten, hat man uns alles beigebracht, was man auf einem Bergbauernhof können muss.
Ja, wir haben wirklich alles gelernt und machen müssen, darunter auch Dinge, für die wir eigentlich zu klein waren, Arbeiten, die wir gar nicht mochten. Widerrede war zwecklos.
Rückblickend muss ich sagen, es war eine Schinderei und vieles hat den Bogen deutlich überspannt. Oft haben wir gearbeitet, bis wir umgefallen sind. Heute würde man zurecht sagen: „Das ist strafbar! Das ist Kinderarbeit!“
Wir mussten jede Arbeit machen, auch die gefährliche, wie die im Stall zum Beispiel. „Pass auf, dass d‘ nit z‘ammtreten wirst!“ hieß es immer. Das war gar nicht so einfach als kleiner Bub zwischen so großen Tieren.
Unfälle, gerade bei Holzarbeiten oder der Arbeit mit Tieren, gab es immer wieder.
In der Nachbarschaft sah man Etliche mit verkrüppelten Gliedmaßen. Selbst schwerste Verletzungen an Armen und Beinen waren meist nicht von einem richtigen Arzt – den man teuer hätte bezahlen müssen – sondern selbst oder von „Kurpfuschern“ behandelt worden. Entsprechend schlecht sind die Wunden auch verheilt.
Jedenfalls – und das sollte man nicht schönreden – gab es damals viele äußerst anstrengende und riskante Arbeiten, die man uns Kindern nicht hätte zumuten dürfen.
Vieles wurde gemacht, das nicht begründet oder erklärt werden konnte. Wenn ich nachfragte, hieß es oft: „Das gehört sich einfach so! Das muss so gemacht werden und Punkt!“
Damals wie heute war wichtig, „was die Nachbarn sagen werden.“ Sinn hin oder her.
Die Atmosphäre am Hof war geprägt von Zwang und Strenge und ich habe nie verstanden, warum bei der Arbeit nur selten gelacht oder gesungen werden durfte.
Oft habe ich mir als kleiner Bub gedacht: Wenn ich einmal den Hof bekommen sollte, dann stelle ich das um, dann mache ich vieles ganz anders, viel besser!
Ich fand es zum Beispiel unnötig anstrengend, Erde und Mist mit dem Kuhgespann den Hang hinaufzubringen. Das Auf- und Abladen war eine Wahnsinnsarbeit und für eine einzige Fuhre Mist haben wir mindestens einen halben Tag gebraucht. Es ist mir nicht in den Kopf gegangen, warum man für so wenig Wirkung so einen Aufwand betreibt.
Zuwider war mir als Bub auch das ewige Steineklauben. Stundenlang sind wir in der prallen Sonne gestanden und haben uns mit den schweren Brocken abgemüht. Die Steine mussten weit weg vom Feld getragen und zu einem Haufen aufgeschichtet werden.
Was für eine Schinderei das war! Heute wäre so etwas unvorstellbar.
Solche Arbeiten wollte ich nicht machen, habe aber meinen Mund gehalten, weil der Vater bei Beschwerden sofort Watschen ausgeteilt hat: „Du hast zu machen, was ich dir sage und aus!“
Die schwere Arbeit hat mich aber auch zum Denken angestiftet: Wenn ich einmal den Hof übernehmen sollte, was würde ich damit wohl anfangen? Was würde ich anders machen und vor allem, wie?
Meine ersten unabhängigen Schritte waren kleine Waldgärten, die ich überall auf dem Hof anlegte und die mich in meiner Vermutung bestätigten, dass es auch andere, viel weniger anstrengende Möglichkeiten der Bewirtschaftung gibt.
„Diese oder jene Fläche, gerade auch die schwierigen, undankbaren, könnte man doch auch ganz anders nutzen“, dachte ich. Und die ersten Experimente mit kleinen, aber erstaunlich produktiven Einheiten haben mich motiviert, weiter in diese Richtung zu gehen und alles Mögliche auszuprobieren.
Zu jener Zeit, also Anfang der 50er-Jahre, war die Not im Lungau groß. Ich würde es sogar eine Hungersnot nennen. Viele meiner Schulkollegen sind noch 1954 von Hof zu Hof gegangen, um zu betteln: „Geh‘, Krameterbauer, hast du nicht ein Ei für mich oder zwei?“
Das waren Kinder, die zuhause oft noch bis zu zehn Geschwister hatten. Die haben mit den Eltern gemeinsam in einem einzigen Zimmer geschlafen – getrennt nur mit Tüchern, die man im Raum aufgehängt hat.
Der Hunger war vor allem bei denen groß, die keinen Hof hatten und deren Eltern in der Fabrik im Tal arbeiteten. In der Schulpause kamen die hungrigen Kinder dann zu uns und haben gebettelt, denn wir Bergbauernkinder hatten immer Brot, etwas Butter und ab und zu sogar ein Stück Speck dabei. Die meisten anderen dagegen hatten nur trockenes Brot – und oft nicht einmal das.
Man musste aufpassen, dass man selbst zum Essen gekommen ist, so sehr wurden wir bekniet, unsere Jause zu teilen. Das ist so weit gegangen, dass so mancher sein Pausenbrot heimlich am Klo gegessen hat, damit er nicht so viel davon abgeben musste. Auch wenn wir immer was zu essen hatten, üppig war die Kost selbst für uns Bauernkinder nicht.
Eine harte Zeit war das. Besonders für Kinder, die damals überhaupt keine Rechte hatten. Körperliche Gewalt war allgegenwärtig. Es reichte schon, wenn ein Erwachsener schlecht gelaunt war und – Zack! – ist man schon wieder geschüttelt und abgewatscht worden.
Wenn man als Kind etwas wollte, musste man bedacht vorgehen, erfinderisch sein und es sich über Umwege beschaffen.
Ein wenig Freiraum verschafften mir kleine Summen Geld, die ich mir verdiente, indem ich selbstgezogene Pflanzen, Basteleien und manchmal auch kleine Tiere verkaufte.
Diese kleinen Geschäfts-Erfolge motivierten mich. Das bisschen Geld war zwar nicht der Rede wert, machte mich aber wenigstens ein Stück weit unabhängiger von den Erwachsenen – und das gefiel mir sehr.
Mein Glück war, dass man zu jener Zeit so gut wie alles handeln konnte: selbstgemachtes Spielzeug, ein Stück Speck oder einen jungen Hasen.
Das Verkaufen und Tauschen hat mir schon damals gut gefallen und erfolgreich war ich damit auch. Mit dem Erfolg ist auch mein Appetit gewachsen und ich wollte mehr und mehr produzieren.
Rückblickend kann ich sagen, dass mich dieser Drang weit gebracht hat, denn ich habe in der Folge vieles ausprobiert.
Was funktioniert hat, habe ich weiterverfolgt und so hat meine Permakultur am Krameterhof – ich hatte damals natürlich keine Ahnung, was das sein sollte – nach und nach Gestalt angenommen.
Schaue ich heute auf diese Zeit zurück, sehe ich, dass ich als Kind zwei wesentliche Dinge gelernt habe. Erstens: Du darfst nie aufgeben, musst Dich durchkämpfen und kreativ mit Widerständen umgehen. Und Zweitens: Wenn Du der Schinderei entgehen willst, musst du lernen, die Natur und die Zeit für dich arbeiten zu lassen.
PRÄGENDE VERSUCHEVON SEPP HOLZER
Den ersten Kastanienkern habe ich im Alter von fünf Jahren gepflanzt. Meine Mutter hatte behauptet, dass daraus ein Rosskastanien-Bäumchen wachsen würde und das hat sofort meine Neugierde geweckt. Ich sollte die Kastanie in die Erde stecken, diese feucht halten und abwarten, meinte sie. Ich war ganz aufgeregt und bin ständig zur Fensterbank gelaufen, um nachzusehen, ob sich im Blumentopf endlich was tut.
„Du musst schon Geduld hab’n“, mahnte meine Mutter. Als es endlich so weit war und der Samen keimte, hatte ich eine Riesenfreude. Aus meiner Kastanie wird tatsächlich ein Baum werden! Mein Baum!
In der Rückschau kann ich sagen, dass aus diesen ersten Versuchen in der Stube alles Weitere entstanden ist. Denn angetrieben von den ersten Erfolgserlebnissen, habe ich immer mehr Samen eingesetzt. Als ich erfahren habe, dass man auch Stecklinge ziehen kann, waren bald alle Blumentöpfe und Fensterbänke in der Stube und der Küche voll mit meinen Pflänzchen.
Meiner Mutter wurde dieser Wildwuchs – „Stauderach!“ – schließlich zu viel und ich musste meine Versuche ins Freie verlagern. Nur wohin? In ihren schönen Garten durfte ich nicht – den brauchte sie ja selbst. Auch andere schöne Flecken rund ums Haus waren tabu, weil der Vater dort regelmäßig mit der Sense gemäht hat – kein Grashalm durfte stehen bleiben, selbst jeder Zaunpfahl wurde rundherum feinsäuberlich ausgemäht. Ich musste also weiter weg vom Haus und suchte einen Platz im steilen Gelände, einen Flecken, der für meinen Vater möglichst unbrauchbar war.
Letztlich habe ich die meisten meiner Pflanzen zu einer Fläche gebracht, die der Vater von den Österreichischen Bundesforsten, also dem Staatswald, als Schafweide gepachtet hatte. Recht glücklich war er damit aber nie gewesen und oft schimpfte er über diese „Zeckenhoit“: bocksteil, trocken, felsig und eben reich an Zecken.
Für mich und meine Pläne war dieser Flecken aber geradezu ideal. Denn es gab hier felsige Stellen, zu denen die Tiere keinen rechten Zugang hatten. Zwischen die Steine und Felsen habe ich etwas Erde und verwittertes Laub gelegt und darin dann alle möglichen Samen gesteckt. Es dauerte nicht lange und – Bumm! – überall schossen Pflanzen in die Höhe!
Warum das dort so wunderbar funktioniert hat, habe ich erst später verstanden:
Die sonnenbeschienenen Steine erwärmten sich tagsüber und gaben die gespeicherte Wärme an ihre Umgebung ab. Seither nenne ich diesen Temperaturausgleich, der sich positiv auf das Pflanzenwachstum auswirkt, den „Kachelofen-Effekt“. Außerdem war es unter und – dank der Mulchschicht aus Laub – auch zwischen den Steinen immer schön feucht, was das Bodenleben und somit das Wurzelwachstum der Jungpflanzen förderte.
Mein erster Garten wuchs und wuchs und ich hatte eine riesige Freude damit. Bis mein Vater schließlich meinte, dass das dem Förster wohl nicht recht wäre: „Du kannst da nicht so viel herumgraben, das g‘hört ja nicht uns!“
Aber das hat mich nicht aufgehalten – im Gegenteil: Ich habe mehr und mehr günstig gelegene Flecken gefunden und auch diese erfolgreich kultiviert.
Dann allerdings haben Hirsche und Hasen meinen Garten entdeckt und einigen Schaden angerichtet. Ich war ganz verzweifelt: „Das darf doch nicht wahr sein! Was kann ich tun!?“