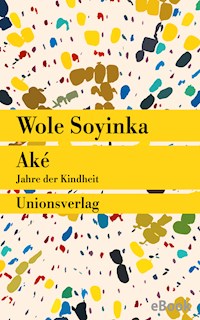
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inmitten überwucherter Hügel, umgeben von dichtem Unterholz und steil abfallenden Felswänden, liegt Aké. Der lärmerfüllte Markt und der verschwenderische, nach Mangos und Zitronenblättern duftende Obstgarten sind ebenso faszinierend wie das Pfarreigehöft mit seinem geheimnisvollen Pferdestall. Nach den aufregenden Geschichten der Mutter von Waldgeistern und wiederkehrenden Toten finden die Kinder Ruhe im vertrauenerweckenden Gesicht von Mrs B, der Frau des Buchhändlers. Mit drei Jahren verlangt der junge Wole, die Schule besuchen zu dürfen, gebannt von den Buchstaben in seinen Büchern. Sein Elternhaus, intellektueller Nährboden Akés, bestimmt seine Kindheit, in der der heraufdämmernde Weltkrieg sich einreiht neben der ebenso großen Sorge um das erste Paar Schuhe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
In Aké, zwischen duftendem Obstgarten und lärmendem Markt, lauscht der Junge Geschichten von Waldgeistern. Mit drei Jahren verlangt er, zur Schule zu gehen. Sein Elternhaus, intellektueller Nährboden Akés, bestimmt seine Kindheit, in der der heraufdämmernde Weltkrieg sich einreiht neben der ebenso großen Sorge um das erste Paar Schuhe.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Wole Soyinka (*1934 in Abeokuta, Westnigeria) ist Schriftsteller, Literaturwissenschaftler, Theatermacher sowie politischer Essayist und erhielt den Nobelpreis für Literatur. Aufgrund seiner Opposition zur Diktatur in Nigeria wurde er inhaftiert. Heute lehrt er an Universitäten rund um den Globus.
Zur Webseite von Wole Soyinka.
Inge Uffelmann (*1948) studierte Englische Literatur- und Sprachwissenschaft mit Schwerpunkt Schwarzafrikanische Literatur. Seit 1981 ist sie freiberufliche Übersetzerin.
Zur Webseite von Inge Uffelmann.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Wole Soyinka
Aké
Jahre der Kindheit
Roman
Aus dem Englischen von Inge Uffelmann
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1981 bei Random House, New York
Die deutsche Erstausgabe erschien 1986 im Ammann Verlag, Zürich
Originaltitel: Aké: The Years of Childhood
© by Wole Soyinka 1981
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Thomas Cockrem (Alamy Stock Photo)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31139-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 14:59h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AKÉ
1 – All das überwucherte, hügelige Gelände gehört zu Aké …2 – Wenn ich morgens aufwachte, war Tinu schon weg …3 – Ich konnte noch nicht allein auf die Leiter …4 – Ich prustete, tastete nach Nubis Hand und kämpfte …5 – Selbst der Baobab ist mit der Zeit geschrumpft …6 – Ich lag auf der Matte und stellte mich …7 – Es war unmöglich, die Veränderung vorauszusagen. Ein Zeitmaß …8 – Handwerker kamen ins Haus. Sie schlugen dünne Stifte …9 – In ganz Isara wusste man, dass die Kinder …10 – Die Gerüche sind dahin. Geräusche haben ihren Platz …11 – Es fiel mir auf, dass er sich mehr …12 – Großvater hatte recht. Nicht alle waren Männer in …13 – Wild Christian nahm ihre Freundin Mama Aduni zur …14 – Mrs Kutis Rückkehr machte aus dem Schulgelände der …15 – Die Frauen verschanzten sich zur Belagerung. Stoßtrupps streiften …GlossarMehr über dieses Buch
Über Wole Soyinka
Über Inge Uffelmann
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Afrika
Für Eniola (Wild Christian) und in Erinnerung an »Essay«.
Und für Yeside, Koyode und Folabo, die den hier erzählten Erinnerungsraum nicht bewohnen.
1
All das überwucherte, hügelige Gelände gehört zu Aké. Wir empfanden mehr als bloße Loyalität gegenüber dem Pfarrhaus, und daraus erwuchs – nicht ohne stillen Groll – die Frage, warum es Gott gefiel, von der profanen Höhe Itokos aus auf seine fromme Zweigstelle, das Pfarreigelände, hinabzuschauen. Denn dort, fast auf dem Gipfel des Berges, gab es auch den geheimnisvollen Pferdestall des Chiefs mit seinen richtigen Pferden. Dahinter scherte dann der schwindelerregende Pfad ab, führte von einem lärmerfüllten Markt zum nächsten und gab schließlich über Ibàràpa und Ita Aké den Blick frei bis hinein in die tiefsten Schlupfwinkel des Pfarreigrundstücks.
An diesigen Tagen wurde die steile Anhöhe von Itoko eins mit dem Himmel. Wenn Gott vielleicht auch nicht wirklich dort oben wohnte, so gab es doch kaum Zweifel, dass er zuerst auf diesen Gipfel herabstieg, ehe er mit gigantischem Schritt über die schnatternden Märkte setzte – die es wagten, am Sonntag Waren feilzubieten – und die Kirche von St. Peter betrat. Danach besuchte er das Pfarrhaus und nahm mit dem Kanonikus den Tee. Immerhin gab es den kleinen Trost, dass er, trotz der Versuchung, zu Pferde herabzukommen, niemals zuerst beim Chief einkehrte, denn der war als Heide bekannt. Nie sah man den Chief bei einem Gottesdienst, außer am Jahrestag der Krönung des Alake. Nein, Gott schritt zur Morgenandacht geradewegs auf St. Peter zu, verweilte kurz zur Mittagsmesse, behielt sich seine feierlichste und exotischste Audienz aber für die Abendandacht vor, die zu seinen Ehren immer auf Englisch abgehalten wurde. Dann tönte die Orgel dunkel, rauchig-sonor; zweifellos wollte sie mit diesem Timbre eines Egúngún ihren normalen Klang Gottes eigener Grabesstimme angleichen, mit der er auf die ihm dargebotenen Gebete antwortete.
Nur das Haus des Kanonikus konnte dem allwöchentlichen Gast Herberge bieten. Schon allein, weil es das einzige mehrstöckige Gebäude im Pfarreigelände war, quadratisch und massig wie der Kanonikus selbst, durchlöchert von schwarzen, holzgerahmten Fenstern. BishopsCourt war auch ein mehrstöckiges Gebäude, aber es wohnten nur Schüler darin, und folglich war es kein Haus. Vom obersten Stock im Hause des Kanonikus aus konnte man fast dem Gipfel von Itoko direkt ins heidnische Auge blicken. Das Haus stand auf dem höchsten bewohnten Punkt im Pfarreigelände, es war knapp hoch genug, das Tor zu überragen. Seinen Rücken kehrte es der Welt der Geister und Ghommiden zu, die den dichten Wald bewohnten und die die Kinder verjagten, die zu tief in den Wald eindrangen auf der Suche nach Feuerholz, Pilzen und Schnecken. Das quadratische weiße Haus des Kanonikus war ein Bollwerk gegen die Bedrohung und Belagerung durch die Waldgeister. Seine Rückfront bildete die Grenze ihres Territoriums, die verhinderte, dass sie sich gegenüber der Welt der Menschen Freiheiten herausnahmen.
Nur die Klassenzimmer der Volksschule teilten diese Nähe zum Wald, und sie standen nachts leer. Umgeben von rau verputzten Mauern, mit seinen fensterlosen Rückfronten, seinen Felstumuli, die die riesigen Bäume vergeblich zu verdecken suchten, gab sich das Pfarreigehöft von Aké mit seinen Wellblechdächern den Anschein einer Festung. In ihrem Schutz turnten wir nach Herzenslust zwischen den überlappenden und auseinanderklaffenden Dachflächen herum, kletterten in den steil abfallenden Felswänden, krabbelten ins Unterholz und in das plötzlich sich auftuende Versteck der gepflegten Obsthaine. Der Hibiskus wucherte üppig. Schwer hing der Duft von Zitronenblättern, Guaven und Mangos in der Luft, mitunter war sie direkt klebrig vom Saft der Boum-Boum und den Absonderungen des Regenbaums. Die Schulhöfe waren von diesen Regenbäumen mit ihren weit ausladenden Schatten spendenden Zweigen gesäumt. Nadelpinien reckten sich über die Akazien, und die Bambuswälder hielten uns in ständiger Alarmbereitschaft; wenn die Riesenschlangen die Wahl hatten, dann suchten sie sich in den dichten Bambusstauden einen Wohnplatz.
Zwischen der linken Flanke des Hauses des Kanonikus und dem Schulspielplatz lag – der Obstgarten. Viel zu artenreich, viel zu verschwenderisch ausgestattet, um nur schlicht ein Obstgarten genannt zu werden, es war ein Obstparadies. Hier gab es Pflanzen und Früchte, die den Garten zu einer Fortsetzung der Bibelstunde, der Sonntagsschule, der Sonntagspredigt machten. Eine Blattpflanze, weiß und rot gesprenkelt, hieß Cana lily. Als man Christus ans Kreuz nagelte und das Blut aus seinen Wunden spritzte, blieben einige Tropfen auf den Blättern haften und stigmatisierten die Lilie für alle Zeiten. Niemand hielt es für nötig, uns zu erklären, woher die unendlich vielen weißen Flecken auf den Blättern stammten. Vielleicht hatte es etwas mit der Reinwaschung von den Sünden durch das Blut Christi zu tun, das ja selbst die schwärzesten Stellen in den Seelen der Menschen schneeweiß wusch. Es gab auch die Passionsfrucht, einem anderen Teil der gleichen Geschichte entsprungen, bei uns Kindern dennoch nur wenig beliebt. Die grüne, prallsaftige Schale der Frucht schmiegte sich angenehm in die Handfläche, doch dann reifte sie in ein gedörrtes Gelb und fiel zusammen wie die Gesichter der alten Männer und Frauen, die wir kannten. Und sie schaffte es nur selten, süß zu werden, womit sie den untrüglichen Test, eine echte Frucht zu sein, nicht bestand. Unbestrittener König des Obstgartens war der Granatapfel, der nicht aus einem Samenkorn gewachsen war, das die Steinkirche gesät hatte, sondern aus der Saat der lyrischen Sonntagsschule – denn es war dort in der Sonntagsschule, wo die wirklichen Geschichten erzählt wurden, Geschichten, in denen die Ereignisse zum Leben erwachten, Geschichten, die die Zeitgrenzen des Sonntags und die Bibelseiten überschritten, die in die Welt der Fabelländer und richtiger Männer und Frauen eindrangen. Der Granatapfelbaum war ein höchst geiziger Lieferant. Er brachte seine hartschaligen Früchte nur selten hervor, geduldig gehegt von dick geäderten Händen und einem Gesicht, die jemandem gehörten, den wir nur als »Gärtner« kannten. Nur ihm konnte man vertrauen, wenn es darum ging, die gelegentliche Frucht unter die kleine Gruppe hingebungsvoller Granatapfelwächter zu verteilen, und noch der kleinste Bissen schickte uns auf die Reise ins Land der illustrierten Bibelgeschichten. Der Granatapfel war die Königin von Saba, Aufstand und Krieg, die Leidenschaft der Salome, die Belagerung von Troja, das Lob der Schönheit im Hohen Lied des Königs Salomo. Diese Frucht, die aussah und sich anfühlte, als habe sie ein Herz aus Stein, öffnete uns die Keller des Ali Baba, befreite den Geist aus Aladins Wunderlampe, schlug die Saiten der Harfe, die Davids verwirrte Sinne heilte, teilte die Wasser des Nil und erfüllte das Pfarreigehöft mit Weihrauch aus dem düsteren Tempel Jerusalems.
Er wachse nur im Obstgarten, sagte der Gärtner. Der Granatapfel sei ein Fremdling auf dem Boden des Schwarzen Mannes, aber irgendein früherer Bischof, ein Weißer, habe die Samen mitgebracht und sie im Obstgarten gepflanzt. Wir fragten, ob es der Apfel sei, aber der Gärtner lachte nur und sagte Nein. Noch, fügte er hinzu, würde man diesen Apfel auf dem Boden des Schwarzen Mannes finden. Der Gärtner wurde für total unwissend erklärt. Es war völlig klar, dass nur der Granatapfel der Apfel sein konnte, der Adam und Eva um die Freuden des Paradieses gebracht hatte. Es gab noch eine andere Frucht, die hier Apfel genannt wurde, weich und doch knackig, mit rosafarbener Schale und leidlich saftig. Vor der Entdeckung des Granatapfels hatte sie die Stelle jenes Apfels eingenommen, der dem nackten Paar zum Verhängnis geworden war. Der Geschmack des ersten Granatapfels aber entlarvte den Hochstapler und verwies ihn auf seinen Platz.
Schwärme von Fledermäusen bevölkerten den Feigenbaum; ihr samengespickter Kot lag noch vor der Abenddämmerung festgebacken auf Steinen und Wiese, auf dem Pfad und den Büschen. Ein immergrüner Baum, weich und üppig wuchernd, stand an der Grenze zwischen dem Spielplatz und dem Grundstück des Buchhändlers und trotzte dem Harmattan; von dort her war das Pfarreigelände mit dem unermüdlichen Konzert der Webervögel erfüllt.
Böses ist dem Pfarreigelände von Aké widerfahren. Das Land ist ausgewaschen, der Rasen kahl, alles Geheimnisvolle ist aus den verschwiegenen Talmulden gewichen. Einst offenbarte jeder Tag ein neues, unentdecktes Versteck, eine Felshöhle, ein dichtes Gebüsch, eine Schneckenkolonie. Das Autowrack steht noch, wo es einst aufgebockt wurde; die Kinder kletterten darin herum und unternahmen Reisen in ferne Fabelländer. Jetzt ist es nur noch ein abgetakeltes Gestell, rostige Höhlen seine Augen, das Drachengesicht zusammengefallen vom fortschreitenden Zahnausfall. Unter der Motorhaube gedeihen fette Unkräuter und glänzende Schlangen, das Ganze ist nur noch ein Dreckhügel. Die noch stehenden Häuser – Häuser, die einst das innere Festungsgemäuer des Pfarreigehöfts von Aké bildeten – sind jetzt alte Kisten in einer geräumten Landschaft, voller Risse, preisgegeben und ohne Widerstandskraft.
Und die Stimmungen sind dahin. Selbst die offenen Wiesen und breiten Pfade, gesäumt von gekalkten Steinen, Lilien und Zitronengrasbüscheln, wechselten von Jahreszeit zu Jahreszeit, von Werktag zu Sonntag, von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang ihren Charakter. Und das von den Wänden im unteren Pfarreigelände widerhallende Echo nahm mit den wechselnden Jahreszeiten neue Klangfarben an, änderte sich, wenn sich die Wiesen leerten und sich die Schüler mit den beginnenden Ferien zu ihren Eltern verstreuten.
Wenn ich mich auf die Wiese vor unserem Haus legte, das Gesicht zum Himmel gewandt, den Kopf in Richtung BishopsCourt, dann zeigte jedes ausgestreckte Bein auf ein umzäuntes Grundstück im unteren Pfarreigelände. Ein Teil der Anglikanischen Mädchenschule nahm einen dieser unteren Bereiche ein, der andere Teil der Schule hatte von BishopsCourt Besitz ergriffen. Im Erdgeschoss lagen die Klassenzimmer der jüngsten Schülerinnen und ein Schlafsaal, davor war ein Obstgarten angelegt, mit Papayas, Guaven, Bambus und wildem Unterholz. Während der Regenzeit fand man hier immer Schnecken. Auf dem anderen Grundstück lebte der Missionsbuchhändler, ein runzliger Mann mit einer gelassen-heiteren Frau, deren geräumiger Rücken uns allen irgendwann einmal Platz bot, die Welt zu betrachten oder an ihm zu schlafen. Durch dieses Grundstück führte eine Abkürzung zur Straße nach Ibarà, Lafenwá und Igbèin mit seinem Gymnasium, über das Ransome-Kuti die Aufsicht führte und wo er auch mit seiner Familie lebte. Auf dem Grundstück des Buchhändlers war die einzige Quelle des Pfarreigeländes; während der Trockenzeit blieb dieser Ort niemals verlassen. Und sein Boden schien die einzigen Kokospalmen hervorbringen zu können.
BishopsCourt im oberen Pfarreigelände ist nicht mehr. Bischof Ajayi Crowther trat manchmal aus den Blütentrauben der Hortensien und Bougainvilleen hervor, ein Gnomengesicht mit vorquellenden Augen, das uns zuerst als steife Fotografie vom Einband seiner Lebensgeschichte angestarrt hatte. Er hätte, so sagte der Lehrer, in BishopsCourt gelebt, und seit ich das wusste, spähte er mir aus den Kletterpflanzen heraus nach, wenn ich auf einem Botengang zu unserer Großtante, Mrs Lijadu, an dem Haus vorübermusste. BishopsCourt war jetzt das Wohnheim der Anglikanischen Mädchenschule und gab für uns einen extra Spielplatz während der Ferien ab. Der Bischof saß still auf der Bank unter dem hölzernen Vorbau vor dem Eingang, seine Gewänder waren über und über mit den Ranken der Bougainvilleen bedeckt. Als ich näher herankam, wandelten sich seine Augen in leere Höhlen. Meine Erinnerung schweifte zu einer anderen Fotografie, auf der er einen klerikalen Anzug mit Weste trug, und ich fragte mich, was wohl am Ende der Silberkette hing, die in einer der Westentaschen verschwand. Er grinste und sagte, komm näher, ich will es dir zeigen. Während ich mich dem Vorbau näherte, zog er an der Kette, bis eine kugelrunde Taschenuhr zum Vorschein kam, die massivsilbern glänzte. Er drückte auf ein Knöpfchen, und der Deckel sprang auf, doch es zeigten sich nicht Glas und Zifferblatt, sondern ein tiefer, wolkengefüllter Raum. Der Bischof blinzelte mit einem Auge, und es fiel aus seinem Gesicht in die Schale der Uhr. Dann blinzelte er mit dem anderen Auge, und es folgte dem ersten in das Uhrgehäuse. Er ließ den Deckel wieder zuschnappen, nickte und wurde kahl, seine Zähne verschwanden, seine Haut rollte sich zurück, bis die gebleichten Backenknochen entblößt lagen. Dann stand er auf und kam, während er die Uhr wieder in die Westentasche steckte, einen Schritt auf mich zu. Ich rannte nach Hause.
BishopsCourt, so schien es manchmal, wollte dem Haus des Kanonikus den Rang streitig machen. Es sah wie ein Hausboot aus, trotz seines Schutzwalls aus gekalkten Steinen und seiner reichen Blütenpracht, trotz seiner Holzgitter an der Vorderfront, die fast völlig von Bougainvilleen überwuchert waren. Dazu wurde es noch überschattet von diesen allgegenwärtigen Felsen, aus deren Klüften, wie durch ein Wunder, hohe, dickstämmige Bäume wuchsen. Wolken zogen sich zusammen, und die Felsen verschmolzen mit ihren vertrauten grauen Wirbeln; dann warf es die Bäume hin und her, bis sie schwebend über BishopsCourt zu stehen schienen. Doch geschah dies nur bei heftigen Stürmen.
BishopsCourt, anders als das Haus des Kanonikus, grenzte nicht unmittelbar an die Felsen oder den Wald. Die Spielplätze der Mädchen lagen dazwischen, und wir wussten, dass diese Pufferzone schon immer bestanden hatte. Bischöfe hatten offensichtlich keine Neigung, die Geister herauszufordern. Nur die Vikare. Dass mir Bischof Ajayi Crowther mit seiner eigentümlichen Verwandlung einen solchen Schrecken eingejagt hatte, bestätigte nur, dass Bischöfe selbst, sobald sie gestorben waren, in das Reich der Geister und Spukgestalten eingingen. Der Kanonikus konnte sich nicht so vor meinen Augen auflösen, auch nicht Hochwürden J. J., der einst das Haus bewohnt hatte, vor vielen Jahren, als meine Mutter noch ein Kind war wie wir heute. J. J. Ransome-Kuti hatte zu seinen Lebzeiten sogar einige Ghommiden auf ihren Platz zurückverwiesen; meine Mutter konnte es bestätigen. Sie war seine Großnichte, und ehe sie in unser Haus zog, hatte sie im Haushalt von Hochwürden J. J. gelebt. Ihr Bruder lebte auch dort und wurde von allen als Òrò anerkannt, weshalb er auch in den Wäldern wie zu Hause war – sogar bei Nacht. Einmal allerdings ist er wohl zu weit gegangen.
»Sie waren schon mal zu uns gekommen«, sagte sie, »um sich zu beschweren. Wohlgemerkt, sie kamen nicht wirklich bis auf unser Grundstück, sie blieben weit weg stehen, genau da, wo der Wald endet. Ihrem Anführer, demjenigen, der für sie sprach, sprühten wild die Funken aus dem Kopf, es sah so aus, als sei sein Kopf ein einziger Funkenball – nein, halt, ich bringe ja zwei ganz verschiedene Sachen durcheinander –, das war erst beim zweiten Mal, als er uns bis nach Hause jagte. Beim ersten Mal haben sie nur einfach einen Abgesandten geschickt. Er war ziemlich klein, dunkel und rußig schwarz. Er kam bis an den Garten hinterm Haus und stand da und befahl, dass man Hochwürden rufe. Es war, als habe der Onkel seinen Besuch erwartet. Er kam aus dem Haus und fragte ihn, was er wolle. Wir duckten uns alle in der Küche zusammen und spähten hinaus.«
»Wie klang seine Stimme? Sprach er wie ein Egúngún?«
»Darauf komme ich gleich. Dieser Mann, doch, ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein Mann war. Obwohl er kein wirklich menschliches Wesen war, das konnten wir sehen. Sein Kopf war viel zu groß, und die Augen hielt er zu Boden gerichtet. Er sagte, er sei gekommen, um über uns Meldung zu machen. Sie hätten nichts dagegen, wenn wir in den Wald kämen, selbst bei Nacht, aber in das Gebiet hinter den Felsen bei der dichten Bambusstaude am Fluss dürften wir nicht eindringen.«
»Und was hat der Großonkel gesagt? Und du hast noch immer nicht gesagt, wie seine Stimme geklungen hat.«
Tinu blickte mich mit den Augen der älteren Schwester an. »So lass Mama doch ihre Geschichte in Ruhe zu Ende erzählen.«
»Du willst immer alles ganz genau wissen, was? Also gut, seine Stimme klang genau wie die deines Vaters. Bist du jetzt zufrieden?«
Ich glaubte es nicht, aber ich ließ es durchgehen.
»Erzähl weiter, was hat der Großonkel dann gemacht?«
»Er rief uns alle zusammen und warnte uns, den Ort nie wieder zu betreten.«
»Und trotzdem seid ihr wieder hingegangen?«
»Na ja, du kennst doch deinen Onkel Sanya. Er war verärgert. Schon allein, weil es da drüben auf der anderen Seite des Baches die fettesten Schnecken gab. Also maulte er herum, dass diese Òrò einfach und schlicht selbstsüchtig seien und er ihnen schon zeigen würde, mit wem sie es bei ihm zu tun hätten. Na ja, und genau das hat er getan. Etwa eine Woche später führte er uns wieder an den Ort. Und er hatte recht, müsst ihr wissen. Wir sammelten einen ganzen Korb voll Schnecken und noch einen halben, die größten Schnecken, die ihr euch vorstellen könnt. Wir hatten natürlich längst die Warnung vergessen, und außerdem schien der Mond besonders hell. Ich habe euch doch erzählt, dass Sanya selbst ein Òrò ist …«
»Aber wie ist das möglich? Er sieht doch ganz normal aus, so wie du und wir.«
»Das verstehst du noch nicht. Jedenfalls ist er ein Òrò. Also fühlten wir uns in seiner Gegenwart völlig sicher. Bis plötzlich in der Ferne dieses eigentümliche Licht erstrahlte, wie ein Feuerball. Und selbst als es noch weit weg war, hörten wir schon Stimmen, als würden um uns herum ganz viele Leute gemeinsam immer die gleichen Worte murmeln. Sie sagten so etwas wie: ›Ihr dickköpfigen, halsstarrigen Kinder; wir haben euch gewarnt, wieder und wieder, aber ihr wollt ja einfach nicht hören …‹«
Wild Christian schaute über unsere Köpfe hinweg und runzelte die Stirn, um sich besser erinnern zu können.
»Man kann nicht mal sagen, dass es mehrere waren. Es war eigentlich nur diese eine feurige Gestalt, die ich sah, und sie war noch immer sehr weit weg. Und dennoch konnte ich sie ganz deutlich hören, als habe sie ganz viele Münder, die sie alle gleichzeitig gegen meine Ohren presste. Von Augenblick zu Augenblick wurde der Feuerball größer und drohender.«
»Was hat Onkel Sanya gemacht? Hat er ihn angegriffen?«
»Sanya wo ni yen? Er war der Erste, der Fersengeld gab. Bo o ló o yá mi, o di kítipà! Keiner dachte mehr an all die fetten Schnecken. Dieser Iwin verfolgte uns bis zum Haus. Unsere Schreie kamen lange vor uns an, und der ganze Haushalt war … na, ihr könnt euch den Aufruhr vorstellen. Der Onkel war schon die Treppe heruntergestürmt und stand hinten im Garten. Wir rannten an ihm vorbei, und er ging hinaus, dem Wesen entgegen. Diesmal überschritt der Iwin tatsächlich die Grenze des Waldes, er ging unbeirrt weiter, als wolle er uns bis ins Haus hinein verfolgen. Das heißt, er rannte nicht, aber er folgte uns stetig.«
Wir warteten. Aber das war’s! Wild Christian hing ihren Gedanken nach, während wir in Spannung verharrten. Dann holte sie tief Luft und schüttelte mit eigentümlich traurigem Gesichtsausdruck den Kopf.
»Die Zeit des Glaubens ist dahin. Unsere ersten Christen, die hatten noch Glauben, Vertrauen und wirklichen Glauben; nicht nur in die Kirche rennen und fromme Lieder singen. Glauben. Igbàgbó. Und es ist dieser Glauben, aus dem wahre Kraft und Macht erwächst. Der Onkel stand da wie ein Felsen, er hielt seine Bibel hoch und befahl: ›Geh zurück! Geh zurück in jenen Wald, der dein Zuhause ist. Zurück, sage ich, im Namen des Herrn.‹ Hm, und das war’s! Das Wesen drehte sich einfach um und ging weg. Die Funken fielen von ihm ab, schneller und schneller, bis es sich schließlich nur noch als schwaches Glimmen in den Wald zurückzog.« Sie seufzte. »Natürlich, nach dem Abendgebet hatten wir schon noch unseren Preis zu zahlen. Sechs von den Besten auf das Hinterteil von jedem. Sanya bekam zwölf. Und die ganze nächste Woche mussten wir jeden Tag Gras schneiden.«
Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass die Angst als Strafe vollauf genügt hätte. Obgleich Wild Christian zu dem quadratischen Haus hinüberstarrte, schien sie doch zu ahnen, was in meinem Kopf vorging, denn sie fuhr fort: »Glauben und – Disziplin. Das war es, was die ersten Gläubigen hatten. Pah! Gott macht sie nicht mehr so wie früher. Wenn ich an den denke, der jetzt dieses Haus bewohnt …«
Dann schien sie sich plötzlich wieder unserer Gegenwart zu erinnern.
»Was sitzt ihr denn noch hier herum? Ist es nicht längst Zeit für euch, euer Bad zu nehmen? Lawanle!«
Auntie Lawanle antwortete »Ma« aus irgendeinem fernen Winkel des Hauses. Doch bevor sie erschien, erinnerte ich Wild Christian: »Aber du hast uns noch nicht erzählt, wieso Onkel Sanya ein Òrò ist.«
Sie zuckte die Schultern. »Es ist eben so. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.«
»Wann? Wann?«, quengelten wir im Chor.
Sie lächelte. »Das versteht ihr noch nicht. Ein andermal werde ich es euch erzählen. Oder lasst es euch von ihm selbst erzählen, wenn er das nächste Mal wiederkommt.«
»Du meinst, du hast selbst gesehen, wie er sich in einen Òrò verwandelt hat?«
Jetzt kam Lawanle herein, und wir wurden ihr übergeben.
»Ist es nicht Zeit für die Kinder, ihr Bad zu nehmen?«
Ich bettelte: »Nein, warte noch, Auntie Lawanle«, wohl wissend, dass es vergeblich war. Sie hatte uns schon beide je an einem Arm gepackt. Ich brüllte zurück: »War Bischof Crowther ein Òrò?«
Wild Christian lachte: »Was wirst du wohl als Nächstes fragen? Ihr habt wohl in der Sonntagsschule von ihm gehört, was?«
»Ich hab ihn gesehen.« Ich stemmte mich gegen den Türrahmen und zwang Lawanle, stehen zu bleiben. »Ich sehe ihn immer. Er kommt und setzt sich unter den Vorbau der Mädchenschule. Ich habe ihn gesehen, als ich zu Auntie Mrs Lijadu hinüberlief.«
»Jaja, schon gut«, seufzte Wild Christian. »Geh jetzt und nimm dein Bad.«
»Er versteckt sich unter der Bougainvillea und …« Lawanle zerrte mich außer Hörweite.
Später am selben Abend erzählte sie uns den Rest der Geschichte. Bei der bewussten Gelegenheit befand sich Hochwürden J. J. gerade auf einer seiner zahllosen Missionsreisen. Er reiste viel, zu Fuß oder per Fahrrad, um mit den zahlreichen Zweigen seiner Diözese Kontakt zu halten und das Wort des Herrn zu verbreiten. Er stieß häufig auf Widerstand, doch nichts konnte ihn abschrecken. In einem der Dörfer in Ijebu ereignete sich einmal eine erschreckende Sache. Man hatte ihn gewarnt, an einem bestimmten Tag zu predigen, denn an diesem Tag sollte der öffentliche Auftritt eines Egúngún stattfinden. Aber er ließ sich nicht beirren und hielt seine Predigt. Die Egúngún-Prozession kam vorbei, während die Messe in vollem Gang war, und mit der Stimme der Ahnen befahl der Egúngún dem Prediger, auf der Stelle Schluss zu machen, seine Gemeinde nach Hause zu schicken, herauszukommen und der Maske zu huldigen. Hochwürden J. J. nahm keinerlei Notiz. Der Egúngún zog sich mit all seinem Gefolge zurück, doch als er am Hauptportal der Kirche vorbeikam, klopfte er mit seinem Stab dagegen, dreimal. Kaum hatte das letzte Mitglied der Prozession das Kirchengrundstück verlassen, da stürzte die Kirche ein. Die Wände fielen einfach um, und das Dach zerbröckelte. Wie durch ein Wunder aber brachen die Wände nach außen, während die Stützbalken des Daches in das Mittelschiff oder ebenfalls nach außen fielen – überallhin, nur nicht auf die Gemeindemitglieder. Hochwürden J. J. beruhigte die Gläubigen, hielt in seiner Predigt inne, um ein Dankgebet zu sprechen, und setzte dann seine Kanzelrede fort.
Vielleicht war es das, was Wild Christian meinte, wenn sie von Glauben sprach. Aber es brachte die Dinge gehörig durcheinander, denn schließlich war es ja dem Egúngún gelungen, die Kirche zum Einsturz zu bringen. Wild Christian unternahm keinen Versuch, zu erklären, wie das geschehen konnte. Folglich gehörte dieses Bravourstückchen wohl in jene Kategorie von Glauben, der Berge versetzt oder Wild Christian befähigte, Erdnussöl aus einer breitrandigen Schüssel durch einen schmalen Flaschenhals zu gießen, ohne dabei auch nur einen Tropfen zu verschütten. Sie hatte die eigentümliche Angewohnheit, dabei wie in Verzückung zu seufzen, die Ruhe ihrer Hand ihrem Glauben zuzuschreiben und Gott dafür zu danken. Wenn ihr aber die Schüssel wegrutschte oder auch nur ein oder zwei Tropfen danebengingen, dann murmelte sie, dass ihre Sünden zu groß seien und sie wohl inbrünstiger beten müsse.
Wenn Hochwürden J. J. Glauben besaß, so hatte er aber auch den Starrsinn mit unserem Onkel Sanya gemeinsam.
Starrsinn war, wie wir leicht erkannten, eine der schwersten Sünden; und ganz gleich, wie Wild Christian auch immer versuchte, die Predigt von Hochwürden J. J. zu verteidigen, die er am Tage des Auftritts des Egúngún entgegen allen Warnungen gehalten hatte, es hörte sich sehr nach Starrsinn an. Und was Onkel Sanya anging, so gab es überhaupt keinen Zweifel; kaum war Hochwürden J. J. in Erfüllung seiner pastoralen Pflichten außer Sichtweite geradelt, als Sanya auch schon unter irgendeinem Vorwand in den Wald entschlüpfte, und zwar genau in die Gegend, die der Òrò zur Bannzone erklärt hatte. Pilze und Schnecken waren das wahre Ziel, dass er Feuerholz sammeln wollte, war eine Ausrede.
Doch selbst Sanya wagte sich nun nachts nicht mehr in den Wald. Er sah ein, dass es zu gefährlich war. Tagsüber und in der frühen Dämmerung lauerte wenig Gefahr, denn die meisten Waldgeister kamen erst nachts hervor. Mutter erzählte uns, dass bei der bewussten Gelegenheit sie und Sanya Pilze sammelten. Sie waren nur durch ein paar Büsche voneinander getrennt, sie konnte alle seine Bewegungen ganz deutlich hören, denn sie achteten jetzt sehr genau darauf, dass sie dicht beisammenblieben.
Plötzlich, so erzählte sie, hörte sie, dass sich Sanya mit irgendjemandem angeregt unterhielt. Erst lauschte sie eine Weile, dann rief sie Sanya beim Namen, aber er gab keine Antwort. Außer seiner Stimme war nichts weiter zu vernehmen, trotzdem schien er mit einer anderen Person freundlich zu plaudern. Sie spähte durch die Büsche, und da saß Onkel Sanya auf dem Boden und palaverte munter drauflos mit jemandem, den sie nicht sehen konnte. Mit ihren Blicken versuchte sie, die umliegenden Büsche zu durchdringen, doch es war niemand im Wald – außer ihnen beiden. Und dann fiel ihr Blick auf seinen Korb.
Sie hatte das schon mehrmals beobachtet, sagte sie. Es war immer dasselbe, ganz egal, wie viele Kinder aus dem Haushalt sich auch aufmachten, Schnecken, Beeren oder sonst was zu sammeln, Sanya verbrachte die meiste Zeit damit, herumzutollen, auf Bäume oder Felsen zu klettern oder irgendwohin zu spazieren. Seinen Korb ließ er achtlos stehen. Und doch, wenn sie sich auf den Heimweg machten, war sein Korb immer voller als der der anderen. Diesmal war es nicht anders. Als sie näher kam, fuhr unser Onkel Sanya erschrocken hoch, brach seine Unterhaltung brüsk ab und tat so, als suche er im Unterholz nach Schnecken.
Mutter sagte, dass sie sich gehörig fürchtete. Sein Korb war voll bis zum Rand, zum Bersten voll. Außerdem war sie ziemlich entmutigt. Sie nahm also ihren fast leeren Korb auf und bestand darauf, dass sie sofort nach Hause gingen. Sie ging voran, doch als sie sich nach einiger Zeit umschaute, schien es, als versuche Sanya, ihr zu folgen, werde aber gehindert – so als ob unsichtbare Hände ihn zurückhielten. Von Zeit zu Zeit schlug er mit seinem freien Arm um sich und fauchte: »Lass mich doch los! Siehst du denn nicht, dass ich nach Hause muss. Ich sag dir doch, ich muss jetzt gehn, also lass mich!«
Jetzt rannte sie los, und Sanya tat es ihr gleich, sie rannten den ganzen Weg bis nach Hause.
An diesem Abend wurde Sanya krank. Er bekam einen heftigen Schweißausbruch, wälzte sich die ganze Nacht auf seiner Matte hin und her und murmelte ständig vor sich hin. Am nächsten Morgen war das ganze Haus in heller Aufregung. Seine Stirn fühlte sich brennend heiß an, und niemand konnte einen zusammenhängenden Satz aus ihm herausbringen. Zum Glück kam gerade eine ältere Frau, eine von J. J.s Konvertiten, zu einem ihrer üblichen Besuche vorbei. Als sie von Sanyas Zustand hörte, nickte sie weise. Sie verhielt sich ganz so wie jemand, der genau weiß, was hier zu tun war. Zunächst einmal fand sie heraus, was zuletzt geschehen war, bevor Sanya krank wurde. Sie rief meine Mutter zu sich und fragte sie haarklein aus. Die erzählte ihr alles, und die alte Frau nickte die ganze Zeit verständnisvoll. Dann gab sie ihre Anweisungen: »Ich brauche einen Korb voll Àgìdi, für fünfzig Portionen. Dann bereitet mir eine große Schüssel voll Èkuru zu. Dass ihr mir aber jede Menge Johannisbrot und Krebsfleisch hineintut. Es muss so appetitlich wie möglich riechen.«
Die Kinder stoben in alle Richtungen. Einige rannten zum Markt, um die Àgìdi zu holen, andere begannen, die Bohnen für die gewünschte Menge Èkuru zu mahlen. Den Kindern lief das Wasser im Mund zusammen, denn sie nahmen an, dass dies ein Beschwichtigungsfest werden sollte, ein Sàarà für einen gekränkten Geist.
Doch als alles fertig zubereitet war, trug es die alte Frau in Sanyas Krankenzimmer, dazu einen Krug kaltes Wasser und Tassen, schloss Sanya im Zimmer ein und schickte alle Kinder fort. »Ihr geht euren ganz normalen Arbeiten nach, und dass mir keiner dem Zimmer hier nahe kommt. Wenn ihr wollt, dass euer Bruder wieder gesund wird, dann tut, was ich sage. Versucht nicht, mit ihm zu sprechen, und guckt auch nicht durchs Schlüsselloch.«
Sie verschloss sogar die Fensterläden und setzte sich dann am anderen Ende des Hofes nieder, von wo aus sie alle Unternehmungen der Kinder gut überschauen konnte. Aber sie nickte bald ein, und so konnten Mutter und die anderen Kinder ihre Ohren an Tür und Fenster pressen, obwohl sie natürlich Sanya selbst nicht sehen konnten. Es hörte sich an, als sei Onkel Sanya nicht allein. Sie hörten ihn sprechen, er sagte Dinge wie: »Benimm dich, es ist doch genug da für jeden. Also gut, nimm das da, und hier ist eine Extraportion für dich … Mund auf … So … Ihr braucht euch doch nicht um jeden Bissen zu zanken. Hier hast du noch ein Stück Krebsfleisch … Benimm dich, hab ich gesagt …«
Und sie hörten etwas, das klang wie ein Klaps auf die Finger, wie das Schaben von Schüsseln auf dem Boden, wie das Gluckern von Wasser, das in eine Tasse gegossen wird.
Als die Frau entschied, dass es nun Zeit sei, und das war lange nach Einbruch der Dämmerung, gut sechs Stunden nachdem sie Sanya eingeschlossen hatte, ging sie und öffnete die Tür. Sanya lag da und schlief fest, doch diesmal ganz friedlich. Sie fühlte seine Stirn und schien mit der Veränderung zufrieden. Die Haushaltsmitglieder, die sich mit ihr zusammen ins Zimmer gedrängt hatten, interessierten sich allerdings nicht für Sanya. Alles, was sie sahen, und mit höchst erstaunten Gesichtern, waren die überall verstreut liegenden Blatthüllen von fünfzig Portionen Àgìdi, ohne Inhalt, eine riesige, leere Schale, die zuvor mit Èkuru gefüllt war, und ein fast leerer Wasserkrug.
Nein, da gab es überhaupt keine Frage, unser Onkel Sanya war ein Òrò, Wild Christian hatte mehr als nur einmal Beweise hierfür gesehen und gehört. Doch seine Kumpane gehörten offensichtlich eher zum wohlwollenden Typus, sonst wäre er sicher mehr als einmal zu Schaden gekommen, ungeachtet des schützenden Glaubens von J. J. Onkel Sanya besuchte uns zu der Zeit nur sehr selten, und so konnten wir ihm die Fragen nicht stellen, die Wild Christian uns zu beantworten sich weigerte. Als er uns das nächste Mal im Pfarreigelände besuchte, bemerkte ich seine fremden Augen, die kaum je zu blinzeln schienen und die starr über unsere Köpfe hinwegschauten, wenn er mit uns sprach. Doch dann wieder schien er viel zu lebhaft für einen Òrò; eine Zeit lang verwechselte ich ihn sogar mit dem hiesigen Pfadfinderführer, der den Spitznamen »Activity« hatte. Also fing ich an, die Wölflinge zu beobachten, denn sie kamen der Art von Gesellschaft, mit der sich unser Onkel Sanya in seiner Kindheit umgeben haben mochte, zweifellos am nächsten. Wenn ich ihre gespannten, kleinen Gesichter sich auf den Wiesen von Aké zum Kreis formieren sah, wenn sie bei ihrer Jamboree ihre kleinen Lagerfeuer entzündeten, mit Händen und Zweigen und mit genau zusammenpassenden Steinen ihre geheimen Zeichen austauschten, dann hatte ich das sichere Gefühl, die versteckten Kumpane entdeckt zu haben, die genau vor den Nasen der übertölpelten Wild Christian und der anderen Kinder aus J. J.s Haushalt ungesehen durch die Ritzen und Spalten der Tür oder direkt aus dem Boden gekrabbelt waren, um sich an fünfzig Portionen Àgìdi und einer riesigen Schüssel Èkuru gütlich zu tun.
Die Mission gestand der Pfarreistelle nur einen Vikar zu und seinen Katecheten; Aké war keinen Bischof mehr wert. Aber selbst das »Palais« des Vikars ist nur noch die Schale seiner selbst. Der Obstgarten ist verschwunden, und längst wurde das Zitronengras von den Ziegen abgefressen. Zitronengras – das Heilmittel gegen Fieber und Kopfweh; ein oder zwei Aspirin, eine Tasse heißen Tee aus Zitronengras und ab ins Bett. Doch der Tee strömte auch einen solchen Duft aus, dass wir ihn gern zur Abwechslung statt des schwarzen Tees tranken. Erstarrt, geschrumpft unter dem Einfluss der Zeit, ist jenes weiße quadratische Monument, das, gegen die Felsen gefügt, das Pfarreigelände beherrschte, das Auge auf sich zog, sobald ein Besucher durch das Tor des Pfarreigeländes trat. Der Herr dieses Hauses war ein Brocken von jenen Felsen, schwarz, riesig, ein Granitschädel und gewaltige Füße.
Meist wurde er Pastor genannt. Oder Vikar, Kanonikus, Hochwürden. Oder, wie meine Mutter ihn nannte, einfach Pa Delumo. Vaters Wahl hieß Kanonikus, und das war auch die meine, aber erst nach einem Besuch in Ibara. Wir unternahmen einige solcher Ausflüge; Besuche bei Verwandten, um Wild Christian bei ihren Einkäufen zu begleiten, oder aus irgendeinem anderen Grund, den wir aber nie ganz verstanden. Immer hatten wir am Ende eines solchen Ausflugs das vage Gefühl, man habe uns mitgenommen, damit wir etwas sehen oder erfahren sollten: Doch dann ließ man uns mit unserer Erwartung und Neugier im Stich – und mit unserer Erschöpfung natürlich, denn weite Strecken des Weges gingen wir immer zu Fuß. Manchmal war es schwierig, sich zu erinnern, welche speziellen Dinge wir gesehen hatten, was der eigentliche Grund für unseren Ausflug war, für den wir besonders fein angezogen und ordentlich gekämmt worden waren. Und immer gingen diesen Reisen Vorbereitungen mit viel Gewusel voraus.
Wir waren eine steile Straße hinaufgestiegen und zu einem imposanten Eingang gekommen – weiße Säulen und eine Platte, auf der stand: THE RESIDENCY. Ganz klar, hier lebte irgendein Weißer. Vor dem Tor patrouillierte ein Polizist in ausgebeulten Shorts und starrte über unsere Köpfe hinweg. Das Haus selbst stand leicht zurückgesetzt auf einem Hügel, zum Teil von Bäumen verdeckt. Doch die Objekte, auf die sich meine Augen hefteten, waren zwei schwarze wulstmäulige Rohre, auf hölzerne Räder montiert. Sie standen neben den Säulen, waren auf uns gerichtet, und daneben lagen Metallkugeln zur Pyramide aufgeschichtet, fast so groß wie Fußbälle. Das sind Geschütze, sagte meine Mutter, man nennt sie Kanonen, und im Krieg wird damit geschossen.
»Aber warum nennt Papa Pa Delumo denn einen Kanonikus?«
Sie erklärte den Unterschied, aber ich hatte längst meine eigene Antwort gefunden. Es war der Kopf; Pa Delumos Kopf sah aus wie eine Kanonenkugel, darum nannte Vater ihn Kanonikus. Das ganze Drum und Dran der Geschütze beschwor das Bild des Mannes herauf, seine Macht und Massigkeit. Die Kanonen sahen unverrückbar, unzerstörbar aus, genau wie er. Er schien alles zu überragen. Wenn er uns besuchen kam, dann füllte er die ganze Eingangshalle aus. Nur das Wohnzimmer schien ihm angemessen; wenn er sich erst einmal in einem der Sessel niedergelassen hatte, wurde er leichter überschaubar. Ich empfand Mitleid für seinen Katecheten, Jungvikar oder Kuratus – auch sein Assistent schien verschiedene Namen zu haben –, der einen faden Eindruck machte, wie eine verhungerte Parodie seiner selbst, und so offensichtlich arm im Geiste, dass ich mich später seiner nur als einer Kirchenmaus erinnerte. Unter den Männern, die den runden weißen Kragen trugen, kam nur unser Onkel Ransome-Kuti – den alle Daodu nannten – der Persönlichkeit Pa Delumos gleich, ja übertraf sie sogar. Pa Delumos Gegenwart flößte mir Ehrfurcht ein, er beherrschte nicht nur das Pfarreigehöft, sondern ganz Aké, und das auf noch eindrucksvollere Weise als Kabiyesi, unser Oba, zu dessen Füßen ich oft Männer sich zu Boden werfen sah. Gelegentlich traf ich sehr viel geheimnisvollere Kleriker, unnahbar in ihrer ganz eigenen Ehrfurchtgebietung, wie zum Beispiel Bischof Howells, der in der Nähe unseres Hauses im Ruhestand lebte. Aber der Kanonikus war der Vikar von St. Peter, und er füllte die Pfade und Wiesen ganz und gar aus, wenn er den Hügel hinunterschritt, um seine Herde zu besuchen oder seine donnernden Predigten zu halten.
Der Kanonikus kam häufig, um mit Vater zu diskutieren. Manchmal waren ihre Gespräche sehr ernst, dann wieder schallte sein Lachen durchs ganze Haus. Aber sie führten niemals Streitgespräche. Schon gar nicht habe ich sie je über Gott streiten hören, in der Art, wie es mein Vater mit dem Buchhändler und seinen anderen Freunden tat. Zu Anfang war es erschreckend, sie so über Gott reden zu hören. Besonders der Buchhändler mit seiner schrillen Stimme und seinem Truthahnhals schien für derart respektlose Bemerkungen über eine solche Macht physisch sehr schlecht ausgestattet. Manchmal schien der Kanonikus selbst diese Macht darzustellen, und so war der Wettstreit, wenn auch nur indirekt ausgetragen, sehr ungleich und ziemlich riskant für den Buchhändler. Meinen Vater hielt ich natürlich für gänzlich unverwundbar. Einmal ging der Kanonikus gerade durch das Pfarreigelände, während sie über irgendetwas disputierten, das mit der Geburt Christi zusammenhing. Sie schrien aus vollem Halse, und alle redeten durcheinander. Der Kanonikus war nur durch die Wiese draußen von ihnen getrennt, und ich fragte mich – weil er plötzlich stehen blieb, ob er sie wohl gehört hatte und nun käme, um sie zu maßregeln.
Aber er war nur stehen geblieben, um mit einem kleinen Jungen zu sprechen, der an der Hand einer Frau ging, wahrscheinlich seiner Mutter. Er bückte sich, um dem Jungen den Kopf zu tätscheln, sein breiter Mund öffnete sich in ein endloses Lächeln, und seine Augenwinkel zogen sich in Fältchen. Seine Stirn runzelte sich – manchmal war es schwer zu sagen, ob er über etwas erfreut war oder plötzlich Kopfschmerzen bekommen hatte. Sein Jackett war viel zu klein, die Hosenbeine endeten ein gutes Stück oberhalb der Knöchel, und der runde Kragen schien ihn fast zu ersticken. Der breitkrempige Priesterhut stauchte seine gigantische Gestalt; ich blickte rasch hinüber, um zu sehen, ob er sich vielleicht plötzlich verkleinert hätte, doch seine gewaltigen Schuhe, die, wie mich ein Vetter belehrte, Londoner Quadrat-Format genannt wurden, beruhigten mich. Mein Blick erhaschte gerade noch einmal sein ausladendes Hinterteil, ehe er sich wieder aufrichtete und die Hand der Frau zur Gänze verschwand, als er sie mit der seinen umfasste. Dieser Wechsel zwischen übermenschlichen Fähigkeiten und schlecht sitzender, gewöhnlicher Kleidung verwirrte mich; ich wünschte, er würde immer nur Soutane und Chorrock tragen.
Essay nahm bei allen Disputen mit Vorliebe die Position des Advocatus Diaboli ein – er wurde nach seinen Initialen S. A. genannt, von manchen auch HM oder »Headmaster« und von seinen stürmischeren Freunden auch Es-Ay-Sho. Aus irgendeinem Grund nannte ihn kaum jemand bei seinem richtigen Namen, und lange Zeit fragte ich mich, ob er überhaupt einen hatte. Es brauchte nicht lange, bis er in mein Bewusstsein einfach als Essay eindrang, geradeso wie jene sorgfältigen Stilübungen in Prosa, die ihren eigenen festgelegten Regeln der Komposition folgen und Produkte höchsten Anspruchs und ausgefeilter Eleganz sind, niedergeschrieben in wunderschöner Kalligrafie, die jeden Kopisten jedes Zeitalters vor Neid erblassen ließe. Wie groß war seine Verzweiflung darüber, dass er einen Sohn gezeugt haben sollte, der von Anfang an erkennen ließ, dass er nichts von dieser Schönschreibkunst geerbt hatte. Die gleiche Eleganz stellte er in seiner Kleidung zur Schau. Seine Essgewohnheiten waren eine Quelle ständiger Verwunderung für Mutter, die ich um des Kontrastes willen bald The Wild Christian, die ungezähmte Christin, taufte. Wenn Essay sich ein Stück Yarn abschnitt, es sorgfältig auf sein Gewicht hin abschätzte, es auf seinen Teller hinüberhob, innehielt, es umdrehte, ein Stückchen abtrennte und in die Schüssel zurücklegte, und dann dieses Ritual mit dem Fleisch und dem Gemüse fortsetzte, dann schüttelte sie den Kopf und fragte: »Macht dieses Schnipselchen denn nun einen Unterschied?«
Essay lächelte bloß und fuhr fort, mechanisch zu kauen, das Fleisch, den Yams in Stücke zu schneiden, als handle es sich um die Lösung einer Geometrieaufgabe; mit der Messerspitze nahm er eine Kellenladung vom Gemüseeintopf auf und bewarf das Stückchen Yams wie ein Maurermeister. Er trank nie zwischen den einzelnen Bissen, nicht einen einzigen Schluck.
Wenn sie zu debattieren begannen, war Essay allerdings genauso leicht erregbar wie der Buchhändler, der am schrillsten und verbissensten schrie, während seine winzigen Augen funkelten. Es sah aus, als schiene ihm immerzu die Sonne in die Augen. Der Buchhändler verbreitete im Hause eine Aura von Perlhühnern, Truthähnen, Schafen und Ziegen, Tiere, die er alle im Übermaß auf seinem Grundstück züchtete. Die Schafe mussten alle naselang zusammengetrieben werden; entweder hatte ein unachtsamer Besucher das Tor offen stehen lassen, oder die halsstarrigen Viecher hatten schon wieder eine Lücke in der Mauer aus Stein und Lehm gefunden. Dünn und hitzig, mit hervorstehenden, ledrig straff überzogenen Backenknochen unterstrich er seine Ausführungen mit vogelgleichen Bewegungen. Selbst wenn er noch so sehr in Angriffsstimmung war, ließ er doch die Schultern schlaff hängen; seine Finger weigerten sich, das Stoffkäppi loszulassen, das im Freien immer auf seinem Kopf saß – vielleicht weil er eine Vollglatze hatte. Wir konnten sein Lachen immer deutlich heraushören, schrill und rasplig entblößte es zwei lückenreiche Zahnreihen, die seinem Gesicht schließlich das Aussehen eines alten Korbsessels verliehen.
Die Frau des Buchhändlers war eine von unseren vielen Müttern; hätten wir in der Angelegenheit eine Wahl gehabt, sie hätte in vorderster Front noch vor unserer eigenen Mutter rangiert. Von bovider Schönheit, mit pechschwarzer Haut und von unerschöpflicher Güte, erfüllte sie meinen Kopf doch mit beunruhigenden Gedanken, und das alles nur wegen ihres Ehemannes. Im Gegensatz zu ihm war sie ausgesprochen füllig, und manchmal, wenn der Buchhändler für Tage verschwand, dann war ich ganz sicher, dass sie ihn schlicht verschlungen hatte. Ich verspürte große Erleichterung, wenn ich seinen kahlen Kopf wieder im Haus oder Laden lebhaft hin und her rucken sah. Von all den Frauenrücken, auf denen ich getragen wurde, war keiner so sicher und gemütlich wie der von Mrs B. Er war geräumig, weich und beruhigend, er strahlte die gleiche vertrauenerweckende Ruhe und Freundlichkeit aus, die wir auch in ihrem Gesicht lesen konnten.
Wir übernachteten oft im Hause des Buchhändlers. Mrs B schickte das Dienstmädchen zu unserem Haus hinüber, um ausrichten zu lassen, dass wir bei ihr essen und übernachten würden, und damit basta! Wenn es was setzen sollte, versteckten wir uns hinter ihr, und sie schützte uns.
»Nein, nein, nein, da musst du erst mich schlagen …«
Wild Christian versuchte, mit ihrem Prügel um sie herumzulangen, aber sie stellte einfach zu viel Masse dar. Damit war die Angelegenheit erledigt, es sei denn, die Missetat wäre ganz besonders schwerwiegend gewesen.
Ihre einzige Tochter, Bukola, war nicht von dieser Welt. Wenn wir unsere Stimmen gegen die Wände des Schulgebäudes im unteren Pfarreigelände schmetterten, um aus der Ferne das zurückhallende Echo zu hören, dann schien es mir immer, als sei Bukola ein eingebürgertes Wesen aus jener anderen Welt, in der die Stimmen gefangen, gesiebt, neu gesponnen und dann in immer kleiner werdenden Kopien zurückgeworfen werden. Amulette, Anhänger, winzige Rasseln und dunkle, aus Kupfer gedrehte Ringe erdeten sie an Knöcheln, Taille, Handgelenken und Fingern. Sie wusste, dass sie ein Àbikú war. Auch die zwei winzigen Narben auf ihrem Gesicht gehörten zu den Abwehrmaßnahmen gegen die Verlockungen ihrer Gefährten aus jener anderen Welt. Wie alle Àbikú war sie privilegiert, abgesondert. Ihre Eltern wagten es nicht, lange oder ernsthaft mit ihr zu schimpfen.
Plötzlich drehte sie ihre Augen nach oben, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Sie tat es uns zuliebe, wann immer wir sie darum baten, Tinu stand dann in sicherer Entfernung, bereit, sofort wegzulaufen; irgendwie erwartete sie wohl, dass schreckliche Dinge folgen würden.
Ich fragte Bukola: »Kannst du was sehen, wenn du das mit deinen Augen machst?«
»Nur Dunkelheit.«
»Erinnerst du dich an irgendetwas aus der anderen Welt?«
»Nein. Aber ich gehe immer dahin, wenn ich in Trance falle.«
»Kannst du jetzt in Trance fallen?«
Aus ihrer sicheren Entfernung drohte mir Tinu, sie werde mich bei den Eltern verpetzen, wenn ich Bukola noch weiter ermuntern sollte. Und Bukola sagte, dass sie wohl in Trance fallen könne, aber nur, wenn ich sicher sei, dass ich sie auch wieder zurückrufen könne.
Ich war mir nicht sehr sicher, dass ich das konnte. Ich schaute sie an und fragte mich, wie Mrs B wohl mit so einem übernatürlichen Wesen zurechtkam, das starb, wiedergeboren wurde, erneut starb, das einfach kam und ging, sooft es ihm gefiel. Wenn sie lief, klingelten die Glöckchen an ihren Knöcheln und vertrieben die kleinen Gesellen aus der anderen Welt, die sie unaufhörlich belästigten und sie anflehten, doch wieder zu ihnen zu kommen.
»Kannst du sie wirklich hören?«
»Oft.«
»Und was sagen sie?«
»Dass ich kommen und mit ihnen spielen soll.«
»Haben sie denn keine eigenen Spielkameraden? Warum belästigen sie dich?«
Sie zuckte die Achseln.
Ich empfand Groll, schließlich war Bukola unsere Spielkameradin. Dann hatte ich eine Idee. »Warum bringst du sie nicht mit hierher? Wenn sie dich das nächste Mal rufen, dann lade sie doch ein, hier mit uns zu spielen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das können sie nicht.«
»Warum denn nicht?«
»Sie können sich nicht einfach frei bewegen. Du kannst ja auch nicht zu ihnen hinüber.«
Sie war etwas Besonderes, diese privilegierte Person, die, anders als Tinu und ich und auch ihre Gefährten aus dieser anderen Welt, so leicht von einer Sphäre in die andere wechseln konnte. Einmal konnte ich sie beobachten, als sie unter dem Bann der Ohnmacht stand, die Augen nach oben verdreht, die Zähne fest zusammengebissen, während ihr Körper schlaff wurde.
Mrs B jammerte und schrie: »Egbà mi, ara è ma ntutu! Ara èma ntutu!« Dabei rieb sie verzweifelt Bukolas Glieder, um sie ins Leben zurückzubringen. Der Buchhändler kam durch die angrenzende Tür aus dem Laden gerannt und öffnete ihr gewaltsam den Mund. Schon hatte eines der Hausmädchen eine Flasche aus dem Schrank geholt, und mit vereinten Kräften flößte man ihr eine Flüssigkeit ein. Die Àbikú erlangte das Bewusstsein nicht sofort zurück, aber ich sah bald, dass die Gefahr vorüber war. Die Spannung im Haushalt ließ nach, man streckte Bukola auf dem Bett aus, sie entspannte sich, und ihr Gesicht überzog sich mit übernatürlicher Schönheit. Wir saßen neben ihr, Tinu und ich, und beobachteten, wie sie aufwachte. Dann brachte ihr ihre Mutter etwas leichte Fischsuppe zu trinken, die sie rasch zubereitet hatte, während Bukola schlief. Normalerweise aßen wir alle zusammen aus derselben Schale, aber diesmal gab Mrs B etwas Suppe in ein kleines Gefäß und fügte eine zähflüssige Substanz aus einer Flasche hinzu. Es sah wie Brackwasser aus und hatte einen stechenden Geruch. Während wir unsere Suppe löffelten, stützte Mrs B den Kopf ihrer Tochter und ließ sie ihre Suppe in einem Zug austrinken. Bukola war offensichtlich darauf vorbereitet; sie schluckte die Arznei ohne Widerrede.
Später gingen wir hinaus spielen. Die Krise war überstanden. Doch Mrs B bestand darauf, dass wir innerhalb ihres Hofes blieben.
Ich erinnerte Bukola an den Bannzustand: »Hatten dich deine anderen Spielkameraden gerufen?«
»Ich kann mich nicht erinnern.«
»Aber du kannst es machen, wann immer du willst?«
»Ja. Besonders, wenn meine Eltern etwas tun, was mich ärgert. Oder das Hausmädchen.«
»Aber wie machst du das? Wie stellst du es an? Ich weiß, erst werden deine Augen ganz weiß …«
»Ach ja? Ich weiß nur, dass, wenn … na ja, wenn ich was haben will und meine Mutter sagt Nein. Es kommt ja nicht immer vor, aber manchmal verweigern mir meine Eltern etwas, und dann höre ich meine Kameraden, und sie flüstern mir ins Ohr: ›Siehst du, sie wollen dich nicht haben da drüben, wir haben es dir doch schon immer gesagt. Irgend so etwas sagen sie, und dann habe ich den Wunsch, wegzugehen, ich will unbedingt weggehen. Ich sage es meinen Eltern immer wieder, ich werde gehen, ich werde für immer gehen, wenn ihr das und das nicht macht. Und wenn sie es dann immer noch nicht machen, dann falle ich einfach in Ohnmacht.«
»Was passiert, wenn du nicht zurückkommst?«
»Aber ich komme doch immer zurück.«
Es bedrückte mich sehr. Mrs B war eine viel zu freundliche Frau, um mit einem solch schwierigen Kind geplagt zu sein. Andererseits wussten wir, dass Bukola nicht wirklich grausam war, ein Àbikú war eben so, sie konnte nichts für ihre Natur. Ich dachte an all die Dinge, die Bukola verlangen konnte, sogar Dinge, die zu beschaffen gar nicht in der Macht ihrer Eltern lag.
»Und wenn du sie jetzt eines Tages um etwas bittest, das sie dir unmöglich geben können, zum Beispiel das Auto des Alake?«
»Sie müssen mir alles geben, was ich will«, beharrte sie.
»Aber es gibt Dinge, die haben sie einfach nicht. Selbst ein König hat nicht alles.«
»Als es das letzte Mal passierte, hatte ich nur einfach um ein Sàarà gebeten. Mein Vater verweigerte es. Er sagte, ich hätte gerade erst eins gehabt, also fiel ich in Ohnmacht. Ich war wirklich entschlossen, für immer zu gehen.«
Tinu protestierte: »Aber man kann doch nicht jeden Tag ein Sàarà veranstalten.«
»Ich will ja auch nicht jeden Tag ein Sàarà«, insistierte sie, »und außerdem war das Sàarà, um das ich gebeten hatte, nicht für mich, sondern für meine Freunde von drüben. Sie sagten, wenn ich nicht sofort zu ihnen hinüberkommen könne, um mit ihnen zu spielen, dann sollte ich für sie ein Sàarà veranstalten. Ich sagte es meiner Mutter, sie stimmte zu, aber mein Vater war dagegen.« Sie zuckte die Achseln. »Na ja, so ist das eben, wenn die Erwachsenen sich weigern zu verstehen: So musste Papa noch ein Huhn extra opfern, weil es viel länger dauerte als sonst, bis ich zurückkam.«
Der Ausdruck ihres ovalen ernsten Gesichtes wechselte, während sie sprach, von Unschuld zu Autorität. Ich beobachtete sie sehr aufmerksam und fragte mich, ob sie wohl wieder eine Reise plante. So natürlich, wie das alles schien, fühlte ich doch eine vage Unruhe, das war doch ein bisschen viel Macht, die ein Kind da über seine Eltern ausüben konnte. Ich rief mir die Gesichter all derer, die bei besagtem Sàarà anwesend waren, ins Gedächtnis, wie wir aßen und tranken, den plötzlichen Streit, der aufkam, die beschwichtigenden Stimmen der Erwachsenen; nichts Ungewöhnliches war dabei geschehen. Es war ein Sàarà wie jedes andere. In kleinen Grüppchen hatten wir im Garten auf ausgebreiteten Matten gesessen, alle in unserem Sonntagsstaat, und Bukola war besonders prächtig gekleidet. Ihre Augen waren dick mit Antimon ummalt, und ihr Gesicht war gepudert. Sie saß mit auf unserer Matte und aß aus derselben Schüssel wie wir, es war absolut nichts Außergewöhnliches an ihr; und schon gar nicht sah ich sie heimlich ihren unsichtbaren Gefährten irgendwelche Leckerbissen zustecken – und doch war das Sàarà ja eigentlich für diese bestimmt.
Ich fragte mich manchmal, ob sich Mr B wohl in unser Haus flüchtete, um der Tyrannei seines Kindes ab und zu einmal zu entfliehen. Sosehr mein Vater Diskussionen liebte, über jedes Thema im Himmel und auf Erden, war es doch der Buchhändler, der die Gespräche gewöhnlich bis tief in die Nacht hinein ausdehnte. Er quälte ein längst totgerittenes Argument mit seinen Falkenkrallen, gab äußerst widerstrebend in einem Punkt nach, nur um sofort einen Standpunkt einzunehmen, der längst überholt oder durch andere Argumente schon lange widerlegt war. Sogar ich bemerkte das, und die übertriebene Geduld, die in Essays Stimme schwang, schien es zu bekräftigen.
Und manchmal nahmen ihre Diskussionen ganz erschreckende Wendungen. Eines Tages begleiteten der Buchhändler, Fowokan – der stellvertretende Rektor der Volksschule, der Katechet und noch einige von Essays Busenfreunden Essay nach der Sonntagsmesse nach Hause. Osibo, der Apotheker, nahm gern an den Diskussionen teil, trug aber selbst wenig dazu bei. Ihre Stimmen hatten schon längst das Haus erreicht, alle waren sie hitzig in die Debatte verwickelt, alle redeten durcheinander, und keiner gab ein Jota nach. Über Flaschen mit warmem Bier und Limonade wurde die Diskussion fortgesetzt; sie erschöpfte Wild Christians Vorräte an Chin-Chin und süßem Gebäck und zog sich bis zum Mittagessen hin. Doch obwohl sie voll Verzweiflung den Kopf schüttelte über »diese Freunde deines Vaters« und sich fragte, wie er es immer wieder schaffte, Freunde an sich zu ziehen, die solchen Heißhunger auf Argumente und Nahrungsmittel hatten, war es doch ganz offensichtlich, dass Wild Christian es sehr genoss, dass das Haus des Rektors die intellektuelle Wasserquelle für Aké und seine Umgebung war.
Wenn der Spätnachmittag heranrückte, lieferten Tee und belegte Brote oder Kuchen ihrer Stimmkraft neue Energie für den letzten Schlagabtausch; dann wurde es Zeit für die Abendandacht, und alle mussten nach Hause gehen, um sich umzuziehen. Gewöhnlich war es um diese Zeit, dass Bukolas Vater in der größten Gefahr schwebte. Die Argumente nahmen eine physische Wendung, bei der der Buchhändler, und immer nur der Buchhändler, als lebender Beweis für einen Diskussionspunkt herhalten musste. Meine Loyalität seiner Frau gegenüber stürzte mich in ein scheußliches Dilemma. Ich hielt es für meine Pflicht, hinüberzurennen und sie zu warnen, dass man dabei sei, ihren Mann in die Sklaverei zu verkaufen, aus Abeokuta zu verbannen, aus einem Flugzeug zu stoßen, vom Kirchturm zu stürzen, an einen Baum gefesselt allein bei Nacht den Waldgeistern zu überlassen, auf Erkundungsfahrt in die Hölle oder auf Friedensmission zu Hitler zu schicken … immer war es eine gefährliche Konsequenz des gerade debattierten Themas, und die einzige Möglichkeit, darüber waren sich alle einig, zu einer Lösung zu kommen. An jenem Tag wollten die sauberen Freunde ihm doch tatsächlich einen Arm abschneiden.
»Also gut, dann kann ich ja Joseph Bescheid sagen, dass er schon mal die Machete schärft.«
Die Diskussion hatte sich aus dem Thema der Morgenpredigt entwickelt. Im Laufe des Tages hatte sie, wie gewöhnlich, hundert Wendungen genommen, und jedes Mal hatten die gestikulierenden Arme des Buchhändlers die Funken der erschöpften Standpunkte neu entfacht. Jetzt war es so weit, dass er seinen Arm verlieren sollte. Trotzdem kämpfte er verbissen. Das tat er immer.
»Habe ich etwa behauptet, dass mein rechter Arm mir Ärgernis schafft?«
Unter Gelächter – und das war das Unbegreifliche, sie lachten immer – rief Essay, Joseph solle die Machete bringen.
Mr Fowokan schlug vor: »Oder eine Axt, was schärfer ist.«
Mr Bs Hände flatterten immer verzweifelter. »Halt, halt! Habe ich gesagt, dass mein rechter Arm mir Ärgernis schafft?«
»Willst du jetzt etwa behaupten, du seist ohne Sünde?«, konterte der Katechet.
»Nein! Aber wer kann mit letzter Sicherheit behaupten, dass es meine Hand war, die die Sünde beging? Und welchen Arm wollt ihr abschlagen, den rechten oder den linken?«
»Hm …«, mein Vater dachte über die Sache nach. »Du bist Linkshänder, also besteht große Wahrscheinlichkeit, dass dein linker Arm die Sünde beging. Joseph!«
»Nicht so voreilig. Lasst uns Gottes Wort noch einmal genau betrachten … wenn aber deine Hand dir Ärgernis schafft … Ärgernis schafft, heißt es, wohlgemerkt … davon, dass sie eine Sünde beging, ist nicht die Rede. Meine rechte Hand kann eine Sünde begehen, oder auch meine linke. Das mag für Gott ein Grund zum Ärgernis sein, aber es muss noch lange nicht bedeuten, dass es mir zum Ärgernis gereicht. Wenn Gott verärgert ist, dann ist das seine Sache, dann soll er nach seinem Gutdünken handeln.«
Essay blickte ihn entsetzt an. »Du willst also allen Ernstes sagen, dass etwas, was für Gott ein Ärgernis bedeutet, vom Menschen nicht als Ärgernis betrachtet zu werden braucht. Du weigerst dich, dich auf Gottes Seite gegen die Sünde zu stellen?«
Hastig war der Buchhändler bestrebt, Gott zu beschwichtigen. »Aber nein. Unterstell mir nichts, was ich nicht gesagt habe. Was du da behauptest, habe ich nie …«
Wie aus einem Mund riefen sie: »Na also, dann wollen wir keine Zeit mehr verschwenden.«
Joseph stand schon hinter den Kulissen bereit. Mein Vater nahm ihm jetzt die Machete ab, die anderen grapschten sich den Buchhändler.
»Halt! Wartet noch«, flehte der Mann.
Ich drehte mich zu Tinu um, mit der zusammen ich von einer Ecke des Wohnzimmers aus die Szene belauschte. »Einer von uns sollte vielleicht rüberlaufen und Mrs B holen.«
Aber da Tinu eigentlich nie wirkliches Interesse an den Diskussionen zeigte, merkte sie auch nicht, wann der Punkt erreicht war, an dem ein Argument auf eine gefährliche Probe gestellt werden musste.
Essay prüfte die Schärfe der Schneide mit der Daumenkuppe. Der Buchhändler schrie: »Aber ich versichere euch, weder mein rechter noch mein linker Arm schafft mir Ärgernis.«
Mein Vater seufzte. »Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Stell dir vor, du stündest jetzt vor ihm. Du bist sein Diener. Ein angesehenes Mitglied des Kirchenrates von St. Peter. Du behauptest und beharrst darauf, dass die Worte Jesu Christi wörtlich zu nehmen sind. Also gut, Gott also fragt dich jetzt: Hat deine rechte Hand dir jemals Ärgernis bereitet? Ja oder nein?«





























