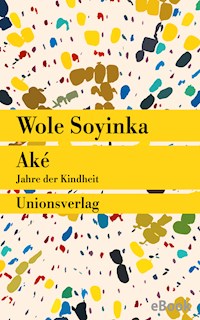8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Nigeria, das wegen Vorwahlen zur Präsidentschaft außer Rand und Band ist, verkauft ein gerissener Geschäftemacher aus einem Krankenhaus gestohlene Körperteile für rituelle Praktiken. Der Chirurg Dr. Menka, teilt seine grausige Entdeckung mit seinem ältesten College-Freund, dem Lebemann und Ingenieur Duyole Pitan-Payne. Dieser ist im Begriff, einen prestigeträchtigen Posten als Energieberater bei den Vereinten Nationen in New York anzunehmen, aber es scheint jetzt, dass jemand entschlossen ist, dies zu verhindern. Und weder Dr. Menka noch Duyole wissen, wer ihre Feinde sind.
Wole Soyinka nimmt uns mit auf eine Tour de Force: ein mit Galgenhumor versetztes hochspannende Epos darüber, wie Macht und Gier und die Schatten des britischen Kolonialismus die Seele einer jungen Nation verderben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Wole Soyinka ist der erste afrikanische Schriftsteller, der einen Nobelpreis für Literatur erhielt. Nach 48 Jahren legt er jetzt wieder einen Roman vor.
In Nigeria verkaufen gerissener Geschäftemacher aus einem Krankenhaus gestohlene Körperteile für rituelle Praktiken. Der Chirurg Dr. Menka teilt seine grausige Entdeckung mit seinem ältesten College-Freund, dem Lebemann und Ingenieur Duyole Pitan-Payne. Dieser ist im Begriff, einen prestigeträchtigen Posten als Energieberater bei den Vereinten Nationen in New York anzunehmen, aber es scheint jetzt, dass jemand entschlossen ist, dies zu verhindern. Und weder Dr. Menka noch Duyole wissen, wer ihre Feinde sind.
Mit Phantasie, Wut und schwarzem Humor zeichnet dieser Roman ein ungeschöntes Bild einer postkolonialen Gesellschaft.
DERAUTOR
Wole Soyinka, geboren 1934 in Abeokuta, Nigeria, schrieb zahlreiche Theaterstücke und wurde mit Romanen wie »Aké (1981/deutsch: 1986), »Isara« (1989/1994) und vor allem »Die Ausleger«(1965/1983) bekannt. 1967 wurde er wegen seiner Friedensbemühungen im nigerianischen Bürgerkrieg für zwei Jahre inhaftiert. Nach seiner Freilassung lebte er sowohl in den USA als auch in Nigeria. Er erhielt 1986 als erster afrikanischer Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur. 2008 erschien auf Deutsch seine große Autobiografie »Brich auf in früher Dämmerung«. 2017 zerstörte er als Protest gegen Trumps Regierungsantritt seine Greencard.
WOLE
SOYINKA
DIE GLÜCKLICHSTEN
MENSCHEN
DER WELT
ROMAN
AUS DEM ENGLISCHEN
VON INGE UFFELMANN
BLESSING
Originaltitel: Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth
Originalverlag: Bloomsbury Circus, London, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Wole Soyinka
und Agentur Liepman AG – Literary Agency, Zürich
Copyright © 2022 der Übersetzung by Karl Blessing Verlag, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Leingärtner, Nabburg
Umschlaggestaltung: SERIFA, München
ISBN 978-3-641-28457-2V001
www.blessing-verlag.de
Das vorliegende Werk ist ein Roman. Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse sind entweder Produkte der Fantasie des Autors oder werden fiktiv gestaltet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Begebenheiten und Örtlichkeiten ist rein zufällig.
In Erinnerung an den Investigativjournalisten Dele Giwa und den einzigartigen Politiker Bola Ige, die beide von nigerianischen Mördern gemeuchelt wurden.
Sowie an Femi Johnson, einen vollendeten Menschen und eine Ausnahmeerscheinung kreativer Lebensfreude.
INHALT
ERSTER TEIL
1 Der Hort des Propheten
2 Das Evangelium nach der Glückseligkeit
3 Die Reise des Pilgers
4 Die Reise des Spötters
5 Villa Potenzia
6 Vater, sind Sie das?
7 Warten auf Goddie
8 Aufruhr im Club
9 Die Image Task Force bei der Arbeit
10 Die Audienz
11 Die Hand Gottes
12 Boriga oder die Flucht
13 Chirurgische Transplantation
14 Badetona
15 Badagry
16 Codex Seraphinianus
17 Eine tödliche Rivalität
18 Eine überlange Wache
ZWEITER TEIL
19 Das diskrete Begräbnis der Bourgeoisie
20 Heimkehr
21 Zikkurat oder Tod
22 Das Gremium der Glückseligkeit
23 Kampf der Titanen
DANKSAGUNG
GLOSSAR
ERSTER TEIL
1
DERHORTDESPROPHETEN
Papa Davina, den man auch als Teribogo kannte, schmiedete gern seine eigenen Spruchweisheiten. Eine seiner berühmtesten lautete: »Perspektive ist alles.«
Die morgendliche Sucherin, erste und einzige Klientin an diesem Tag einer ganz besonderen, allein ihr gewidmeten Zusammenkunft, blickte auf und nickte zustimmend. Mit dem Finger zeigend, sagte Papa Davina: »Geh zu dem Fenster dort; zieh den Vorhang zurück und schau hinaus!«
Da es düster im Audienzraum war, dauerte es eine Weile, bis die Sucherin zwischen den weiten Falten tastend die Trennstelle der Vorhänge fand. Sie ergriff den schweren Stoff mit beiden Händen und wartete. Papa Davina bedeutete ihr, die Bewegung zu vollenden, während er in seinem beruhigenden, fast meditativen Ton fortfuhr: »Wenn du dieses Gelände betrittst, so ist es ganz wichtig, dass du vergisst, wer du bist und was du bist. Denke an dich einzig als die Sucherin. Ich werde dich leiten. Ich gehöre nicht zu den gewöhnlichen Vertretern der prophetischen Berufung. Dahin sind die Tage der großen Propheten. Ich bin lediglich als ein Vorausschauender bei dir. Nur Gott der Allmächtige, Allah der Unergründliche, ist die Gegenwart selbst, die Präsenz. Wer könnte es wagen, in die Präsenz des Einen und Einzigen zu gelangen? Unmöglich! Doch wir können vordringen in seine Vorausschau; ich kann es. Wir sind wenige. Wir sind auserwählt. Wir mühen uns, Seine Pläne zu lesen. Du bist die Sucherin. Ich bin der, der dich leitet. Unsere Gedanken können uns nur zu einem führen – der Offenbarung. Bitte, zieh den Vorhang völlig auf!«
Die Sucherin öffnete auch die andere Vorhanghälfte. Tageslicht flutete in den Raum. Papa Davinas Stimme folgte ihr: »Schau hinaus und sage mir, was du siehst!«
Die Sucherin hatte sich auf der anderen Seite des Hügels über eine gleichförmige Müllhalde hinaufgequält. Auf dieser Seite jedoch sprang ihr sofort ein bunt gewürfeltes Durcheinander in die Augen. Ganz weit unten sah sie vereinzelte rostige Wellblechdächer, Lehmziegelbauten, Simse aus Eisenplatten, hier und da durchsetzt von wenigen sauberen Reihen isoliert stehender, hoch aufragender, ultramoderner Gebäude. Ineinander verschlungene Bänder, auf denen man Motorfahrzeuge aller Art sah, wanden sich durch diese Zone des Kontrasts. Die Stadt kam gerade in ihren morgendlichen Schwung und wurde zu einem pulsierenden menschlichen Bienenstock; Motorradtaxis mit Arbeitern auf den Soziussitzen mäanderten zwischen den Pfützen des nächtlichen Regens und den überlaufenden Abwassergräben. Ganz in der Ferne schimmerte ein Stück der Lagune. Die Sucherin drehte sich um und beschrieb dem Apostel, was sie sah.
»Jetzt wünsche ich, dass du deinen Blick auf die Höhe hebst, auf der wir uns in diesem Raum befinden. Lass deinen Blick von der schwärenden Stadt aufwärts wandern! Zwischen dem Punkt, wo du hier stehst, und der rasenden Szenerie da unten, was siehst du noch?«
Die Sucherin zögerte nicht: »Müll. Berge von Abfall. Genau wie auf der anderen Seite – es war ein Weg voller Hindernisse, über den ich hier hinauf geklettert bin. Nichts als der gestapelte Kehricht der Stadt.«
Davina schien zufrieden. »Ja, ein Dunghaufen. Über ihn bist du hier heraufgekommen. Doch jetzt bist du hier. Und würdest du sagen, dass du auf einem Misthaufen stehst?«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Ganz und gar nicht, Papa Davina.«
Wiederum sichtlich zufrieden nickte der Apostel. »Bitte, schließe den Vorhang wieder!«
Als die Sucherin der Bitte nachkam, erwartete sie, dass der Raum erneut die ursprüngliche Düsternis annehmen würde und sie sich vorsichtig tastend bewegen müsste – doch nein. Vielfarbige Pfeile, ähnlich denen, die auf dem Boden von Flugzeugen zum Notausgang weisen, lenkten ihre Füße zu einem anderen Teil des großen Raums. Sie bedurfte keiner erläuternden Rezitation, um ihren Zweck zu begreifen – sie folgte den Lichtern. Diese endeten an einem auserlesen fein geschnitzten Hocker, der sie an die königlichen Thronhocker der Aschanti erinnerte, die sie von Bildern kannte.
»Setz dich auf diesen Hocker! Ich werde dich auf eine Reise mitnehmen, also mach es dir bequem!«
Der Prediger stand vor ihr und sprach: »Viele, und dazu gehören auch unsere Mitbürger, beschreiben diese Nation als einen einzigen gewaltigen Misthaufen. Aber die das tun, wollen uns herabwürdigen. Ich hingegen empfinde Glückseligkeit bei dem Gedanken. Denn wenn die Welt nichts als Mist produziert, muss sich dieser Mist doch irgendwo stapeln. Wenn also unsere Nation wirklich der Misthaufen der Welt ist, dann heißt das doch, dass wir der Menschheit einen Dienst erweisen. Und siehst du, das ist – Perspektive. Soll ich dir ein weiteres Beispiel geben?«
Die Sucherin nickte. »Ich höre aufmerksam zu, Papa Davina.«
»Gut. Schon in dem Augenblick, als ich deine Stimme am Telefon hörte, wusste ich, du bist keine gewöhnliche Sucherin. Deine Stimme sagte mir, da spricht jemand, der begierig ist zu lernen. Ich berate alle möglichen Leute. Sie alle kommen durch dieses Eingangstor dort. Du wärst überrascht, welch unterschiedliche Seelen schon auf diesem Hocker Platz genommen haben, sollte ich dir davon berichten.«
Die Sucherin lächelte schief und winkte mit einer Geste ab. »Papa Davina, ich bin hier, weil ich weiß, dass Sie einen gewaltigen Ruf haben, man kennt Sie nicht nur hier im Land, sondern auf dem ganzen Kontinent.«
»Ja, das mag sein.«
»Und noch darüber hinaus.«
»Oh? Dann erzähl mir, was du gehört hast! Die, die deine Füße hierhergeleitet haben, was sagen sie über Papa Davina?«
»Wo soll man da anfangen?«, seufzte die Frau. »Nehmen wir das jüngste Beispiel. Der Besucher von den Seychellen … Sie haben für ihn gebetet, und die Welt kennt das Ergebnis.«
Davina machte eine selbstabwertende Geste, indem er die geöffneten Hände wie schlaffe Schalen mit den Handflächen nach oben hielt und die Schultern leicht hob, als wollte er die Anerkennung – und die Ehre – jemand anderem zukommen lassen.
»Ich habe etwas für dich vorbereitet, eine – besondere Perspektive.«
Während er sprach, schien sich Papa Davina in der peripheren Düsternis aufzulösen, indessen der Raum selbst sich langsam mit einer Helligkeit erfüllte, die das Tageslicht ersetzte, das sie gerade gesehen hatte. Das aber war bloß der Anfang. Unter dem staunenden Blick der Sucherin verwandelte sich der öde Besuchsraum in ein Märchenland. Es verschlug der Frau den Atem. Ihr Gastgeber, den einen Arm nach oben gereckt, schien sich langsam zu drehen. Offenbar stand er auf einem leicht versenkten Drehteller. In der Hand hielt er ein kleines silbernes Gerät. Er streckte es zur Decke hin – und es ward Licht. Ein weiterer unhörbarer Klick, und das Gurgeln von Wasser unterbrach die Stille. Es entsprang einem Spalt in einem Felsen, der sich magisch aus dem Boden hob, eine Quelle, deren glitzernde Wasser sich in einlullenden Kaskaden ergossen und zu einer Grotte schlängelten, in der sie verschwanden. Wie an fernen Horizonten boten sich schimmernd Hügel und Täler, Ebenen und Hochländer dem Blick dar, während sanft leuchtende Röhren langsam vom Boden zur Zimmerdecke emporwuchsen und den Raum in einen psychedelischen Glanz tauchten. Langsam wurde ein schimmernder Alkoven sichtbar, dann, genau gegenüber, ein weiterer, sodann im Neunziggradwinkel zu diesem ein dritter und zuletzt ein vierter, der die dreidimensionale Installation vervollständigte. Die in regelmäßigen Abständen platzierten Alkoven erschienen wie das Abbild der vier Himmelsrichtungen. Auf dem mit polierten Holzfliesen belegten Fußboden entstanden, nacheinander illuminiert, Karten mit den Sternbildern der Tierkreiszeichen. Aus den Falten der Bänder an den Decksteinen der überwölbenden Bogen der Alkoven quollen nun Rauchschwaden hervor, die es in einer Spirale nach unten zog, sodass sie sich über die Sternkreiszeichen legten. Die Sucherin war von Weihrauchwolken umhüllt.
Sie hörte Papa Davinas Stimme: »Ich sprach von anderen Perspektiven. Siehst du nun, dass du dir, selbst wenn du einen Misthaufen bewohnst, doch sicher sein kannst, dass du auf dessen Spitze lebst? Das ist die andere Perspektive. Das unterscheidet die Berufenen von der allgemeinen Herde. Diese Erkenntnis sitzt im Herzen allen menschlichen Verlangens.«
Die Sucherin seufzte auf. Bis zu diesem Augenblick war es eine lange Reise gewesen, eine Reise voller erstaunlicher Diskrepanzen und Offenbarungen – physischer wie psychischer. Unterwiesen im obligatorischen Protokoll des Prophetenhorts, hatte sie sich diesem gänzlich unterworfen, bis hin zu den Inhalten des pinkfarbenen Umschlags, den sie mitgebracht und feierlich auf dem kleinen Altartisch abgelegt hatte, der neben dem eigentlichen Eingang des Gebäudes stand. Die Sache, um die es ging, duldete nicht die kleinste Abweichung von den Erlösung versprechenden Übergangsriten, deren einige sie unter normalen Umständen als persönliche Herabsetzung und Beeinträchtigung ihres gesellschaftlichen Rangs angesehen hätte. Es hatte sie viel Zeit gekostet, fast ein ganzes Jahr, diese Audienz zu arrangieren. So war dies nicht der Augenblick, die Erlösung aufs Spiel zu setzen. Unterwegs hatte sie die heimlichen bösen Blicke derer gesehen, die auf der Müllkippe nach Brauchbarem stöberten. Sie ließen ihre Augen von ihr zu Papa Davinas Horst hinaufwandern, als wollten sie sagen: Wart’s ab, eines Tages werden auch wir die Erlaubnis erlangen, diese letzten gepflasterten Stufen hinaufzusteigen, um von Dem Vorausschauenden empfangen zu werden. Man hörte so vieles darüber, hörte Geschichten vom magischen Inneren, wo sich die Transformation vollzog, ein Inneres, das im Widerspruch stand zu der Außenwelt aus rissigen Wänden und zerborstenem Zement. Nachrichten sickerten durch und berührten das Leben derer, die sich nach einer Schicksalsänderung sehnten. Manche schworen mit religiöser Inbrunst auf das Fußballtoto, andere auf die jährliche nationale Lotterie, doch am meisten erhofften alle die Berührung durch den Zauberstab – den Segen Papa Davinas. Sie träumten von dem Tag, an dem sie selbst die einundzwanzig glitzernden Stufen hinaufsteigen durften und hineingeleitet wurden in die Gegenwart Des Vorausschauenden. Ob sie tätig waren oder nur träumten, sie alle horteten Bilder des Glanzes des Einsiedlers in sich, jenes Magiers, den man Papa Davina nannte.
Die Sucherin war ihrer Schwester dankbar, dass sie den Papa Davina geschuldeten Obolus immer so pünktlich geleistet hatte. Man erhielt keine Privataudienz bei ihm, wenn man nicht mindestens ein Jahr lang an den öffentlichen Andachten teilgenommen hatte, die er am Fuß des Hügels für jedermann abhielt, der bereit war, seinen Zehnten als Abgabe zu leisten. Ihre Schwester hatte ihr sogar ihre »Erlösungscoupons« abgetreten. Natürlich machte Papa Davina Ausnahmen für Notfälle. Doch um die Auflagen zu umgehen, musste der Sucher – neben anderen Forderungen – erst die Jahresrückstände auf einen Schlag begleichen, und zwar in doppelter Höhe. Zu den Notfällen zählten Unvorhersehbarkeiten wie Gerichtsverfahren, die Mittel erforderlich machten, die sadistische Seele des Richters so milde zu stimmen, dass er einen Freispruch verkündete und vielleicht obendrein den Spieß umdrehte und den Ankläger beschuldigte.
Ihr eigenes Dilemma war weniger drastisch, und wie manche Patienten dies vor dem Arztbesuch zu tun pflegen, hatte auch sie sich bereits um eine Selbstmedikation bemüht. Bei ihr ging es schlicht um schlecht laufende Geschäfte, eine drei Jahre lang anhaltende Pechsträhne, die ihr hohe Verluste eingetragen hatte. Jetzt war noch das tödliche Gift der Abgaben für den Zoll hinzugekommen, auf Waren, die ohnehin kaum vor dem Zugriff der Piraten gerettet werden konnten, die neuerdings die Flussarme im Delta des Ostens unsicher machten. Nicht ausreichend, um die Verhängung der Ölblockade auszugleichen, aber immerhin. Das war der Grund, warum sich die Sucherin an Papa Davina wandte.
Und nun endlich befand sie sich also von Angesicht zu Angesicht vor dem Schicksal, mit einem Wunsch, dessen Erfüllung in den Händen des einsamen Hüters des Prophetenhorts ruhte. Und hier stand er, der Gärtner der Seelen – ein weiterer von Papa Davinas Titeln –, mit ausgetrecktem Arm, in der Hand ein elektronisches Gerät, das, wie der Stab des Mose, aus unfruchtbarem Fels das unschätzbar kostbare, lebenserhaltende Geheimnis sprudeln ließ. Nur war der Stab dieses modernen Moses auf Ölquellen eingestellt. Das Schwarze Gold, das sich unter Äckern, Plantagen und Fischteichen der Ahnen in den Boden schmiegte. Mit der Moderne änderten sich die Perspektiven.
Als wären die Gedanken der Sucherin gelesen worden, erweiterte sich die visuelle Schau jetzt um den akustischen Aspekt, denn es ertönten sonore, schnaufende Klänge aus Orgelpfeifen und verbreiteten den Hall einer erhebenden Komposition. Dies versetzte die Sucherin in nie erträumte Gefilde, in unerreichbar scheinenden Visionen. Papa Davinas Stimme sammelte die Empfindungen im sorgenschweren, frustrierten Geist der Sucherin und erdete sie in diesem außergewöhnlichen Moment.
»Unter deinem Hocker befindet sich eine Schublade – auf der rechten Seite. Öffne sie, du findest eine Mappe und einen Füllhalter darin. Einen altmodischen Füllfederhalter, keinen Kugelschreiber. Entnimm der Mappe ein Blatt!«
Die Sucherin gehorchte. Ihre Hand berührte die Mappe und spürte den Luxus feinsten Pergaments.
»Ich lasse mir das direkt aus Jerusalem kommen«, verriet Papa Davina in beiläufigem Ton. Die Sucherin aber war überzeugt, dies war der nämliche Papyrus, auf dem die Engel das Buch des Lebens schrieben.
»Schreibe darauf, was es ist, wonach du suchst!«, ermunterte Papa Davina die Sucherin.
Als sie die Aufgabe erfüllt hatte und aufblickte, stand Papa Davina neben ihr, in der einen Hand einen kleinen Flakon, der eine klare Flüssigkeit enthielt, in der anderen eine mittelgroße Schale. Die Sucherin wollte ihm das Blatt reichen, doch Davina schüttelte den Kopf. »Nein, ich weiß, was darauf steht. Mir musst du nichts offenbaren. Leg das Pergament in die Schale!«
Als es darin lag, goss Papa Davina die Flüssigkeit über die Schrift, schwenkte die Schale leicht hin und her, und die Gedanken der Sucherin reisten in ihre Kindheit zurück, zu den Tagen, als man noch Fotografien machte. Vom belichteten und entwickelten Film wurde das Bild auf Spezialpapier übertragen. Das Papier wurde in eine chemische Flüssigkeit gelegt, die sich einer anderen Schale befand, und ganz langsam kam ein Bild zustande, nass wie ein frisch geborenes Baby. Doch jetzt war die Perspektive verkehrt, der Prozess begann mit dem Sichtbaren und endete mit dem Unsichtbaren. Die Schrift wackelte, löste sich auf, und das Pergament erhielt seinen ursprünglichen Zustand zurück. Die zuvor klare Flüssigkeit war hingegen von der Tinte geschwärzt.
»Trink!«, befahl Papa Davina.
Die Sucherin zauderte nur kurz und nahm sich rasch zusammen. Zögern hätte einen Mangel an Vertrauen verraten und die Mission gefährdet. Sie lächelte glücklich. Sie war so weit gekommen – also trank sie. Sofort fühlte sie sich leicht benommen und zugleich beschwingt. Papa Davina reichte ihr ein parfümiertes Tüchlein, mit dem sie sich die Lippen abtupfen konnte. Eine schwere Last hob sich von ihren Schultern. Plötzlich stand ihr die Zukunft vor Augen, ein glänzendes Blatt voller unendlicher Möglichkeiten. Ihr war, als hätte sich bereits alles erfüllt. Sie reichte dem Apostel das Mundtuch hin, doch der hob abwehrend die Hand. »Behalte es! Leg es von jetzt an unter dein Kopfkissen! Und lasse während der nächsten zwei Wochen niemanden in dein Zimmer!«
Die Sucherin nickte rasch und freudig erregt.
Eine Stimme brach in ihre Euphorie ein: »Das diesjährige Festival rückt näher. Planst du, daran teilzunehmen?«
Die Frau schien unschlüssig. »Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, Papa Davina.«
»Es ist ein Festival der Freude – nimm teil! Ich kann dir garantieren, dass du bei diesem Ereignis Neuigkeiten von Interesse erfährst, Zeichen auf deiner Suche nach Erfüllung.«
»Natürlich, Papa Davina. Sobald Sie es befehlen.«
Davina legte der Sucherin eine Hand auf die Stirn: »Suchet, und ihr werdet finden. Lebe in Frieden. Über dem Torbogen zum kommenden Festival der Freude sehe ich deinen Namen geschrieben stehen, in großen goldenen Buchstaben. Die Glückseligkeit winkt dir am Horizont.«
Die Sucherin fiel auf die Knie und lobte den Herrn, die Augen in Verzückung geschlossen. Da sie mit dem Protokoll der Gemeinde der Ekumenika vertraut war, zog sie ihr Gebet nicht ungebührlich in die Länge. Leuchtende Pfeile – einfarbig diesmal, nicht in Technicolor – wiesen ihr den Weg zum Ausgang.
Kaum hatte die Sucherin das Tor der Ekumenika durchschritten und war auf die Spitze des Oke Konran-Imoran – des Hügels der Erkenntnis und der Aufklärung – hinausgetreten, zog Papa Davina, alias Teribogo, sein Handy aus der Tasche und tippte eine Nummer ein. Am anderen Ende ließ eine Stimme ein lang gezogenes »Jaaa?« hören.
»Sie ist gerade gegangen. Sie können es hier abholen lassen, Sir Goddie«, sagte Papa Davina.
2
DASEVANGELIUMNACHDERGLÜCKSELIGKEIT
Dass die Nation, die man den Riesen Afrikas nennt, auch als diejenige galt, die die glücklichsten Menschen auf Erden beherbergt, war keine Neuigkeit mehr. Verwirrend blieb, wie sie sich diese Anerkennung erworben und ob sie sie, allgemeiner Übereinstimmung gemäß, verdient hatte. Aufsteigende Nachbarländer mussten aus ihrem Dauerzustand neidischen Strebens befreit werden, geheilt von jener Malaise, welche die zum Scheitern verurteilte Bemühung hervorrief, der Nation der Glückseligen die Krone vom Haupt zu rauben. Die Weisheit der Ältesten rät, dass es ehrenhafter ist, den unangefochtenen Champion anzuerkennen und sich seiner Führerschaft anzuvertrauen, als ständig herumzunörgeln und sich frustriert zu winden. Wie die Yoruba zu warnen pflegen: Ti a ba ri erin igbo k’a gba wipe a ri ajanaku, ka ye so wipe a ri nka nto lo firi – Wenn wir einem Elefanten begegnen, dann lasst uns zugeben, dass wir den Herrn des Waldes sahen, und nicht leichthin behaupten, es sei bloß irgendetwas durch unser Gesichtsfeld gehuscht.
Nicht viele Nationen konnten mit einem Ministerium für Glückseligkeit prahlen. Dennoch gab es in einem der ärmsten der Bundesstaaten der föderalen Nation diese Neuerung. Die erste Ministerin – Kommissar genannt – war die Gattin des fantasievollen Gouverneurs besagten Bundesstaates, während andere Familienmitglieder und Anverwandte die übrigen Posten besetzten, die durch diese weltweit einzigartige Kabinettsbildung entstanden waren. Doch damit nicht allein dieser ersten Familie das Bravourstück eines einstimmigen Juryentscheids zugerechnet wird, muss man erwähnen, dass die freizügige Vergabe von begehrten Titeln überall im Lande eine Rolle spielte. Dass die mit einer einzigen Titelvergabe verbundenen Feierlichkeiten Summen verschlangen, die dem gesamten Jahresbudget anderer Nationen entsprachen, war ein oft übersehenes Faktum. Es gab freilich weitere, oft übersehene, dennoch monströse Exempel. Muss man beispielsweise die ständig und exponentiell wachsende Zahl von traditionellen Würdenträgern erwähnen, die ihren Titel quer über Geschichte, Kultur und Tradition hinweg durch den Federstrich eines Gouverneurs erhielten?
Die altehrwürdige Yoruba-Stadt Ibadan, einst eine unabhängige königliche Domäne, wurde eines Tages, ohne vorherige Zeichen einer Schwangerschaft, von vierundzwanzig neuen Königtümern entbunden, und das in Zeiten wütend tobender demokratischer Umbrüche.
Diese Glanzleistung blieb nicht unangefochten. Schon bald folgte das nahezu passende Pendant. Am entgegengesetzten Pol der nationalen Achse gebar eine historische Entität namens Kano vierzehn junge Emirate. Die präsidierenden Gouverneure der Bundesstaaten stellten den frisch gekürten Königen respektive Emiren – zuvor bloße Dorfälteste oder unbedeutende Chiefs – ihre Mitarbeiterstäbe vor, und die feierliche Übergabe der schnörkelstrotzenden Urkunden ihrer königlichen Amtseinsetzung generierte bunte Massenzeremonien der jubilierenden Bevölkerung. Die individuellen Kronen hier, Turbane dort, je nach den Maßen der königlichen Schädel passgenau fabriziert oder geschneidert, wurden auf die Köpfe der neuen Monarchen gesetzt oder um dieselben gewunden. Die professionellen Neinsager dieser Welt blieben außerstande, diese einfallsreichen Bravourstücke zu goutieren, die selbstverständlich gewaltige, das ganze Land mitreißende Festivitäten auslösten, die ihrerseits Garanten eines nahezu täglich stattfindenden Karnevals waren, was wiederum den Tourismus ankurbelte wie auch den Boom des ergänzenden Gewerbes: Entführungen zur Erpressung von Lösegeld.
Viele, zu viele eine Rolle spielende, hervorstechende Faktoren wurden von den Interessengruppen der wettstreitenden Nationen übersehen, meist weil sie zu sehr von dem Wunsch besessen waren, dem verdientermaßen reichen Nachbarn die Krone der Glückseligkeit zu entwinden. Unglücklicherweise führten die parteiischen, eigennützigen Haltungen lediglich zu Verwirrung bei den ganzjährig routinemäßig stattfindenden Festivitäten – seien sie religiöser, säkularer, moralischer oder sonstiger Natur –, die jede unabhängige Nation begeht, sofern sie sich auch nur das kleinste Quäntchen traditionellen Respekts vor der Welt der Lebenden, der Ungeborenen und der Ahnen bewahrt hat.
Typisch für das Missverständnis der lediglich Vergnügen heischenden Touristen – darunter nicht wenige gedankenlose Einheimische – war deren Neigung, den politischen Mummenschanz mit echten Festivitäten des Volkes zu verwechseln. Diese Verwechslung hing vor allem mit dem Festival der Wahl des Volkes zusammen, denn zugegebenermaßen eignen politischen und kulturellen Festlichkeiten ein paar Ähnlichkeiten. Am auffälligsten darunter die Gewohnheit, dass sie fast das ganze Jahr über andauern, Jahr um Jahr, obwohl sie eigentlich bestimmten festen Daten zugeordnet sind, die klar auf dem Kalender der Nation verzeichnet stehen. Dennoch sind die beiden eben getrennte Entitäten. Auch unter Bezeichnungen wie ›Schlag des Jahres‹, ›Concordia der Leute‹, ›Nacht der Nächte‹ etc. bekannt, war das Festival der Wahl des Volkes eindeutig ein reines Fest der Bevölkerung, das, mit deren Einwilligung, alljährlich an dem Wochenende stattfand, das auf den Unabhängigkeitstag folgte. Letztgenannter hingegen war eindeutig eine politische Angelegenheit. Das beinahe Zusammentreffen der beiden Ereignisse schuf eine weitere Quelle der Konfusion, wenn auch nur eine kleine und mit keinen Konsequenzen, da sich kaum noch jemand erinnerte, worum es sich bei der Unabhängigkeit handelte. Eine Militärparade, eine lustlos vorgetragene Rede an die Nation, Rufe nach Patriotismus, Rezitation einer ermüdenden Liste nationaler Ehrungen, und rasch gingen die Menschen wieder ihren Geschäften nach, in Erwartung des eigentlichen, wahren Ereignisses des Jahres und der damit verknüpften Nacht der Verleihung der Preise, was immer unter großem Jubel der Leute geschah.
Einige Zyniker und Revisionisten neigten zu der Unterstellung, das Festival sei eine Schöpfung der People on the Move genannten Partei. Das allerdings war fern der Wahrheit. Natürlich putzte sich auch diese Partei als Vorzeigemodell demokratischer Praktiken heraus, aber damit endeten auch schon alle assoziativen Vorstellungen. POMP – so das sprechende Akronym der Partei – reklamierte lediglich den Liberalismus für sich, der ein solches Festival möglich machte, ein alle umfassendes, unparteiisches Fest, das nicht nur Wurzeln geschlagen hatte, blühte und gedieh, sondern sich auch beständig nach beiden Richtungen hin über das festgesetzte Datum hinaus ausgeweitet hatte, bis es das ganze Jahr umfasste, manchmal bis ins nächste hineinragte und dadurch mit seinen verschiedenen Festivitäten den Neuanfang ein- und überholte. Kein anderes Festival der Welt konnte sich einer solchen feststehenden Rücklage rühmen. Es wurde nicht nur ein bewegliches Fest, sondern eine Festivität, die ständig mit Ereignissen im Rückstand war – immer ragten unerledigte Reste hinüber in die nächstfolgende Neuauflage.
Was der Wahl des Volkes gelang, ging über das Aufpolieren des Images der Regierung oder der Partei, die gerade am Ruder war, weit hinaus, denn in den Augen der Welt verbesserte das Fest das ramponierte Ansehen der Einheimischen ganz ungemein. Dieses Festival, Veteran zahlreicher Editionen, bewies, dass, ungeachtet des gegenteiligen Zeugnisses der politischen Wahlen, die Bürgerschaft des Landes, wenn man ihr nur eine entsprechende Chance ließ, die Welt noch so einiges lehren konnte bezüglich jener politischen Kultur, die man üblicher-, jedoch fälschlicherweise den Athenern zuschrieb. Wenn man der Regierung irgendeine Einmischung vorwerfen konnte, dann lediglich die, dass sie per formalem Erlass den Höhepunkt der Nacht der Nächte mit jener maximalen Intensität ausstattete, die der Yeomen of the Year genannte Preis darstellt, durfte dieser doch den Titel ›Weltkulturerbe‹ tragen. Die Regierung hatte nämlich den beispiellosen Schritt unternommen, der UNESCO die erforderliche Resolution vorzulegen – mit nicht weniger als fünfundzwanzig Millionen computerverifizierten Unterschriften, ein Bravourstückchen, das allerdings erst erreicht werden konnte, nachdem drei Volkszählungen stattgefunden hatten! Hätten wir das nicht getan, hätten wir unsere Pflicht versäumt und würden zu Recht der Gleichgültigkeit gegenüber Patriotismus, Kunst und Kreativität geziehen. Jetzt, wo wir getan haben, was wir tun mussten, stellt man uns an den Pranger und behauptet, wir begünstigten finstere Machenschaften der Regierung. Unseren Leuten kann man es einfach nicht recht machen!
Alter Gewohnheit gemäß war, wie gesagt, der Termin für das Festival der Wahl des Volkes das Wochenende, das auf den Unabhängigkeitstag folgte, jenen manifesten Ausdruck des Triumphs des Willens seines Volkes, ein historischer Tag, an dem man die ehemaligen imperialen Herren friedlich, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergießen, aus dem Amt gewählt hatte – »Unabhängigkeit auf goldenem Tablett serviert«, wie ein führender Nationalist und späterer Präsident des Landes damals trompetete. Dass sich die Nation beeilte, diesen Lapsus durch einen zwei Jahre anhaltenden Bürgerkrieg mehr als wettzumachen, konnte der POMP nicht angelastet werden, da sie zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit noch nicht existierte und auch nicht zur Zeit jener Sezession, die als Biafrakrieg bekannt ist. Für die Bevölkerung zählte allein der prachtvolle Phönix, der aus der Asche der Kolonisation gestiegen war.
Das Festival war in der Tat einzigartig. Es endete jeweils mit einem derartigen Schwall verliehener Preise, dass dadurch eine ganz neue Klasse von Bürgern in die Öffentlichkeit katapultiert wurde, bekannt als die Yeomen of the Year – kurz YoY –, Menschen, von denen die Allgemeinheit anerkannte, dass sie sich dieser Anerkennung durch Pflichterfüllung, Hilfsbereitschaft, Verdienste aller Art als würdig erwiesen hatten. Man sprach das Akronym wahlweise »Joi« aus oder auch – augenzwinkernd – buchstabengetreu als »Why o Why«. Und was für einen Kontrast bot diese Wahlparade zur Liste derer, die eine Ehrung zum Unabhängigkeitstag erhielten: fast der Alternative Oscar. Die Liste derer, die am Unabhängigkeitstag zu würdigen waren, stellte eine Nationale Anstands-Kommission zusammen, von deren Existenz und personeller Zusammensetzung kaum jemand etwas wusste. Ihr lagen keine Eingaben von Mann, Frau oder Kind für ihre Wahl vor, ihre Entscheidung war eine Konspiration hinter der verschlossenen Tür der heimlichen Kabale.
YoY hingegen etablierte sich als die echte, authentische, offen demokratische Abstimmung des Volkes, die erste dieser Art, seit sich die Nation auf die Reise in die Unabhängigkeit begeben hatte. YoY entwickelte sich zum Barometer des Pulses der Leute. Den Stirnen der Sieger drückte er jene seltenen, unauslöschlichen Stigmata einer Urmenschheit vor dem Sündenfall auf. Er lähmte allen Wettstreit und wurde als die Reality-Show des 21. Jahrhunderts bekannt. Selbst Big Brother Africa und andere voyeuristische Günstlinge virtueller Publikumsbeteiligung stach er aus.
Auch den Musikliebhabern, deren Loyalitäten zwischen den Polen Fußball und Song oszillierten, waren der Grammy Award und der Global Song Contest der Biennale in Venedig schnuppe, seit es YoY gab. Africa Can Dance entwickelte zwei linke Klumpfüße. Das berühmte Filmfestival von Cannes, diese Parade von Mode, Glamour und Hoffnungsfrohen, verlor sein globales Regenbogenspektrum, als sich das nigerianische Kontingent zurückzog – dem man mit umwerfender Originalität den Namen Nollywood verpasst hatte –, das einst die mediterranen Strände mit seinen exotischen Textilien beherrscht hatte. YoY verursachte einen gewaltigen Blutsturz und ließ das beliebte Filmfestival blass und anämisch zurück. Nur Wettbüros überlebten, ja vermehrten sich – wer wird welchen Preis in welcher YoY-Kategorie gewinnen, war die alles beherrschende Frage. Kein einziges den Durchbruch ersehnendes Film- oder Videosternchen, kein drahtiger Hip-Hop-Tänzer konnte es sich leisten, die alles überragende Show der nationalen Extravaganz zu verpassen: Yeomen of the Year. Der Versuch einer für Geschlechtergerechtigkeit kämpfenden Gruppe, rivalisierende Yeowomen zu kreieren, endete im vorhersehbaren Kollaps. Die Frauen selbst beschieden den Vorschlagenden, dass YoY von Anfang an alle Geschlechter inkludierte und einen fairen Wettbewerb auf gleicher Augenhöhe für alle verlangte, keine Pro-forma-Zugeständnisse, durch die das weibliche Geschlecht nur noch weiter degradiert würde. So allgemein war der Preis anerkannt.
Mit den Aufrufen, Vorschläge für die Nominierungen einzureichen, begannen bereits vier Monate vor der Nacht der Nächte die Vorbereitungen für die Preisverleihungsgala. Über Nacht änderte sich die Autorenschaft von Onlineplattformen. Sie wurden unter Pseudonymen gekauft oder gemietet und unter übernationale Schirme gestellt, die sich zum Beispiel »Kommentiere als Erster« nannten. Dies waren offene Plattformen für diejenigen Abonnenten, die dem marginalisierten Teil der Menschheit angehörten – manche zogen es freilich vor, vom marginalen Teil zu sprechen. Einige der Abonnenten wurden fast zu Millionären. Professionelle Betreiber von Portalen zur Imagepflege, die schon vor dem Ruin gestanden hatten, wurden plötzlich wieder solvent. Viele nutzten diese Profite, um ihr Geschäft zu erweitern, und spezialisierten sich vor allem in einem Nebenprodukt, das in Verbreitung und Unternehmergeist aufblühte und sich den gefeierten Namen Fake News erwarb. Im Handumdrehen wurde die Meinungsbildung synthetisiert, destilliert und verdaut. YoY verleibte sich Gallup-Umfragen und andere Hinweise auf kursierende Trends und Präferenzen der Menschen ein. Man konsultierte sie, ehe die Devisenmärkte öffneten, handelte sie an der Börse und tauschte sich mit mindestens zwei Dritteln der kontinentalen Ministerien für Finanzen, Kultur und Entwicklung aus. YoY breitete seine Flügel aus und erweiterte seinen Einfluss auf nicht wenige EU-Mitglieder und asiatische Nationen. Und doch hatte das Festival ganz klein angefangen, als kaum mehr als ein verschrobenes Verständnis der gesellschaftlichen Werte einer einzelnen Nation, die man in weiten Kreisen als Riese von Afrika feiert.
Urheber, Sponsor, einziger Organisator und Ein-Mann-Jury des Ganzen (obwohl sich formal ein aus dreizehn Mitgliedern bestehendes Gremium am Abend vor der Preisverleihung zusammenfand, sich mit Speis und Trank bewirten ließ und sein Honorar einsäckelte) war Chief Modu Udensi Oromotaya, Besitzer der Zeitung The National Inquest, ein ausgebuffter Geschäftsmann, der den Marktwert von Eitelkeit und Rampenlicht genauestens abzuschätzen verstand, unbeirrbar richtig investierte und sicherstellte, dass alle Bürger mit einem durchschnittlichen Einkommen teilhaben konnten. Sein Vorname Udensi war schon vor Jahren zu Ubenzy umgemünzt worden, eine Vereinnahmung des Mercedes Benz, dem Statussymbol nach der Unabhängigkeit, ehe diese Nobelkarosse dem Privatjet weichen musste. Dem Yeomen of the Year genannten Preis, durch eine Initiative aus dem Privatsektor entstanden, die ihre Weihe durch ein ritualisiertes gigantisches Ereignis erhielt, lag ein brillant dehnbares Konzept zugrunde, konnte er doch für alle menschlichen Aktivitäten verliehen werden – sei es die Aufdeckung eines Pädophilenrings, sei es, dass jemand einer alten Dame über die Straße geholfen hatte –, vorausgesetzt, die preiswürdige Tat war von einer Kamera eingefangen worden. Jedes Jahr bekam die Preisverleihungsjury neue Kategorien genannt – Stand der letzten Zählung: siebenunddreißig. Es hing allein davon ab, welcher neue Bewerber in der öffentlichen Arena gesichtet, zum Ziel erklärt und im Netz gefangen worden war.
Chief Oromotaya war ein erfindungsreicher Geist. Wenn die Öffentlichkeit – sprich, die aufwärtsstrebende Elite – meinte, der Gipfel der zu erlangenden, heiß ersehnten Titel sei erreicht, dann griff er einfach zur Methode »erhöhe den Einsatz« und schuf so eine ständig höher wachsende Spitze der Aspiration. Nicht anders als bei den National Independence Day Awards, den zur Unabhängigkeitsfeier verliehenen Preisen, doch gab es zwischen diesen beiden Preisgattungen einen leicht erkennbaren, entscheidenden Unterschied, denn nicht nur waren die Letzteren in Stein gemeißelt, sie wurden auch, wie jeder Beobachter leicht feststellen konnte, im Schnellverfahren lokal, unterschiedslos und ohne alle Steigerung, quasi horizontal verliehen. Chief Ubenzys Kreationen waren vertikal und autogen. Dadurch reizten sie zum Wettstreit an, was gelegentlich dazu führte, dass bereits Ausgezeichnete sich erneut am Startblock einfanden. Es entwickelte sich jenes kulturelle Charakteristikum, das der Schriftsteller Nkem Nwankwo – natürlich ein Sohn des Landes – so lebhaft in Titel und Werk seines Romans Mein Mercedes ist größer als deiner eingefangen hatte. Es entstand ein Zustand, nicht unähnlich den Emotionen, die religiös Besessene im Moment der höchsten Verzückung erleben. Doch bisher hatte die immer weiter zunehmende Zahl der preiswürdigen Kategorien – von denen jede logischerweise ihre konzentrischen Kreise von Tochterkategorien erzeugte – den absoluten Spitzenreiter, die Crème de la Crème, nicht entthronen können, jenes ultimative Crescendo der jährlichen Zeremonie, den People’s Award for Common Touch – kurz PACT. Vorhersagbar: Schließen wir doch einen Pakt mit dem gemeinen Mann – so ein Kommentator des National Inquest, denn der Preis ehrte ja diejenigen, die ihre ganz besondere Volksverbundenheit zur Schau gestellt hatten.
Niemand erwartete, dass der absolute Höhepunkt der alljährlichen Preisverleihungen erreicht war, ehe die ersten Sonnenstrahlen auf die versilberten Lamellen der großen Kugel an der Decke des Veranstaltungsortes fielen. Kein einziger Sitzplatz in der Arena blieb lange leer, aus der Schlange im Bereich der Stehplätze löste sich ein Aspirant, der bereits mit einer Nominierungsnummer ausgestattet war. Andere hielten weiter erwartungsfroh durch, die Erregung ein spürbares Fieber, während der Augenblick der ultimativen Preisverleihung herannahte. Immerhin gab es zur Stärkung ein traditionelles sowie ein internationales Frühstücksbuffet, das schon für sich allein genommen größtes Durchhaltevermögen rechtfertigte. Zugleich bildete es eine weitere Quelle der Konfusion mit dem politischen Zirkus, bei dem ebenfalls sichergestellt war, dass es vor und während der Wahlen eine Speisung der Tausenden gab – und eine weitere nach Ablegung des Amtseids zum Beweis der Erfüllung der Wahlversprechen.
Für die Politiker, die ihr Geschäft professionell betrieben, war es kaum überraschend, dass das mit den YoY-Wahlen verknüpfte Prestige mit Händen greifbar war – vielleicht sogar übertrieben –, doch der PACT war eine Krone – nein, ein Halo, ein Band der Heiligsprechung –, von dem die Gewinner meinten, man müsse es in jeder Situation um ihre Stirnen gewunden sehen können, immer zur Stelle, als Zeugnis des untadeligen Charakters ihrer Träger zu dienen, vor allem dann, wenn sie – wie es nicht selten geschah – wegen krimineller Machenschaften oder höchst unfrommer Praktiken auf der Anklagebank landeten. Ein YoY nach Namen und Titeln auf der Visitenkarte – Chief Dr. Soundso, M.Sc. Dip. Ed. YoY – hob den individuellen Status bereits weit genug, um als allgemeiner Türöffner zu dienen, doch diesem noch den nur einmal im Jahr an nur einen Anwärter verliehenen PACT hinzufügen zu können, war das ultimative Eintrittsbillett in die Halle der Unsterblichen der Nation, denen man zudem das Privileg eingeräumte, ihr Porträt in der Nationalgalerie aufgehängt zu sehen, Seite an Seite mit den Konterfeis der Mitglieder des Staatsrats und ausgewählter Gründungsväter der Nation. Und es billigte jedem – laut allgemeiner Zustimmung – das Recht zu, sich vor Gericht großzügige Sonderkonditionen, wie etwa mildernde Umstände, einräumen zu lassen oder sich auf das Begnadigungsrecht zu berufen, alles oft genug parat, noch ehe der Prozess überhaupt begann. Das Recht auf lebenslange Immunität – unabhängig vom begangenen Verbrechen – war ein Vorschlag, der in der Öffentlichkeit noch kontrovers diskutiert wurde.
So war es nur zu erwarten, dass diese Preiskategorie ebenso begehrt wie heftig bekämpft war. Keine Unterstützung der Öffentlichkeit war den Kritikern zu gering, um nicht umgarnt, keine zu larifari, um verschmäht zu werden. Jede Preisklasse erschuf und maximierte ihre eigene Bedeutung, ihr Potenzial, ihre Anerkennung für den Gewinner, sei es im beruflichen, geschäftlichen oder schlicht familiären Bereich. Zwar wurden wegen des unaufhaltsamen Anwachsens der untergeordneten Preiskategorien und der zunehmenden Zahl der Privilegien Zweifel laut, vor allen Dingen die Tendenz zur Einführung der allgemeinen Immunität für die dafür nicht für Wert befundenen Kategorien weckte ernste Besorgnisse, doch die ließen sich durch die Einführung der Doktrin der stillschweigenden Billigung durch die Allgemeinheit rasch zerstreuen. Was die Immunität anging, mangelte es schließlich nicht an Parallelen und Präzedenzfällen, man denke nur an die Pädophilen und Erpresser von Geständnissen, die in den Gerichten selbst oder in den Gouverneurspalästen das Zepter schwangen und durch angeblich zuerkannte religiös begründete Rechte immunisiert waren. Und vergrößerten sie alle nicht den Boom der Glückseligkeit selbst der Minderjährigen?
Auch das Muster der Verleihungen erfuhr einfallsreiche Variationen. Es kam vor, dass der Gewinner des Preises diesen nicht persönlich in Empfang nehmen konnte; für solche Abwesenheiten gab es Myriaden von Gründen. Ein traditioneller Herrscher, ein Geschäftsmagnat oder Gouverneur mochte meinen – selten, doch es kam vor –, es sei unter seinem Status, sich im Kreise der niederen Kreaturen des Entertainments, der Gewerkschafter oder gemeinen Agitatoren, der berüchtigten unpatriotischen Mitglieder der Gilde der Akademiker oder schlicht ihrer jungen lokalen Berater blicken zu lassen. Ein großspuriger Richter konnte der Ansicht sein, die Würde seines Amtes werde durch das grelle und protzige Ambiente der Galanacht beschädigt, ein Bischof oder Mullah konnte fürchten, allzu puritanische Schäfchen ihrer Gemeinden würden zukünftig die Gottesdienste meiden, was Einbußen in den Klingelbeuteln bedeutet hätte. Der Gedanke der erweiterten Gastfreundschaft spielte ebenfalls eine Rolle. Die Argumentation lag auf der Hand: Abwesenheit bei der eigentlichen Gala rechtfertigte eine eigene, spezielle, ganz auf die individuelle Preisübergabe abgestimmte Zeremonie – Chief Ubenzy Oromotaya hatte ein sehr anpassungsfähiges Temperament. Bei einem solchen Event bekam der Sieger seinen Preis von einem Minister, einem anderen hohen Tier, einer First Lady oder deren Sohn oder Tochter überreicht. Der Designatus seinerseits hielt auf seinem Gut eine besondere Zeremonie ab, bei der er Glückseligkeiten in einer normalerweise stark vernachlässigten Weise gewährte, ja oft mit einer Großzügigkeit, wie man sie bisher in keiner Ecke der Nation gesehen hatte.
Um seiner Idee, ein Preis des gemeinen Mannes zu sein, gerecht zu werden, wurde der heiß begehrte PACT jedoch üblicherweise von einem Bauern, einer Marktfrau, einem Fabrikarbeiter oder Straßenverkäufer überreicht. Man klaubte sie irgendwo am Straßenrand auf, duschte sie, kleidete sie ein und behängte sie mit Karnevalsschmuck, ehe man sie auf die Bühne zerrte. Für den Fall, dass der Gewinner ferngeblieben war, wurde der verwirrte Volksvertreter als Ehrengast erneut zu den besonderen Feierlichkeiten geladen, um teilzuhaben am Toast auf die nächsten vierundzwanzig Stunden Glückseligkeit. Die Ehre, dem Symbol der absoluten Beliebtheit beim Volke den eigentlichen Preis zu überreichen, blieb, überflüssig, es zu erwähnen, in diesem Falle natürlich dem Zeitungsbesitzer persönlich, dem efferveszierenden Ubenzy Oromotaya vorbehalten.
Vielleicht sollte man bemerken, dass bei der Einführung des Preises die In-absentia-Variante nicht erlaubt war. Entweder man war anwesend und wurde geehrt oder abwesend und ging leer aus, was einen freilich nicht hinderte, seinem Curriculum Vitae eine Rubrik hinzuzufügen, in der vermerkt war, dass man zwei- oder dreimal für den YoY oder PACT nominiert war. Für den Medienbesitzer und Organisator bot der Absentismus freilich die schöne Gelegenheit, im folgenden Jahr in der übergangenen Kategorie zwei Preise zu vergeben. All dies änderte sich dank des reichlich extremen Verhaltens eines außerordentlich temperamentvollen Gewinners, eines Gouverneurs. Später, sagte Oromotaya, hätte er sich dafür ohrfeigen können, nicht gleich selbst auf die hervorragende, nur Vorteile bietende Idee gekommen zu sein, eine besondere In-absentia-Kategorie einzurichten – Rühren Sie sich nicht vom Fleck, wir bringen Ihnen den Preis an die Haustür!
Die Vorteile waren fabelhaft offensichtlich! Es ging schon damit los, dass YoY sich dadurch in ein bewegliches, das ganze Jahr über mögliches Fest verwandelte, das überall im Lande begangen werden konnte, denn jeder Gewinner konnte seinen Sieg ganz nach Gusto zur genehmen Zeit, im eigenen Milieu auf die passende Art und Weise feiern, und zwar – sofern es sich um einen Amtsinhaber handeln sollte – auf öffentliche oder auf Firmenkosten. Wie viele konnten sich schon die Logistik leisten, eine Kuh, ein Schaf, einen Widder oder eine Ziege, vielleicht auch ein junges Kamel zu kaufen, in den Veranstaltungsort – das in einem Außenbezirk von Lagos gelegene Nationaltheater – zu zerren, dort zu schlachten und auf dem Spieß zu rösten? Natürlich waren nicht wenige überglücklich, beides zu kriegen – das Bad im Glitzer und Glamour der Galanacht der Nächte und die kleine Mini-Fiesta auf eigenem Grund und Boden – Glückseligkeit auch für die weniger Privilegierten, die weder die Zeit noch die Mittel haben, sich nach Lagos zu begeben. Der entscheidende Urmoment, der die formale Änderung in den Usancen einläutete – Gewohnheiten, die sich ohnehin bereits zu höchst extravaganten und ökonomisch robusten Mischungen der Varianten entwickelt hatten –, bot allerdings noch keinen Ausblick auf deren zukünftige Chancen, vielmehr geriet er fast zur Tragödie.
Es begab sich nämlich, dass der erwartungsfrohe Preisträger, Usman Bedu, Gouverneur aus dem Gebiet nördlich des Flusses Benue, mit einer Wagenkolonne, bestehend aus dreißig Luxusbussen und weiteren Vehikeln, anreiste, die seinen gesamten Harem von siebenundzwanzig Ehefrauen plus deren Familienmitgliedern herankarrte, summa summarum dreihundertfünfundachtzig Personen, dazu eine Kulturtruppe seines Bundesstaates mit Reiterakrobaten, die wie Figuren aus Tausendundeiner Nacht gekleidet waren und glitzernde Lanzen schwangen. Um die einströmenden Gäste zu empfangen, nahmen sie Aufstellung vor dem Eingang der großen Rotunde, die als Nationaltheater bekannt ist – Replik eines bulgarischen Sportpalasts, der hier bis auf den letzten Bolzen, Nagel und Zementklumpen nachgebildet war. Der Aufmarsch war ein persönlicher Beitrag des Gouverneurs – ein nicht bestelltes Zeichen seiner Dankbarkeit.
Nun war aber just sein Preis, wie es nicht zum ersten Mal geschah, am Morgen vor der Zeremonie anderweitig vergeben worden, das heißt, durch geheimes Votum an den Meistbietenden versteigert. Niemand hatte mit dem persönlichen Erscheinen des Gouverneurs gerechnet, niemand erwartete ihn, denn der junge Aspirant hatte seine wahren Absichten geheim gehalten, wollte er mit seinem spektakulären Auftritt doch allen eine nie gesehene Überraschung bereiten. Das geplante Szenario sah so aus: Seine Kavallerie sollte zum Flughafen kantern, um den Gouverneur zu empfangen und im bereitstehenden Rolls Royce Silver Cloud in großer Formation zum Nationaltheater zu eskortieren. Das berüchtigte hohe Verkehrsaufkommen in den Straßen von Lagos hatte der Zelebrant nicht bedacht, so narkotisierend war die Macht der Nacht der Nächte des Volkes. So war Usman Bedus Ankunft in der Tat ein Spektakel der Sonderklasse, das von den normalen Verkehrsteilnehmern, die an jenem unrühmlichen Samstag unterwegs waren, so schnell nicht vergessen werden sollte. Der junge Adelsspross hatte seine Sommerferien regelmäßig in London verbracht und dort vor dem Buckingham Palast die Parade beobachtet, die man als Trooping of the Colour kennt, und sich entschieden, seinen Gewinn in einer nicht weniger prachtvollen Weise zu zelebrieren.
Chief Oromotaya ahnte nichts von der Anwesenheit des Gouverneurs in Lagos, bis das Hufgetrappel der Pferde auf dem Zement zum Aufgang der Rotunde zu hören war. Routinier in der »Regulierung« kleiner Pannen, wie etwa der doppelten Vergabe ein und desselben Preises, war der Sponsor äußerst überrascht von der Unsportlichkeit, mit der der Zelebrant reagierte. Doch für den Gouverneur und seine Leute galt Gesichtsverlust nicht als Kleinigkeit. Als Chief Ubenzy also Seiner Exzellenz, dem Ehrenwerten Usman Bedu, in der VIP-Lounge des Theaters zu verklickern versuchte, wie es zu der »unglücklichen Verwechslung« hatte kommen können, erfuhr die herzliche Atmosphäre einen dramatischen Wandel. Ubenzy sah, wie die Hand des Gouverneurs in den Falten seiner babanriga verschwand und mit einem juwelenbesetzten Krummdolch wieder hervorkam, wie man ihn sonst nur aus Bollywood-Filmen kannte. Der Chief stieß einen Schrei aus und spürte, wie seine Knie nachgaben. Er stürzte zu Boden und griff sich ans Herz. Jetzt packte den Gouverneur das Entsetzen, glaubte er doch, sein geselliger Gastgeber erleide gerade einen tödlichen Herzinfarkt. Mit wehenden Fahnen flüchtete er aus dem Theater und begab sich schnurstracks in die Sicherheit seines Privatjets auf dem Flughafen von Ikeja, nicht ohne unterwegs seinen Sicherheitsleuten Anweisung zu geben, seine Karawane zu sammeln und eiligst die Heimreise antreten zu lassen. Ubenzy, der sich nach rasch erfolgter Erste-Hilfe-Behandlung in Form eines gewaltigen Schlucks aus der Johnny-Walker-Flasche schon wieder erholte, wurde zu einem vorsorglichen Check-up in eine Privatklinik gebracht. Von dort ließ er sich zur weiteren Untersuchung und gründlichen Erholung nach Dubai fliegen – angeblich.
Die Gala-Nacht der Nächte nahm danach ihren friedlichen Verlauf. Oromotaya beobachtete und kontrollierte das Geschehen von seiner dauerreservierten Suite im Interconti auf Victoria Island aus, während der verängstigte Gouverneur per Handy die neuesten Nachrichten über den Gesundheitszustand seines heimgesuchten Gastgebers verfolgte, der, wie man ihm sagte, in Dubai auf einer Intensivstation liege, zwischen Leben und Tod schwebend. Ehe Ubenzy offiziell in die Heimat zurückkehrte, war der Frieden, wie immer, wiederhergestellt. Der Gouverneur hatte keine Wahl. Vermittler stellten sicher, dass er Informationen zugespielt bekam, denen er entnehmen konnte, dass der Chief im Besitz von »heiklen« Unterlagen sei, die von öffentlichem Interesse sein könnten und höchst abträglich für ihn, sollten sie im National Inquest veröffentlicht werden. Diese erleuchtende Information befähigte den Gouverneur einzusehen, dass die nigerianische Verfassung persönlichen Blutfehden eine klare Grenze setzt und dass stattdessen eine Interessengemeinschaft von Leuten, die in Geschäftsbeziehungen miteinander stehen, die Entscheidungsträger sind. Die Duellanten nahmen ihre alten diplomatischen Beziehungen wieder auf, und man schwor sich ewige Freundschaft. Gouverneur Bedu bekam eine individuelle, ganz besondere Ausfertigung des YoY verliehen – den Krummdolch des Volkes. Die beiden tauschten weitere gegenseitige Ehrenpreise aus, die Udenzy in Bedus Heimatstadt, Bedu in Udenzys feierlich entgegennahmen. Bedu veranstaltete ein Fest, bei dem zum ersten Mal in der Geschichte Nigerias ein gefülltes, am Stück am Spieß gebratenes Jungkamel auf der Menükarte stand – eine Spezialität, die offenbar aus Saudi-Arabien stammte. Bei diesem Anlass verlieh Oromotaya dem Gouverneur die Lebensschirmherrschaft über den YoY – der Chief war bekannt für seinen Einfallsreichtum, wenn es darum ging, lindernde Vaseline auf Wunden zu streichen, die manche für unheilbare Tumore hielten. So jedenfalls lautete die authentische Berichterstattung über den Verlauf der Ereignisse aus Ubenzy Oromotayas Mund – wenn er sich im Kreise seiner Vertrauten sicher wusste.
Die Jagd nach dem Goldenen Vlies, dem YoY, war allerdings, wie man beobachten konnte, nichts für Hasenfüße. Gegen die Aspiranten gerichtete Sabotageakte und Rufschädigungen, kruder wie höchst ausgeklügelter Art, waren an der Tagesordnung. Fake News verbreiteten sich tausendfach, führten zum Ruin von Ehen und Freundschaften wie zum Bankrott von Geschäftsleuten. Es gab plötzliche, unerklärliche Todesfälle. Dessen ungeachtet mussten viele zugeben, dass der Wettstreit um den Yeomen Award, und ganz besonders der um den PACT, auch die kreativen und egalitären Seiten der Bewerber zum Vorschein brachte, von denen es weltweit hieß, dass sie den Nigerianern eigen seien. Im Netz kursierten Videos von einem Gouverneur, der an einer Bauernbude am Straßenrand amala aß, das aus dem Mehl der Jamswurzel hergestellte klebrige Grundnahrungsmittel der Yoruba, wobei ihm die begleitende Okrasoße auf den schütteren Bart tropfte, als er sich die Finger mit seiner breiten Zunge leckte und in die Kamera rülpste – Für mich kein elitäres Silberbesteck, herzlichen Dank! Dazu trank er Palmwein – aus der Kalebasse, versteht sich, nicht aus einem Glas oder Plastikbecher. Ein anderer Beitrag zeigte einen Senator, der eine alte Frau aufforderte, es sich in seinem BMW bequem zu machen – den er natürlich selbst steuerte –, während sein Fahrer das Bündel Feuerholz, mit dem sich die Alte geplagt hatte, im Kofferraum verstaute. Bildunterschrift: »Eine helfende Hand«.
Von einem anderen Politiker machte ein Bild die Runde, das ihn zusammen mit seinen Leuten hackeschwingend bei der Arbeit auf einem Jamsfeld zeigte, eine weitere sinnenfrohe Stimme, die eines der traditionellen Arbeitslieder schmetterte. Unterschrift: »Magen-Infrastruktur«. Ein ausgesprochen abenteuerlustiger Gouverneur ließ sich bei der Teilnahme an einem Breakdance-Wettbewerb filmen, der im berühmten Federal Palace Hotel auf Victoria Island stattfand: Unterschrift: »Gouverneur als Kaskadeur«. Und so ging es fort, während die begeisterten Follower im Netz ihre Kommentare verbreiteten, sowohl schriftlich als auch in der neuen Kurzschrift der Analphabeten – den Emoticons.
Nicht unerwartet gab es Kritiker. Was, fragten sie, passiert mit der Regierungsgewalt unter einer seriellen, zyklischen Festivalhysterie? Solche Stimmen konnten rasch zum Schweigen gebracht werden. Die Regierung, attestierten hastig herausgegebene Verlautbarungen von Ministerien und Regierungsvertretungen, blieb davon unberührt. Vielmehr profitierten alle möglichen Geschäftszweige, vor allem im sogenannten informellen Sektor. Eine Autofahrt zwischen zwei Städten, die normalerweise neunzig Minuten gedauert hatte, konnte jetzt vier, sechs, neun, zwölf Stunden dauern, ja sich manchmal bis in den nächsten Tag hinein hinziehen, besonders während der Regenzeit, wenn sich mitten in den Schnellstraßen Seen bildeten, in denen sogar Tankschiffe versunken wären. Wo es zu solchen Staus kam, entstanden unverzüglich Straßenmärkte – die richtiger amphibische Märkte genannt werden sollten –, die das informelle BSP in astronomische Höhen schnellen ließen. Stauungen, bei denen nichts mehr ging, verhalfen der Realität zu wirtschaftlich abwechslungsreicher Gestaltung. Sogar die Kultur profitierte, gab es doch völlig neue Einträge in den Namensregistern Nigerias, einer Nation, die sich zu Recht den Ruf erworben hatte, in dieser Beziehung besonders innovativ zu sein – Tonade (»auf der Strecke geblieben«), Bisona (»auf der Straße geboren«), Aderupoko (»Überfracht«), oder Namen, die einfach nur das Gefährt bezeichneten, Bolekaja (»Personenlastwagen«), Toyota etc. lauteten die Namen der Kinder, die in öffentlichen oder privaten Transportmitteln zur Welt gekommen waren, während der Verkehr stillstand und Autofahrer unvermittelt auf den Beruf der Hebamme umsatteln mussten. Die Jagd nach fehlenden Milliarden im Staatssäckel intensivierte sich, der Premierminister persönlich flog außer Landes, um die Repatriierung neu entdeckter, bislang versteckt gebliebener Vermögen zu konsolidieren, was jedes Mal mit Fanfarenstößen verkündet wurde – die Caymaninseln, Dubai, die Vereinigten Staaten und die Schweiz standen auf seiner Liste. Diese Konterschläge würgten die missbilligenden Stimmen ab, hielten den Adrenalinspiegel der Nation hoch und die Hoffnung stetig am Leben. Ein paar unbedachte, anmaßende Parteimitglieder wurden geschasst, um die Unparteilichkeit in der Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit zu demonstrieren. Dieser sich immer wieder verjüngende Zyklus – Fehlbeträge, Verfolgung, Whistleblower, Hyperaktivität, Anwälte, Zeugen, egal, ob sie sich am Tage ihres vorgesehenen Auftritts vor Gericht als vermisst erwiesen oder nicht – vervollständigte die Liste beneidenswerter Leistungen. Das Getrommel auf die eigenen Brustkästen tönte lauter als die Membranophone des jährlichen Trommel-Festivals in einem der angeblich glücklichen Bundesstaaten.
Da kam es als »grober Schock« für die Exekutive, die Legislative und die gesamte Bürgerschaft, als bekannt wurde, dass sich die Nation den unerwarteten – und unverdienten – Titel der »extraordinär korruptesten Nation der Welt« eingefangen hatte, verliehen von einem ehemaligen Kolonialbeamten. Diese offenbar aus dem Stegreif formulierte Belobigung löste eine sehr viel längere und heftigere Reaktion aus, als es das fortgesetzte Verschwinden von gewaltigen Brocken des Staatsbudgets je vermochte. In beiden Kammern des gesetzgebenden Hauses wurde die Arbeit unterbrochen, um die Äußerung zu debattieren und zu verurteilen. Was, so argumentierten die Debattierenden, war, bitte schön, extraordinär an einer kulturellen Verhaltensnorm? Es war purer Missbrauch der Sprache – nur weil es ihre Sprache war, war das schon Grund genug, sie so einzusetzen? Dachten sie vielleicht, der Riese Afrikas könne durch solche Worte eingeschüchtert werden? Die Legislative befürwortete eine Bewegung, die sich für den Boykott britischer Waren starkmachte. Als Nächstes ventilierte man die Möglichkeit, alle britischen Vermögenswerte einzufrieren oder alternativ alle britisch-stämmigen Einwohner des Landes zu verweisen, und natürlich den Bruch der diplomatischen Beziehungen mit einer derart impertinenten fremden Macht – jawohl, fremden! Dachten sie vielleicht, das Land stehe noch immer unter kolonialer Herrschaft, dass es solche Beleidigungen hinnehmen müsse?
Es war Zeit für den Premierminister, Sir Godfrey Danfere, sich auf eine neue Weltreise zu begeben, diesmal um Dialog zu halten mit den ausländischen Nationen, die ebenfalls die Überzeugung hegten, es handle sich bei dem seinen um einen korrupten Staat, um so das beschädigte Image seines Landes zu reparieren. Begleitet von einer Entourage, die die Karawane des so leicht zu ergrimmenden Gouverneurs Usman Bedu zwergenhaft erschienen ließ, begab sich Sir Goddie auf eine beispiellose Blitzkampagne. Die Charmeoffensive endete gerade rechtzeitig für die neuen Nominierungen der nächsten YoY-Edition. Es war eine triumphale Rückkehr. Der Premier freute sich darauf, zuerst dem Präsidenten, dann dem ganzen Volk in einer Rede an die Nation seinen Bericht vorzulegen, in dem er nachwies, dass die Verunglimpfer lediglich einen Haufen Lärm gemacht hatten und nichts weiter waren als aufgeblasene Windbeutel, Wirtschaftssaboteure, die gegen die Diversifizierung des eingleisigen Ölhandels anarbeiteten. Wir brauchen mehr Ministerien für Glückseligkeit, würde er mit Nachdruck in seiner Rede fordern, in den Bundesstaaten, die noch auf den fahrenden Zug aufspringen müssen.
»Ich bin überall gewesen«, tat er der versammelten Pressemeute kund. Erfolg auf der ganzen Linie, verkündete die Neonschrift über seiner imposanten Gestalt, die ihm seinen Lieblingsspitznamen eingebracht hatte: die Präsenz. »Es wird mir ein Vergnügen sein, dem Präsidenten zu berichten, wenn ich ihn morgen über die Reise informiere, dass ich nirgendwo eine einzige divergierende Stimme vernahm. Die Nation ist in keinerlei Gefahr. Wir bewahren uns unseren Platz an der Spitze als – Die Glücklichsten Menschen auf Erden.«
Auf dem Weg zurück zu seiner Machtbasis, der Villa Potenzia, in den weichen Sitz der Stretchlimousine geschmiegt, tippte er seinem Stabschef, der vorn neben dem Chauffeur saß, auf die Schulter: »Rufen Sie Teribogo an. Sagen Sie ihm, er soll dafür sorgen, dass mich in der Villa ein wenig – Glückseligkeit – erwartet.«
Der Stabschef verzog keine Miene. »Glückseligkeit ist bereits da, Sir Goddie.«
3
DIEREISEDESPILGERS
Hart waren die Anfänge, groß die Sorgen und Nöte, lang und beschwerlich die Reise – wenn auch immer wieder unterbrochen von kurzen Spannen lukrativer Linderung – jenes Mannes, dessen Herkunft Grund für endlose Spekulationen blieb. Zu der Zeit, als er seinen zweiten Pass ausgehändigt bekam, war er als Dennis Tibidje registriert. Das Vorgängerexemplar endete in einem mitternächtlichen Freudenfeuer, entzündet im Hinterhof des Hauses seiner ersten Liaison, von dem aus er eine hastige Rückreise zum eigenen Home Sweet Home antrat. Das jugendliche Multitalent verabschiedete sich abrupt von seinem europäischen Studienort, schüttelte in einem Anfall rechtschaffener Entrüstung den Staub des Vereinigten Königreichs von den Füßen, denn der Dekan seiner Fakultät hatte ihn zu einem Vieraugengespräch gebeten, bei dem er seinen Ruf und seine Ehre verteidigen sollte, lag doch eine Anzeige wegen versuchter Vergewaltigung gegen ihn vor – eingereicht von einer Kommilitonin. Weder seine engsten Studienkollegen wussten von seiner Abreise noch seine Zimmerwirtin, der er noch ein paar Monate Miete schuldete, plus einiger bei ihr aufgenommener Notkredite, rückzahlbar, »sobald die Stipendiumsgelder eingehen«.
Nach Hause zurückgekehrt, fand Tibidje eine Nische im Filmgeschäft als Nebendarsteller in Callywood-Streifen – Produktionen, die im äußersten Südosten, in Calabar, als Konkurrenz zum nigerianischen Bannerträger Nollywood entstanden. In diesem Bundesstaat war in dem rustikalen, wasserumspülten kleinen Ort Tinapa ein brandneues, mit ultramodernen Studios ausgestattetes Filmdorf entstanden. Ein von der Filmerei besessener Gouverneur, der auch eine ungewöhnliche Leidenschaft für die Natur und ihren Schutz hegte, hatte es aus dem Boden gestampft. Tinapas technische Einrichtungen wurden genutzt, doch die Filmleute schreckten davor zurück, ihre Produktionen mit dem hinterwäldlerisch klingenden Label Tinapa zu vermarkten. Sie zogen es vor, als weiteres Findelkind jenes knorrigen Familienstammbaums zu gelten, der seine Wurzeln in dem fernen Ort an der Westküste der Vereinigten Staaten hatte, den die Welt als Hollywood kennt.
Tinapas Neuzugang verbesserte seine prekären Lebensumstände als Schauspieler durch einen Posten bei einer Publicity- und Marketingfirma. Auch besaß Tibidje eine Reihe weiterer künstlerischer Fähigkeiten, die ihm halfen, den Kopf während der Durststrecken zwischen den Engagements, die alle Berufsschauspieler nur zu gut kennen, über Wasser zu halten. Zu diesen Talenten gehörte die natürliche Begabung, die Hand- und Unterschriften anderer perfekt nachahmen und so in der Not dringend benötigte Dokumente herstellen zu können. Allerdings führte diese Fertigkeit leider auch dazu, dass sein Verbleib in der Firma nur von kurzer Dauer war. Da er die Originalurkunde seines Uniabschlusses aus bekannten Gründen nicht vorlegen konnte, präsentierte er ein Dokument, dessen Authentizität bedauerlicherweise nicht anerkannt wurde. Allerdings nicht etwa, weil das künstlerische Geschick, mit dem das Falsifikat gestaltet war, Zweifel geweckt hätte, nein, die Fälschung war perfekt, es war ein winziger computergenerierter Widerspruch in den angegebenen Daten, der einem in der Personalabteilung arbeitenden Nerd aufgefallen war. Sein Chef lud Tibidje zu einem Gespräch vor und legte ihm nahe, den Beruf zu wechseln. Man gab zu, dass man es sehr bedaure, sich von einem Talent wie ihm trennen zu müssen, und steckte ihm sogar noch das Fahrgeld für den Bus zu, damit er in seinen angeblichen Heimatort im Bundesstaat Lagos zurückfahren konnte. Die Behauptung, er stamme aus Lagos, erklärte er damit, dass seine Ahnen dort ihre Ursprünge hätten. Tatsächlich kamen sie als Angehörige des Volksstammes der Itsekiri aus der Deltaregion. Nicht wegen sentimentaler Sehnsüchte hegte Tibidje den tiefverwurzelten, wenngleich unterdrückten und nicht gern zugegebenen Ehrgeiz, seinen Ahnen Lagos als Herkunftsort zuzuweisen, sondern weil dieser Ort der logische Förderer seines angestrebten beruflichen Schicksals war.
Eine Zeit lang verweilte der wagemutige junge Mann am Ort eines Zwischenstopps, in der quirligen Stadt Port Harcourt, und überdachte seine weiteren Schritte. Eine Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Die drei Monate seiner Festanstellung sowie der Ausflug in die Gefilde der Filmemacherei hatten mehr als ausgereicht, ihn mit hilfreichen Kontakten auszustatten. Der Schritt in die virtuelle Welt des Internets war rasch getan, wobei er sich vor allem auf die Accounts seiner einstmaligen Kollegen fokussierte. Nur knapp einer Polizeirazzia entkommen, die sich das Café zum Ziel genommen hatte, in dem sich die Yahoo-Yahoo-Bruderschaft – so die Eigenbezeichnung dieser Bauernfänger – zu treffen pflegte, entschied Tibidje, dass es erneut Zeit sei für einen Tapetenwechsel, und zwar einen so gründlichen, dass er auch seine Person betraf. Eine seiner früheren Publicityfirma geleistete Zahlung zu stornieren und den Betrag auf das Konto einer Reiseagentur umzuleiten, war in ein paar Stunden intensiver morgendlicher Arbeit erledigt. Als nunmehriger Besitzer eines Rückreisetickets nach Houston, USA – via New York –, sowie eines Passes, der der genauen Prüfung der Einreisebehörde standhalten müsste, war die Sache seines Abschieds geritzt. Allerdings, wie ihm siedend heiß einfiel, fehlte ihm noch das Visum. Doch mit der ihm eigenen Dreistigkeit war er sich sicher, den Beamten der amerikanischen Einwanderungsbehörde glaubhaft versichern zu können, dass er ein politisch Verfolgter sei, der Hals über Kopf habe fliehen müssen. Tibidje flog ab, landete und erhielt seine Aufenthaltsgenehmigung – für ein Sammellager für illegale Einwanderer in Newark, New Jersey. Zusammen mit einem bunt gewürfelten Haufen internationaler Reisender hatte man ihn per Bus dort hingekarrt.
Neun Monate später, nach einem aussichtslosen Kampf mit Amerikas Homeland Security, fand er sich auf afrikanischem Boden wieder. Die Übergangszeit in dem Pferch für ungeladene Gäste hatte er genutzt, um sich mit neuen Bekannten zu vernetzen, innerhalb und außerhalb der Anstalt. Er hatte telefonieren können und mit Menschenrechts- und Wohltätigkeitsorganisationen korrespondiert, sogar mit ein paar einsamen Damen. Am wertvollsten waren ihm die internen Kontakte – vor allem die Besuche eines christlichen Geistlichen unbestimmter Konfession, doch mit Verbindungen zu einer westafrikanischen Mission in Liberia. Für eine Weile beschäftigten den Festgesetzten auch die Besuche der Geistlichkeit der Nation of Islam. Diese Seelenhirten von Louis Farrakhans Büro für Gefangenenbetreuung waren ebenfalls sehr an dem jungen Mann aus Nigeria interessiert. Sie versorgten ihn großzügig aus der zakat, der obligatorischen Armensteuer, die ihre Glaubensgenossen für den gefangen gehaltenen Märtyrer zur Verfügung stellten, aber auch mit Lesungen aus ihren heiligen Schriften. Tibidje schloss sich ihnen an und stellte sicher, dass ihm die Dividende aus diesem Kampf um seine Seele aus beiden rivalisierenden Lagern zufloss. Die Balgerei um ihn hielt über die Dauer seines Verbleibs an; er erwog die Optionen und entschied sich am Ende für die christliche Glaubensgemeinschaft, kam sie seinen Plänen für sein persönliches Heil doch deutlich näher. Als der Augenblick kam und der Bus ihn und einen Teil seiner Mitgefangenen zwecks Ausweisung zum Flughafen brachte, da war er, anders als die meisten anderen in dem Vehikel, keineswegs der niedergeschlagene Illegale, der zu seinem Leidwesen zum Kontinent seiner Geburt retourniert wurde.
Allerdings kehrte er nicht genau zum Ausgangspunkt zurück, denn es war Tibidje gelungen, seine Kaperer mit Hinweis auf die ihm dort drohende Verfolgung zu bewegen, ihn nicht nach Nigeria zu verbringen, sondern nach Liberia, dem Land der Freiheit. Durch Unterhaltungen mit seinen Mitgefangenen sowie durch fleißige Lektüre wusste er, dass Liberia mit den Vereinigten Staaten enge Beziehungen pflegte, handelte es sich doch fast um eine ehemalige Kolonie, was ihm nun zum Vorteil gereichte. Irgendwann während der Flugreise gestand sich der zukünftige Seelenhirte ein, dass er seine wahre Berufung gefunden hatte – die Predigt des Evangeliums. Er hatte, so erklärte er, einen höchst lehrreichen Aufenthalt hinter sich, der den großen Wandel seines Lebens bewirkt hatte. Der Aufenthalt im Gefangenenlager war nicht gänzlich inhuman gewesen. Das Essen war ausreichend und einigermaßen genießbar. Es hatte eine kleine Anzahl gespendeter Bücher und Zeitschriften gegeben, ein einziges Regal voller vorrangig religiöser Erbauungsschriften, das als Bibliothek durchging. Zum Bestand gehörten nicht nur die zu erwartenden Heiligen Schriften der christlichen wie der islamischen Religion, sondern auch Oscar Wildes Ballade vom Zuchthaus in Reading, John Bunyans Pilgerreise, Khalil Gibrans Der Prophet, die Schriften Thomas Mertons sowie andere Werke spiritueller Suche und Erbauung. Dass sich darunter auch das Kamasutra fand, war verblüffend, doch es ging das Gerücht, einem ehemaligen Insassen sei es gelungen, den für die Bibliothek zuständigen Wärter zu überzeugen, dass es sich bei diesem Buch um die »Bibel« einer Hindusekte handle, die von den Vereinten Nationen, zu denen ja auch die USA gehörten, offiziell als Religion anerkannt werde. Es liefe also auf die Verletzung der UN-Rechte hinaus, würde dieses Buch aus der Bibliothek ausgeschlossen. Bei seinem Abschied befreite Tibidje die Einrichtung von der peinlichen Gegenwart dieses Lesestoffs.
Die Insassen hatten nach Herzenslust fernsehen und sogar beratende Anwälte empfangen können. Tibidjes Geist war auf Trab gehalten, er genoss die Solidarität des ihn besuchenden Geistlichen, dem er bald hilfreich zur Hand ging bei der Vorbereitung seiner Stegreif-Predigten. Als er schließlich in Monrovia eintrudelte, empfing ihn der dortige Bundesgenosse des amerikanischen Kaplans sofort mit einer herzlichen Umarmung und nahm ihn unter seine Fittiche.
Die Zeit in Liberia erwies sich als weitere Lernphase. Neben anderen Vorzügen, die ihm der Gefängnisaufenthalt in Newark gebracht hatte, war Tibidje nun in der Lage zu behaupten – und zwar absolut wahrheitsgemäß –, er sei in den USA