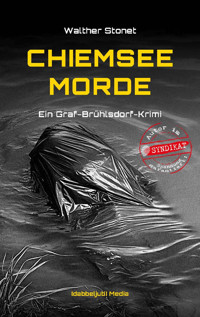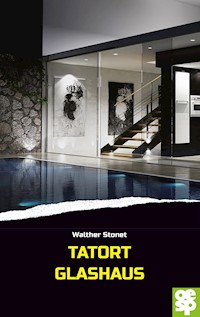Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel + Spörer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In Tübingen wird der IT-Leiter des Biotech-Start-ups VaxiCure ermordet. Hat die Tat einen klaren Bezug zum mysteriösen Datendiebstahl eines hochwirksamen Vakzins auf der Basis der neuen mRNA-Technologie? Während Kriminalhauptkommissar a.D. Graf Brühlsdorf, von seinen Freunden kurz TJ genannt, in Reha in St. Blasien ist, macht sich sein IT-Guru Friedrich J. (Frederico) Schmidt auf die Suche nach den Tätern. Nicht nur im Cyberraum wird um die halbe Erde ein Kampf um Macht und die nackte Wahrheit geführt. Nach „Tatort Glashaus“ nun der zweite Fall von Kriminalhauptkommissar Graf Brühlsdorf, der als Mischung aus einfühlsamen Regionalkrimi, rasantem Cybercrime und Roadmovie auf jeder Seite fesselt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autor
Walther Stonet
Jahrgang 1956, lebt mit seiner Familie in Metzingen. Volkswirtschaftsstudium in Mannheim (Diplom). Selbstständig und leitend in der IT-Branche tätig. Ab dem 14. Lebensjahr Liedtexte und Gedichte, später Kurzgeschichten, Essays, Rezensionen. Zwei Gedichtbände (2014 und 2021). Ab 2015 Herausgabe Blog und Magazin zugetextet.com. Ein polit. Cybercrime-Roman und ein Sonettband (2021/2022) im VSS-Verlag, Frankfurt/Main. Brühlsdorf-Krimi »Tatort Glashaus« bei Oertel + Spörer, Reutlingen (2022).
Titel
Walther Stonet
AKTE VAKZIN
Ein Graf-Brühlsdorf-Krimi
Oertel+Spörer
Impressum
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen.Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel + Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2023
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen
Alle Rechte vorbehalten.Titelfoto: Walther Stonet
Gestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, Reutlingen
Lektorat: Bernd Storz
Korrektorat: Sabine Tochtermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-96555-153-4
Besuchen Sie unsere Homepage und informierenSie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
Man kann nicht alles habenund selbst davon dennoch zu viel des Guten bekommen. Egal, wie oder was es auch sei: Weder das Eine noch das Andere ist wahrscheinlich von Dauer.
Tankred Jürg Gustav Adolf Graf BrühlsdorfPhilosoph, Kriminalist, Weltverbesserer
I
Die beiden Einbrecher waren perfekt vorbereitet. Der Mieter weilte in der Firma bei der Arbeit. Abends würde er ins Training gehen. Dass nichts schieflief, dafür war vorgesorgt. Er würde keinen Schritt tun können, ohne dass ihm jemand folgte.
Das Team, das dafür abgestellt war, hatte seine einschlägigen Erfahrungen. Es war mehr als nur gut darin, nicht entdeckt zu werden, ohne den zu verlieren, den es zu beobachten hatte.
Vom Versuch, das Smartphone zu hacken, hatte man wegen der Expertise seines Besitzers vorsichtshalber abgesehen. Man musste nicht den Fehler machen, jemanden aufzuscheuchen, den man in Sicherheit wiegen wollte. Das war nicht nur dumm und unnötig, das war dazu auch kontraproduktiv.
Und in der Tat, der Mensch war so vorhersehbar, die Routine siegte. Das Opfer ging ins Studio und verausgabte sich bis zu Atemlosigkeit und Schweißausbruch. Er nahm das Training noch ernster als zuvor schon, seit er Manon Steinbrecher zur Freundin hatte. Sie war seine große Liebe und sein ganzes Glück. Er wollte schön für sie sein.
Am Ende war er jedoch nur schön genug fürs Sterben. Aber das wusste er zum Zeitpunkt seiner durch einen Trainer angeleiteten gezielten Körperoptimierung nicht. Den Trainer hatte er sich erst geleistet, nachdem seine neue Liebe sein Herz geklaut hatte, wie er seinem Freund Rico seinen Zustand geschildert hatte.
Eine sportliche blonde Schönheit, die erst seit Kurzem im Studio Mitglied war, beobachtete ihn unauffällig. Sie war schon da, als er kam, und ging duschen, als er duschen ging – nicht ohne zuvor genau das nach draußen zu melden, wo seine Überwachung vor dem Haus bereits auf ihn wartete.
Mit dem E-Bike ausgestattet wie auch das zukünftige Mordopfer. Sie froren, solange er schwitzte. Als er sich unten auf sein Rad schwang, machten sie sich startbereit. Eine Person fuhr voraus, eine weitere hinterher.
Chat Ho war vorgewarnt, als sein Opfer seine Wohnung betrat. Er hatte absichtsvoll dunkle Kleidung gewählt, trug Ballettschuhe und hatte alles, was er brauchte, bei sich am Körper. Es waren ein spezieller Dolch und eine Spritze. Das reichte.
Kevin Jakob Malchow packte seine Sportsachen in die Waschmaschine. Danach kochte er sich einen Rooibostee und bereitete sich seinen üblichen Eiweißshake. Pistazie schmeckte am besten. Er hatte extra eine Maschine zum Aufschäumen gekauft. Sie hatte ein kleines Vermögen gekostet. Aber er verdiente ja gerade gut. Warum also nicht, hatte er sich gedacht.
Mit einem Lächeln setzte er sich an seinen Schreibtisch im Arbeitszimmer. Rico, sein White-Hat-Hacker-Freund Friedrich J. Schmidt, hatte gesagt, heute Abend würde der Bericht fertig. Er wollte ihn gleich lesen, wenn er kam.
Außerdem wollte er sich noch ein bisschen im Darknet tummeln und nachsehen, ob es etwas gab, das auf einen Cyberangriff auf seinen Arbeitgeber, die Biotech-Firma VaxiCure mit Sitz in Tübingen, hindeutete. Vorsicht war die Mutter der Porzellankiste. Aber zuerst wollte er mit seiner Manon ein wenig facetimen. Er sehnte sich nach ihr.
Mit diesem versonnenen Lächeln auf dem Gesicht starb er einen schmerzlosen Tod. Es war ihm, als würde ein leiser Luftzug über seinen Nacken fahren. Es kribbelte kalt. Er spürte nichts als einen kleinen feinen Piks. Dann wurde es Nacht um ihn. Denn er fiel in einen tiefen Schlaf, aus dem er nicht mehr erwachen würde. Den professionell ausgeführten Stich ins Herz spürte er schon gar nicht mehr.
***
Sein Mörder ließ Spritze und Dolch in seiner dafür angefertigten Gürteltasche verschwinden. Chat Ho nahm den Laptop und das Smartphone seines Opfers an sich. Dieses saß mausetot und zusammengesunken auf seinem Schreibtischstuhl. Durch die beiden Armauflagen wurde seine Leiche dort festgehalten.
Er würde in der Haltung vorgefunden werden, als seine Manon nach ihm schauen kommen würde, nachdem er am Freitag nicht in die Firma gekommen war und sich bei ihr weder meldete noch an sein Telefon ging, wenn sie anrief. Und das tat sie nach dem Mittagessen regelmäßig einmal jede Stunde. Abends verkürzte sich das Intervall nach und nach auf fünf bis zehn Minuten.
Schließlich hielt sie es nicht mehr aus vor lauter innerer Unruhe und beschloss, nach ihm zu schauen.
Da waren Chat Ho und sein Komplize Dimitri Vasiliev sowie ihr Team längst dabei, Spuren zu verwischen. Am Ende würden sie allerdings nur zwei ganze Tage Vorsprung haben. Sie hatten gehofft, es wären mehr. O.K., man konnte nicht alles haben.
Denn bereits am Samstagmorgen hatte Manon Steinbrecher ihren unfreiwillig verschiedenen Freund vorgefunden, weil sie es vor Sorge um ihn nicht mehr ausgehalten hatte. Sie war völlig aufgelöst zur Wohnung geeilt, nachdem sie von dem Freund ihres Freundes, einem Herrn Friedrich J. Schmidt, am frühen Morgen einen Anruf erhalten hatte, ob sie denn wüsste, wo Jacko Malchow wäre.
Er hätte mit ihm gestern Nachmittag eigentlich eine Telko gehabt, aber Jacko wäre zur Webkonferenz nicht erschienen.
Dieses Verhalten wäre so gar nicht ihres Jackos Art, sagte sie ihm. Friedrich J. Schmidt, von seinen Freunden Rico oder Frederico genannt, stimmte dieser Feststellung zu.
Der Anruf brachte das Fass zum Überlaufen. Manon Steinbrecher wusste: Das war nicht ihr Jacko. Nein. So war er nicht. Es musste etwas Schlimmes passiert sein.
Doch nicht nur Manon bekam es mit der Angst zu tun. Angesichts der Konstellation informierte Frederico Schmidt sofort seine geliebte Oberstaatsanwältin Isa Clementelli sowie seinen Freund und Chef TJ Brühlsdorf. Auf dessen Rat hin kontaktierte er gemeinsam mit seiner Isa Hauptkommissarin Rieke Bechtel. Bereits während dieser Webkonferenz ging auf der Tübinger Leitstelle der Notruf einer völlig aufgelösten Manon Steinbrecher ein, die den überraschenden und unerklärlichen Tod ihres Freundes meldete.
Ab jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Diesen Zustand sollten sie die nächste Zeit beibehalten.
II
Als sich die Welt noch im Zustand der Ordnung befand, konnte TJ Brühlsdorf, Hauptkommissar a. D. mit Adelspatent und Grafentitel, sich um seine äußeren und inneren Angelegenheiten kümmern. Er hatte wahrlich deren genug, könnte man sagen.
Nach seiner Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit hatte er sein ganzes Leben neu austariert und sich entschlossen, in die Kriminalforensik zu gehen und zugleich etwas gegen das PTBS-Syndrom zu tun, unter dem er selbst seit der Einsatzkatastrophe litt, die zu seiner Entlassung aus dem aktiven Polizeidienst geführt hatte. Man hatte ihm einen Sesselfurzerjob angeboten; auf den hatte er dankend verzichtet. Nicht, dass er sich dafür zu schade gewesen wäre. Hinter dem Schreibtisch zu sitzen, war schlicht nicht sein Ding, oder etwas gebildeter formuliert, seine Sache nicht.
Die hochriskante OP an seinem Unterschenkel war gut verlaufen. Auch die Rehabilitation danach. Anschließend hatte sich Brühlsdorf aufs Studium gestürzt, seine Nachfolgerin als Leiterin der Sonderkommission Mafia im Südwesten, Hauptkommissarin Rieke Bechtel, hatte mit Isodora Clementelli, der ermittelnden Oberstaatsanwältin, den Mafia-Prozess vorbereitet.
Friedrich J. Schmidt, TJs Freund und Vertrauter, kümmerte sich um die Sicherheit der Brühlsdorf’schen Aktivitäten und Latifundien. Und natürlich, und das mit großer Begeisterung, zusammen mit Henriette Walcher, um seine kleine Tochter Emiglia, neben der Hündin Lassie der Sonnenschein des Hauses.
Ebendieser Friedrich J. Schmidt war dank TJs Verkupplungsgeschick mit der Oberstaatsanwältin liiert. Emiglia war ihr gemeinsames Kind der Liebe. Er, der gerne Rico (von seiner liebsten Isa) oder Frederico (vom Rest der Welt) genannt wurde, war gern Vater. Er liebte seine Kleine wie seine Große.
Sogar Brühlsdorf sittete das Mädchen immer wieder einmal mit steigendem Spaßfaktor. Die süße Kleine liebte ihn, was seine Umwelt zu gelegentlichen Neidanfällen verführte. Der Herr Graf konnte mit Kindern, erkannte Henriette Walcher mit stiller Trauer. Nur eigene, die waren nicht in Sicht.
Brühlsdorf und die Kleine saßen am liebsten im Teehaus der großen Gründerzeitvilla an einer der Tübinger Halbhanglagen, wobei das Mädchen in seiner Wiege schlief, spielte und vor sich hinblubberte und -plapperte. Ihr gräflicher Babysitter quälte die Laptoptastatur oder seine Augen – oft auch beides. Hündin Lassie hatte sich in ihrem Teehauskörbchen eingerollt und freute sich des Lebens. Die Welt schien in bester Ordnung zu sein. Das war sie auch. Na ja, fast, wie Brühlsdorf eingestand.
Die neu gestylte und tiefenüberholte Rieke Bechtel hatte es ohne Probleme geschafft, TJ so zu faszinieren, dass die erste horizontale Begegnung der beiden nur eine Frage der Zeit gewesen war. Der daraus erwachsende Sturm der Liebe war ein ungeheurer. Das Paar geriet fast vollkommen aus der Kontrolle und konnte nur durch ein Verbrechen getrennt werden – im wahrsten Sinn des Worts.
Die Oberstaatsanwältin empfand einerseits einen gewissen Triumph, dass sie den Grafen an seine Grenzen geführt hatte. Er war illoyal geworden zu der Frau, die er vorgab zu lieben. Dachte sie.
Jana Eisele, seine ehemalige Psychologiedozentin und Hausarbeitsbetreuerin, war ihm in die grüngraublauen Augen ge- und seinem Intellekt hoffnungslos verfallen. Er hingegen hatte sich über ihre blonden Schläfenlocken in ihren etwas kurzsichtigen blauen Augenseen verloren, war danach an ihren weiblichen Kurven ausgerutscht und, um im Bild zu bleiben, in ihren tiefen Graben gefahren.
Isodora Clementelli hatte sich als Rachegöttin versucht und durch das Dressing-up der Hauptkommissarin die totale Verwirrung der Gefühle absichtsvoll angerichtet. Nun war das zugrundeliegende Arbeitsmaterial in seiner Physiologie derart umwerfend, dass ihr selbst das Wasser im Mund zusammenlief und eine Etage tiefer ein regelrechtes Sumpfgebiet entstand. Die Oberstaatsanwältin begehrte alles, was schön war, innerlich, wie Rico, und äußerlich, wie Rieke. Nein, rief sie sich versonnen zur Ordnung, das galt auch umgekehrt.
Eigentlich hätte sie einerseits mit dem Ergebnis ihres liederlichen Tuns zufrieden sein können. Andererseits entstand, je länger diese Sache lief, ein gewisses Schuldgefühl. Denn dass Jana Eisele dabei litt wie ein Tier, hatte sie großzügigerweise einfach ausgeblendet. Zumal der arme Brühlsdorf mit einem Mal vor dem Faktum der Polyamorie stand, die ihn ereilt hatte.
Er liebte beide Frauen, die ihn umschwärmten. Und er wusste nicht, wie er diese Gemengelage managen sollte. Gefühle ließen sich nicht steuern. Sie waren da oder nicht da, Hamlet, ick hör dir trapsen. Man konnte sie nicht einfach an- und ausschalten. Sie waren es, die die Kontrolle hatten, stupid cupid.
Klar, sagte der angehende Therapeut in ihm: Vielleicht könnte eine Gesprächstherapie helfen. Aber wenn nicht? Was, wenn er tiefinnerlich gar keine Entscheidung, keine Auflösung des Knotens wollte? Noch jedenfalls war TJ nicht bereit dazu, diese Fragen mit einem Dritten zu diskutieren.
Jedenfalls war es zutiefst fatal, dass Glück und Unglück untrennbar verbunden und ohne einander eigentlich nicht zu haben waren. Noch fataler war die bei allen Protagonisten reifende Erkenntnis, wie nahe sie beieinanderlagen. Sie lagen sozusagen Bett an Bett, Körper an Körper. Manchmal vereinigten sie sich mit diesen Körpern und schufen höchste Ekstase und tiefste Melancholie, unglaublichstes Glück und schrecklichstes Unglück im gleichen Moment. Sie waren untrennbar verwoben und maximal einen Wimpernschlag voneinander entfernt.
Auch wenn er augenscheinlich das Vergnügen hatte, litt er mit seinen beiden Frauen. Was tat man in solchen Fällen? Man betäubte sich. Und wie tat man das? Man vergrub sich in seinen Alltagsaufgaben.
Jana Eisele hatte hier das schlechteste Ende. Die beiden anderen konnten sich leichter bis zur Besinnungslosigkeit aufarbeiten, um ja die Signale von Herz und Seele nicht bewusst wahrzunehmen. Bis sie auf die segensreiche Idee kam, zu habilitieren und zu forschen. Oder andersherum. Der Effekt war der gleiche. Oder eine neue Tür sich auftat, die in eine ganz andere Richtung führte.
***
Der Prozess um die Tübinger ’Ndrangheta war zäh verlaufen. Die Verteidigung zog alle Register. Das war ihr gutes Recht. In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten. So musste es sein. Nur das verhinderte die staatliche Willkür. Der Rechtsstaat war neutral – oder hatte es wenigstens zu versuchen, so gut oder weniger gut das auch immer funktionierte, wenn Menschen am Werk waren.
Am Ende konnten auch die besten Strafverteidiger das Urteil nicht verhindern: zweimal lebenslänglich. Die Indizien wogen schwer. Die Zeugenaussagen waren kaum zu widerlegen. Das hatte zum Ergebnis, dass auch die Revisionen der Angeklagten zurückgewiesen wurden. Nun ja, jetzt begannen die üblichen juristischen Verfahrenswege, wenn nichts mehr ging. Das dauerte – und änderte nichts. So war das in solchen Fällen. Man ließ nichts unversucht. Jedenfalls bis zum Grund des Geldbeutels des jeweiligen Angeklagten.
Auch Diana Maria Casabianca, deren Verfahren man abtrennte, bekam ihre gerechte Strafe. In diesem Fall war die Sache noch klarer, sodass die Verfahrensdauer sich erheblich reduzierte. Sie bekam ebenfalls lebenslänglich.
Um die besondere Schwere der Schuld kam sie herum. Sie hatte also eine reale Chance, ihre Kinder nach fünfzehn Jahren Haft wiederzusehen. Ob sie ihren Mann wiedersehen wollte, konnte bezweifelt werden. Ihre Beziehung war am Ende eher eine geschäftliche gewesen, »Partners in Crime« sozusagen, schließlich hatte der liebe Michele Casabianca, der Chef der Tübinger Mafia, zum Vergnügen gern mit gewissen Damen geturtelt plus X, unter anderem auch mit einer gewissen gewaltsam aus dem Leben geschiedenen Lisa Mazzarella, eine Angelegenheit, die den Anfang vom Ende eingeläutet hatte.
Fabrizio Cilio, Casabiancas Nachfolger und TJ Brühlsdorfs Lieblingsmafioso, kam ebenfalls nicht ungeschoren davon. Wegen Beihilfe zur Vertuschung einer Straftat, Störung der Totenruhe, Hausfriedensbruch und einem Sammelsurium verschiedenster anderer Delikte bekam er zwei Jahre mit Bewährung und eine saftige Geldbuße aufgebrummt. Er nahm es zähneknirschend und dennoch sportlich entgegen. Schließlich kam er um Beihilfe zu Mord herum. Das hätte ihm ein paar Jahre gesiebte Luft eingebracht und ihm seine nicht gerade ethisch-sauberen Geschäfte kosten können. So zonte er sein Profil herunter und riss sich genau diese zwei Jahre zusammen.
In dieser Zeit lernte er auch, wie man seine Beziehungen zur Umwelt besser managte. Das machte ihn nicht unbedingt zu einem besseren Menschen, weit gefehlt. Aber sicherlich zu einem besseren Mafioso moderner Prägung.
Genau damit wurde er dem Auftrag seiner Mentoren aus jenem kalabresischen Dorf gerecht, es könnte sich um das berühmt-berüchtigte San Luca handeln, über das jüngst eine ganze SWR-Podcast-Serie berichtete. Aus diesem 3500-Einwohner-Flecken waren seine Eltern nach Deutschland ausgewandert, um ihren Kindern ein besseres Leben, am liebsten ohne die ’Ndrangheta, zu ermöglichen. So ganz funktioniert hatte das nicht für alle Familienmitglieder. Für seine Schwestern schon, für seinen Bruder und ihn nicht.
Der Bruder lag bereits im Familiengrab in Süditalien. Das war eine deutliche Mahnung zur Vorsicht.
***
Brühlsdorf selbst hatte diese ganzen Entwicklungen nur am Rande mitbekommen. Er war Zeuge und Sachverständiger. Mehr nicht. Er fragte sich, warum er nur wenig Genugtuung empfand, dass viele der Täter und die Auftraggeber des damaligen Blutbads gefasst und abgeurteilt wurden. Die Toten blieben tot. Die Welt wurde nicht wiederhergestellt. Warum auch. Sie ging über alles hinweg, ohne mit der Schulter zu zucken. Es war wie immer frustrierend.
Als das Urteil gefällt war, hielt er Zwiesprache mit Salima – der Kripokollegin und zugleich Liebe seines Lebens, mit der er immer wieder Zwiesprache hielt. Sie hatte der Mordanschlag, mit dem alles begann und der ihm fast sein Bein nahm und sein Herz herausriss, das Leben gekostet. Er traf sich am Tag nach der Urteilsverkündigung mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder Özcan. Der gemeinsame Tee brachte ihn an die Grenzen seiner seelischen Kräfte.
Nachts hatte er zum ersten Mal seit längerer Zeit einen Flashback. Jana war bei ihm, als der Anfall über ihn kam. Das war sein Glück. Sie wusste, was in solchen Fällen zu tun war. Es war ihr erstes Erlebnis dieser Art mit ihm.
Manche Frau hätte danach das Weite gesucht. Ein seelisch derart verwundeter Partner bedeutete schließlich eine Belastung. Bei ihr war das anders. Es vertiefte ihre Zuneigung zu ihm noch. Jetzt wollte sie auch noch beschützen. Die Liebe war eine merkwürdige Einrichtung, dachte Brühlsdorf staunend.
Jedenfalls nahm der Wettbewerb der beiden von Brühlsdorf angebeteten Schönheiten eher zu als ab. Henriette Walcher machte sich Sorgen. Um alle drei Menschen in diesem schönen und zugleich bösen Spiel, das nur im Unglück enden konnte und in dem es schließlich, das nahm sie als gesichert an, keine Sieger und schon gar kein Glück geben würde.
Ihr Schorsch sah das nicht ganz so schwarz. Das mochte daran liegen, dass er insgeheim seinen guten Grafen bewunderte. Zwei solche Frauen – wer hatte schon dieses Vergnügen.
Selbst Isodora Clementelli wurde die ganze Sache langsam aber sicher unheimlich. Sie war sich nicht mehr so sicher, ob das mit dem Erteilen einer Lehre an Brühlsdorf eine gute Idee gewesen war. Vielmehr hatte sie das untrügliche Gefühl, eingreifen zu sollen, bevor die ganze Geschichte so an die Wand gefahren wurde, dass aus dem Trio Infernale Amoroso letztlich ein dreifaches Unglück entstand. Der Graf schien nicht in der Lage zu sein, sich für eine der beiden Grazien, die um ihn herumtanzten, zu entscheiden. Man konnte die Fluchtbewegungen erkennen. Wie Henriette Walcher, die andere Frau in der direkten Umgebung, erwartete sie das totale Desaster. Aus zu viel Liebe würde am Ende höchstwahrscheinlich gar keine werden.
Friedrich J. Schmidt liebte seinen Freund und litt mit ihm. Er gönnte ihm die Freuden, die diese Dreieckssache mit sich brachte. Aber er sah auch, dass das keine Dauer haben konnte, weil alle drei darunter litten, auch Brühlsdorf, der sich immer stärker bewusst wurde, dass er eine Wahl zu treffen hatte, die er beim besten Willen weder treffen wollte – noch aus seiner Sicht konnte.
Er nahm sich immer vor, mit seinem Freund zu sprechen, schreckte dann aber zurück, weil er nicht wusste, welchen Rat er geben sollte – denn auch er mochte alle beide, Jana und Rieke, gleichermaßen.
Also gab es immer wieder hitzige Debatten mit Isa, die anschließend in einem Fest der Liebe endeten. Irgendwann wusste er nicht mehr, ob er den Streit mit seiner Oberstaatsanwältin nur anzettelte, um exakt das auszulösen – oder ob es ihm um die Sache ging, nämlich der, seinem Freund und Arbeitgeber aus dieser Scheiße zu helfen, wie er diese Gefühlsverwirrung und Herzenskatastrophe nannte.
Er mochte sich selbst nicht, wenn ihm wieder einmal die Hutschnur platzte, weil ihn seine Isa bei seiner Forderung abprallen ließ, das, was sie mit angerichtet hatte, endlich in Ordnung zu bringen.
III
TJ Brühlsdorf hatte sehr gemischte Gefühle, als er zum Fenster seines Zimmers in der Rehaklinik hinaussah, in die er sich geflüchtet hatte. Nebel, nichts als Nebel. Wer ging auch im Herbst zur Rehabilitation. Selbst schuld. Apropos selbst schuld: Er wusste gerade nicht so ganz genau, ob diese verordnete Lebenspause nicht in Wahrheit eine Flucht war.
Sein Adlatus, Fahrer und Bodyguard Kurt-Georg Walcher war längst mit dem gräflichen E-SUV zurück nach Tübingen gegondelt und in der Stadt des Geistes in Wartestellung. Der hatte es gut. Dessen Leben war klar und wohl geordnet. Wenigstens strebte die Pandemie ihrem Ende zu. Das war vielleicht eher ein Abfinden mit dem SARS-Virus als dessen Ausrottung. Dazu hätten sich erst einmal alle impfen lassen müssen. Und die reichen Länder der Nordhalbkugel samt China hätten völlig ohne jeden Eigennutz im Sinn die Impfstoffe teilen müssen. Hatten sie nicht, und deswegen mutierte das Virus fröhlich vor sich hin.
Wer verlangte, dass die Spezies Mensch lernfähig wäre, musste sich jeden Tag mit der Wirklichkeit konfrontieren lassen. Lernen? Dessen waren Menschen am wenigsten fähig.
Er hatte am Ende auch nichts dazugelernt. Vielmehr hatte er die beiden Damen, die sich um ihn balgten, bis heute im Unklaren gelassen, welche denn nun durchs Ziel käme. Als die Einzige und eine. Es war schon unglaublich, dass sie sich überhaupt so lang hinhalten ließen.
Er an ihrer Stelle hätte sich selbst schon vor einiger Zeit in den Wind geschossen. Isodora Clementelli, die Oberstaatsanwältin und halb Angetraute seines Freundes Frederico Schmidt, schüttelte inzwischen nicht einmal mehr den Kopf. Sie verdrehte nur noch die Augen, wenn sie Hahn und Hühner bei ihren Tänzen beobachtete.
Also kam die Aufforderung seiner Dottoressa für Orthopädie, er möge sich doch bitte einer seit Längerem empfohlenen weiteren Rehamaßnahme unterziehen, sonst wäre der Effekt der an und für sich gut verlaufenen Unterschenkel-OP nicht vollumfänglich erreichbar, gerade sehr zupass. Henriette Walcher, die Hausdame und Mutterersatz in der Villa Brühlsdorf, hatte das auf Schwäbisch treffend ausgedrückt. Er hatte still sich hineingelächelt, als er das erkannte.
»Schorsch«, hatte sie leise geschimpft, »dess kommt unserm jonga Grafa wia geschliffa. Nå håt die arm Sääl a Weil a Rua!« Ihr Ehemann, Bodyguard und Grafen-Chauffeur grinste spitzbübisch. »Schorsch!« Und der drohende Zeigefinger machte dieses Grinsen nur noch breiter. »Ihr Siach halded evill zeema. On mir händ dr Salad.«
Der Graf hörte das zum Glück nicht alles, aber er konnte sich denken, was Henriette Walcher zum aktuellen Beziehungsstand samt seinen Aus- und Nebenwirkungen dachte. Das Schlimme daran war: Sie hatte ganz recht damit. So ging das Gefühlschaos nicht weiter. Es musste eine Entscheidung her. Das gebot schon der Respekt für Jana und Rieke.
Ihn überraschte, dass er die beiden Damen nicht wirklich vermisste. Ganz stimmte das natürlich nicht. Allein zu schlafen war nicht eines seiner Favorites, wie man das neudeutsch so schön formulierte. Aber die Ruhe um ihn herum, die genoss er. Zwei andere Damen fehlten ihm dagegen wirklich: die kleine Emiglia, Isas und Ricos wildes Töchterlein.
Und Lassie, die eigentlich Rieke Bechtel gehörte, der er das Herz brechen würde.
Hunde gehörten vor Lassie auch nicht zu den Errungenschaften, die er gerne gehabt hätte. Aber das Kraulen und das Wedeln. Das Spazierengehen und Spielen. Das vermisste er doch sehr.
Er wandte sich seiner Arbeit zu, die er sich mitgebracht hatte. Mit ihr hatte er auch begründet, warum er nicht gestört werden wollte. Das war ein wenig an den Haaren herbeigezogen, wie nicht nur er zu genau wusste. Interessanterweise wurde es hingenommen. Ihm schwante, dass im Hintergrund jemand dabei Regie geführt hatte und dass dieser Jemand eine Jemandin war und auf den schönen italienischen Vornamen Isodora – oder kurz und knapper – Isa hörte.
***
In den vergangenen vierundzwanzig Monaten hatte er wie ein Wahnsinniger erst seinen Bachelor und gleich anschließend seinen Master abgelegt. Er hatte neben der Rekonvaleszenz von der schweren Unterschenkel-Operation die Pandemie dazu genutzt, sein Studium mit einem Marathon ohne jeden Urlaub und jedes Luftholen hinter sich zu bringen. Einen Knopf dran. Wenigstens da.
Währenddessen waren die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner seiner viel zu weitläufigen Villa damit beschäftigt, den großen Mafiaprozess über die Bühne zu bekommen. Die Plädoyers fanden in diesen Wochen statt. Er hatte es vorgezogen, den Verhandlungen fernzubleiben, nachdem seine Einvernahmen als Zeuge erledigt waren. Es belastete ihn zu sehr. Seine Schuld und sein Verlust schmerzten so oder so.
Für ihn hatte dieser Lebensabschnitt mit der Verhaftung der beiden Capos Michele Casabianca und Pier Paolo Manzotti seinen Abschluss gefunden. Endlich. Endgültig. Die Trauer um die Opfer blieb.
Als Beigabe hatte er Diana Casabianca überführt; er vermutete sehr stark, dass diese eine viel größere Rolle im ganzen Geflecht gespielt hatte, als bekannt geworden war. Frederico hatte bei der Sichtung der rechtlich nicht ganz sauber beschafften Mitschnitte der Gespräche im Hause Casabianca entsprechende Hinweise gefunden, die aber nicht als Beweismittel Verwendung finden konnten. Im Gegenteil: Wäre ihre schiere Existenz der Verteidigung kund und zu wissen gekommen, hätte das die ganze Ermittlung kontaminieren und das Verfahren zum Platzen bringen können. Also behielten sie es schön fein für sich.
Besser so …
Er recherchierte hier für seine Promotion – hatte er vorgegeben. Im gewissen Sinne tat er das auch. Aber eigentlich suchte er nach einem Ausweg: Ebendiese Promotion im Ausland fertigzustellen. Am besten an einer Forschungseinrichtung mit den Spezialisierungen Forensische Psychiatrie, Operative Fallanalyse (OFA) und Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS). Im Moment schwankte er zwischen dem John Jay College of Criminal Justice und der University of Nebraska-Lincoln.
So weit weg von Tübingen wie nur irgend möglich.
Beide Programme offerierten Praxisteile, unter anderem bei der Polizei und in anderen Bereichen der Strafverfolgung. Nebraska hatte den Vorteil, dass, wie er sich gut erinnerte, dort ein recht großer landwirtschaftlicher Betrieb zum Brühlsdorf’schen Besitz gehörte. Recht groß war eher vornehm untertrieben. Die Ländereien waren riesig. Kommerziell wurde man nicht richtig glücklich damit, aber sein Vater hatte diese Ranch immer als Zufluchtsort für den Fall der Fälle gesehen.
Grund und Boden verkaufte man nicht. Das hatte ihm sein Vater eingeschärft. Brühlsdorf war an dieser Stelle ganz Schwabe und hielt sich daran.
Vom Vater stammte auch die US-Staatsbürgerschaft, die die Sache erleichterte. Von den geringeren Studiengebühren einmal abgesehen. Man musste sein Geld ja nicht zum Fenster rauswerfen, befand er – praktisch veranlagt, wie er war.
Wäre er zehn Jahre jünger, wäre New York sicherlich dennoch erste Wahl gewesen. Da wäre immer etwas los, Nachtleben, Kunst, Kultur – ein großer Marktplatz der Eitelkeiten und mit einer gigantischen Auswahl an Frauen, die das Gleiche im Sinn hatten: Spaß, Partnerschaft und auch beides. In dieser Reihenfolge.
Brühlsdorf hatte momentan so gar keinen Bedarf nach Fun, Sex and Booze. Er wollte seine Ruhe. Und jetzt, mit beinahe dreiundvierzig Jahren, einfach seinen Doktor machen, um sich anschließend in Tübingen niederzulassen. Mit einer Praxis für Psychiatrische Forensik, Fallanalyse und PTBS. Dieses Ziel fest vor Augen war Brühlsdorf bereit, größte Opfer zu bringen, auch private.
Jedenfalls redete er sich das ein. Damit er es nachher anderen glaubhaft einreden konnte. Sie würden ihm ebenfalls nicht so ganz glauben. Aber so tun, als würden sie das, wohl schon.
***
Während der gräflichen Seelenkartause in St. Blasien ließ es die Welt sich nicht nehmen, sich sogar im total vergeistigten Tübingen weiterzudrehen. Darum herum machte sie es ebenso. Eskapismus, wusste der kluge Beobachter, löste die Probleme nicht. Er machte sie allenfalls unangenehmer.
Vor jedem Mord schürzte sich, auch das war nicht neu, ein Knoten. Frederico Schmidt, dem gewieften IT-Spezialisten, dem Brühlsdorf in seiner Villa schon lange dauerhaftes Wohnrecht eingeräumt hatte, erhielt in diesem Zusammenhang überraschend einen Anruf auf seinem Handy. Die Nummer kam ihm sehr bekannt vor.
»Rico?«, näselte es in seine aufnahmebereite rechte Ohrmuschel im weichen anhaltinischen Sächsisch aus der Gegend von Halle an der schönen Saale.
»Yo, Jacko, was kannsch denn für disch tun, sachma?«, antwortete er im um einiges härteren Dialekt Dresdens. Danach schossen die Gags nur so durch den mit wenigstens 4G verdrahteten Äther. Die beiden alten CCC-Kumpels hatten sich lange nicht gesprochen, aber einen Haufen gemeinsamer Abenteuer hinter sich, in denen sie sich kennen und schätzen gelernt hatten. Der Hamburger Chaos Computer Club (CCC) war der größte europäische Hackerclub, bekannt durch die Berichterstattung über seinen Kongress und durch seine Expertise in allen Fragen der Digitalisierung – gerade von staatlichen Aufgaben –, die er meist kritisch begleitete.
Aber wie das Leben so spielte: Man entwickelte sich auseinander. Schließlich fand man sich in den Tübinger Hügeln, die die Ufer des Neckars säumten, überraschenderweise wieder.
»Sach an, wolln wa nicht mal wieder een heben?«, fragte Jacko schließlich, dessen bürgerlicher Name Kevin Jakob Malchow lautete. Er war für seinen Durst – und zwar nicht nur nach Wissen – sattsam bis sehr bekannt in der White-Hat-Hacker-Szene.
»Jacko«, bremste Frederico ihn aus. »Isch muss dir ein bissschen was erzähln.« Und dann legte er seinem alten Freund ein paar Sachen klar, die diesem die Sprache raubten.
»Wir haben uns lang nisch gesehn, merksch grade.«
»So kann man durchaus sagn, meen Froind.«
Es entstand eine Pause.
»Weeßte was? Du hoppst eenfach rieber zu mir in de Villa. Des Mittagessen wirste nisch vergessn, gloobste ma.«
Und so geschah es.
Als die Oberstaatsanwältin zum Mittag in das Speisezimmer kam, saß dort neben Emiglia und Frederico ein unbekannter Glatzkopf. Er war rabenschwarz gewandet mit weißen Sneakers. Sein Gewicht wies im Verhältnis zu seiner Größe eine gewisse Unausgewogenheit auf. Diese überflüssigen Kilos hatten sich unvorteilhaft auf die untere Körperhälfte verteilt.
Die beiden waren in Fachgespräche versunken, während die Kleine nach dem Verteilen des Futters auf dem Tellerchen nun damit begonnen hatte, sich selbst, den Kindersitz, Tisch und Boden zu dekorieren. Selbiges tat sie mit ihrem besten Lächeln und fröhlichem »Dadada«, das arhythmisch von plutsch-platsch-plitsch-plong-pong-klonk-klick-klack unterlegt war. Die beiden Herren gestikulierten, nickten, lachten und scherzten. Inzwischen kamen ihnen die Spritzer immer näher. Im Körbchen saß Lassie und ruhte sich vom Ausruhen aus. Was sich ihr bot, war ein Bild für Götter.
Als der nächste Spritzer des von Henriette Walcher pürierten Biogemüses mit Hühnerfleisch das linke Brillenglas von Emiglias Vater erreichte und die Apple Watch des Gastes verschönerte, konnte sich ihre Mutter das Lachen nicht länger verkneifen. Der Blick der Herren war erst strafend und dann entschuldigend. Allein das war schon Erheiterung genug für diesen ansonsten recht angegrauten Herbsttag.
»Buongiorno, ragazzi!«, sagte Isodora Clementelli durchaus wohlgelaunt in den Raum, »ihr drei scheint euch ja köstlich zu amüsieren, mia figlia ganz besonders!«
Die Kleine kommentierte das mit heftigem Gautschen im Kindersitz, ausgestreckten Ärmchen und »Mama! Mama!«-Rufen. Die Mutter strebte daraufhin dem Tisch zu, während Jacko seinen Mund nicht zubekam und gefesselten Blicks die Schönheit durch den großen Raum auf sich zuschreiten sah. Allein dieser Anblick versetzte den armen Kerl in Atemnot.
»Isa«, schmunzelte Frederico frotzelnd, »ich sehe, dir geht es gut, und dein Tag ist bisher erträglich gewesen!« Ohne die Miene zu verziehen fuhr seine Hand aus und kniff seinem im Anblick der Schönheit erstarrten Gast spürbar in dessen linken Unterarm.
Dieser schreckte leicht auf und schluckte hörbar. Schnell führte er sein Glas an den Mund und verschluckte sich. Das Husten übertönte Friedrich J. Schmidt ungern, indem er die Honneurs vornahm:
»Jacko, das ist Isa, meine Liebste und Mutter unseres gemeinsamen Kindes.«
Die Mutter hatte inzwischen das Kind grundgereinigt und nahm es in den Arm. Mit der freien Hand klopfte sie Fredericos Freund herzhaft auf den Rücken, bis dieser seine Rechte hob und damit um Einhalt bat. Mit rotem Kopf räusperte er ein reichlich zerquetsches »Hallo!« hervor und danach ein »Sorry!« – wofür auch immer.
Die beiden Turteltäubchen küssten sich gegenseitig die Fingerspitzen und versenkten die Blicke in den tiefen schwarzen Irisseen des jeweils anderen. Dabei lächelten sie sich verzückt an. Dem Spuk versetzte Emiglia ein Ende, indem sie eine nahe Mineralwasserflasche auf eine Schüssel stürzen ließ, was jener nicht wirklich gut bekam.
Henriette Walcher hatte – aus weiser Voraussicht – das Gebrauchsgeschirr verwandt. Ihr graute vor der Aussicht auf nachheriges Aufräumen, so sehr sie die Kleine auch herzlich liebte.
»An derra Gloina isch an Bua verlaure ganga«, beschwerte sie sich bei ihrem Schorsch.
Der meinte nur: »Mr keht moina, der jong Graf wär der Vaddr. Ischer aber edda, wiara mir en d’Håd vrschbrocha håt.«
Damit war das auch geklärt. Nur die Schüssel blieb kaputt.
Isodora verfütterte den Brei an ihre Tochter und aß den übriggebliebenen Rest.
Henriette brachte ihr eine Portion Kalbsschnitzel mit Polenta und Tomatensoße aus pochierten Tomaten aus dem eigenen Garten, fein säuberlich eingefroren während des letzten Sommers. Dazu eine kleine Schale Eissalat.
Mehr wollte die Oberstaatsanwältin nicht.
Als sie in ihre Räume ging, die sie mit Frederico teilte, nahm sie die Tochter mit. Diese war auf ihrem Schoß bereits eingeschlafen. Gegen drei Uhr würde die Babysitterin kommen. Bis dahin würde es einigermaßen gehen. Hoffte sie.
Es galt, dem Plädoyer den letzten Feinschliff zu geben. Da brauchte frau ihre Ruhe. Obgleich sie etwas Nähe gerade durchaus gerngehabt hätte. Doch der liebe Rico war gerade mit seinem Kopf woanders.
Als die Oberstaatsanwältin ein leises Sehnen in bestimmten Gefilden fühlte, kam Fredericos Freund Jacko endlich zum eigentlichen Grund seines Besuchs, nicht ohne zuvor einen kleinen Schlenker einzuflechten.
»Sachma, wie bistn du an diese Granade gekomm?«
Der Angesprochene lächelte.
»Weeßisch nisch, Jacko, mit eemal war se da.«
Der Freund wusste, dass das Thema damit durch war.
»Nu, warum bistn da. Du hast doch was uffm Herzn.«
Man konnte den guten Rico nicht täuschen, erkannte Jacko.
»Nu, Rico, wenn du misch schon so fragen dust, dann muss isch ja!«, begann ebendieser seine Geschichte. Nicht immer to the point, wie Friedrich J. Schmidt es eigentlich gerne gehabt hätte, aber immerhin: Es wurde am Ende ein recht klares Bild draus.
***
Und das ging so: Kevin Jakob Malchow hatte vor circa zwanzig Monaten im Auftrag eines Cybersicherheitsberaters die VaxiCure, ein Tübinger Biotechnologie-Start-up im Bereich mRNA, cybersicherheitstechnisch geprüft. Und zwar auf Herz und Nieren. Das Ergebnis fiel ziemlich durchwachsen aus. Die Auftraggeber waren die Finanzinvestoren. Sie sollten eine weitere Finanzierungsrunde übernehmen. Das machte man heute so. Due Diligence nannte man das.
Die Investoren waren von der Klarheit und Professionalität des Abschlussberichts und der Schlüssigkeit der Empfehlungen an den Prüfling begeistert. Aber nicht vom Prüfungsergebnis selbst. Daher lag es für sie nahe, sich für den Berater näher zu interessieren.
Als Jacko bereits die Rechnung an seinen Auftraggeber schrieb – er war Freischaffender, und das war er gern, denn das garantierte dicke Kohle und immer wieder mal was Neues –, kamen die Investoren auf einen naheliegenden Gedanken. Dem, der die schonungslose Analyse gemacht hatte, auch die anschließende Remedur des aufgedeckten Schweizer Käses anzuvertrauen. Also das, was man bei VaxiCure als IT-Sicherheit verstand, in einen weitgehend lochfreien Zustand zu verbringen.
Ganz lochlos ging es bei IT-Sicherheit leider nicht.
Jacko bat sich Bedenkzeit aus und verschwand erst einmal ein paar Wochen nach Bali, um seinen Rettungsring im Indischen Ozean zu wässern. Als er zurückkam, hatte sich sein angebotenes Salär mehr als verdoppelt. Die Pandemie und die Aussicht auf eine mRNA-Impfstoffgranate von VaxiCure machten es möglich.
Er wollte dennoch nicht so recht, weil er seine Freiheit nicht aufgeben wollte. Als man die Sache nochmals aufstockte, mit Aktienoptionen garnierte und in einem zweiten Schritt in einer Weise aufhübschte, dass ein Nein faktisch unmöglich schien, schlug er schließlich ein.
Auf diese Weise war er nach Tübingen gekommen.
Als Jacko seinem alten Hackerkumpel sein Jahressalär flüsterte, bekam dieser eben jene Atemnot, die zuvor den Ersteren beim Anblick der göttlichen Oberstaatsanwältin befallen hatte. Jacko kam zur Überzeugung, dass es auf dieser Welt durchaus gelegentlich Gerechtigkeit gab. Aber leider nicht immer, als er den aufgenommenen Gedanken weiterspann. Er hätte den Gehaltsschatz gegen einen Schatz neben sich im Bett nur zu gern eingetauscht.
»Und wo issn nu der Hase im Pfeffer? Das wird ja langsam zur Folter, Jacko!«, scherzte Frederico Schmidt, als dieser seinen Redefluss kurz unterbrach.
»Isch hab da was rausgefundn«, schwenkte dieser endlich auf die Sache ein, derentwillen es dieses Treffen gab. Was er dann kurz und knapp schilderte, glich einer banal-platten Crimestory aus einem Heftchenroman: Zurückgesetzter Mitarbeiter stahl wichtiges Firmenwissen, kontaminierte Versuchsreihen, um der Firma zu schaden, und wollte mit den entwendeten Erfindungen gegen viel Geld zum Wettbewerber überwechseln.
Pech war, dass er sich nicht schlau genug anstellte, sodass er erwischt wurde, und zwar von Jacko. Nun war dieser ein Gegner von einem anderen Stern, nein, aus einer anderen Galaxie. Ihn auszutricksen und Datenspuren seines eignen bösen Tuns zu verwischen, war schlicht unmöglich. Dazu hätte es eines anderen Levels an IT-Wissen bedurft. Und anderer Sicherheitsvorkehrungen in den IT-Systemen. Daher konnten die Tat lückenlos dokumentiert und der Täter erkannt werden.
Allerdings handelte es sich beim Verdächtigten um einen der Gründer. Es war also nötig, dass ein Experte in Sachen Cybersicherheit und Cyberforensik das Ergebnis gegenprüfte, bevor man die Polizei einschaltete. Die Compliance-Abteilung bestand darauf. Der sollte man Folge leisten, wenn man als Vorstand einer AG im Amt bleiben wollte.
Jetzt kamen Friedrich J. Schmidt und damit die Beratungsfirma eines Grafen Brühlsdorf ins Blickfeld. Sie waren von einschlägigen polizeilichen Sicherheitskreisen als mögliche Kandidaten für die Erstellung eines Gutachtens dieser Art ins Spiel gebracht worden. Netzwerke und so, könnte man sagen.
»O.K., habe verstanden.«
Fredericos Kommentar war angesichts der langen Geschichte, die Jacko erzählt hatte, verdammt kurz, wie dieser befand. Aber gut. So war das bei Frederico. Alles Unwesentliche fiel unter den Tisch. Es war verschwendete Zeit, Kraft und Energie.
***
»Herr Graf, Ihre Anwendung! Ich habe Sie vermisst!«
Der so Angesprochene schrak regelrecht auf. Er hatte seinen Termin tatsächlich verbummelt. Das war Brühlsdorf richtig peinlich und sah ihm eigentlich nicht im Entferntesten ähnlich. Himmel noch mal, dachte er, es ist weit mit mir gekommen, im Geiste bin ich schon auf der Flucht vor dem holden Weibe, und zwar derer zwo.
Die hübsche Adeba Dörflinger schaute ihn leicht vorwurfsvoll an.
»Ich hatte schon Angst, dass es Ihnen schlecht geht, Herr Graf.«
Dieser schüttelte den Kopf, stand auf und meinte entschuldigend: »Ich hatte den Termin fast vergessen, das tut mir sehr leid.«
Er griff sich die vorbereitete Sporttasche.
»Wollen wir?«
Sie wollte. Er wollte schon weniger, fügte sich aber in sein Schicksal. Mit dem Fortschritt der Übungen kamen Konzentration und der Spaß an der Bewegung. Die sich anschließende Wassergymnastik machte er dann schon sehr ausgelassen mit, weil die leise Trübsal, die er geblasen hatte, in Vergessenheit, nun ja, genauer, in den Hintergrund geraten war.
Danach die Bahnen in der kleinen Schwimmhalle, die viel zu schnell zur Wendung führten. Die Bahnen waren dafür nicht lang genug. Aber spätestens bei der Sauna waren die dunklen Gedanken wieder da und die Stimmung gedrückt.
Die Massage verging schließlich doch im Flug. Adeba verstand ihr Handwerk. Er fühlte sich selten locker und besser. Es war gut, dass er die Reha endlich machte. Sie war nicht nur Flucht, sie half auch dabei, mehr und mehr die Beweglichkeit des verletzten Beins zurückzugewinnen und Vertrauen in seine Belastbarkeit. Es würde nie wieder werden, wie es einmal gewesen war. Aber es würde besser werden als jetzt. Dessen war er sich inzwischen sicher.
Eigentlich gab es auf den Zimmern kein WLAN. Er hatte sich sowieso ein weitgehendes Medienverbot auferlegt. Zur Erholung und um sich besser auf das Schreiben zu fokussieren. Wer’s glaubte, würde selig. Er wollte schlicht und ergreifend seine beiden Damen nicht die ganze Zeit am Smartphone haben, telefonierender-, simsender- oder chattenderweise. Oder gar alles auf einmal.
Frederico war angewiesen worden, bei Todesstrafe, wie sein Chef und Freund TJ Brühlsdorf formulierte, zu verraten, dass er natürlich mit dem Rest der Welt in bester Verbindung stand. Sein umgebauter Spezial-Vito stand in Sichtweite an der Batterieladestation. Sein Satelliten-Uplink sorgte für höchsten Bandbreitenkomfort bei bester Cybersicherheit. Man gönnte sich ja sonst so wenig.
Sein Freund hatte tatsächlich dichtgehalten – auch und besonders seiner geliebten Isodora gegenüber. Ebenso verlässlich schwieg Kurt-Georg alias Schorsch, der das mobile Büro seines jungen Grafen vor Ort gebracht und mit dessen SUV-Stromer wieder nach Tübingen zurückgegondelt war. Diesen hatte er so geparkt, dass ihm seine Henriette bisher nicht auf die Schliche gekommen war.
Wie jeden Abend nach dem Abendessen schlüpfte der Patient in den Vito. So auch heute. Diesmal gab es etwas, das seine Sinne vibrieren ließ. Wenn die Websession hielt, was sie nach Fredericos kryptischen Andeutungen versprach, könnte ein Auftrag ins Haus stehen, der das Zeug hatte, der aktuellen Eintönigkeit des Daseins etwas Würze zu verleihen.
TJ Brühlsdorf sehnte sich regelrecht nach dieser Form von Würze.
»Nun lasst mal hören«, forderte er nach der Vorstellungsrunde, »um was geht es denn?«
Der kriminelle Dreigroschenroman war schnell erzählt. Die Story klang verdächtig nach einer Freitagabendfolge von »Der Alte«. Das Einzige, was noch fehlte, war der Mord. Nun, der musste schließlich auch nicht unbedingt sein, schoss Brühlsdorf durch den Kopf.
»Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie, Herr Malchow, den Täter bereits cyberforensisch überführt. Boris Sutov, Mitgründer und Miterfinder einer mRNA-Wirkstoffreihe gegen Krebs bei VaxiCure, hat Daten gestohlen. Außerdem Versuchsreihen des neuen SARS-Impfstoffkandidaten verfälscht. Und das, weil man ihn bei der Besetzung von Leitungspositionen regelmäßig nicht berücksichtigt hatte. Korrekt?«
Die weitere Geschichte war recht kurz. Diese Zurücksetzungen hatten Sutov offenbar zunehmend wütend gemacht und sehr verletzt. Anstatt seine Forderungen klar vorzutragen, hatte er den Zorn in sich hineingefressen.
Am Ende waren es Rache und Gelegenheit, die den finalen Anstoß zur Tat gegeben hatten. Sutovs »Geschäftspartner« hatte ihm das Blaue vom Himmel herunter versprochen, wenn er lieferte, was er versprach zu liefern. Allerdings verlangte man dort immer mehr und versuchte, sich den Gegenleistungen zu entziehen.
Mittlerweile wurde Sutov bereits erpresst. Als er aussteigen wollte, hatte man ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Jetzt kochte man ihn gegen Geld regelrecht ab.
Jacko, Fredericos Hackerfreund und Cybersicherheitschef von VaxiCure, hatte alle nötigen E-Mails, Chatverläufe, Telefonate, Systemlogs, kurz: alle Spuren gesichert.
Den Bericht hatte er dem Vorstandschef übergeben. Dieser hatte das, was in den Unterlagen stand, erst nicht glauben wollen. Da sich die anderen Gründer Boris Sutov verbunden fühlten, musste der Beweis von einem externen Spezialisten begutachtet werden.
TJ Brühlsdorf begriff jetzt den Hintergrund.
»Gut, Herr Malchow. Sie brauchen ein Angebot von mir?«
Rasch wurden die Details des Auftrags festgezurrt.
»Wann soll es losgehen?«
»Am liebsten gleich, ich habe für eine Beauftragung Carte blanche.«
***
Während Graf Brühlsdorf vor lauter Aufregung nicht schlafen konnte und sich das selbstredend nicht eingestand, begann Friedrich J. Schmidt noch am gleichen Abend mit der Prüfung der gesammelten Daten und Beweise unterschiedlichster Art. Irgendetwas sagte ihm, es wäre Gefahr im Verzug. Sein schlechtes Gefühl deckte sich mit dem seines Chefs und Freundes. Auch der hatte Bauchgrimmen.
Frederico gautschte gern in seinem Hightech-Rollstuhl, wenn er unter Anspannung stand. Das tat er momentan, und zwar mächtig.
Jacko Malchow war sicherlich ein gewiefter White-Hat-Hacker. Er war dazu ein gigantisch guter IT-Spezialist. Davon, wie man herausfand, ob man beobachtet wurde, und zwar physisch und nicht elektronisch, hatte er allerdings nicht den blassesten Schimmer. Daher war es auch nicht verwunderlich, dass er nicht registrierte, dass man ihm seit geraumer Zeit auf Schritt und Tritt folgte und seine Wohnung verwanzt hatte. Auch sein Büro wurde abgehört.
Es gab Mittel und Wege, so etwas hinzubekommen. Da war zum Beispiel die Putzkolonne. Der Fensterputzer. Der Lieferant eines neuen Schreibtischstuhls. In der Wohnung der Hausmeister. Der Rauchmelderkontrolleur. Der Wärmeableser eines bekannten Nebenkostenabrechnungsdienstleisters. Alles ganz easy. Man musste nur wissen, wie.
Ein Profi sein. Einfach ein Profi.
Dementsprechend war die Gegenseite informiert, dass ihr Informant aufgeflogen war. Jetzt galt es, den Schaden zu begrenzen. Und wie machte man das? Man beseitigte Beweise und, wenn es nicht anders ging, Zeugen.
Das mit den Beweisen war bereits außer Kontrolle geraten. Den Datendiebstahl selbst konnte man nicht ungeschehen machen. Die Spuren zu verwischen, das ging auch nicht mehr. Viel zu kompliziert, viel zu viele Imponderabilien. Die trockene Lösung des Problems war also vom Tisch. Blieb die nasse.
Auch da gab es Alternativen. Entscheidend war in diesem Zusammenhang, ob man herausgefunden hatte, wer der Auftraggeber wenigstens des Datenklaus war. Wenn das herauszukommen drohte, würde es blutig werden, also nass. Und wieder kompliziert. Höchst kompliziert.
IV
TJ Graf Brühlsdorf schlief zum wiederholten Mal bei der Massage ein. Es entging ihm daher der sehnsuchtsvolle Blick aus den Kohlenaugen Adebas. Und nicht nur dieser. Es entging ihm auch der Blick auf die Formen, die sich unter dem enganliegenden Gymnastikbody abzeichneten, als die Physiotherapeutin sich Erleichterung durch Abstreifen des Kittels verschaffte.
Der aufkommenden Hitze wegen, von der nicht so ganz ermittelt werden konnte, woher sie denn kam. Von außen, wegen des warmen Raumklimas und der doch größeren Anstrengungen durch das Walken durchaus ausgeprägter Muskeln an Rumpf und Beinen. Oder von innen, gespeist durch gewisse körperliche Sehnsüchte.
Den Kittel legte sie sorgsam über die Lehne des Stuhls, der achtlos an der Wand stand. Sie betrachtete ihren Patienten mit einer Sympathie, die über Zuneigung weit hinausging. Der derart mit hungrigen Augen Abgetastete nahm davon nicht die geringste Kenntnis. Er schien völlig in sich zu ruhen. Dabei war er bloß todmüde.
Der Patient jedenfalls schlief. Er holte den Schlaf nach, der ihm des Nachts durch das Wälzen eher unerfreulicher Gedanken geraubt worden war. Diese hatten sich wieder einmal um die beiden wunderschönen und wunderbaren Frauen gedreht, die ihm in vielfältigster Weise den dringend benötigten Schlaf stahlen. Das taten sie selbst dann, wenn sie selbst nicht physisch anwesend waren.
Sein schlechtes Gewissen quälte ihn. Er wusste, es war an ihm, sich zu entscheiden. Doch genau dazu sah er sich außerstande. Was ihn besonders belastete, war das Faktum, dass er sie beide liebte, und zwar mehr als sich selbst. Er ertappte sich, dass er sich bei seiner Salima ebenso nach Rat erkundigte wie bei seiner Mutter.
Beide Frauen konnten ihm keinen Rat mehr geben. Henriette Walcher traute er sich nicht zu fragen. Isodora? Nein, die war nicht satisfaktionsfähig. Außerdem schien Isa irgendwie Rieke Bechtel zuzuneigen. Ebenso, weil sie auf Jana Eisele ein Auge geworfen hatte, und zwar was für eines! Wie er entdeckt hatte! Doch Jana hatte dankend abgelehnt. Wer mochte schon Zurückweisung. Damit war Isa raus, weil Isa eben nicht nur die Männer liebte – was ihn nicht im Geringsten störte. Andere hingegen schon.
Gestern am späten Abend hatte er im Vito in einer Web-Konferenz Friedrich J. Schmidt grünes Licht gegeben. Danach hatte Frederico wie vereinbart das mit ihm, Brühlsdorf, abgestimmte Angebot an den Kunden versendet. Das E-Mail war noch nicht richtig draußen, da war schon der Auftrag im Haus. Wow! Da hatte es aber einer richtig wichtig und richtig eilig!
»Muss ich mir Sorgen machen?«, hatte er seinen Freund Frederico gefragt.
»Da kommt nichts nach, Boss«, war die kurze Antwort.
»Nenn mich nicht Boss, Frederico«, schimpfte er gespielt.
»Ist o.k., Boss.«
Dann hatten beide gelacht.
Als TJ im Bett lag und ihm die schwarze Zimmerdecke auf den Kopf fiel, um ihn zu erdrücken, war ihm nicht mehr zum Lachen zumute gewesen. Er mochte es eben gern richtig dunkel. Also war der Rollladen unten.
Nein, das Gefühl des Erdrücktwerdens entstand nicht aufgrund der Frauengeschichten. Es war wegen des Auftrags. Etwas in ihm warnte nagend, dass da doch noch etwas nachkommen würde. Sein Kriminalisten-Gen, durch seine Ermittlungserfahrung geschärft, signalisierte Unheil.
»Da ist noch etwas, und ich weiß nicht, was«, sprach er halblaut in den weitgehend konturlosen Anthrazit um ihn herum. Dieses Dunkel gab ihm keine Antwort. Ein »Ich verstehe dich!« hätte gereicht. Es hätte durchaus in der wärmenden Stimme Frederike Bechtels sein dürfen. Er konnte sie riechen, ihr Parfum, ihr … alles. Er konnte ihre Haut spüren, ihre Haare knistern hören, fühlen, wie sie durch seine Hände glitten, wenn sie sich liebten.
Es musste gegen zwei gewesen sein, da war er endlich weggedämmert, um gegen vier mit voller Blase und schweißnass hochzuschrecken. Auf dem Weg in die Nasszelle ließ er die Zehen seines linken Fußes an einem Tisch- oder Stuhlbein hängen und war auf einmal hellwach.
»Diese Nacht ist gegessen!«, war sein Gedanke – er saß auf dem Klo und stützte die Ellenbogen auf die Knie, um den Kopf in die Hände legen zu können – als der Schmerz nachließ und sich die Blase leerte. Er sollte recht behalten mit dieser Einschätzung.
Nun, nach der Massage durch die Krankengymastin, fühlte er sich sehr entspannt, und fast erfrischt tauchte er wieder empor aus seiner schweren Müdigkeit. Seine betreuende Therapeutin dagegen war »geschafft«. Ihn zu massieren war Schwerstarbeit – auch wenn sie die Möglichkeit, ihn zu berühren und zu schmecken sowie sich ihre eigenen Fantasiegeschichten, die sich um sie beide drehten, spinnen zu dürfen, etwas entschädigte.
Geradezu erhebend war sein aus tiefstem Herzen gesprochenes »Danke vielmals, Adeba, ich fühle mich wie neugeboren!«. Noch mehr freute sie das anschließende »Sie haben magische Hände, ganz bestimmt haben Sie das!«. Wenn er sich nicht geschmeidig vom Massagetisch geschwungen hätte, wäre es ihm nicht entgangen, dass sich ihre Wangen ein wenig verdunkelten – und ihre Augen die Tiefe eines Mahres bekamen.
Dass ihm dabei das Handtuch von den Hüften rutschte, verschaffte ihr einen Anblick, der sie, das ahnte sie trotz des Genusses, bis in ihre Träume verfolgen würde. Er lächelte jungenhaft und war auch schon in der Dusche im Nebenraum verschwunden, um das Massageöl abzuduschen und sich anzukleiden.
Er würde jetzt ins Schwimmbad fahren, um seine Bahnen zu ziehen. Das kleine Becken hier in der Klinik war für das, was er vorhatte, nicht geeignet. Das hatte er ihr leichtsinnigerweise eröffnet. Er besuchte immer das Radon Revital Bad im benachbarten Bad Menzenschwand. Adeba überlegte, ob sie nicht zufällig dort sein könnte. Und verwarf diesen Gedanken.
Es war nicht gern gesehen, mit Patienten eine Beziehung einzugehen. Besonders einem Patienten wie diesem. Der einen Haufen Geld in die angespannte Kasse brachte – Long Covid hin oder her. Es stand jedoch so schlimm um sie, dass ihr das gleichgültig zu werden begann. Aber noch hielt es sie zurück.
Graf Brühlsdorf hingegen hatte mit seinen eigenen Seelennöten genug Beschäftigung. Ein Abenteuer war daher so weit weg wie der Nord- – nein, weiter: wie der Südpol. Er hatte kein Auge für irgendwelche Schönheiten und noch weniger für sehnsuchtsvolle Blicke – um das Wort »begehrende« anstandshalber nicht zu bemühen.
Er war derartig mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht wahrnahm, dass für manche Mitpatientinnen und -patienten sowie der einen Mitarbeiterin oder dem anderen Mitarbeiter der Klinik die Sonne aufging, wenn er vorbeiflanierte.
Das mit der aufgehenden Sonne galt, obgleich oder auch wenn der Nebel die Gegend wie ein durch Glas mit durch Wasser verdünnte fetthaltige Milch wabernd weichzeichnete; das galt sogar für die Schlieren, die er zog. Auch sie entsprachen dem bemühten poetischen Bild.
Es hatte sich herumgesprochen, dass er an seiner Promotion arbeitete. Diesem Faktum schrieb man seine häufige Geistesabwesenheit zu, die gelegentlich dazu führte, dass er sogar das höfliche Grüßen und Zurückgrüßen vergaß. Man erlebte sogar Fastzusammenstöße, die auch Türrahmen, Stühle und Tische ereilen konnte. Man musste aufpassen, wenn er sich näherte.
Irgendwie schaffte er es jedoch immer, genau diesen Zusammenstoß dann doch gerade noch so zu vermeiden. Man machte sich sogar am einen oder anderen Tisch echte Sorgen um den vergeistigen Patienten, dessen Physis so gar nicht zu diesem Verhalten reiner Geistesmenschen passte. Wie man sich täuschen konnte!
Brühlsdorf selbst nahm nichts davon wahr. Er stand neben sich. Seine Umwelt verstand sein Verhalten als ein »Über-allem-Schweben«, denn Arroganz passte nicht dazu, dass er, wenn er tatsächlich einmal auf der Welt war, mit großer Freundlichkeit, gänzlich ungespreizt und durchaus höflich seine Mitmenschen behandelte. Man verzieh seine durchaus schwankend häufigen Aussetzer, bei denen er grußlos wie auf einem eigenen Planeten durch die Klinik zu seinen Terminen wandelte.
Der einzige Mensch, der eine von TJ Brühlsdorf offiziell ausgestellte Erlaubnis hatte, ihn zu besuchen, war Kurt-Georg Walcher. Doch auch der hielt sich stark zurück. Er kannte seinen Arbeitgeber und Beinahe-Ziehsohn zu gut. Dieser wollte allein sein. Punkt.
Der wusste ganz genau, dass das Ganze eine mehr schlecht als recht umetikettierte und kaschierte Flucht war und nichts sonst. Da er die Nöte des Grafen besser kannte als jeder andere, verstand er ihn sogar im gewissen Sinn, ohne dass er das Manöver guthieß.
Was ihn nicht nur anfangs sogar amüsierte, war die unübersehbare Tatsache, dass sein lieber junger Graf dabei war, gleich die nächste Gefühlsturbulenz anzurichten. Mit einem gewaltigen Unterschied: In diesem Fall wusste er nichts davon, nein, er ahnte die sich anbahnende nächste Katastrophe nicht einmal. Seine Anziehungskraft auf die holde Weiblichkeit, so hatte der Schorsch das seiner Henriette beschrieben, war augenscheinlich magisch.
»Wo der Kerl isch, ischs um die Herzla der Mädla geschäha.«
Sie, die Henry, Kurt-Georgs Ehefrau, Hauhälterin und TJs Ersatzmama, hatte ihre Augen verdreht und den Kopf geschüttelt, dass ihre Lockenpracht nur so flog. Da hatte der Schorsch seine Henry in den Arm genommen und geküsst. Sie hatte bloß scherzhaft »duhu!« gesagt und sich dann diesem Ansinnen gern hingegeben.
Kurt-Georg Walcher beschloss jedenfalls, seinem Chef diesmal die Augen zu öffnen – bevor wieder ein Herz gebrochen wurde. Er nahm wie die letzten Male immer den E-SUV, der Vito stand ja in St. Blasien.
Wenn sich das denn noch verhindern lassen würde. Er war sich dessen durchaus nicht sicher. Vielleicht war es zu spät. Dabei war sie eine richtig Hübsche und sehr Patente, die Adeba. Es war einfach ungerecht, wie Liebe spielte.
Warum musste man – in diesem Fall: frau – immer das Unerreichbare wollen, fragte er sich mit einer tief empfundenen Trauer. Aber wenn er ehrlich war, hatte er damals nicht auch nach einem Stern gegriffen, den er – folgte man dem gesunden Menschenverstand – nie hätte erreichen können? Wie man es drehte und wendete, das Leben und erst recht die Liebe waren ungerecht!
»Tankred, Bub, deine Gefühlswelten ganged mi ja nix an. Aber gerade brichsch des nächschde Herz!«
Die beiden Männer saßen im Vito, wie sie es immer taten, wenn er den Grafen besuchte.
»Wie meinen?«, war die total konsternierte Reaktion des Jüngeren.
»Du siehsch nix, glaub i.«
Brühlsdorfs Gesichtsausdruck wechselte auf »geschockt«.
»Ich stehe wirklich auf der Leitung, Schorsch.«
Jetzt musste der Ältere lachen.
»O.K., du weisch wirklich ned, was om di rom los isch. Dann klär i dich mal uff.«
Und dann kam Brühlsdorf aus dem Staunen erst einmal nicht heraus: Adeba, die glutäugige Königin von Sabah, so nannte Kurt-Georg Walcher sie, würde ihn am liebsten bei lebendigem Leib »ufffressa«. Die äthiopische Löwin würde ihn bereits umkreisen wie eine Beute.
»Blumig warst du schon immer, Schorsch«, scherzte er »halblebig«, wie Schwaben das nannten. Und dann diagnostizierte der Graf ganz unadelig: »Du heilige Scheiße, mir bleibt auch nichts erspart!«
Doch Schorsch stimmte nicht zu. Vielmehr meinte er trocken:
»Also den Ärger mit deiner Löwin hier, den hasch dir ed einbroggd. Aber den Reschd drhoim fei scho.«
Dem konnte der so Getadelte schlechterdings kaum widersprechen.
»Und was mach ich jetzt?«
Lächelnde Antwort:
»Mit der jungen Dame schwätza.«
Augenrollen und Stöhnen.
»Du überforderst mich.«
Kopfschütteln.
»Nix da.«
Brühlsdorf fährt sich durchs Haar.
»Du scheinst es zu lieben, mich zu quälen.« Seufzer.
»Wer quält hier bitte wen?«
Danach kam der erhoffte Themenwechsel. Man brachte sich wechselseitig auf den Stand der Dinge. Von den sechs geplanten Wochen waren bereits vier verstrichen. Mit der Doktorarbeit war er überraschenderweise weitergekommen. Ein Fluchtplan war geschmiedet und implementiert. Die Zulassung zum Ph.D.-Studium war bereits in Aussicht gestellt.
»Geld regiert die Welt!«, stellte der Fluchtwillige knochentrocken fest. Sein schlechtes Gewissen war dadurch noch schlechter. Wenigstens ging es seiner Fitness besser. Auch seine traumatische Erfahrung hatte er in einer begleitenden Gesprächstherapie weiterbearbeitet. Immerhin.
So richtig glücklich war er nicht. Und, da er nun einmal Gefühlskonflikte scheute, hatte er die Sache mit Adeba entgegen den Mahnungen Kurt-Georgs schleifen lassen. Das hatte Folgen, die ihn vor nicht unerhebliche Probleme stellen würden.
Der erste Zwischenfall, geschehen am Donnerstag der vorletzten Woche seiner Rehabilitation, war noch harmlos. Wie es der Zufall so wollte – wenigstens hoffte Adeba, dass es so aussah – sank sie, mit dem knappestmöglichen, faktisch transparenten Badeanzug mehr ent- als bekleidet im Menzenschwander Hallenbad an seine Heldenbrust, als sie gekonnt ausrutschend in ihn hineinfiel. Der Fall war zirkusreif: Stolpern, ausgleiten, Arme hoch, Überraschungsruf und dann hoffen, dass der Kerl einen auffing. Das Fallen war gemeint, der zweite Teil von Fall eines Falles.
Jeder andere hätte sich glücklich geschätzt, die wohlgeformte dunkle Schönheit länger als nötig an sich gedrückt und sie danach zu einem Kaffee eingeladen. Er fing sie auf, stellte sie behutsam wieder aufrecht auf ihr sehr ansehnliches Fahrgestell und schob sie rasch wieder von sich. Anschließend meinte er mit einem besorgten Gesicht:
»Haben Sie sich wehgetan, Adeba?« – und hatte seine Hilfe angeboten.
Nachdem das ausgemalte Szenario nicht eingetreten war, wand die junge Frau sich aus der Situation heraus und die Gelegenheit des außerberuflichen Kennenlernens hatte sich in Luft aufgelöst. Brühlsdorf war sehr erleichtert, und mit einem »Dann ist ja alles gut, ich muss jetzt aber weiter!« war er auch schon gemessenen Schritts verschwunden.
Da Adeba die Zeit davonlief, griff sie zum vermeintlich letzten Mittel. Als er nach dem Samstagnachmittag-Sportprogramm in seine Suite zurückkam, die aus zwei Doppelzimmern mit einer Durchgangstür bestand, lag eine kraushaarige Venus, wie Gott sie erschaffen hatte, erwartungsvoll in seinem Bett. Er holte tief Luft, um sich zu fangen.
Der Anblick machte ihn für einen Moment sprachlos. Nicht dass er das, was sich ihm bot, nicht sehr reizvoll und schön zum Anschauen gefunden hätte. Adeba war nicht nur gut aussehend. Sie war wunderschön und sicher auch wunderbar. Aber eben nicht für ihn bestimmt – so wie er nicht für sie.
»Bitte entschuldigen Sie, liebe gnädige junge Frau«, sagte Brühlsdorf geistesgegenwärtig, »ich muss mich in der Tür geirrt haben!«