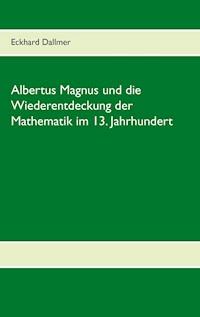
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Buch 'Albertus Magnus und die Wiederentdeckung der Mathematik im 13. Jahrhundert' von Eckhard Dallmer ist die erste, durchaus gelungene und für einen breiten Leserkreis bestimmte Darstellung des deutschen Universalgelehrten und Dominikanermönchs Albert des Großen (gest. 1280) als Mathematiker. Diese kleine Monographie charakterisiert in prägnanter Weise das Zeitalter der Scholastik, sie stellt in wesentlichen Zügen Alberts Biographie vor und präsentiert anhand seiner philosophischen Schriften und des Kommentars zur Geometrie des Euklid die singuläre Stellung, die er auf dem Gebiet der Mathematik im Hochmittelter einnimmt. Henryk Anzulewicz, Albertus-Magnus-Institut, Bonn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 75
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Eckhard Dallmer studierte Mathematik und Chemie und unterrichtete diese Fächer neben Informatik in einem Gymnasium. Nach seiner Pensionierung 2004 beschäftigte er sich mit Themen aus der Geschichte der Mathematik. Er lebt in Schöningen, der Stadt der Speere.
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorwort des Autors
1. Zeit der Scholastik
2. Zur Person Albertus Magnus
2.1. Sein Lebenslauf mit Eckdaten
2.2. Weitere Anmerkungen zu seiner Charakterisierung
3. Mathematik im Mittelalter
4. Mathematik in den Schriften von Albertus Magnus
4.1. Zur Existenzfrage des Euklidkommentars von Albertus Magnus
4.2. Worum geht es bei den Elementen des Euklid?
4.3. Über den Euklidkommentar des Albertus Magnus
4.4. Aus dem Euklidkommentar des Albertus Magnus
5. Mathematik in den philosophischen Schriften
5.1. Mathematische Begriffe und Mathematik als exakte Wissenschaft
5.2. Proportionen und die Begriffsbestimmung der Seele
5.3. Punkt-Linie, Linie-Fläche, Fläche-Körper
6. Über das Kontinuum
6.1
. Zeit, Bewegung, Indivisibilien und das Kontinuum von Aristoteles bis zur Scholastik
6.2.
Das Unendliche in der Kontinuumsdiskussion
7. Ausblick auf spätere Entwicklungen zu Indivisibilien und Unendlichkeit
7.1. Vertreter der ausgehenden Scholastik
7.2. Momentangeschwindigkeit
7.3. Indivisibilien des Cavalieri
7.4. Johannes Kepler
7.5. Sir Isaak Newton
8. Anhang mit Abbildungen
8.1. Weitere Euklid-Übersetzungen nach Albertus Magnus
8.2. Aus der Handschrift des Euklidkommentars
8.3. Aus der Geometrie des Boethius
8.4. Reisen des Albertus als Kreuzzugsprediger
8.5. Studien an der Pariser Universität
9. Literaturverzeichnis
Albertus pflegte zu sagen:1
"Hoc scio sicut scimus nam omnes parum scimus"
1 „Das wissen wir, soweit wir es wissen, denn wir wissen nur wenig“, Meister Eckart, Sermo Paschalis, a. 1294 Parisius habitus, ed. Loris Sturlese (Meister Eckart, Die lateinischen Werke V), Stuttgart, W. Kohlhammer 2006, S. 145. 5–6
Geleitwort
Wer die archäologischen Denkmäler auf unserem Planeten genauer studiert hat, kann den Eindruck gewinnen, dass schon die ältesten Kulturen von homo sapiens nicht nur mit konkreten und abstrakten Zahlen sowie Zahlzeichen, sondern auch mit komplexen mathematischen Berechnungen vertraut waren. Denn sowohl die monumentalen Pyramiden in Ägypten und Mesoamerika, der Sonnenkalender der Ägypter und der Azteken und die astronomischen Beobachtungen der Babylonier und der Mayas belegen beachtliche mathematische Kenntnisse und Kalkulationen sowie deren Darstellung in Schriftzeichen. Es mag daher verwundern, dass man von der „Wiederentdeckung“ der Mathematik im lateinischen Mittelalter spricht, und dies in einer Epoche, die nach Meinung vieler Zeitgenossen „finster, abschreckend und barbarisch war, und in der die Menschen unaufgeklärt, abergläubisch mit dunklem und dumpfen Bewusstsein lebten“.2 Der Grund für diese Einschätzung liegt sicher darin, dass das mathematische Erbe an seiner Bedeutung im vorwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Denken der Lateiner bis zur karolingischen Renaissance und der ersten großen Übersetzungswelle logischer, philosophischer, astronomisch-astrologischer, medizinischer und mathematischer Schriften im 12. und 13. Jh. stark eingebüßt hatte. Zwar wurde die Mathematik auch im frühchristlichen Mittelalter im Rahmen der sieben freien Künste (artes liberales), näherhin des Quadrivium gelehrt, aber nicht schöpferisch entfaltet. Mit der Entstehung der Universitäten um 1200 und der einsetzenden Verwissenschaftlichung des Denkens im Zuge der Aristoteles-Rezeption und der wissenschaftlichen Übersetzungsliteratur der Araber und Griechen kam es zu einer Wiederentdeckung der Mathematik, die im Kanon der Wissenschaften spätestens seit Boethius fest etabliert war.
In diesem Prozess der Wiederaufnahme der wissenschaftssystematischen Reflexion und der Umsetzung des mit ihr aufgestellten Programms kommt Albertus Magnus eine führende Rolle zu. Denn er hat die Mathematik nicht nur in seinem wissenschaftssystematischen Entwurf zum wesentlichen Teil der Realphilosophie erhoben, sie, genauer gesagt, in diesem Rahmen der Naturphilosophie vorgeordnet sowie ihren Gegenstand genau bestimmt,3 sondern vor allem hat er mathematische Probleme in seinen philosophischen und theologischen Werken vielfach behandelt. Offensichtlich hat er neben den gesamten aristotelischen naturwissenschaftlichen Schriften auch die ersten vier Bücher der Geometrie des Euklid kommentiert.4 Trotz dieser beachtlichen Leistungen auf dem Gebiet der Mathematik und speziell der geometrischen Optik und der Geometrie wurde Alberts Name in der Geschichte der Mathematik bis zur Mitte des letzten Jahrhundert kaum erwähnt. Mit der vorliegenden Monographie trägt der Mathematiker Eckhard Dallmer wesentlich dazu bei, das wissenschaftsgeschichtliche Defizit zu beseitigen und das mathematische Erbe des Doctor universalis einem breiten, auch fachfremden Publikum in leicht verständlicher Form näher zu bringen. Der Verfasser wird für seine verdienstvolle Arbeit entlohnt, wenn das vorliegende Buch viele interessierte Leser findet. Mit diesem Wunsch möchten wir das Buch auf dem Weg zum Leser gerne geleiten.
Henryk Anzulewicz
2 Albert Zimmermann, „‘Finsteres Mittelalter‘. Bemerkungen zu einem Schlagwort“, in: Andreas Speer (Hg.), Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nominalismus und Humanismus (Miscellanea Mediaevalia 23), Berlin – New York 1995, 1.
3 Albertus Magnus, Physica, I–IV, ed. Paul Hossfeld (Alberti Magni Opera Omnia IV/1), Münster 1987, 1.43–49.55–58,67–2.24.54-56.63–69
4 Albertus Magnus, Super Euclidem, ed. Paul M. J. E. Tummers (Alberti Magni Opera Omnia XXXIX), Münster 2014. Cf. Robert Ineichen, „Zur Mathematik in den Werken von Albertus Magnus“, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 40 (1993) 55–87. Anthony Lo Bello, The Commentary of Albertus Magnus on Book I of Euclid’s Elements of Geometry (Ancient Mediterranean and Medieval Texts and Contexts / Medieval Philosophy, Mathematics, and Science III), Boston – Leiden 2002.
Vorwort des Autors
Meine erste Begegnung mit Albertus Magnus liegt inzwischen viele Jahre zurück. Im Jahre 2002 besuchte ich in Regensburg die Ausstellung in der Dominikanerkirche über Heilige, „die im Licht sind“. Darunter aus dem 13. Jahrhundert Albertus Magnus. Seine Lebensbeschreibung, seine Neugier, sein Wissensdurst faszinierten mich.
Selbst neugierig geworden, kaufte ich mir ausgewählte Texte des Albertus Magnus in der lateinisch – deutschen Übersetzung von Albert Fries. Jetzt wurde die Beschäftigung mit dem ‚Doctor universalis’ für mich noch spannender.
Im „Spektrum der Wissenschaft“ von Nov. 2003 nennen ihn die Autoren in einer Abhandlung über ihn auch „…der große Neugierige“. Und sie ergänzen: „In den Schriften des mittelalterlichen Naturforschers und Universalgelehrten lassen sich auf eindrucksvolle Weise die Anfänge einer erfahrungsorientierten Naturwissenschaft erkennen“.5
Ich las Ausschnitte zu seiner Theologie, seiner Philosophie, seiner Naturforschung, seiner Einstellung zu empirischen Untersuchungen und zu seinen Bemerkungen zur Mathematik.
In seiner Vorlesung im Jahre 2004 zur Geschichte der Mathematik erwähnte Thomas Sonar6 Albertus Magnus als einen Vertreter der Scholastik, der wohl auch über den mathematisch-philosophischen Bereich der Kontinuumsproblematik nachgedacht hätte.
Mit dieser Anregung begann meine Suche nach der Mathematik bei Albertus. Es verwundert sicher nicht, dass ich mich auch mit seiner Zeit, mit Zusammenhängen, Beziehungen und den Voraussetzungen seiner Zeit beschäftigen musste. Das Material über Albertus ist sehr umfangreich, allerdings nicht dasjenige über seine mathematischen Gedanken. Albertus war kein Mathematiker im heutigen Sinne. Er hat die ersten vier Bücher der Elemente des Euklid kommentiert und auch mit eigenständigen Gedanken und Beweisen versehen. Das hat niemand vor ihm im lateinischen Westen getan und schon gar nicht in einem derartigen Umfang. Er hat über die euklidische Geometrie hinausgehendes mathematisches Gedankengut wieder aufgenommen, modifiziert und somit auch die weitere Entwicklung in der Mathematik mit vorbereitet. Ungeklärt ist, warum es wieder Jahrzehnte dauerte, bis seine mathematischen Überlegungen und Arbeiten beachtet wurden.
Die Mathematik wurde bis dato fast tausend Jahre vernachlässigt und erst im 13. Jahrhundert geradezu wiederentdeckt. In der Antike gab es in den griechisch-sprachigen Ländern eine Blütezeit, geradezu eine Explosion des Wissens über die Welt. Wissenschaftliche Theorien erschienen als Lösung praktischer Probleme und dienten zum besseren Verständnis der Natur. Diesen Zugang verdanken wir Wissenschaftlern wie Archimedes, Euklid, Eratosthenes und manchen anderen Persönlichkeiten, nicht zu vergessen Aristoteles.
Um 300 v.Chr. entstanden die „Elemente des Euklid“, überwiegend in der Hafenstadt Alexandria nahe dem Nildelta. Um 250 v.Chr. wirkte Archimedes von Syrakus. Erhalten sind z.B. seine Abhandlungen über Spiralen, Kugel und Zylinder, über die Quadratur der Parabel, über Paraboloide, über schwimmende Körper. Seine Arbeiten nehmen wichtige Elemente der Infinitesimalrechnung vorweg7.
Alexandria war mit seiner berühmten Bibliothek ein damaliges wissenschaftliches Zentrum. Viele Arbeiten wurden dort gesammelt, eben auch die von Euklid und Archimedes. Und es wurde kopiert, sehr viel von Arabern. Viele wissenschaftliche Werke wurden auch ins Arabische übersetzt.
Aber schon kurze Zeit nach diesem wissenschaftlich geradezu goldenen Zeitalter wurden große Teile dieser Entwicklung rückgängig gemacht. Die Bibliothek von Alexandria mit etwa 700.000 Schriftrollen verbrannte 47 v.Chr. bei der Eroberung der Stadt durch Caesar. Unschätzbares war verloren. Die Römer übernahmen von den Griechen was ihnen möglich war und bewahrten es für kurze Zeit. Doch sie waren mehr an rein praktischen Anwendungen interessiert. Nennenswerte eigene wissenschaftliche Beiträge schufen sie nicht. Nach kurzer Zeit versank Europa in einer Erstarrung, in eine wissenschaftliche Dunkelheit, die über tausend Jahre hinweg nahezu jede geistige Entwicklung blockierte.
Erst die Wiederentdeckung der antiken Kultur bereitete den Weg in die Neuzeit. Die Wiederentdeckung ergab sich z.T. auch durch die Kreuzzüge, auf denen die Abendländer in engen Kontakt mit der Hochkultur des Islam kamen.





























